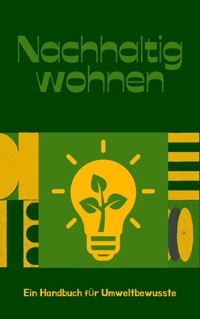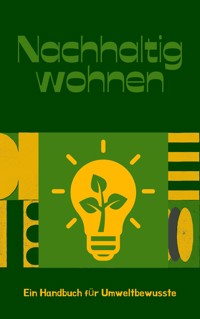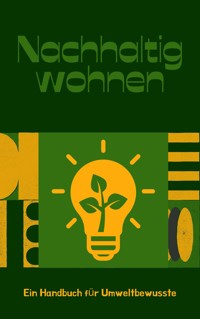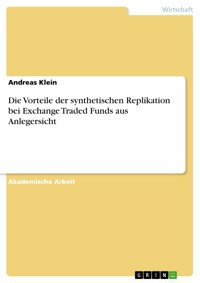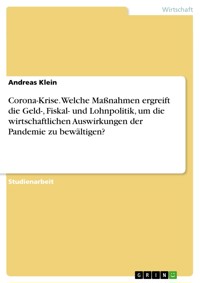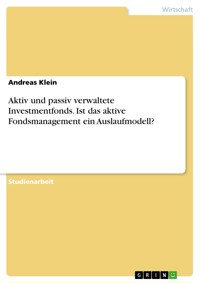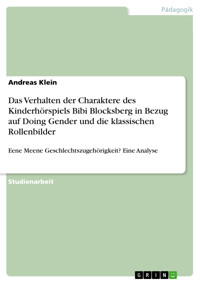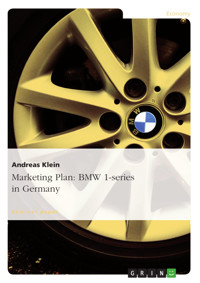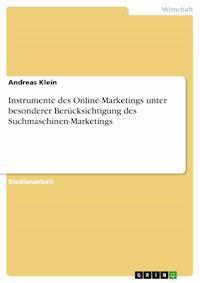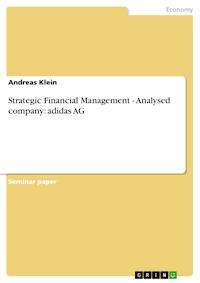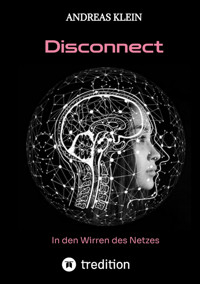
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Internet hat unsere Welt in atemberaubendem Tempo verändert: Wie wir arbeiten, kommunizieren, lieben und uns informieren. Es hat neue Freiheiten eröffnet – und zugleich neue Abhängigkeiten, Gefahren und gesellschaftliche Spannungen hervorgebracht. Cyberkriminalität, Fake News, Spionage, Deepfakes und organisierte Kriminalität im Darknet bedrohen uns ebenso wie Hassrede, digitale Süchte oder die permanente Erreichbarkeit. Zugleich wächst der Einfluss weniger Tech-Unternehmen und deren Inhaber stetig an. Sogar unsere Demokratie und das gemeinsame Verständnis fundamentaler Werte sind bedroht. Während Jugendliche in der digitalen Welt aufwachsen, stehen viele Erwachsene und Senioren vor der Herausforderung, Schritt zu halten. Dieses Buch zeigt die Schattenseiten des Netzes – kritisch, verständlich und mit vielen Beispielen aus dem Alltag. Es fordert dazu auf, das Internet nicht nur als Werkzeug, sondern als prägenden Teil unserer Gesellschaft zu begreifen. Und es macht Mut, Verantwortung zu übernehmen, damit die digitale Welt ein besserer Ort werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Andreas Klein
Disconnect
In den Wirren des Netzes
© 2025 Andreas Klein
Verlagslabel: Little Books
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg,
Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich.
Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors,
zu erreichen unter:
tredition GmbH,
Abteilung "Impressumservice",
Heinz-Beusen-Stieg 5,
22926 Ahrensburg, Deutschland.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Einleitung
Welcome to the Internet – Bo Burnham, 2021
1. Disruptionen – Wandel als Konstante
2. Das Internet und die Wirtschaft
2.1 Onlinehandel – das Dilemma im Warenkorb
2.2 Plattform-Ökonomie – Lust auf Monopoly?
2.3 Bewerten Sie uns!
2.4 Tech-Milliardäre – nur nicht die Beherrschung verlieren
2.5 Der Wert von Daten
2.6 Werbung – von der Information zur Manipulation
2.7 Was kostet das Internet?
2.8 Kryptowährungen – es geht auch kompliziert
2.9 Energieverbrauch – surfen, bis die Erde warm wird
2.10 Schneller, reicher, intransparenter
2.11 Das Internet als Arbeitsplatz
2.12 Schutzgeld
3. Cybercrime
3.1 Was macht Ihr Computer gerade?
3.2 Spionage und hybride Kriegsführung
3.3 Das Darknet
3.4 Pornografie – im Schutze des Tabus
3.5 Deepfakes – täuschend echt und echt getäuscht
3.6 Meins, deins oder unsers?
3.7 Strafverfolger und -verfolgte – auf welcher Seite stehen wir?
4. Das Internet und die Bildung
4.1 Was stimmt denn nun?
4.2 Die Wikipedia - zitieren geht über studieren
4.3 Kann ich noch ein Prädikat?
4.4 Onlineseminare und Coaches für alle Lebenslagen
4.5 ChatGPT und Co. – ist heute schon Zukunft?
4.6 Politik nach Likes – click and elect
4.7 Clickbaits - Alles von Irrelevanz
4.8 Etablierte Medien: alte Prinzipien und neue Ansprüche
4.9 Alternative Medien: von Zweitmeinungen zu Parallelwelten
5. Der Einfluss des Internets auf die Gesellschaft
5.1 Senioren im Netz
5.2 Jugend im Netz
5.3 Der Wunsch, ein Influencer zu sein
5.4 Die gestohlene Zeit
5.5 Mit Klicks zum Kick
5.6 Swipe, Match, Date – und dann?
5.7 Online-Misogynie
5.8 Radikalisierung
5.9 Die bösen Nachbarn – Shitstorms, Trolle und Bots
5.10 Der Chip im Kopf
6. Lösungsansätze
6.1 Von Gratis zu Gerecht – das Netz neu denken
6.2 Das Gemeinschaftsprojekt
6.3 Entfesseln wir die vierte Gewalt
6.4 Objektive Bewertungsmaßstäbe
6.5 Wege aus den Wirren des Netzes
Disconnect – Rollins Band, 1994
Schluss
Disconnect
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Einleitung
Schluss
Disconnect
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
Einleitung
Das Internet ist großartig! Nur damit das gleich zu Beginn gesagt ist. Seine Erfindung war ohne Untertreibung ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte. Vor allem für Menschen, die erst im dritten Jahrtausend geboren wurden, muss die Vorstellung von einem Leben ohne Internet nahezu dystopisch sein. Um wieviel beschwerlicher wäre es Informationen ohne Google, Wikipedia oder ChatGPT zu recherchieren? Im Gegensatz zu Universallexika, deren Inhalt sich nicht aktualisiert, in denen man das genaue Stichwort wonach man sucht kennen muss, um überhaupt den gewünschten Inhalt zu finden. Querverweise sind wohl angegeben, erfordern aber lästiges hin- und herblättern. Das Ganze ist dann auch noch sehr kostspielig und belegt wertvollen Platz im Regal.
Dank sozialer Medien spielt räumliche Distanz kaum noch eine Rolle. Selbst im Karibikurlaub können wir die Zuhausegebliebenen in Echtzeit teilhaben lassen. Ob sie das nun wollen, ist zweitrangig. Postkarten, die erst nach der eigenen Ankunft in der Heimat eintrudeln oder eventuell auch ganz verloren gehen, haben sehr an Wert verloren, obwohl sie zugleich immer teurer wurden.
Schon bevor der Urlaub losgeht, kann man über Google Earth erfahren, was tatsächlich mit „Hotel in Strandnähe“ gemeint ist. Ein Visum wird online beantragt und bezahlt, anstatt die Botschaft zu kontaktieren. Für die Buchung von Flug, Hotel und Mietwagen ist kein Reisebüro mehr notwendig. Selbst abgeschiedene Lokale haben eine Website, auf der man die Speisekarte schon mal vorab prüfen kann. Das schützt vor Enttäuschungen und unnötigen Wegen. Wer seinen Urlaub effizient gestalten will, erhält mit wenigen Klicks die perfekte Reiseroute mit den Points-of-Interest des Sehnsuchtsortes. Den Reiseführer kann man sich sparen und selbst das Erlernen von Fremdsprachen verliert seinen Sinn, wenn das Smartphone synchron übersetzt, was man der Person gegenüber gerne sagen möchte. Freilich schwingt dabei immer das Risiko mit, ob die App hier eventuell Unsinn in unserem Namen von sich gibt.
Und so wurden viele Dinge und Abläufe vom Internet verdrängt, weil sie umständliche Relikte einer anderen Zeit waren. Einer Zeit, in der die Menschen quasi analog improvisiert haben, bis das Internet kam, um endlich die richtige Lösung zu bieten. Der Totoschein wich den zahllosen Plattformen für Sportwetten. Xetra digitalisierte den Börsenhandel und brachte ihn den Deutschen näher. Zugleich gewährten die Banken ihren Kunden den permanenten Überblick über die eigenen Finanzen von zu Hause aus. Termine mit Kundenberatern und der Ausdruck und das Ordnen von Kontoauszügen wurden obsolet. Nach und nach wurden wir alle ein wenig zu Mitarbeitern gemacht, weil wir der Bank lästige Aufgaben, wie die Eingabe von handschriftlichen Überweisungen, abnahmen. Verkauft wurde es uns als Service, weil man sich ja schließlich den Weg spart und nicht mehr auf die Öffnungszeiten achten musste. Dennoch war es für die Banken der Einstieg in die Schließung von Geschäftsstellen und massenhaften Stellenabbau.
Es ist so super einfach heute eine Versicherung oder den Strom- und Gasversorger zu wechseln. Auch wenn die einschlägigen Vergleichsplattformen nicht alle Tarife abdecken, wäre eine manuelle Prüfung im gleichen Umfang nicht zu bewältigen. Während Kundenberatern aus Fleisch und Blut der Makel anhaftet, dass sie sich selbst bereichern wollen, wirken Vergleichsportale so herrlich neutral. Da ist niemand, der mit rhetorischen Kniffen und Verkäufertricks auf mich einwirken will. Die Zahlen und Bewertungen sprechen für sich und als Kunde treffe ich meine Entscheidung souverän. Dass hinter der Plattform selbstverständlich auch Menschen stehen, die Geld verdienen wollen und müssen, ist nebensächlich. Preisvergleichsportale schaffen Transparenz und bieten uns optimale Entscheidungshilfen bei Anschaffungen aller Art. Sie, lieber Leser kennen selbst genügend weitere Beispiele für den alltäglichen Nutzen des Internets, wie Online-Gaming, Dating, Streaming und all die anderen Anglizismen, um die unsere Sprache in den letzten Jahrzehnten bereichert wurde.
So richtig fällt uns der Wert des Internets dann auf, wenn es fehlt. Wenn die Sorge offline für andere nicht mehr erreichbar zu sein krankhaft wird, sprechen Experten von Nomophobie. Das steht für „no mobile phone phobia“ und ist wohl auch sinnbildlich dafür, dass im technischen Bereich gerne mit Akronymen anstelle der üblichen, aber etwas verstaubten altgriechischen Begriffe gearbeitet wird. Dabei geht es auch darum, das Smartphone zu verlieren. Diese Befürchtung ist nachvollziehbar, weil es sich schließlich um einen beträchtlichen materiellen Wert handelt. Der immaterielle Wert den Smartphones für viele Menschen mittlerweile haben, ist jedoch weitaus größer und Aussagen wie „da steckt mein ganzes Leben drin!“ kann man immer wieder hören. Menschen werden abhängig davon nicht nur Zugang zum Netz zu haben, sondern Teil des Netzwerkes zu sein. Die virtuelle Welt verwächst zunehmend mit der physischen.
Eklatant wird eine fehlende oder nur langsame Internetverbindung vor allem für Unternehmen. Auftragseingänge und deren Abwicklung, sowie die interne und externe Kommunikation läuft über das Netz und wird zur Achillesferse. Wer sein Unternehmen in einer ländlichen Region ansiedeln möchte, muss zuvor prüfen, wie es dort um den Netzausbau bestellt ist. Andernfalls ist die ganze Investition hochgradig riskant, selbst wenn andere Faktoren, wie günstige Grundstückspreise, niedrige Gewerbesteuer, gute Verkehrsanbindung und der Zugang zu Facharbeitern gegeben sind, wäre eine schwache Internetverbindung ein KO-Kriterium. Dementsprechend sind davon betroffene Regionen in einem Teufelskreis. Wegen des schwachen Netzes siedeln sich keine Unternehmen an und die Gegend verliert an Attraktivität für die Bürger. Es kommt zu Abwanderungen und der Sinn für den Netzausbau nimmt weiter ab. Der Begriff, dass Landstriche abgehängt sind, passt. Weil wir eben alle vom Netz abhängig sind.
Nicht zuletzt war das Internet auch ein gigantisches Versprechen für das Zusammenwachsen der Menschheit. Dessen Anfänge waren beseelt vom gemeinsamen Austausch. In den Foren hielt man sich an die Netiquette. Dieser Kodex war nicht weniger als die Regelung des gemeinsamen Umgangs rund um den Globus über alle Kulturen hinweg. Bestimmt gab es auch damals Unstimmigkeiten, aber wer gegen die Regeln verstieß, konnte nicht mit Beifall rechnen. Das Netz hatte noch etwas Magisches und wer diesen virtuellen Raum betrat verhielt sich wie ein Gast. Grenzen und Sprachbarrieren wurden überwunden und der Reiz bestand für viele darin in Chatrooms mit Fremden, andere Ansichten zu erfahren und daran zu reifen.
Das waren auch meine eigenen ersten Erfahrungen mit dem Internet. Selbst hatte ich in den 90ern zwar einen Computer aber noch keinen Internetanschluss. Als ich 1997 mit dem Studium anfing, gab es an der Hochschule bereits Computersäle mit Internetverbindung und zunächst war gar nicht klar, was man damit anfangen sollte. Es gab bereits erste Suchmaschinen wie Web-Crawler, Alta-Vista und Yahoo. Ab 1998 kam Google dazu. Zu finden waren überwiegend Texte, weil Bilder und Multimediainhalte zu lange Ladezeiten beanspruchten. Die Standardinternetverbindung für den privaten Bereich hatte 56 kBit/s. Da brauchte man noch Geduld und man hat sich überlegt, welche Anfrage man stellen möchte. Erst der Start von DSL, Ende der 90er mit nun 768 kBit/s und die etwa zeitgleiche Einführung von WLAN änderte alles und das Internet wurde nun für immer mehr Menschen relevant. Es gab noch keine Wikipedia und soziale Netzwerke spielten noch keine Rolle. Zusammen mit der immer besseren Performance der Endgeräte wuchs aber die Nachfrage im privaten Bereich sprunghaft. Schließlich war sogar Boris Becker „drin“, wie er in einem Werbespot für AOL verriet und die Dinge nahmen ihren Lauf.
Neben allen alltäglichen Annehmlichkeiten soll aber auch erwähnt sein, welchen Stellenwert das Internet in jenen Gesellschaften hat, in denen die freie Meinungsäußerung eingeschränkt oder verboten ist. Repressive Regime fürchten nichts so sehr, wie ihr eigenes Volk und müssen daher verhindern, dass große Menschenmengen einen gemeinsamen Willen formulieren und groß angelegte Aktionen koordinieren können. Dafür braucht es einen Raum in dem Menschen zusammenkommen und sich austauschen können. Im Wendejahr 1989 stand den Bürgern der DDR die Kirche zur Seite, weil es noch keine technische Lösung gab. Die Möglichkeit sich zu vernetzen ist mit Hilfe des Internets jedoch viel einfacher und durch Anonymität geschützt. Demokratische Bewegungen konnten mit Hilfe des Internets während des Arabischen Frühlings von 2010 – 2012 große Menschenmassen mobilisieren und zumindest in Tunesien und Ägypten anfängliche Erfolge erzielen. Die katastrophalen Folgen in Libyen, Syrien und Jemen hatten eine Vielzahl von Gründen, die man nicht dem Internet anlasten kann. Es soll hier nur verdeutlicht werden, welch mächtiges Werkzeug wir damit geschaffen haben und wie wichtig es ist, dass wir es uns nicht wieder entreißen lassen.
Dennoch ist dies eine Anklage, denn das Internet hat längst den Reiz des Neuen und Unschuldigen abgelegt. Es gibt unzählige Publikationen und Diskussionsbeiträge zu den einzelnen Themenbereichen, die ich im Weiteren aufführe, aber es fehlt die Gesamtsicht in der Debatte. Bei all den oben angeführten und den vielen hier nicht genannten Vorteilen, die uns das Internet bringt, ist es Zeit eine Gegenrechnung aufzumachen. Ich möchte den Blick auf die andere Seite des Internets lenken. Auch wenn es das Leben erleichtert, sind uns dadurch Probleme entstanden, die wir ohne das Netz nicht hätten. Dieses Buch soll kein Plädoyer zu dessen Abschaffung aber zu seiner kritischen und umsichtigen Nutzung sein.
Welcome to the Internet – Bo Burnham, 2021
Welcome to the internet
Have a look around
Anything that brain of yours can
think of can be found
We've got mountains of content
Some better, some worse
If none of it's of interest to you,
you'd be the first
Welcome to the internet
Come and take a seat
Would you like to see the news
or any famous women's feet?
There's no need to panic
This isn't a test, haha
Just nod or shake your head and
we'll do the rest
Welcome to the internet
What would you prefer?
Would you like to fight for civil
rights or tweet a racial slur?
Be happy
Be horny
Be bursting with rage
We got a million different ways
to engage
Welcome to the internet
Put your cares aside
Here's a tip for straining pasta
Here's a nine-year-old who died
We got movies, and doctors,
and fantasy sports
And a bunch of colored pencil
drawings
Of all the different characters in
Harry Potter fucking each other
Welcome to the internet
Hold on to your socks
'Cause a random guy just kindly
sent you photos of his cock
They are grainy and off-putting
He just sent you more
Don't act surprised, you know
you like it, you whore
See a man beheaded
Get offended, see a shrink
Show us pictures of your children
Tell us every thought you think
Start a rumor, buy a broom
Or send a death threat to a
boomer
Or DM a girl and groom her
Do a Zoom or find a tumor in
your
Here's a healthy breakfast option
You should kill your mom
Here's why women never fuck
you
Here's how you can build a
bomb
Which Power Ranger are you?
Take this quirky quiz
Obama sent the immigrants to
vaccinate your kids
Could I interest you in everything?
All of the time?
A little bit of everything
All of the time
Apathy's a tragedy
And boredom is a crime
Anything and everything
All of the time
Could I interest you in everything?
All of the time?
A little bit of everything
All of the time
Apathy's a tragedy
And boredom is a crime
Anything and everything
All of the time
You know, it wasn't always like
this
Not very long ago
Just before your time
Right before the towers fell,
circa '99
This was catalogs
Travel blogs
A chat room or two
We set our sights and spent our
nights
Waiting
For you, you, insatiable you
Mommy let you use her iPad
You were barely two
And it did all the things
We designed it to do
Now look at you, oh
Look at you, you, you
Unstoppable, watchable
Your time is now
Your inside's out
Honey, how you grew
And if we stick together
Who knows what we'll do
It was always the plan
To put the world in your hand
Hahaha
Could I interest you in everything?
All of the time
A bit of everything
All of the time
Apathy's a tragedy
And boredom is a crime
Anything and everything
All of the time
Could I interest you in everything?
All of the time
A little bit of everything
All of the time
Apathy's a tragedy
And boredom is a crime
Anything and everything
And anything and everything
And anything and everything
And all of the time
1. Disruptionen – Wandel als Konstante
Don′t you know
They're talking about a revolution?
It sounds like a whisper
- Tracy Chapman, 1988
Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt. Die Ursprünge des Menschen liegen sechs Millionen Jahre zurück. Auch wenn nicht alle Forscher darin übereinstimmen, ist doch sehr viel Zeit vergangen bis unsere Vorfahren begannen, aufrecht zu gehen. War das die erste Disruption der Menschheitsgeschichte? Hängt wohl von der Definition des Begriffes ab. Er leitet sich vom englischen Verb ‚to disrupt‘ ab, welches so viel bedeutet wie stören, unterbrechen oder aufbrechen. Das ist zunächst nicht besonders positiv konnotiert. Es bedeutet schließlich sich von Althergebrachtem und bisher bewährten Methoden zu verabschieden und in gewisser Weise neu anzufangen. Das heißt nicht, dass die Geschichte immer in eine positive Richtung verlief. Die vielen Fehlversuche entlang des Weges haben lediglich nicht so tiefe Spuren in unseren Geschichtsbüchern hinterlassen. Der aufrechte Gang war für unsere Spezies definitiv von Erfolg gekrönt, auch wenn sich dieser Vorgang über tausende von Jahre entwickelt hat. Damit sind wir beim Knackpunkt der Definition, denn Disruptionen verändern den Lauf der Geschichte innerhalb kurzer Zeitspannen.
Die Entwicklung von Techniken, wie man Feuer macht, veränderte sicher sehr schnell die Gewohnheiten des Stammes, der diese beherrschte. Sie nahm Einfluss auf die Jagdgewohnheiten, die Zubereitung der Speisen, die Verteidigung gegen Wildtiere und wärmte in kalten Nächten. Heute würde man von einem Game Changer sprechen. Das bedeutete nicht, dass alle Sapiens wussten, wie man Feuer machte. Einige Stämme genossen die Vorzüge dieses Wissens und gaben sie an die nächste Generation weiter. Andere mussten sich in der rauen Natur ohne diesen Vorteil behaupten und hatten fortan schlechtere Karten als ihre Artgenossen.
Gleiches gilt für die Entwicklung von Sprache, Steinwerkzeugen, Pfeilspitzen etc. Schließlich setzten sich vor gut zwölftausend Jahren Ackerbauern und Viehzüchter gegenüber nomadisch lebenden Wildbeutern durch. Gemessen an der Zeitspanne, die seit den ersten Gehversuchen auf zwei Beinen gemacht wurden, liegt das nicht besonders weit zurück. Seit dieser sogenannten neolithischen Revolution wuchs die Menschheit auf über acht Milliarden Individuen an und wird gegen Ende des 21. Jahrhunderts bei zehn bis elf Milliarden stehen. Und das, obwohl wir seit dem Neolithikum auch allerhand Disruptionen in Kriegsgerät geschaffen haben. Wir haben große Anstrengungen unternommen, unsere Bevölkerungszahlen nach unten zu regulieren. Auf die Steinzeit folgte die Bronzezeit, die wiederum durch die Eisenzeit abgelöst wurde. Dabei ging es auch um nützliche Gebrauchsgegenstände aber in erster Linie sind diese Epochen nach dem Material benannt, mit dem zu jener Zeit Krieg geführt wurde. Das Volk, welches die Technologie als erster bzw. am besten beherrschte hatte den entscheidenden Vorteil, um andere Völker zu unterwerfen.
All das waren Disruptionen, die zwar nicht über Nacht kamen, deren Einflüsse die Menschheit aber stets in eine neue Richtung lenkten. Mit der Erfindung der Schrift begann die Konservierung von Wissen und die Überzeugung, dass dies gleichbedeutend mit Macht ist. Einige sagen, dass hier der Grundstein für das Informationszeitalter gelegt wurde, in dem wir uns heute befinden. Ein Wissensvorsprung bedeutete die Grundlage für immer neue Disruptionen. Aus einfachem Zählen wurden die algebraischen Operationen und damit die Mathematik geboren. Diese war wiederum die Basis für den Handel. In Kombinationen mit den Beobachtungen der Natur und der Gestirne brachten diese Erkenntnisse den Kalender hervor und damit ein Verständnis für die Messbarkeit von Zeit und der Natur an sich. Das Unerklärliche, Göttliche wich zunehmend der Logik und mit jedem Jahrhundert verlor die Welt an Zauber.
Es entstanden die Druckerpresse, die Dampfmaschine und das Automobil. Und bei jeder neuen Errungenschaft gab es Kollateralschäden, die wir in unserem Fortschrittsdrang einpreisten. So war die Druckerpresse ein Beschleuniger der Reformation und ein Brandbeschleuniger der damit verbundenen Reformationskriege. Die Dampfmaschine erhöhte die Produktivität und ermöglichte die Entwicklung der Eisenbahn, zugleich verstärkte sie den Raubbau an der Natur in Kohlebergwerken, verpestete die Luft mit ungefilterten Abgasen und führte zur Verelendung der Fabrikarbeiter. Das Auto kommt trotz allgemeiner Beliebtheit bei dieser Betrachtung auch nicht nur gut weg. Der Kautschuk für die Reifen der ersten Automobile wurde im Kongo mit unfassbarer Grausamkeit geerntet. Das Öl für den Betrieb der Verbrennungsmotoren rückte eine zum Ende des 19. Jahrhunderts völlig unbedeutende Region in den Fokus der Kolonialmächte – den Nahen und Mittleren Osten. Die Obsession nach Erdöl war maßgeblich für viele Spannungen, die wir noch heute in der Region sehen. Und schließlich ziehen Asphaltstraßen in jeden Winkel der von Menschen bewohnten Welt als Todesstreifen für die dort lebenden Wildtiere. So lässt sich das beliebig fortsetzen.
Verzeihen Sie mir diesen wilden Ritt durch die Menschheitsgeschichte. Ich wollte Ihnen nur in aller Kürze aufzeigen, dass wir die Dinge aus verschiedenen Perspektiven sehen müssen. Fortschritt bedeutet nicht, dass es nur Gewinner gibt. Mit etwas Abstand interessiert sich nur niemand mehr für dessen Verlierer.
Was hat das nun mit dem Internet zu tun? Ich bitte noch um etwas Geduld, denn wir sollten uns auch dessen Anfänge ansehen, die ins Jahr 1968 zurückreichen. Im Auftrag des US-Militärs wurde das ARPANET zur Vernetzung von Universitätsrechnern aufgebaut. Der Austausch von Forschungsergebnissen sollte auf diese Art beschleunigt werden. Die Ausgestaltung dieses Netzwerkes, in das zunächst nur vier Einrichtungen eingebunden waren, ähnelte technisch bereits sehr dem heutigen Internet. Seine Bedeutung für die Allgemeinheit ließ jedoch noch lange auf sich warten. Computer waren noch zu teuer und zu groß für den privaten Gebrauch. Für die Forscher an den angeschlossenen Universitäten, dürfte sich aber schon früh abgezeichnet haben, dass hier etwas Bahnbrechendes mit ungeheurem Potenzial geschaffen wurde. Noch war der Riese aber ein Kleinkind.
Als in den 1980er Jahren Home-Computer erschwinglich wurden und letztlich auch durch Computerspiele eine immer größer werdende Nachfrage an diesen Geräten entstand, wuchs das Interesse an Digitaltechnik. Technikbegeisterte, wie beispielsweise vom 1981 gegründeten Chaos Computer Club, begannen die Grenzen der neuen Technologie zu erkunden.
Im September 1983 nahm in Deutschland der Bildschirmtext (BTX) den Betrieb auf. Jetzt konnte man schon online diskutieren, Informationen von Behörden abrufen und auch Onlinebanking war vertreten. Das Ganze war jedoch noch stark durch die Deutsche Post reglementiert und mit hohen Kosten verbunden. Neben einer Grundgebühr musste man auch noch für jeden einzelnen Seitenabruf bezahlen. Der Gegenwert hielt sich in Grenzen. Wie der Name schon sagte, ging es um reine Textinformationen und war deshalb nicht vergleichbar mit dem multimedialen Antlitz des heutigen Internets. BTX war ziemlich dröge und deshalb floppte es dramatisch. Das Ziel, eine Million Nutzer bis 1986 von dieser neuen Technologie zu überzeugen, wurde deutlich verfehlt. Lediglich 60.000 Technikbegeisterte folgten bis dahin dem Weg in die Moderne.
Man könnte sagen, dem Internet wurde es nicht leicht gemacht. Was einen langen Anlauf nahm, setzte erst in den 1990ern zum großen Sprung an. 1995 wurde schließlich die Schwelle von einer Million Nutzern in Deutschland erreicht. Neue Computer mit dem von Intel entwickelten Pentium Prozessor ermöglichten nun zumindest ein flüssiges Lesen von Texten und detailreiche Bilder mit großem Farbumfang. Geduld mussten die User wegen der langsamen Datenübertragung dennoch mitbringen. Das war aber im Umgang mit Computern allgemein gültig. Es war die Zeit, in der Disketten als Datenträger noch Realität und Ladezeiten im Minutenbereich für ein einfaches Spiel völlig normal waren.
Die steigende Zahl der Nutzer des Internets beförderte auch das Angebot. Unternehmen, die etwas auf sich hielten, erstellten einen eigenen Internetauftritt. Anfangs vor allem als Teil der Öffentlichkeitsarbeit um sich betont modern zu zeigen. Privatpersonen erstellten ebenfalls ihre eigenen Websites und führten einen Monolog mit der Welt. Den meisten war sicher klar, dass außer den Leuten, die man ohnehin regelmäßig trifft, niemand von der mühsam erstellten Seite Notiz nehmen würde. Es war wohl eine Form der Selbstwirksamkeit, die Menschen dazu veranlasste allerhand privaten Content, vom Kochrezept, über Hobbies, Reisetipps, bis hin zu tiefen Erkenntnissen, Weltanschauungen und Spezialwissen zu veröffentlichen. Das Internet wurde zum Medium, an dem man aktiv teilnehmen konnte. Vieles davon liegt noch immer in den staubigen Winkeln des Netzes, in die sich keine Google-Suche verirrt.
Nach und nach begann das Internet in neue Bereiche unseres Alltags zu dringen. Wie bereits in der Einleitung erwähnt veränderten Chatrooms die Art der Kommunikation. Es wurde internationaler, englischer. Als User fühlte man sich wie ein Teil eines Paralleluniversums, von dem weniger technikaffine wohl gehört haben, selbst aber im wahrsten Sinne des Wortes keinen Zugang hatten.
Um Bücher oder CDs zu kaufen, musste man nun nicht mehr das Haus verlassen. Zur Bank ging man nur noch, um Bargeld abzuholen, welches der Bankautomat unabhängig von den Öffnungszeiten zur Verfügung stellte. Ich hatte selbst meine Ausbildung zum Bankkaufmann 1997 abgeschlossen und es war damals unter den Kollegen noch nicht absehbar, in welchem Ausmaß ihre Stellen einmal obsolet sein werden. Man sprach eher über die schrittweise Abschaffung von Bargeld durch die Verbreitung von Kartenlesegeräten. In Deutschland hält sich die Abneigung dagegen zumindest für kleine Zahlungsbeträge noch immer hartnäckig. Dennoch war dies einer der ersten alltäglichen Dinge, in die das Internet eindrang.
Eine Entwicklung, die aus Sicht der Banken und Händler durchaus nachvollziehbar war. Bargeld ist immer auch ein Sicherheitsrisiko. Gerade bei vielen Transaktionen wie in Supermärkten, an Tankstellen aber auch in Bäckereien schleichen sich leicht Fehler beim Wechselgeld ein. Das sind natürlich nur kleine Probleme verglichen mit Raubüberfällen oder dem Diebstahl durch die eigenen Mitarbeiter. Daher werden Geldtransporte von bewaffneten Objektschützern durchgeführt und der alltägliche Kassensturz in den Banken und Geschäften endet nicht selten im Heulkrampf, weil die Belege einfach nicht mit dem gezählten Geld zusammenpassen wollen. Passiert das häufiger kann man als Kassierer schnell seinen guten Ruf verlieren.
Hinzu kommt, dass Bargeld trotz immer raffinierterer Sicherheitsfeatures gefälscht werden kann und somit bei jeder Transaktion die Möglichkeit besteht einem Betrug aufzusitzen. Bargeld kostet Geld. Und weil Unternehmer, zu denen auch Banker zählen, unnötige Kosten vermeiden wollen, setzen sie gerne auf technische Lösungen. Unterm Strich sind elektronische Geldtransaktionen günstiger und werden sich deshalb auch langfristig durchsetzen. Ob Bargeld nun wirklich Freiheit bedeutet, wird auf die Probe gestellt werden, sobald dessen Akzeptanz im Handel nachlässt.
Heute drängt sich der Eindruck auf, dass alles, was in irgendeiner Weise digitalisierbar ist, schließlich auch digitalisiert wird. (Ein Seitenhieb auf unsere Behörden ist an dieser Stelle unnötig. Ihr schafft das!) Das Internet wurde zur Mutter aller Disruptionen, weil so vieles darauf aufbaut.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Ausspruch von Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Das Internet ist für uns alle Neuland.“ Das war im Jahr 2013 und den Hintergrund werden wir uns im Kapitel zur Spionage genauer ansehen. Dafür gab es viel Spott insbesondere im Netz. Auf Nachfragen verwies die promovierte Physikerin darauf, dass die Smartphones schließlich noch nicht lange auf dem Markt sind. Wollen wir ihr zugutehalten, dass die passionierte SMS-Schreiberin damals tatsächlich sehr viel um die Ohren hatte, um in der nun sehr schnelllebigen Zeit schritthalten zu können.
Auch wenn das LG Prada schon 2006 auf den Markt kam, gilt heute das iPhone von Apple aus dem Jahr 2007 als Einstieg in die Welt der Smartphones. Hatten noch wenige Jahre zuvor Handys die Kommunikation revolutioniert, wurden sie schon wieder von der nächsten Generation verdrängt. Ich selbst hatte erst ziemlich spät den Sinn von Handys für mich erkannt. 1999 schenkte mir ein Freund sein ausrangiertes Gerät, dass alles andere als handy im eigentlichen Sinn von handlich war. Seine Intention war dabei, mich leichter telefonisch zu erreichen. Leider hatte das Gerät noch keine SMS-Funktion und so ließ ich mich schließlich auch zu einem Nokia 3310 überreden. Das war damals ziemlich angesagt, weil es besonders kompakt war. Überhaupt dominierte Nokia den Handymarkt. Sie hatten zwar starke Konkurrenz aus den USA, Japan, Südkorea und mit Siemens auch aus Deutschland, aber die Finnen hatten technologisch in dieser Zeit die Nase vorn und dominierten das Spiel. Bis Apple kam und mit ihrem iPhone ein komplett neues Spiel erfanden.
Diese Geschichte wird immer gerne zitiert, wenn es darum geht, in der Geschäftswelt nie zu selbstsicher zu sein, den Markt stets zu beobachten und agil auf dessen Bedürfnisse zu reagieren. Allerdings muss man den Managern von Nokia zugutehalten, dass etwas Vergleichbares zuvor nicht passiert war. Der Aufstieg des Unternehmens im Bereich Mobiler Kommunikation begann nahezu gleichzeitig mit der massenhaften Verbreitung des Internets. Während dieses aber immer leistungsfähiger wurde, hinkten die Handys zu dieser Zeit noch technisch hinterher. Es wurde das Wireless Application Protocol, kurz WAP (scherzhaft auch Wait and Pay genannt) eingeführt, das wegen des schlechten Preis-Leistung-Verhältnisses nur wenig Akzeptanz fand. Die Disruption war das Smartphone, mit dem heute gängigen großen Display und Touchscreen. Auf der Strecke blieben die Größen unter den Mobiltelefonherstellern wie Black-Berry, Siemens Mobile später BenQ oder Palm.
Die Dynamik, die den wirtschaftlichen Erfolg von High-Tech-Unternehmen bestimmt ist erschreckend und erfreulich zugleich.
So verlor der bisherige Platzhirsch in der KI-Technologie NVDIA im Januar 2025 innerhalb eines Tages 600 Milliarden Dollar an Börsenwert, weil deren chinesischer Konkurrent Deep-Seek eine leistungsfähigere Technologie bei deutlich geringeren Herstellungskosten veröffentlichte. Besonders spannend daran ist, dass dieses Unternehmen erst im Mai 2023 gegründet wurde. NVDIA entstand 30 Jahre zuvor und hatte sich über die Entwicklung von Grafikprozessoren Jahr für Jahr weiter an die Spitze der Hardwarehersteller vorgearbeitet. Die Entwicklung von KI war praktisch ein Nebenprodukt. Erschreckend ist daran, wie schnell die Früchte der eigenen Arbeit durch Disruption verderben und zugleich ist es erfreulich, dass die Marktmacht von Technologieriesen immer durch Innovation herausgefordert werden kann.
Unweigerlich muss man bei diesen Beispielen an die deutsche Autoindustrie denken, die durch Innovationen aus China und den USA unter Druck geraten ist. Die Schwächen in der Software und bei der Einbindung des Internets in das Fahrerlebnis, ist dafür nicht der ausschlaggebende Punkt. Diese Geschichte ist komplizierter und würde uns an dieser Stelle zu weit von unserem Thema entfernen. Allgemein lässt sich aber sagen, wer erfolgreich ist, möchte doch, dass sich daran möglichst nichts ändert und ist daher in seinem Denken und Handeln eher konservativ. Diejenigen, die sich etwas erarbeitet haben, jedoch wegen äußerer Einflüsse ihre Felle davonschwimmen sehen, wünschen sich die Vergangenheit zurück. Nur wer nichts zu verlieren hat, ist wirklich bereit für große Veränderungen, weil darin ein möglicher Ausweg aus der eigenen Krise besteht. Das gilt im persönlichen ebenso wie für Unternehmen und ganze Volkswirtschaften. Immer wieder die gleichen Antworten auf neue Fragestellungen zu liefern, ist nicht erfolgreich. Diese Erkenntnis ist nicht neu aber das Internet veränderte auf dramatische Weise die Schlagzahl.
Disruption lauert an jeder Ecke. Heute statten die Hersteller von technischem Gerät ihre Produkte mit einer Internetanbindung aus. Egal, ob es um Kühlschränke, Rasenmäh- und Staubsaugerroboter, Kaffeemaschinen, Klimageräte, Fernseher, Bewässerungs- oder Sicherheitssysteme geht. Das Internet-of-Things (IoT) ist dabei und erlaubt beispielsweise die Steuerung über das Smartphone oder Updates over-the-air (OTA). Denn man weiß nie so recht, was der nächste Hype wird. Sicher ist nur, dass man den Zug auf keinen Fall verpassen darf. So umspannt das Netz nicht mehr nur unsere Computer und die virtuelle, sondern auch zunehmend unsere reale Welt.
Jeder noch so unbedeutende Haushaltshelfer bekommt eine IP-Adresse und wird zum Sicherheitsrisiko für Ihr persönliches Netzwerk. Uns ist klar, dass wir fürs Internetbanking eine 2-Faktoren-Authentifizierung benötigen. Aber wie sicher ist Ihr Staubsauger? Spioniert dessen Kamera vielleicht ganz nebenbei Ihre Wohnung aus? Und sind Sie sicher, dass der Hersteller Ihrer günstigen Smartwatch verantwortungsvoll mit Ihren Daten umgeht, oder vielleicht eigene Sicherheitslücken hat, die OTA bei Ihnen ankommen? Vielleicht ist Ihr Kühlschrank bereits Teil eines Botnetzes und Sie wissen es nur nicht. Die Warnung vor sprachgesteuerten Assistenzsystemen wie Alexa und Siri haben Sie bestimmt auch schon gehört. Ich erspare es Ihnen an dieser Stelle.
Heute stehen wir an der Schwelle, an der das Internet bzw. damit verbundene Geräte vom nützlichen Helfer zum Entscheider werden. Denn wenn ein Rasenmäher selbst entscheidet, wann er seine Arbeit beginnt oder sie wetterbedingt einstellt, ist das zwar für uns ein nützlicher Service aber wir geben auch etwas aus der Hand. Das ist nicht das gleiche wie ein Kühlschrank, der seinen Kompressor anwirft, wenn das Thermostat eine erhöhte Temperatur meldet. Die Algorithmen, die den Entscheidungen zugrunde liegen, sind für uns undurchsichtig. Die Gefahr besteht, dass wir uns zunehmend nach Entscheidungen von Geräten richten und nicht mehr der Herr im eigenen Haus sind.
Ich werde in den folgenden Kapiteln aufzeigen, welche teils fatalen Folgen das Internet bereits auf unsere Art zu wirtschaften hat. Inwieweit Kriminelle die riesigen weißen Flecken in der neu geschaffenen Welt der Möglichkeiten besiedelt haben und welchen Schaden unsere Gesellschaft nimmt. Sowohl in der Art wie wir uns informieren und weiterbilden als auch im Umgang miteinander. Nicht immer kann die Trennung so scharf erfolgen, denn zu sehr sind durch das Netz verschiedenste Lebensbereiche miteinander verwoben.
Wir werden das Internet nicht als gescheitertes Projekt behandeln und es wieder abschaffen. Es gibt keinen Weg zurück. Aber das Kind ist zu schnell erwachsen geworden und wir müssen dessen Fehlentwicklungen benennen und Lösungen dafür entwickeln. In anderen Bereichen des Lebens sind wir auch nicht bereit, die Dinge einfach sich selbst zu überlassen und darauf zu vertrauen, dass alles wieder in Ordnung kommt. Wir laufen sonst Gefahr, dass die Nachteile des Internets bald seinen Nutzen überflügeln und wir am Ende etwas geschaffen haben, das keiner wollte.
2. Das Internet und die Wirtschaft
2.1 Onlinehandel – das Dilemma im Warenkorb
Wooden Jesus, where are you from?
Korea or Canada or maybe Taiwan?
But I didn't know it was the Holy Land
But I believed from the minute the check left my hand
And I pray
- Temple of the Dog, 1991
Sie fragen sich vielleicht, ob Online-Shopping wirklich ein guter Start ist, um gegen das Internet zu wettern? Praktisch jeder bestellt doch Ware im Netz. Was kann daran denn falsch sein?
Die Antwort darauf geht tiefer als es die Frage vermuten lässt. Wirtschaftsunternehmen haben, wenn sie erfolgreich sein wollen, ein gutes Gespür dafür neue Märkte zu erschließen. Sie waren die ersten bedeutsamen Siedler in diesem Neuland. Der Onlinehandel zählte somit zu den Haupttreibern für die explosionsartige Ausdehnung des Internets zu Beginn des neuen Jahrtausends, und dass, obwohl wir kaum etwas über die gescheiterten Start-ups wissen. Laut einer Untersuchung der Huffington Post, Forbes und Marketing Signals scheitern 90 % aller E-Commerce-Unternehmen bereits in den ersten 120 Tagen. In anderen Geschäftsfeldern liegt die Ausfallrate im ersten Jahr nur bei etwa 20 %, wenn auch stark branchenabhängig.
Jeder trifft seine eigenen Konsumentscheidungen und das Internet ist nicht nur der größte Marktplatz der Geschichte, sondern auch der transparenteste. Für den Kunden ist es eher unlogisch nicht im Internet zu kaufen, sind wir doch darauf konditioniert unseren Nutzen zu optimieren. Früher musste man das Angebot des stationären Händlers akzeptieren, weil die Markttransparenz nicht gegeben war. Zugleich gaben sich die Kunden schneller mit dem zufrieden was da war. Ob es bessere Produkte oder günstigere Angebote gab, war schlichtweg nicht ersichtlich. Heute weiß man durch das Internet, was es gibt, und ist unzufrieden, wenn es der stationäre Händler nicht hat oder teurer ist als ein Onlinehändler irgendwo auf der Welt. Wenn dann auch noch, wie bei vielen Anbietern im Internet, der Versand umsonst und problemloser Umtausch garantiert ist, gibt es eigentlich nur noch die Lieferzeit als störende Komponente. Auch hier ist allerdings viel passiert, wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit vor dem Internetshopping. Dessen Vorläufer war der Versandhandel.
Dabei ging zumeist halbjährlich ein aufwändig erstellter Hochglanzkatalog an alle Haushalte, deren Adressen das jeweilige Versandhaus habhaft war. Es wurden also vor allem ehemalige Kunden mit Katalogen beliefert, in der Hoffnung, dass diese an Nichtkunden im Freundes- und Bekanntenkreis weitergereicht wurden. So wurde im 20. Jahrhundert Content geteilt: ohne Mausklicks aber bei Kaffee und Kuchen. Bestellungen wurden entweder telefonisch oder über beigelegte Postkarten aufgegeben. Übliche Lieferzeiten waren dabei zwei Wochen. Es durfte also kein allzu eiliger Handlungsbedarf bestehen, weshalb Kleidung besonders stark nachgefragt wurde. Selbst wenn ein besonderes Kleidungsstück benötigt wird, ist der Anlass meist lange vorher bekannt.
Bei Kleidung sind Retouren aber unvermeidlich. Zu unterschiedlich fallen die Größen aus, Farben werden im Katalog nicht korrekt abgelichtet, Details sind nicht gut sichtbar und überhaupt können die Models einfach alles tragen. Am eigenen Leib sieht es dann irgendwie nicht mehr so gut aus. Ich entschuldige mich, falls Ihnen das bekannt vorkommt. Ich beschreibe hier eine Problematik, die sich durch das Shopping im Internet nicht verändert hat, denn Ihr Monitor fungiert hier als Katalog. Immerhin können Sie die Darstellung vergrößern und meistens auch verschiedene Ansichten auswählen. Wir sparen uns also vor allem den Druck des Katalogs und dessen Versand. Die Versandhäuser kamen den Kunden bei Retouren auch früher schon großzügig entgegen. Meist waren diese umsonst oder es gab die Möglichkeit die Ware in eigenen stationären Shops abzugeben. Dabei stand immer im Vordergrund die Ware wieder zu verwenden. Innovationen kamen in dieser Hinsicht nicht aus dem Onlinehandel.
Eine echte Gefahr für den stationären Handel stellten die Versandhäuser allerdings nicht dar. Obwohl die Kataloge, die in den 50er Jahren mit wenigen hundert Seiten anfingen, immer dicker wurden und ausgerechnet in der Endzeit des klassischen Versandhandels, also Ende der 90er Jahre über tausendseitige Bücher im A4-Format waren, konnten sie nicht mehr mit dem Sortiment des Internets konkurrieren. Das war der eigentliche Game Changer.
Wir kennen die Geschichte. Amazon begann sein Geschäft mit Büchern und der Idee einfach jedes Buch zu ihnen nach Hause liefern zu können. Eine stationäre Buchhandlung hätte dafür nicht den Platz und es wäre ökonomisch sinnlos gewesen auf Verdacht alles zu bevorraten. Was früher schon ging, war ein bestimmtes Buch über eine Buchhandlung zu bestellen, weil sie über den entsprechenden Beschaffungszugang verfügte. Amazon hat lediglich diesen Mittelsmann übergangen.
Vom Start der Website von Amazon im Juli 1995, bis das Unternehmen zum ersten Mal einen kleinen Gewinn auswies vergingen sechs Jahre. In der Folge war das Unternehmen auch immer wieder in den roten Zahlen, wuchs aber zugleich beträchtlich und stieß in immer weitere Märkte vor. Im Jahr 2018 übertraf Amazon als erstes Unternehmen die Marktbewertung von einer Billion US-Dollar. Der Firmengründer Jeff Bezos wurde wegen seiner Beharrlichkeit oft belächelt und auch wenn der Mann, der selbst gern und laut zu Lachen pflegt, durchaus sympathisch wirkt, hatten die von ihm eingeführten Praktiken teils desaströse Auswirkungen für alle die am System Amazon mitwirken.
Sein wichtigster Grundsatz war dabei immer den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Der Kunde ist nicht nur König, er hat auch immer Recht. Diese Philosophie stammt sicher nicht von Bezos, aber keiner hat sie so konsequent umgesetzt und auch dafür gesorgt, dass alle Drittanbieter, die seinen Marktplatz nutzen wollen, die gleichen Standards zu befolgen haben. Der Kunde findet nicht nur das breiteste Produktangebot aller Zeiten vor, sondern auch eine intuitive Internetseite. Wer eine Amazon Prime Mitgliedschaft hat, spart Versandkosten, wird häufig innerhalb eines Tages beliefert, hat Zugang zum hauseigenen Streamingdienst etc. Ich will hier keine Werbung machen, denn die Medaille hat noch eine andere Seite. Das Wohl der eigenen Mitarbeiter hat geringere Priorität. Vor allem die Mitarbeiter in den Amazon-Lagern, den sogenannten Fulfillment-Centern, klagen über hohe physische Belastung, kurze Pausen, permanentes Tracking und fehlende Tarifbindung.
Bei der Auslieferung der Pakete wird den Kunden dann das Ausmaß der Ausbeutung gelegentlich bewusst. Die Zusteller arbeiten zum Teil direkt für Amazon oder bei Dienstleistern. Deren wichtigster Kunde ist Amazon und kann somit die Preise und das Arbeitsaufkommen diktieren. Für den Kunden mag es ärgerlich sein, wenn Pakete, ohne zu klingeln vor der Haustür ungesichert abgestellt werden. Man erhält eine E-Mail, dass die Ware zugestellt wurde und sogar ein Foto davon. Was mit dem Paket weiter nach der Zustellung passiert, ist für den Lieferdienst nicht wichtig. Ob es nun gestohlen wird, vom Regen durchnässt oder anderweitig beschädigt wird, spielt für den Zusteller keine Rolle, weil er schließlich noch ein großes Pensum zu erfüllen hat. Zeit für Pausen oder Toilettengänge ist dabei nicht vorgesehen. So sieht man die Zusteller häufig noch in den Abendstunden bei der Arbeit und wünscht sich insgeheim, diesen Job niemals machen zu müssen.
Überhaupt sagt es schon etwas über einen Weltkonzern aus, wenn er Fernsehwerbung schalten muss, um Mitarbeiter in der Logistik anzuwerben. Die Pläne beim Ausliefern künftig auf Drohnen zu setzen, blieben bisher im Versuchsstadium. Bei dem bereits erreichten Gesamtpaketvolumen von etwa 9 Millionen Zustellungen pro Tag in Deutschland, möchte ich mir nicht vorstellen, wie Drohnen den Himmel verdunkeln würden. In der Vorweihnachtszeit ist das Volumen dank der Rabattschlachten in und um die Black Week herum noch deutlich höher.
Ich will mich aber nicht nur bei Amazon aufhalten, weil dieses Unternehmen schon so hinlänglich in anderen Publikationen beschrieben wurde. Wichtig ist nur zu erwähnen, dass dieser Pionier des E-Commerce Standards gesetzt hat, an denen sich andere Betriebe orientieren. Aus Sicht des Unternehmers sollte sein Geschäft ähnlich strukturiert sein wie Amazon, um langfristig erfolgreich zu sein. Wollen wir aber eine Gesellschaft, in der ein Großteil der Bevölkerung für Ausbeuter arbeitet, nur um uns beim Konsum für kurze Zeit königlich hofiert zu fühlen? Leider kann man nicht erwarten, dass Unternehmer bei ihren Entscheidungen den besten Nutzen für die Gesellschaft im Blick haben. Diese Aufgabe haben wir selbst. Ob die Zustände bei Otto, eBay, Zalando, Thalia und Co. besser sind, kann ich nicht bewerten.
Wir stehen hier noch immer am Anfang der Entwicklung und es ist nicht abzusehen, dass sich irgendetwas von selbst zum Guten wandelt. Im Gegenteil drängen heute zunehmend chinesische Händler auf den deutschen Markt, die den Wettbewerb in neuem Ausmaß verschärfen. Der Internetauftritt von Ali-Express, welches zum chinesischen Handelsgiganten Alibaba Group gehört, gleicht dem von Amazon, ist aber lediglich eine Handelsplattform wie eBay. Chinesische Firmen nutzen die Seite als Marktplatz um eine Chance zu haben, ihre Produkte außerhalb Chinas verkaufen zu können. Zu undurchsichtig ist das Geflecht, dass sich dahinter verbirgt.
Das Gleiche gilt für Temu. Beide Anbieter fluten den deutschen Markt mit Produkten deren Preise unfassbar niedrig sind und durch ihre krummen Beträge auffallen. Wir sind es in Deutschland gewohnt, dass Preise je nach Wert des Gegenstandes mit neun Cent oder neun Euro enden. Ein typischer Preis bei Temu wäre 14,82 € für einen Pullover oder 10,42 € für eine Herrenuhr. Diese Preise suggerieren, dass hier wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Tiefer kann der Händler nicht mehr runter gehen, ohne sich selbst zu ruinieren. Vielleicht stimmt das sogar. Wahrscheinlicher ist aber, dass es sich hier lediglich um das Ergebnis automatischer Währungsumrechnungen handelt, die somit einen für uns ungewohnten Preis ergeben.
Häufig wird die Qualität der Produkte bemängelt, weil in China niedrigere Standards bei der Produktsicherheit und Gesundheitsverträglichkeit bestehen. Wer als Kunde hier in die Falle tappt, wird entweder klüger und lässt sich in Zukunft nicht mehr darauf ein oder akzeptiert, dass der niedrige Preis eben ein gewisses Risiko birgt. Bei dem einen oder anderen chinesischen Hersteller wird sich mit der Zeit auch das in Europa übliche Qualitätsniveau einstellen. Die Preise werden dennoch günstiger sein als die Produkte der europäischen Konkurrenz. Die produziert zum Teil selbst in China, hat aber höhere Verwaltungskosten zu stemmen. So oder so kommen neue Spieler auf den Markt und üben Druck auf die Platzhirsche im Onlinehandel aus.
Mit Shein drängt ein chinesischer Modehersteller nach Europa, der neben günstigen Preisen auch sein Sortiment permanent anpasst. Diese sogenannte „Fast Fashion“ soll den Kunden gezielt dazu verleiten seine Garderobe häufig auszutauschen und befördert deren Wegwerf-Mentalität. Unabhängig von der Qualität wird den Kleidungsstücken bewusst nur ein geringer Wert verliehen. Teuren Gegenständen messen wir einen höheren Wert bei, weil wir schließlich ein gewisses Opfer bringen mussten, um sie uns zu leisten. Diese persönlichen Bande entfallen hier komplett. Selbst wenn uns das Stück gut gefällt, können wir uns leichter davon trennen, wenn es zumindest wenig gekostet hat. Altkleidersammlungen schlagen bereits Alarm, weil sie die Mengen nicht mehr bewältigen können.
Für die schwindenden Ressourcen des Planeten ist das die völlig falsche Handlungsweise und steht dem Wunsch nach Nachhaltigkeit entgegen. Hinzu kommt die Praxis von Shein einzelne Pakete direkt aus China per Luftfracht zum Endkunden zu liefern. Andere Modemarken, die in Asien produzieren, senden große Warenmengen per Seefracht zu ihren Lagern nach Europa. Von dort koordinieren sie die Einzelauslieferung. Da das Modell von Shein deutlich schneller und offenbar auch günstiger ist, bleibt zu befürchten, dass sich etablierte Modeketten ihm anschließen. Wirtschaftlich mag das ein kluges Konzept sein aber der Umstieg von See- auf Luftfracht erhöht den klimaschädlichen CO2-Ausstoß je nach Zielort um den Faktor 20–100. Hier ist dringender Handlungsbedarf von Seiten der Politik gefordert.
Der Kohlenstoff-Grenzausgleichsmechanismus (EU CBAM), der ab 2026 vollständig in Kraft tritt, ist der richtige Ansatz. Hier sollen auch Unternehmen, die in die EU importieren eine CO2-Abgabe entrichten, um Wettbewerbsverzerrungen vorzubeugen. Allerdings wird dabei nur erfasst wie viel CO2 bei der Erzeugung der Produkte entsteht. Der Transport in die EU bleibt dabei unberücksichtigt und somit der Schwachpunkt dieser Regelung. Bei der Herstellung von Textilien werden nur geringe Mengen an CO2 emittiert. Shein wird so keinen Grund haben das Geschäftsmodell anzupassen. Offenbar wird auch systematisch der Freibetrag für Zölle von 150 € pro Paket unterschritten, indem Bestellungen nicht in einem, sondern auf mehrere Pakete verteilt versandt werden. So fällt nur die Einfuhrumsatzsteuer an. Die EU ist darauf aufmerksam geworden und ersinnt nun den Freibetrag zu reduzieren.
Ein weiterer Kritikpunkt des E-Commerce sind die bereits erwähnten Retouren. Es war schon das Hauptproblem beim Versandhandel des letzten Jahrhunderts und bleibt als solches ungelöst. Nur wurden Retouren von deutschen Kunden an deutsche Händler früher überwiegend innerhalb Deutschlands transportiert. Die CO2-Belastung war hier ein unschöner Nebeneffekt. Heute werden selbst bei deutschen Online-Händlern die Rücksendungen auch mal quer durch Europa gekarrt. Retouren ins Reich der Mitte stellen einen Mehraufwand dar, den man für Billigartikel nicht rechtfertigen kann. Zudem ist die Logistik für Retouren aufwändiger als der reguläre Versand in Kundenrichtung. Die Ware muss geprüft, gereinigt, eventuell aufbereitet, neu verpackt und wieder eingelagert werden. Ist der Aufwand dafür unverhältnismäßig wird die Ware vernichtet. Das Ganze muss auch zügig passieren, weil der ungeduldige Kunde, sofern er in Vorkasse gegangen ist, seine unverzügliche Rückerstattung erwartet. Nicht selten werden Retouren vom Kunden bewusst einkalkuliert und das gleiche Kleidungsstück in mehreren Größen oder Farben bestellt, nur um sicherzugehen, dass das passende dabei ist.
Noch perfider gehen die Konsumenten beim Wardrobing vor. Hier wird ein Kleidungsstück bewusst zum einmaligen Gebrauch bestellt und anschließend mit fadenscheiniger Begründung zurückgeschickt. Die Einführung einer Gebühr für Retouren wäre also längst fällig und käme den Händlern selbst zugute. Nur will niemand den Anfang machen, weil das erstmal einen Wettbewerbsnachteil bedeuten würde. Allerdings müssen wir uns auch bewusst machen, dass die Preise von allem, was wir im Internet bestellen, bereits die Kosten für dessen Retoure und eventuell auch seiner Vernichtung beinhalten. Anders wäre das Geschäftsmodell für die Händler nicht tragbar. Sie würden sonst auf Kosten sitzen bleiben, die nicht vom Umsatz gedeckt sind. Wäre es denkbar, dass sich der Staat dem Thema annimmt und eine Retouren-Steuer einführt? Das kann man natürlich als ein Handelshemmnis sehen. Allerdings handelt es sich um eine Steuer, die man bei vernünftigem Verhalten nicht entrichten muss. Wem das Risiko einer Retoure zu hoch ist, bleibt immerhin noch der stationäre Handel.
Eben dieser stationäre Handel ist der große Verlierer des ECommerce. In der Zeit vor dem Internet haben sich bereits Einkaufszentren in Stadtrandlagen gebildet, die mit ihrem All-in-One-Konzept die Kräfte mehrerer kleiner und großer Geschäfte unter einem Dach bündelten. So haben sie viele Läden aus den Innenstädten verdrängt oder sie sind selbst in Einkaufszentren umgezogen. Die Parksituation, lange Wege zwischen den Geschäften und auch die Wetterbedingungen können einem das Einkaufserlebnis in der Innenstadt vermiesen. So verloren viele von ihnen schon seit langem an Charme.
Obwohl die Innenstädte doch mehr sind als nur Orte des Konsums. Sie machen einen beträchtlichen Teil der Identität und Verbundenheit mit der eigenen Heimat aus. Wohngebiete in Großstädten mögen auch ihren eigenen Reiz haben, sind aber vergleichsweise austauschbar. Die kulturellen Zentren mit ihren Kirchen, Parks, Stadtmauern, Denkmälern und anderen bedeutenden Bauwerken liegen zumeist in den Innenstädten. Es braucht aber offenbar einen Grund für die Bürger diese Begegnungsstätten aufzusuchen. In modernen Zeiten ist dies der Konsum.
Wie ist es mit Ihnen? Gehen sie gerne einkaufen, wenn außer Ihnen niemand auf der Straße ist? Sie müssen nirgends anstehen. Sie genießen die ungeteilte Aufmerksamkeit der Verkäufer. Eigentlich keine so schlechte Vorstellung könnte man meinen. Dennoch ist einem unwohl, wenn man zum Beispiel an einem Dienstagmorgen fast allein durch die Innenstadt schlendert. Man fühlt sich von den wenigen anwesenden Augenpaaren beobachtet und gehemmt die menschenleeren Geschäfte zu betreten, obwohl die Gelegenheit doch günstig wäre. Offenbar brauchen wir den Trubel, um uns beim Shoppen wohlzufühlen. Eben dieses Schicksal teilen nun vermehrt auch die Einkaufszentren. Die großen Kaufhausketten sind längst im Niedergang und führen einen jahrelangen Todeskampf vor, dessen Ausgang längst klar ist.
Auch das innovative Hybridmodell Click and Collect, bei welchem im Internet bestellt, und im Geschäft abgeholt wird, konnte den Trend nur verlangsamen aber nicht stoppen. Hinzu kommt das unfaire Kundenverhalten beim sogenannten Showrooming. Der Kunde lässt sich vom Fachhändler die Ware vorführen und genießt eine umfangreiche Beratung. Anschließend wird das Produkt dann günstig im Internet bestellt. Der stationäre Händler steht vor der Frage, ob er diesen Service überhaupt noch anbieten und damit seinen letzten Trumpf aus der Hand geben soll.
Ist uns denn bewusst, was wir hier gerade verlieren? Sich über alle möglichen Konsumentscheidungen selbst zu informieren, mag dank des Internets viel einfacher geworden sein aber es erfordert auch viel Zeit und Lernbereitschaft sich damit zu beschäftigen. Darüber hinaus sind im stationären Handel abzüglich der Beschäftigten in Supermärkten und Discountern etwa zwei Millionen Menschen in Deutschland beschäftigt – noch.
Und wie reagieren die Städte auf diese schon lange nicht mehr neue Situation? Es gibt viele Ideen und Konzepte die Innenstädte wieder attraktiver zu machen aber der erste Impuls ist immer, dass es der Markt selbst richten soll. Gibt ein Laden auf, versucht eben der nächste Pächter sein Glück. Man hofft darauf, dass dessen Innovationskraft, das Sortiment oder die besondere Dienstleistung den entscheidenden Beitrag leistet, um das Ruder rumzureißen. Es fällt schwer die grundlegenden Strukturen anzuzweifeln, weil die Entscheidungsträger selbst aus einer anderen Zeit stammen, in denen alles noch anders war. Progressive Ansätze wie autofreie, begrünte Innenstädte mit Spielplätzen, Bühnen und einem reichhaltigen Angebot an Kultur und Gastronomie, die vor allem als Ort der Begegnung dienen sollen, scheitern am Protest der noch verbliebenen Händler. Sie machen aus ihrer Sicht nichts falsch und beklagen die Rahmenbedingungen, wie fehlende oder zu teure Parkplätze. Dabei versuchen sie sich so lange wie möglich in den Wind zu stellen, bis der Sturm sie mitreißt.
Selbst wer umsattelt und ein eigenes Handelsunternehmen im Internet aufbauen möchte, sieht sich dabei neuen Herausforderungen gegenüber. Wer in den Algorithmen der Vergleichsportale eine Rolle spielen will, muss konkurrenzfähige Preise bieten können. Der Kunde hat die maximale Transparenz und entscheidet sich nur allzu logisch für das günstigste Angebot. Wer es nicht bieten kann, wird nicht berücksichtigt. Wer aber den Markt unterbietet, muss mit einer Auftragsflut rechnen, die ein Start-up nicht bewältigen kann. Dem Kunden ist das erstmal egal.
Ich kann hier von einem persönlichen Beispiel berichten. Als wir unser Haus gebaut hatten, planten wir direkt den Einbau einer Infrarotkabine. Das ist eine Art Sauna nur mit Infrarotstrahlern anstelle eines Ofens. Wir fanden ein günstiges Angebot im Internet und schlugen zu. Schon früh wurden wir auf eine lange Lieferzeit aufmerksam gemacht, die wir aber akzeptieren konnten. Wir hatten es nicht eilig. Aber als der Liefertermin näher rückte wurden wir wiederholt vertröstet. Ich rief bei der Firma an und hatte schnell direkten Kontakt mit dem Geschäftsführer, der hörbar unter Druck stand. Ich konnte die Verzweiflung in seiner Stimme hören und hätte ihn gerne von seiner Verpflichtung entbunden. Allerdings, sie ahnen es, hatte ich selbst Vorkasse geleistet und musste mein eigenes Vermögen schützen. Wir einigten uns auf einen Liefertermin, der auch eingehalten wurde. Ein Transporter fuhr vor und ein Herr mit seinem geschätzt noch minderjährigen Sohn trugen die vormontierten Kabinenteile ins Haus. Als gute Konsumenten hatten wir uns im Vorfeld mit dem Produkt beschäftigt und im Internet informiert. Wir wollten gerne die Ausführung im dunklen Zedernholz, weil dieses ein angenehmes Aroma verströmt. Beim Anblick der gelieferten Holzwände war sogleich klar, dass es sich bei dem Material um die hellere und häufig verwendete Hemlocktanne handelt. „Das habe ich nicht bestellt!“ war mein Einwand und hatte damit auch Recht. Der Lieferant fragte mich noch mal, ob ich vielleicht bereit wäre den Fehler zu akzeptieren. Offenbar wusste er mehr, machte aber keine weiteren Andeutungen. Als ich sein Angebot ausschlug, war das der letzte Kontakt mit der Firma, bevor ich den Fall an eine Rechtsanwältin weitergeben musste. Bald stellte sich heraus, dass die Firma insolvent war und es dauerte sieben Jahre, bis das Verfahren abgeschlossen war und wir 3,72 € zurückerstattet bekamen.
Kennen Sie das? Ich wünsche es Ihnen nicht. Wäre uns das im stationären Handel passiert, in dem man das Ladenlokal sieht und einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit bekommt? Natürlich war die Vorkasse riskant. Eine andere Zahlungsart war aber nicht akzeptiert, weil der Händler selbst zunächst ins Risiko geht. Selbstverständlich kann man sich die Bewertungen des Unternehmens vorab ansehen. Letztlich ist das aber nur Statistik und muss nichts über den Einzelfall aussagen. Es tut mir leid für die Beschäftigten des Unternehmens, die nur versucht haben in der modernen Geschäftswelt ihren Platz zu finden und sicher nicht mit Vorsatz betrügerisch gehandelt haben. Ich bin jedenfalls nicht der Einzige geschädigte in diesem Fall.
Wir werden übrigens alle tagtäglich geschädigt. Die Handlungsfähigkeit unseres Staates ist auf einen steten Zufluss von Steuereinnahmen angewiesen. Nun haben wir wie insbesondere Vertreter von Union und FDP gerne hervorheben, in Deutschland kein Problem mit den Steuereinnahmen. Sie schieben dann jedes Mal hinterher, dass der Staat lediglich zu viele Ausgaben hat. Das kann man so sehen, denn die Gesamtsteuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden steigen jährlich und sind nach 620 Milliarden Euro im Jahr 2013 nur zehn Jahre später um weitere fast 300 Milliarden auf 913 Milliarden Euro angestiegen. Da spielt natürlich auch die Inflation und die steigenden Löhne eine wichtige Rolle. Auch für den Staat wird es nicht billiger, aber das sind beachtliche Zahlen, die den Fiskus zufrieden stellen sollten. Als Bürger bin ich allerdings nicht zufrieden, wie die Steuereinnahmen generiert werden. Etwa ein Viertel davon entfallen allein auf die Lohnsteuer, die direkt an die Finanzkassen fließen. Der Arbeitnehmer muss im Rahmen seiner Steuererklärung detailreich beantragen, dass ihm zu viel entrichtete Steuern zinslos zurückerstattet werden. Steuerflucht und Steuervermeidung sind Praktiken, die dem einfachen Bürger verwehrt bleiben und das ist auch gut so. Jeder soll seinen fairen Anteil für das Gemeinwohl leisten. International agierende Unternehmen betreiben dieses Spiel allerdings ausgiebig. Immerhin scheint sich nach einem Vierteljahrhundert, in dem E-Commerce von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewann und dementsprechend Steuereinnahmen aus dem stationären Handel wegbrachen, auch in der Politik die Einsicht durchzusetzen, dass Handlungsbedarf besteht.
Am 1. Januar 2023 trat die DAC7-Richtlinie in Kraft, die Online-Plattformen dazu verpflichtet Details zu ihren Umsätzen an die Finanzbehörden zu liefern. Wohlgemerkt handelt es sich dabei um eine Initiative der oft gescholtenen EU. Diese Richtlinie soll Klarheit schaffen, welche Umsätze online generiert werden und den Informationsaustausch zwischen den Behörden vereinfachen. Die EU erhebt ja keine eigenen Steuern aber ist zumindest um Standardisierung bemüht. Für kleine Start-ups, die zwar im Netz agieren und somit weltweit sichtbar sind aber ihr Geschäft nur lokal begrenzt betreiben wollen, stellt die Richtlinie ein bürokratisches Hemmnis dar. Sie stehen nicht nur im Wettbewerb mit einigen der größten Unternehmen der Welt, sie werden auch genauso behandelt.
Die Steuervermeidung wird durch die Richtlinie erschwert aber die komplizierten Firmengeflechte, welche die Onlineriesen geschaffen haben, erlauben ihnen noch immer ausreichenden Spielraum, um ihre Steuerlast so gering wie möglich zu halten. Bei der überstaatlichen Natur des Internets spielt es letztlich auch keine große Rolle, wo der Firmensitz gemeldet ist. Amazon hat für sein EU-Geschäft beispielsweise das beschauliche Luxemburg als seinen Firmensitz ausgewählt. Seit 2024 müssen sie dort auch die globale Mindeststeuer von 15 % für Großkonzerne mit Umsätzen über 750 Millionen Euro pro Jahr bezahlen. Tatsächlich war die Summe aus Körperschaftssteuersatz inklusive des Solidaritätszuschlags (ja, Luxemburg hat auch einen Soli) und Gewerbesteuersatz bei knapp 25 %. Dennoch zahlte Amazon 2020 bei einem europaweiten Umsatz von 44 Milliarden keine Steuern. Direkte Vereinbarungen mit dem Land Luxemburg und Finanzschiebereien innerhalb des Konzerns machten es möglich. Ihnen würde Vergleichbares nicht gelingen, weshalb die Steuergerechtigkeit extrem auf die Probe gestellt wird. Es bleibt spannend, ob die neuen Regelungen greifen und die großen Konzerne sich zukünftig am Gemeinwohl beteiligen.
Die Politik hat das Problem der unverhältnismäßigen Besteuerung von E-Commerce-Unternehmen erkannt und erste Maßnahmen zu dessen Eindämmung ergriffen. Beim Geld hört der Spaß bekanntlich auf. Doch wie wir sehen werden, gibt es noch zahlreiche weitere Baustellen, die dringend bearbeitet werden müssen, um den Missständen im digitalen Raum wirksam zu begegnen. Eine davon betrifft eine besonders einflussreiche Ausprägung des Onlinehandels: die Plattform-Ökonomie.
2.2 Plattform-Ökonomie – Lust auf Monopoly?
Face in the wind, we′re riding the storm
We'll stay our course whatever will come