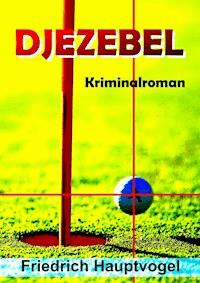
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Djezebel, die junge und schöne Erbin des riesigen Familienvermögens der van Straatens wird auf dem Golfplatz mit einem Hubschrauber entführt. Der frühere Strafverteidiger Hans Feldmann eilt ihr zu Hilfe und wird angeschossen. Rodolfo, der Testamentsvollstrecker des Erbes, engagiert ihn, um die Interessen des zum Erbe gehörenden Konzerns gegenüber der Polizei und dem vermuteten Erpresser zu vertreten. Kurz darauf wird er wieder entlassen, ermittelt aber weiter und wird so in ein altes Familiendrama um Macht und Geld hineingezogen, das blutig endet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DJEZEBEL Friedrich Hauptvogel published by: epubli GmbH, Berlinwww.epubli.de Copyright: © 2015, Friedrich Hauptvogel Covergestaltung: Erik Kinting - www.buchlektorat.net
1. Kapitel
Eine Golfpartie
Im grellen Licht des aufgerissenen Aprilhimmels rollte der alte Volvo des Professors an einem Freitagnachmittag in den Schlosshof von Königsförde.
Als Valerie Ingendaay die Fahrertür öffnete, drängelte sich als erstes Botho, der Airdale des Professors, heraus, begierig, nach der stundenlangen Fahrt seine aufgestaute Kraft auszutoben. Aus dem Eingang des Schlosses stürzten im selben Moment mit Wutgeheul zwei West Highland Terrier. Max und Moritz griffen den Airdale frontal an. Die Hunde jagten sich wechselseitig über den großen Hof. Es war ein festes und völlig harmloses Ritual zwischen den Dreien, das sich immer wiederholte, wenn der Professor zum Golfen auf das Schloss kam. Einige Besucher allerdings schauten sehr bedenklich, weil sie befürchteten, der viel größere und stämmigere Airdale werde den beiden putzigen kleinen Westies der Wirtin der Caféteria umgehend den Garaus machen.
Dem Hunde folgte, um einiges behäbiger, der Herr. Langsam schob sich die massige Gestalt des Professors ins Freie. Die kurz vor Kriegsende als Flakhelfer erlittene schwere Verletzung des rechten Knies machte ihm das Ein- und Ausstiegen beschwerlich, und beim Gehen stützte er sich leicht auf einen Stock. Nichts Elegantes, Feingliedriges, sondern einen richtigen Knotenstock. So einen, wie ihn einstmals wohl Rübezahl benutzt hatte.
Nach dem Aussteigen verlor sich der unbewegliche Eindruck, der dem Professor sitzend zu eigen gewesen war. Er reckte sich, hielt prüfend die Nase in den Wind und man konnte an einen Seehund oder besser See-Elefanten denken: hoch ansetzende dünne Haare über einer glatt wirkenden Stirn, die von dicken Wangen und einem gestutzten Schnäuzer unter der knorrigen Nase gestützt wurde, flink umherwandernde wache Augen hinter randlosen Brillengläsern.
„Botho“, rief er mit lauter Stimme, als er sah, wie dieser Max – oder war es Moritz? – in gefährlich scheinender Manier knurrend an der Gurgel packte. Sofort hielt Botho inne und nun kamen alle drei Hunde einträchtig auf den Professor und Valerie zu. Botho wurde unruhig, als er mit ansehen musste, wie ausgiebig Max und Moritz nun von ihnen gestreichelt und mit allen möglichen Kosenamen bedacht wurden.
Aus dem Haupthaus der Schlossanlage kam Olli auf sie zu, und begrüßte sie herzlich.
„Haben Sie eine gute Reise gehabt?“, erkundigte er sich.
„Der Verkehr in Richtung Norden wird immer schlimmer, wenn man nicht nachts oder vor Tagesanbruch fährt“, knurrte der Professor, „wir sind schon seit zwölf unterwegs. Valerie war so nett, die ganze Zeit zu fahren. Ich glaube, ich habe zwischendurch mal ein längeres Nickerchen gemacht.“
Olli machte eine einladende Handbewegung zum Eingang des Schlosses hin. „Wollen Sie einen Drink nehmen nach der langen Fahrt? Ich leiste Ihnen gern Gesellschaft.“
„Ich weiß nicht“, sagte Valerie, „ich glaube, der Professor will heute Nachmittag noch eine Runde auf dem Kurzplatz gehen, und ich wollte ihn eigentlich begleiten. Da wird es ohnehin fast sieben, bis wir zurück sind.“
„Wir nehmen nur einen Kleinen im Stehen“, entschied der Professor.
Olli lachte zustimmend. „Sehr gut, dann kann Paul inzwischen Ihr Gepäck in die Zimmer bringen und zwei Golfwagen bereitstellen. Kommen Sie.“ Wieder machte er eine einladende Handbewegung, und sie gingen in die Schlosshalle.
„Ich fahre morgen für zwei Wochen nach Frankreich“, sagte Olli, während er Gin Tonics zubereitete, „deshalb noch ein Hinweis: Für Sonntag haben sich sehr viele Gäste angesagt. Wenn Sie den Masterplatz spielen wollen, empfehle ich, eine Abschlagszeit eintragen zu lassen.“ Er verteilte die Gläser.
„Auf ein schönes, besinnliches Golfwochenende“, sagte der Professor, und hob sein Glas. Sie prosteten sich zu, tranken, und dann gingen Valerie und er in ihre Zimmer, um sich umzuziehen.
Bis zum Abschlag des Kurzplatzes waren es nur zweihundert Meter. Als Olli von der Halle des Schlosses die Treppe hochstieg und vom Erker seines Arbeitszimmers hinübersah, puttete Valerie gerade am ersten Loch zum Birdie ein. Der Ball des Professors lag etwa dreieinhalb Meter von der Fahne entfernt, noch knapp auf dem Grün. Bei Schlägen über sehr weite Distanzen war er durch seine Knieverletzung und durch die im Alter abnehmende Spannkraft im Nachteil, aber er glich dies durch geniale Annäherungsschläge wieder aus, und beim Putten kam er selten über zwei Schläge, es sei denn, er erwischte einmal einen rabenschwarzen Tag. Sehr oft lochte er aber auch auf schwierigen, abschüssigen Grüns aus einer Entfernung von sechs oder sieben Metern ein, und macht so Punkte wett. Sein Handicap neun erwähnte er ungern, war aber stolz darauf.
Der Professor bereitete sich auf seinen Putt vor, fand auch gut die Linie, hatte sich aber in der Schnelligkeit des nach einem kurzen Regenguss noch feuchten Grüns verschätzt. Einen Zentimeter vor dem Loch blieb der Ball liegen. Selbst von seinem weit entfernt liegenden Beobachtungsplatz aus konnte Olli noch gut das ärgerliche Kopfschütteln des Professors sehen, bevor er sich mühsam bückte und den Ball aufnahm. Die beiden Spieler verließen das Grün, und verschwanden über die kleine Holzbrücke, die über einen Bach zum zweiten Abschlag führte.
***
Olli hatte eine deutsche Mutter und einen englischen Vater, hieß eigentlich Erich Wingate, aber seit seiner Studentenzeit in England nannte ihn alle Welt aus Gründen, an die sich niemand mehr erinnern konnte, nur Olli.
Er war siebenundvierzig, knapp über Mittelgröße, schlank, mit kräftigen Armen. Ein großer Sportsmann, dabei wortkarg. Ein großmütiger und weitsichtiger Freund seinen Freunden und ein nachtragender, gehässiger Feind seinen Feinden. Als Baumaschinenhändler zweimal reich im Leben und zweimal ruiniert, war er im dritten Anlauf nochmals zu Geld gekommen, hatte das heruntergekommene Schloss in Königsförde gekauft, einen Investor für die Golfanlagen gefunden, und beschlossen, hier den Rest seines Lebens zu verbringen. Diesen Besitz wollte er mit Klauen und Zähnen verteidigen. Fairplay würde dabei nur auf dem Golfplatz gelten, daran ließ er keinen Zweifel. Das Leben war kein sportlich-fairer Zweikampf.
Er war zweimal geschieden. Seine erste Frau verliebte sich in seinen Geschäftspartner, der ihn mit Hilfe eines trickreichen Advokaten aus der gemeinsamen Firma drängte. Bei der Scheidung flöhten sie ihn nach allen Regeln der Kunst aus. Die zweite Frau verließ ihn, als er seine Firma mit waghalsigen Spekulationen selber in den Konkurs getrieben hatte, und so war er mit den Frauen durch. Der Professor war der einzige Anwalt, den er nicht aus innerstem Herzen hasste. Wenn auch im Charakter ganz unterschiedlich, erkannte doch jeder im anderen den gleichen krassen Egozentriker, und saßen sie gelegentlich abends in der fallenden Dunkelheit irgendwo zusammen und tranken Whisky, so schiegen sie zusammen, und fühlten sich miteinander wohl. Über ihre Vergangenheit sprachen sie nie. Sie hatten längst gelernt, dass die unwiederbringlich dahin war und dass es keinen Sinn machte, Fragen zu stellen, auf die man gar keine Antwort wissen wollte.
Olli war überall, seine dunklen Augen wirkten unbeweglich, sahen und registrierten aber alles. Auf die Wünsche und Anregungen seiner Gäste reagierte er in der immer gleichen unveränderten Weise. „Ich kümmere mich“, sagte er, oder „nichts zu machen“. Nur ganz selten gelang es jemandem, ihn zu einem längeren Kommentar zu bewegen. Er war kein wirklicher Frauenhasser. Er behandelte Frauen herzlich und zuvorkommend, aber er hielt sich innerlich von ihnen fern, und zog die Gesellschaft von Männern vor. Die Frauen mochten ihn dennoch.
Er war ein guter Golfspieler, aber nur selten redete er über das Spiel, und niemand, der mit ihm während eines Wettspiels in einen Flight gegangen war, konnte sich daran erinnern, dass er in vier Stunden mehr als drei zusammenhängende Sätze gesprochen hätte. Im Sommer liebte er es, vor Tau und Tag als Erster auf den Platz zu gehen. Nach dem Abschlag sah man seine schlanke Gestalt mit schnellen, geschmeidigen Schritten das Fairway entlanggehen. Er beschränkte sich auf die Hälfte der achtzehn Löcher, war so nach zwei Stunden zurück, und konnte seine Gäste beim Frühstück begrüßen.
Den meisten Menschen schien er eine ziemlich rätselhafte Persönlichkeit zu sein.
***
Gegen neun am Abend erschienen der Professor und Valerie in der Haupthalle des Schlosses, wo die Mahlzeiten serviert wurden. Die wuchtige Holztäfelung der Decke verströmte eine feierlich-düstere Stimmung.
Nur drei der sieben Tische waren besetzt. Im Kamin knackte und gloste ein gemütliches Holzfeuer, an dem vorbei Olli sie zu ihrem Tisch führte. Während der Professor sich bemühte, sein blessiertes Bein mit der Fülle seines Leibes nicht allzu sehr zu belasten, als er sich auf seinen merklich ächzenden Stuhl fallen ließ, winkte Olli den Servierkellner herbei, der große, handgeschriebene Karten vorlegte.
Geraume Zeit grübelten sie über den angebotenen Speisen. Mit den dicken Fingern seiner linken Hand liebkoste der Professor dabei die gerade noch unter dem Tischtuch hervorlugende Schnauze Bothos. Plötzlich wurde diese, die sich dem Streicheln seiner gekrümmten Finger wohlig entspannt hingegeben hatte, von einem unwilligen Zucken überfallen. Der Professor schaute nach unten, und sah, dass Botho gespannt eine neue Witterung einsaugte und langsam seinen rechteckigen Schädel unter dem Tisch hervorzustrecken begann.
Der Professor folgte dem Blick des Hundes, und sah an der Eingangstür ein junges Paar. Das heißt, eigentlich sah er vor allem, um nicht zu sagen ausschließlich, die Frau. Es war der noch nicht ganz erloschene primitiv-chauvinistische Instinkt, der ihn in den vergangenen Jahrzehnten so oft umgetrieben hatte. Einen Moment schaute er – fast verlegen – Valerie an, die sich aber in routinierter, selbstsicherer Diskretion ausschließlich auf die Speisekarte konzentrierte, dann blickte er wieder in Richtung der jungen blonden Frau, die an der Tür jetzt mit Olli wegen eines Tisches verhandelte. Sie schienen miteinander vertraut.
Sie mochte knapp über zwanzig sein, ihr Begleiter ein paar Jahre älter, beide den Glanz der jeunesse dorée auf den Wangen, ihrem selbstverständlichen Auftreten nach Mitglieder der Gesellschaftsschicht, die in solcher Umgebung nur an Nuancen des Stils interessiert ist, nicht am Preis.
Wegen der Unterhaltung der anderen Gäste konnte man nicht verstehen, was die junge Frau sagte, aber der Tonfall ihrer Stimme war bestimmend, hell und von angenehmer Melodie. Ihr Begleiter, den der Professor jetzt mit nachlässiger, aber dennoch wachsamer Aufmerksamkeit musterte, war geringfügig kleiner als sie. Als sie an einem etwas abseits stehenden Tisch in der Nähe des Kamins Platz nahmen, fuhr er sich mit den Händen durch die dicken kastanienbraunen Haare, eine etwas unpassende, verlegen wirkende Geste. Die Frau sagte etwas zu ihm, lächelte, und strich ihm eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Darauf lächelte auch er, aber schüchtern, verlegen und weniger für sie als für einen unbestimmten Partner im Raum.
„Ein sehr gutaussehender junger Mann“, sagte nun Valerie mit ironischer Betonung auf Mann, und betrachtete das Paar aufmerksam. Olli trat an ihren Tisch, um – Zeichen ungewöhnlicher Hochachtung bei ihm – die Bestellung selbst aufzunehmen. Seufzend wandte sich der Professor nochmals der Karte zu. Sie wählten als Vorspeise Steinpilze in Knoblauchtunke und dann Lammrücken, dazu einen leichten roten Landwein.
Valerie hatte sich entschlossen, die Aufmerksamkeit des Professors wieder auf sich zu lenken, und begann, von einer Munch-Ausstellung zu erzählen, die sie Ende März in Paris im Musée d’Orsay gesehen hatte. Die Pilze kamen, aber während der Professor höflich zuhörte und langsam und bedächtig aß, wanderte sein Blick gleichzeitig immer wieder zu dem jungen Paar hinüber.
Valerie spürte, dass ihr Bericht nur eine Begleitmusik zu dem Aufritt war, den er beobachtete. Sie hatte dergleichen schon früher erlebt, sie kannte seine Neigung zu grübelnder Interpretation menschlicher Beziehungen, aber da sie sich sicher war, dass seine Aufmerksamkeit am Ende immer wieder zu ihr als der intelligentesten und offensichtlich am wenigsten egoistischen Partnerin zurückkehren würde, konnte sie es ertragen, im Moment ignoriert zu werden.
„Sie scheinen Krach zu haben“, meinte der Professor, und auf Valeries fragenden Blick fügte er hinzu, „der Junge ist ganz verkrampft. Schau‘ dir nur seine Finger an, wie er die gegeneinander drückt.“
„Ich weiß nicht“, sagte Valerie, um ihn ein wenig weiter herauszulocken. Das Studium der Körpersprache war eine seiner Lieblingsbeschäftigungen, er hatte es in zahllosen Mandantengesprächen und in vielen Strafprozessen bei der Befragung von Zeugen geschult und genutzt.
Neben dem Kamin sprach die Frau pausenlos auf den Mann ein. Der hatte den Kopf etwas eingezogen, und blickte starr auf seine Hände. Die Miene der Frau war jetzt düster.
Das Lammgericht kam. Tief sog der Professor den Geruch von Knoblauch und Kräutern auf. Er nahm sein Glas, und prostete Valerie zu. Während er trank, glitt seine Hand wieder nach unten zu der Hundeschnauze. Einen Moment schaute er etwas verunsichert auf das Tier, dann in Richtung des Paares. „Seltsam“, murmelte er.
„Was ist so seltsam?“, fragte Valerie, die sich um ihre Ausführungen über Munch nun doch etwas betrogen fühlte, in leicht ironischem Ton.
„Unsere kleine Schönheit hat Angst. Ganz offensichtlich.“
Überrascht musterte Valerie die junge Frau, deren Aussehen dieser Feststellung zu widersprechen schien. Ihr klar geformtes, ebenmäßiges Gesicht mit den vollen Lippen unter einer sanft gerundeten Nase glich den zeitlos schönen Tänzerinnen auf altägyptischen Wandbildern. „Meinst du?“
Der Professor schaute ihr ernst in die Augen. „Ich meine gar nichts. Aber Botho.“
„Botho?“
„Botho“, bestätigte der Professor. „Er sitzt da unter dem Tisch, und wendet kein Auge von den beiden ab. Er ist wie erstarrt.“
Ratlos sah Valerie den Professor an. „Er riecht es“, sagte er, „Botho riecht die Angst. Ein Organismus, der Angst empfindet, schüttet bestimmte Hormone aus. Über die Haut umgeben sie den Körper mit einer für uns nicht wahrnehmbaren Aura. Für einen Hund ist das, als wenn dort mit Leuchtschrift das Wort ‚Angst‘ stünde. Ich habe mit Botho ähnliche Situationen schon mehrmals erlebt.“
„Wer von den beiden hat Angst? Warum soll das Mädchen Angst haben?“
Der Professor zuckt nur mit den Schultern, und breitete seine Hypothesen aus: „Vielleicht ist sie verheiratet, und geht zum ersten Male fremd. Dann hat sie Angst, dass jemand sie erkennt. Aber dazu ist sie eigentlich zu jung. Oder sie ist von Zuhause ausgerückt. Aber dazu ist sie wiederum zu alt.“
Valerie war ob dieser trivialen Hypothesen enttäuscht. „Lassen wir die beiden. Sie werden schon zurechtkommen.“
Der Professor knurrte etwas Unverständliches, und winkte dem Ober. „Wir wollen den Nachtisch bestellen.“
Unmittelbar nachdem es das Essen beendet hatte, erhob sich das junge Paar. Der Missklang, der zwischen ihnen herrschte, war nun offensichtlich. Die Art, wie sie voneinander abgewandt zur Türe gingen, ließ keinen Zweifel offen. Einige der anderen Gäste sahen ihnen nach, wobei aus den Augen der durchweg älteren Herren vor allem Bewunderung strahlte, soweit sie sich von ihren Begleiterinnen unbeobachtet glaubten. Auch Ollis düsterer Blick folgte ihnen.
***
Nach dem Essen war Valerie müde, und verabschiedete sich. Der Professor zog sich mit Botho in die hintere Halle des Schlosses zurück, um Zeitung zu lesen. Kein anderer Gast war anwesend. Olli brachte ihm mit einer gewissen Feierlichkeit die Flasche Glenfiddich, die immer für ihn bereitstand. Der Professor prüfte kurz den Pegelstand – noch gut ein Viertel –, und lehnte sich mit zufriedenem Gesichtsausdruck in seinen Ohrensessel zurück.
Nie ging er vor Mitternacht zu Bett, häufig erst gegen zwei Uhr morgens.
Der Raum war viel kleiner als die Haupthalle, aber ausgestattet mit einer riesigen Feuerstelle, groß genug, um einen Ochsen zu braten. Diesen Vorschlag hatte Olli tatsächlich einmal vorgebracht, er war aber natürlich nicht durchführbar. Schwer lastete die niedrige Decke auf dem durchgebogenen Holzbalken. Die abwechselnd in den Farben Milchweiß und Braunrot verlegten Fliesen des Fußbodens hatte der Professor einmal Valerie gegenüber mit einem Schachbrett verglichen – „das Schachbrett unseres Lebens“ und sich damit von ihr nur eine mokante Bemerkung eingehandelt. „Wenn ich hier spätabends sitze“, hatte er aber ungerührt hinzugefügt, „dann fühle ich mich wie ein kleiner Gott. Ich sehe die Menschen, mit denen ich mich gerade beschäftige, wie Schachfiguren; ihre Ziele, Ränke und Machenschaften erscheinen mir als Züge, ihr Hass und ihr Hochmut, ihre Gier, ihre Ängste, aber auch ihre Treue und Opferbereitschaft kann ich wie Variationen schon oft gespielter Partien erkennen. Aber meist sind es Standarderöffnungen und triviale Abschlüsse.“
Noch aus einem anderen Grund liebte er diesen Raum. Hier war der akustische Mittelpunkt des Schlosses. Herangetragen auf unerfindlichen Bahnen, Schallbrücken, durch alte, nicht mehr erkennbare Schächte im Mauerwerk, kreuzten sich hier alle Geräusche aus dem Schloss. So wie eine Spinne im Netz die Schwankungen fühlt, die das unglückliche Insekt verursacht, das sich darin verfängt, so würde der einsame Lauscher in diesem Raume an vielem teilnehmen, wenn er die Fähigkeit hätte, alles zu verstehen, was rings um ihn gesagt, geflüstert, gestöhnt, geradebrecht wurde.
Mehr als zwei Stunden vergingen. Das Lesen hatte der Professor nach einer kurzen Weile aufgegeben. Er trank auch keinen Whisky mehr. Von einer zentralen Stelle aus wurde das Deckenlicht gelöscht. Er saß regungslos, mit offenen Augen, wie in Trance, nur ein wuchtiger Schatten im diffusen Licht der Notbeleuchtung. Botho lag schlafend neben dem Sessel.
Schließlich begann der Professor, sich wieder zu bewegen. Er erhob sich langsam, griff nach seinem Stock, und ging zu einem kleinen Nebenausgang. Als er die Tür öffnete, drängte sich Botho an ihm vorbei, und verschwand mit langen Sätzen in der Dunkelheit. Tief atmete der Professor die kalte Nachtluft ein. Hier, an der Rückseite des Schlosses, brannten keine Lampen.
„Botho“, rief er mit gedämpfter Stimme nach einigen Minuten, und sofort war der Airdale an seiner Seite.
Das Zimmer des Professors war im ersten Stock am Ende des Ganges. Dies war sein Lieblingszimmer, weil die Aussicht nach zwei Seiten ging und er so immer zwei unterschiedliche Perspektiven auf die Welt hatte. Valerie wohnte gegenüber. Als er langsam den Flur entlangging, blieb der ihm vorauseilende Botho vor einer der Zimmertüren stehen. Der Hund neigte den Kopf, und der Professor sah, wie sich langsam sein Nacken unter dem drahtigen, krausen Haar versteifte. Als er näherkam, hörte auch er, was der Hund schon vor ihm wahrgenommen hatte: einen feinen, hohen Ton, regelmäßig, aber in sich verkürzendem Rhythmus an-und abschwellend. Der Professor war irritiert. Neben dem Hund blieb er stehen, und erst jetzt konnte er hören, dass diese Töne offensichtlich aus dem Zimmer hinter der Tür kamen. Heftiges Atmen war jetzt auszumachen und eine helle Frauenstimme: „Ja, mach‘ schon, komm‘!“ Unvermittelt schwang die Stimme um in stöhnendes Keuchen.
Einen Moment lang lauschte der Professor, neigte den Kopf, dann machte er eine abwehrende Bewegung mit der Hand, fuhr mit ihr wie ein Blinder tastend über die Sieben aus Messing, die auf der Tür angebracht war, gab dem Hund einen festen Klaps auf den Rücken, und ging in sein Zimmer.
Botho rollte sich sofort auf seiner Schlafdecke zusammen, während der Professor sich auf den Rand des Bettes setzte und eine Weile vor sich hin grübelte.
„Seltsam“, sagte er zu sich selber, „irgendetwas ist seltsam“. Er schüttelte den Kopf, seufzte, und begann sich auszukleiden.
***
Er hatte abgeschworen. Das erzählte er Valerie ein halbes Jahr nach dem Beginn ihrer Freundschaft, um, wie er sagte, unklare Verhältnisse zu vermeiden. Von Kindheit auf geplagt von einem unberechenbaren Temperament, das in der Befriedigung wildflackernder Leidenschaften seine Haupttriebfeder hatte, reihte er in seinem Privatleben Katastrophe an Katastrophe. Ohne dauernde, sich bewährende Beziehung zermürbte er sich im hektischen Suchen nach ruhiger Zufriedenheit. Und in den kurzen Besinnungspausen – todmüde am Abend mit dem Whiskyglas in der Hand und zufällig sich im Spiegel erblickend oder aus dem warmen Bett einer Frau in den harten und kalten Autositz flüchtend, um für den kurzen Rest der Nacht doch noch nach Hause zu fahren – schienen ihm aus den zerstörten Menschenschicksalen, die die Akten auf seinem Schreibtisch füllten, ebenso viele Facetten eigenen Ungenügens entgegenzublicken. Er kam sich vor wie ein Blinder, der über verschneite Pfade durch die Berge irrt.
Kurz nach seinem sechzigsten Geburtstag lernte er Viola kennen, und wurde von ihr und ihren beiden kleinen Töchtern in eine warme Welt ruhigen Glücks geführt. Da schmolz aller lang verdrängter Groll und Hass, die sich wie Jahresringe um ihn gelegt und ihm die Luft abgedrückt hatten. Die Krusten aus Schmach und Niederlagen brachen auf, und wie erlöst trat er ein in eine neue Welt.
Viola war achtunddreißig, eine dunkelhaarige Frau von slawisch-schwermütiger Schönheit, die nach zehn Ehejahren ihren amerikanischen Mann durch eine heimtückische Krankheit verloren hatte. Als sie bei Freunden den Professor kennenlernte und seine Einladung annahm, hatte sie keine Liaison im Sinn, was sie ihm bei ihrem zweiten Treffen offen sagte. Trotzdem trafen sie sich wieder. Im Laufe dreier Monate wurden die Abstände zwischen ihren Begegnungen immer kürzer. Violas Töchter vernarrten sich in ihn. Er setzte sich zu ihnen auf den Boden, spielte mit ihnen, erzählte ihnen Geschichten, und nahm sie in den Arm. Marise war acht, Cora-Lee zehn. Der Professor verlor sein Herz an die beiden, noch bevor er sich in Viola verliebte. Weihnachten kam, sie saßen alle vor dem geschmückten Tannenbaum, und stellten fest, dass sie eine Familie geworden waren.
Sie heirateten, und lebten zusammen in Violas großer, gemütlicher Wohnung. Zum ersten Mal in seinem Leben genoss der Professor ein langes ungetrübtes Glück. All seine Leidenschaft wandte er nun seiner Familie zu. Zuerst ängstigte ihn diese Ausschließlichkeit, weil sie ihm andere Erfahrungen zu verbieten schien, doch dann begann er, sich ihr mit wachsender Gelassenheit zu ergeben. Viola war finanziell abgesichert, und der Professor war zwar nicht reich, hatte aber durch seine lange Strafverteidigertätigkeit einiges Kapital erworben und in zwei Mietshäuser angelegt, die so viel abwarfen, dass er bequem davon leben konnte. So gab er seine Anwaltskanzlei auf, und widmete sich nur noch Frau und Kindern.
Ein knappes Jahr später, am 21. Dezember 1988, zerbarst sein Glück. Sie wollten Weihnachten in Florida verbringen. Viola wollte mit den Kindern ein paar Tage vorher nach New York fliegen, um dort die Eltern ihres früheren Mannes zu besuchen. Als der Professor von dem Terroraschlag auf das Pan-Am-Flugzeug über Lockerbie hörte, wollte er zunächst – zum ersten Mal in seinem Leben – eine unumstößliche Tatsache ignorieren. As er den Schmerz schließlich doch an sich heranließ, sprach er mit niemandem darüber. Zunächst blieb er wie mit einem unerwünschten Gast allein mit ihm. Dann legte sich der Schmerz über sein ganzes Denken und Fühlen, er mauerte sich in ihm ein und hütete ihn eifersüchtig wie ein Flagellant seine Geißel.
Er folgte der Einladung auf einem Plakat in der Stadt, und besuchte einen Vortrag über die astrale Welt. Eine schöne Hoffnung trat wie eine Fata Morgana vor seine leidgeprüfte Seele. Jede Nacht, so lehrte ein sanfter junger Mann in weitgeschnittener Kleidung, gleite die Seele hinüber in die Astralwelt, die unterste der geistigen Ebenen. Mit bestimmter Technik gelänge es, beim Einschlafen nicht das Bewusstsein zu verlieren und es so mit hinüberzunehmen. Die Wahrheit des Gehörten sprang den Professor derart unvermittelt an, als wisse er das alles längst und habe dieses Wissen nur verdrängt.
Am selben Abend noch machte er den ersten Versuch, völlig übermüdet nach stundenlangem Grübel und Sinnen. Morgens gegen vier wachte er auf, schweißüberströmt, noch angezogen auf dem Bett.
Auch der zweite Versuch misslang. Vier Wochen später tat sich dann das Tor zur anderen Welt auf. Aber er fand nicht, was er suchte. Der Kontakt zu Viola und den Kindern blieb aus. Er begegnete nur sich selber, seinen Gedanken über Viola, seinen Erinnerungen an die vertrauensvoll sich an ihn schmiegenden Kinder.
Er löste die Wohnung auf, verkaufte das Mobiliar, übertrug die Verwaltung der beiden Häuser einem jungen Kollegen, vernichtete all seine privaten Unterlagen, und fuhr nach Japan. Zwei Jahre lebte er in einem Zen-Kloster. Karge Kost, wenig Schlaf, das stundenlange Sitzen mit dem Gesicht zur Wand, das Meditieren über ein vom Abt gestelltes Kōan, eines offensichtlich unlogischen Satzes, die mangelnde Kommunikation aufgrund der sprachlichen Probleme – all das hielt er nur aus, weil sein innerer Schmerz noch größer war als jede andere Empfindung. Das Malträtieren des Körpers mit Kälte und Hunger erinnerte ihn an die harte Sporterziehung in der NAPOLA, jener Nazi-Eliteschule, in die ihn sein Vater geschickt hatte, und die in jenen Flakhelferwochen endete, aus denen er körperlich und seelisch fürs Leben gezeichnet hervorgegangen war. Die körperlichen Torturen des Klosterlebens ertrug er leicht, aber das geistige Umdenken war wie eine Geburt, wobei er gleichzeitig den Schmerz des Gebärenden erlitt, wie die heillose Angst des Neugeborenen. Ein volles Klosterjahr dauerte es, bis er sich nicht mehr gegen die gehirnwäscheähnliche Austreibung seines bewussten Denkens zur Wehr setzte. Schicht um Schicht seines bisherigen Lebens streifte er ab, aber statt des Nichts des buddhistischen Glaubens fand er auf dem Grunde seines Selbst den abendländischen Gott seiner Kindheit. Nicht den Gott der Kirche, sondern, durch alle Verunstaltungen der Jahrhunderte unberührt, den Mann aus den Evangelien, wie ihn ihm seine Mutter heimlich und gegen den Widerstand des Vaters nahegebracht hatte. Fremd und fern auch er. Mit bestürzender Gewissheit trat ihm die Erkenntnis vor die Seele, dass der Rückzug aus der Welt nichts an seinem Selbst änderte, und was später kommen würde, war nicht im Vorhinein zu lösen. In der Gegenwart blieb nur die Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Und da alle Religionen den Weg zum selben Ziel gingen, warum sollte er sich den religiösen Mythen seiner eigenen Kultur entziehen?
Er kehrte nach Deutschland zurück. In Bad Homburg nahm er eine kleine Wohnung, die er nur mit einer spartanischen Einrichtung versah, und in die er nie jemanden einlud. Obwohl er nicht mehr für seinen Broterwerb arbeiten musste, suchte er nach Beschäftigung. Die Frage nach Schuld war nicht mehr nur ein logisches Spiel, ein psychologisches Rätselraten, wie früher in seiner Zeit als Strafverteidiger. Bei mittellosen Angeklagten stellte er sich nun deren Verteidigern ohne Honorar für besondere zeitraubende Ermittlungen zur Verfügung, stellte Kontakte zu schwer zugänglichen wissenschaftlichen Koryphäen her, die von früher wussten, wie sehr er das Verbrechen hasste, und dass er von ihnen keine unehrenhaften Torheiten erwartete. Sein Wille zum Leben war ungebrochen, aber das, was ihm früher alles bedeutet hatte, eine intime, emotionale Bindung an eine Frau, schloss er aus. Diesmal wollte er die Treue bewahren, sein am Hochzeitstag gegebenes Wort halten, auch über den Tod hinaus. Lebenshunger und Lebensüberdruss hielten sich die Waage, bis er beschloss, sich dem Leben zu überlassen, und eine Last von seiner Seele fiel. Er hatte Freude an sportlichen Zweikämpfen, sah manchmal stundenlang im Fernsehen einem Tennisspiel zu, und schaltete dann im fünften Satz ab, weil er nicht Zeuge eines Sieges und einer Niederlage werden wollte. Nach wie vor bedurfte er rauschhafter Eindrücke, Farben, Musik, und sehnte sich nach dem begeisternden Anblick biegsamer Frauenkörper. Aber das innewohnende Versprechen genügte ihm, die Freuden der konkreten Erfüllung waren ihm plump und schal geworden. So sei, wie er Valerie einmal in einem unvermittelt zur Beichtsituation gewordenen Gespräch gestanden hatte, Freundschaft das Äußerste an seelischer Intimität, was er ihr geben könne. Anschließend bat er sie mit seiner zurückgewonnenen zynischen Nüchternheit, das alles zur Kenntnis zu nehmen, er würde nie wieder darauf zu sprechen kommen.
***
Am nächsten Tag war er früh auf den Beinen. Sonst ein großer Trödler in den Morgenstunden, zog ihn heute der wilde blaue Himmel hinaus. Die Luft war kalt, und am Horizont türmten sich wattig-graue Wolkengebirge. Botho startete zu seiner üblichen morgendlichen Tour rund um den Schlosshof und kämpfte dabei brüllend ganze Legionen unsichtbarer Feinde nieder, bis er sich zu diskreteren Geschäften abseits in die Büsche schlug.





























