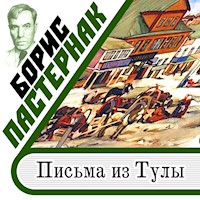4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
*** 10. Februar 2015: 125. Geburtstag von Boris Pasternak *** Boris Pasternaks Meisterwerk ›Doktor Shiwago‹ gehört zu den bedeutendsten Romanen des 20. Jahrhunderts. Sein Held ist im Zarenreich aufgewachsen, erlebt in Moskau den Ausbruch der Revolution. Alle Hoffnungen auf eine Karriere werden von der neuen Ordnung zerstört, und Shiwago beschließt, sich auf ein Landgut zurückzuziehen. Doch das Familienidyll gerät ins Wanken, als Shiwago Lara wiedertrifft, die er in einem Lazarett kennenlernte … Sein halbes Leben lang arbeitete Boris Pasternak an dem Roman, der in der Sowjetunion nicht publiziert werden durfte, aber in der Verfilmung mit Omar Sharif zum Klassiker wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 952
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Boris Pasternak
Doktor Shiwago
Roman
Aus dem Russischen von Thomas Reschke Mit einem Nachwort von Ulrich Schmid
FISCHER E-Books
Inhalt
Erstes Buch
Erster TeilDer Fünf-Uhr-Schnellzug
1
Sie gingen und gingen und sangen das »Ewige Gedenken«, und jedesmal, wenn sie innehielten, schienen die Füße, die Pferdehufe, die Windstöße den Gesang harmonisch fortzusetzen.
Die Passanten ließen den Trauerzug vorüber, zählten die Kränze, bekreuzigten sich. Neugierige folgten der Prozession, fragten: »Wer wird beerdigt?« Sie bekamen zur Antwort: »Shiwago.« Aha. Verstehe. »Doch nicht er. Seine Frau.« Dennoch. Gott schenke ihr das Himmelreich. Ein reiches Begräbnis.
Die letzten Minuten verflogen, gezählt, unwiederbringlich. »Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist; der Erdboden und was darauf wohnt.« Der Geistliche warf mit kreuzschlagender Geste eine Handvoll Erde auf Maria Nikolajewna Shiwago. »Im Geiste der Gerechten« wurde angestimmt. Dann hatten es alle schrecklich eilig. Der Sarg wurde geschlossen, zugenagelt, hinabgesenkt. Ein Regen von Erdklumpen prasselte auf ihn herab, vier Spaten schaufelten hastig das Grab zu. Darauf wuchs ein Hügelchen. Auf dieses stieg ein zehnjähriger Junge.
Nur im Zustand der Abgestumpftheit und Fühllosigkeit, der am Ende großer Beerdigungen einzutreten pflegt, konnte man den Eindruck gewinnen, daß der Junge auf dem Grab seiner Mutter eine Rede halten wollte.
Er hob den Kopf und ließ von seinem erhöhten Standpunkt aus abwesend den Blick über die herbstlichen Weiten und die Kuppeln des Klosters gleiten. Sein stupsnasiges Gesicht verzerrte sich. Sein Hals reckte sich hoch. Bei einem Wolfsjungen würde man an dieser Bewegung erkannt haben, daß es losheulen wollte. Der Junge hielt die Hände vors Gesicht und schluchzte. Eine auf ihn zufliegende Wolke peitschte ihm mit den nassen Ruten eines kalten Platzregens Gesicht und Hände. An das Grab trat ein Mann in Schwarz mit eng anliegenden faltenziehenden Ärmeln. Es war der Bruder der Verstorbenen und der Onkel des weinenden Jungen, der auf eigenen Wunsch aus dem Priesterstand ausgeschiedene Nikolai Nikolajewitsch Wedenjapin. Er nahm den Jungen bei der Hand und führte ihn vom Friedhof.
2
Sie übernachteten in einem der Klosterräume, der Wedenjapin als altem Bekannten zugewiesen wurde. Tags darauf, an Mariä Schutz und Fürbitte, sollten Onkel und Neffe eine weite Reise in den Süden antreten, in eine der Gouvernementsstädte im Wolgaland, wo Vater Nikolai in einem Verlag arbeitete, der die progressive Zeitung der Region herausgab. Die Fahrkarten waren gekauft, die Sachen gepackt, sie standen in der Klosterzelle. Vom nahen Bahnhof trug der Wind die weinerlichen Pfeifkonzerte der dort rangierenden Lokomotiven herüber.
Gegen Abend wurde es sehr kalt. Die beiden ebenerdigen Fenster blickten in einen Winkel des kümmerlichen Gartens mit gelben Akazienbüschen, auf die gefrorenen Pfützen der Landstraße und auf den Teil des Friedhofs, wo Maria Shiwago am Tage beigesetzt worden war. Der Garten war leer bis auf ein paar Reihen Kohl, der in der Kälte bläulich schimmerte. Die fast kahlen Akazienbüsche schwankten bei jedem Windstoß wie Besessene und legten sich auf die Straße.
In der Nacht erwachte Jura von einem Klopfen ans Fenster. Die dunkle Zelle war überirdisch erleuchtet von weißem Flackerlicht. Jura lief im Nachthemd zum Fenster und drückte das Gesicht an die kalte Scheibe.
Draußen gab es weder die Straße noch den Friedhof, auch nicht den Garten. Ein Schneesturm tobte, die Luft rauchte von Schneestaub. Man konnte denken, der Sturm hätte Jura bemerkt und genösse im Bewußtsein seiner Schrecklichkeit den Eindruck, den er auf den Jungen machte. Er pfiff und heulte und trachtete mit allen Mitteln, Juras Aufmerksamkeit zu erregen. Vom Himmel senkte sich Bahn um Bahn ein endloses weißes Gewebe auf die Erde herab und hüllte sie in Leichentücher. Der Schneesturm war ganz allein auf der Welt, und nichts konnte es mit ihm aufnehmen.
Jura stieg vom Fensterbrett herunter. Am liebsten hätte er sich angezogen und wäre hinausgelaufen, um etwas zu tun. Vielleicht erschreckte ihn, daß der Kohl des Klosters ungeerntet zugeweht wurde, vielleicht auch, daß es seine Mutter zuschneite, daß sie wehrlos war und sie noch tiefer, weiter weg von ihm, in die Erde sank.
Wieder kamen ihm die Tränen. Der Onkel wachte auf, sprach zu ihm von Christus und tröstete ihn. Dann gähnte er, trat ans Fenster und überlegte. Sie zogen sich an. Es tagte.
3
Als Juras Mutter noch lebte, hatte er nicht gewußt, daß der Vater längst von ihnen weggegangen war, die Städte Sibiriens und das Ausland bereiste, ein zügelloses Säuferleben führte und ihr Millionenvermögen längst durchgebracht und verschleudert hatte. Man hatte Jura immer gesagt, der Vater wäre bald in Petersburg, bald auf einer Handelsmesse, zumeist in Irbit.
Dann brach bei der Mutter, die schon immer kränklich gewesen war, die Schwindsucht aus. Sie unternahm nun Reisen nach Südfrankreich und Oberitalien, um wieder gesund zu werden, und Jura durfte sie zweimal begleiten. In solcher Unordnung und voller Rätsel verlief seine Kindheit, oft bei fremden Menschen, die ständig wechselten. Er gewöhnte sich an diese Veränderungen, und in dem ewigen Hin und Her vermißte er den Vater nicht.
Als kleiner Junge hatte er noch die Zeit erlebt, als der Name, den er trug, viele ganz verschiedene Dinge bezeichnete.
Es gab die Shiwago-Manufaktur, die Shiwago-Bank, die Shiwago-Häuser, es gab die Shiwago-Methode, einem Krawattenknoten mit einer Nadel festen Halt zu verleihen, und es gab sogar einen süßen Rumkuchen mit dem Namen Shiwago, und man konnte eine Zeitlang in Moskau dem Kutscher zurufen »zu Shiwago!« wie dahin, wo sich die Füchse gute Nacht sagen!, dann fuhr er einen mit dem Schlitten über sieben Berge in ein Märchenreich. Man war von einem stillen Park umgeben. Auf die herunterhängenden Tannenzweige setzten sich, den Reif abschüttelnd, Krähen. Ihr Krächzen hallte lange nach wie das Knacken eines Astes. Von den Neubauten jenseits der Schneise kamen Rassehunde gelaufen. Dort wurden die Lichter angezündet. Es war Abend.
Mit einemmal zerstob das alles. Sie waren arm.
4
Im Sommer neunzehnhundertdrei fuhren Jura und sein Onkel in einem zweispännigen Reisewagen durch die Felder nach Dupljanka, auf das Gut des Seidenfabrikanten und Kunstmäzens Kologriwow, um den Pädagogen und Popularisator nützlicher Kenntnisse Iwan Woskoboinikow zu besuchen.
Es war um das Fest der Gottesmutter von Kasan, und die Ernte war in vollem Gange. Wegen der Mittagszeit oder des Festes aber war keine Menschenseele auf den Feldern. Die Sonne brannte auf die stehengebliebenen Getreidestreifen, die an halbrasierte Zuchthäuslerköpfe erinnerten. Über den Feldern kreisten Vögel. Der Weizen stand mit geneigten Ähren stramm angetreten in vollkommener Windstille oder ragte in Puppen fern der Straße, und man konnte, wenn man lange hinsah, den Eindruck gewinnen, als ob sich dort am Horizont Gestalten bewegten, Landmesser, die etwas notierten.
»Diese Felder«, erkundigte sich Wedenjapin bei Pawel, dem Arbeiter und Wächter des Buchverlags, der seitlich, krumm auf dem Bock saß, ein Bein übers andere geschlagen, zum Zeichen, daß er von Haus aus kein Kutscher sei und die Pferde nicht von Berufs wegen lenke, »diese Felder, gehören sie Gutsbesitzern oder Bauern?«
»Herrenland ist das«, antwortete Pawel und brannte sich umständlich eine Zigarette an, »und die da«, er machte ein paar Züge, dann zeigte er mit dem Peitschenstiel zur anderen Seite, »die sind unsere. He, schlaft ihr?« rief er immer wieder den Pferden zu, deren Schweife und Kruppen er ständig im Auge behielt wie ein Lokführer seine Manometer.
Aber die Pferde zogen wie alle Pferde auf der Welt, das heißt, das Gabelpferd mit der angeborenen Geradheit seiner schlichten Natur, das Beipferd hingegen hätte einem, der nichts davon verstand, als ausgemachter Faulpelz erscheinen können, der nur das eine im Sinn hatte, den Hals zu biegen wie ein Schwan und zu tänzeln beim Klang der Schellen, den es mit seinen Sprüngen selbst hervorbrachte.
Wedenjapin hatte für Woskoboinikow die Korrekturfahnen von dessen Buch über die Agrarfrage bei sich, die wegen des zunehmenden Drucks der Zensur auf den Verlag nochmals durchgesehen werden sollten.
»Das Volk im Kreis schlägt über die Stränge«, sagte Wedenjapin. »Im Landkreis Pankowskaja haben sie einen Kaufmann erstochen, und dem Landhauptmann haben sie das Gestüt angezündet. Was hältst du davon? Was sagen die Leute bei euch im Dorf?«
Es zeigte sich, daß Pawel die Dinge noch düsterer sah als selbst der Zensor, der Woskoboinikows Leidenschaft in der Agrarfrage zügeln wollte.
»Was sollen sie sagen? Das Volk ist von der Leine. Verwöhnt ist es, sagen sie. Bei unsereins ist alles drin. Gib den Mushiks Freiheit, dann murksen sie sich gegenseitig ab, wahrhaftigen Gottes. He, schlaft ihr?«
Es war die zweite Reise des Onkels und seines Neffen nach Dupljanka. Jura glaubte, den Weg in Erinnerung zu haben, und jedesmal, wenn sich die Fluren weiteten und nur noch von Waldstreifen gesäumt waren, kam es ihm so vor, als erkenne er die Stelle, wo die Straße nach rechts abbiegen und in der Kurve das zehn Werst breite Panorama von Kologriwows Besitz mit dem in der Ferne blinkenden Fluß und der dahinter verlaufenden Eisenbahnstrecke für einen Moment in Sicht kommen und gleich wieder verschwinden mußte. Aber er täuschte sich jedesmal. Den Feldern folgten weitere Felder, wieder und wieder von Wald eingefaßt. Dieser Wechsel der Räume hob die Stimmung. Man bekam Lust, zu träumen und an die Zukunft zu denken.
Keines der Bücher, die Wedenjapin späterhin berühmt machen sollten, war geschrieben. Aber seine Ideen standen schon fest. Er wußte nicht, wie nahe seine Zeit war.
Schon bald würde unter den Vertretern der damaligen Literatur, Universitätsprofessoren und Revolutionsphilosophen dieser Wedenjapin seinen Platz haben, der über alle ihre Themen nachsann und doch außer der Terminologie nichts mit ihnen gemein hatte. Sie alle klammerten sich an irgendwelche Dogmen und gaben sich mit Worten und äußerem Schein zufrieden, Vater Nikolai dagegen war ein Geistlicher, der durch Tolstoianertum und Revolution hindurchgegangen war und ständig weiterging. Er dürstete nach einer Idee, die beflügelt substantiell sein, einen ungeheuchelt eigenständigen Weg in seiner Bewegung vorzeichnen, auf der Welt etwas zum Besseren wenden und sogar für ein Kind und einen Ignoranten verständlich sein sollte wie ein Blitzstrahl oder das Echo eines Donnerschlags. Er dürstete nach Neuem.
Jura fühlte sich wohl bei dem Onkel. Der ähnelte seiner Mutter. Wie sie war er ein freidenkender Mensch, der an alles Ungewohnte vorurteilslos heranging. Wie sie hatte er ein aristokratisches Empfinden für die Gleichheit aller Lebenden. Wie sie begriff er alles auf den ersten Blick und wußte seine Gedanken so auszudrücken, wie sie ihm in den Kopf kamen, solange sie noch lebendig und sinnerfüllt waren.
Jura freute sich, daß er mit dem Onkel nach Dupljanka fahren durfte. Dort war es sehr schön, und die malerische Stätte erinnerte ihn wiederum an seine Mutter, die die Natur geliebt und ihn häufig zu Ausflügen mitgenommen hatte. Überdies war es ihm angenehm, Nika Dudorow wiederzusehen, den Gymnasiasten, der bei Woskoboinikow lebte, obwohl der ihn gewiß verachtete, weil er zwei Jahre älter war; bei der Begrüßung zerrte er dem andern die Hand jedesmal nach unten und neigte den Kopf so tief, daß ihm die Haare in die Stirn fielen und das halbe Gesicht verdeckten.
5
»Der Lebensnerv des Pauperismusproblems«, las Wedenjapin aus dem korrigierten Manuskript.
»Ich finde, wir schreiben lieber – das Wesen«, sagte Woskoboinikow und trug die Korrektur ein.
Sie arbeiteten im Halbdunkel der verglasten Terrasse. Das Auge unterschied unordentlich herumliegende Gießkannen und Gartengeräte. Über die Lehne eines zerbrochenen Stuhls war ein Regenmantel geworfen. In einem Winkel standen Wasserstiefel mit angetrocknetem Schlamm und umgeknickten Schäften.
»Die Statistik der Geburten und Todesfälle zeigt jedoch …«, diktierte Wedenjapin.
»Wir müssen einfügen: im Berichtsjahr«, sagte Woskoboinikow und schrieb.
Auf der Terrasse zog es leicht. Auf den Manuskriptseiten lagen Granitbrocken, damit sie nicht wegflogen.
Als sie fertig waren, wollte Wedenjapin gleich nach Hause.
»Es gibt ein Gewitter. Wir müssen los.«
»Kommt nicht in Frage. Ich lasse Sie nicht weg. Wir trinken jetzt Tee.«
»Ich muß am Abend unbedingt in der Stadt sein.«
»Keine Ausrede. Ich will nichts davon hören.«
Vom Garten wehte brandiger Samowargeruch herein, der den Duft des Tabaks und des Heliotrops verdrängte. Aus dem Haus wurden Sahne, Himbeeren und Quarkkuchen gebracht. Dann kam die Nachricht, Pawel sei zum Fluß geritten, um zu baden und die Pferde zu schwemmen. Wedenjapin mußte sich fügen.
»Kommen Sie mit zum Fluß, wir setzen uns ein Weilchen auf die Bank, während der Teetisch gedeckt wird«, schlug Woskoboinikow vor.
Mit dem Recht des Freundes bewohnte er bei dem steinreichen Kologriwow zwei Zimmer im Verwalterhaus. Dieses lag mit dem Vorgarten in dem düsteren, verwilderten Teil des Parks mit der alten bogenförmigen Zufahrtallee. Die Allee war dicht mit Gras bewachsen. Sie wurde nur noch befahren, wenn Erde und Bauschutt zu der Schlucht gebracht werden mußten, die als Kippe diente. Kologriwow, ein Mann mit fortschrittlichen Ansichten und Millionär, der mit der Revolution sympathisierte, weilte derzeit mit seiner Frau im Ausland. Auf dem Gut wohnten nur seine Töchter Nadja und Lipa mit ihrer Erzieherin und einer kleinen Dienerschaft.
Von dem Park mit seinen Teichen und Wiesen und dem Herrenhaus war der Garten des Verwalters durch eine dichte Hecke aus Wasserholunder getrennt. Woskoboinikow und Wedenjapin gingen außen an diesem Gesträuch entlang, und immer wieder stoben Schwärme von Spatzen, von denen es im Gesträuch wimmelte, vor ihnen auf. Das erfüllte die Hecke mit einem gleichmäßigen Rauschen, als flösse an der Hecke Wasser durch ein Rohr.
Sie passierten die Orangerie, die Gärtnerwohnung und ein zerfallenes Gemäuer. Im Gehen unterhielten sie sich über die neuen jungen Kräfte in der Wissenschaft und der Literatur.
»Ab und zu gibt es Leute mit Talent«, sagte Wedenjapin. »Aber es sind gegenwärtig allerlei Zirkel und Vereinigungen im Schwange. Jede solche Vereinigung ist eine Zuflucht für Unbegabte, ob sie nun Solowjow, Kant oder Marx die Treue halten. Nach der Wahrheit suchen nur Einzelgänger, und die brechen mit all denen, die sie nicht genug lieben. Gibt es etwas auf der Welt, was Treue verdient? Nur sehr wenige Dinge. Ich finde, man soll der Unsterblichkeit treu sein, die ein anderes Wort für das Leben ist, nur ein wenig stärker. Man soll der Unsterblichkeit die Treue halten, man soll Christus treu sein! Ach, Sie verziehen das Gesicht, Sie Unglücklicher. Schon wieder haben Sie rein gar nichts begriffen.«
»Tja«, brummte Woskoboinikow, ein dünner, weißblonder, flinker Mann mit boshaftem Spitzbart, der ihn einem Amerikaner aus der Zeit Lincolns ähnlich machte (er nahm ihn aller naselang in die Hand und haschte mit den Lippen nach dem Ende). »Ich sage nichts dazu. Sie wissen, daß ich die Dinge anders sehe. Übrigens, erzählen Sie doch, wie Sie als Geistlicher ausgeschieden sind. Das wollte ich Sie schon immer mal fragen. Man hat Sie bestimmt hart hergenommen? Das Anathema ausgesprochen. Oder?«
»Warum lenken Sie ab? Aber von mir aus. Anathema? Nein, der Bannfluch wird nicht mehr ausgesprochen. Es gab Unannehmlichkeiten, die Folgen haben. So darf ich zum Beispiel für lange Zeit nicht in den Staatsdienst treten. Und nicht in die Hauptstädte. Aber unwichtig. Kehren wir zu unserem Thema zurück. Ich sagte, man müsse Christus treu sein. Das erkläre ich Ihnen. Sie begreifen eines nicht: Man kann Atheist sein und möglicherweise nicht wissen, ob es einen Gott gibt und wozu, aber man kann dennoch wissen, daß der Mensch nicht in der Natur lebt, sondern in der Geschichte, die aus heutiger Sicht von Christus begründet wurde, mit dem Evangelium als Grundlage. Und was ist die Geschichte? Sie ist die Festschreibung jahrhundertelanger Bemühungen um die fortschreitende Enträtselung des Todes und seine künftige Überwindung. Zu diesem Zweck werden die mathematische Unendlichkeit und elektromagnetische Wellen entdeckt, werden Symphonien geschrieben. In dieser Richtung voranzukommen geht nicht ohne einen gewissen Enthusiasmus. Für solche Entdeckungen bedarf es geistigen Rüstzeugs. Grundlagen dafür finden sich im Evangelium. Hier sind sie. Da ist erstens die Nächstenliebe, diese höchste Form von Lebensenergie, die das menschliche Herz erfüllt und nach Hingabe und Verschwendung verlangt. Da sind ferner die Grundkomponenten des modernen Menschen, ohne die er nicht denkbar ist, nämlich die Idee von der freien Persönlichkeit und die Idee vom Leben als Opfer. Bedenken Sie, daß das noch immer ungewöhnlich neu ist. In diesem Sinne hatte das Altertum keine Geschichte. Es gab die sanguinische Gemeinheit der grausamen, pockennarbigen Caligulas, die nicht ahnten, wie unfähig jeder Unterdrücker ist. Es gab die prahlerische tote Ewigkeit der Bronzedenkmäler und der Marmorsäulen. Erst die Jahrhunderte und Generationen nach Christus konnten frei atmen. Erst nach ihm begann das Leben in den Nachkommen, und der Mensch stirbt nicht mehr in der Gosse, sondern bei sich in der Geschichte, mitten in der Arbeit, die der Überwindung des Todes gewidmet ist, er stirbt und ist selber diesem Thema gewidmet. Uff, bin ich in Eifer geraten! Dabei ist alles in den Wind geredet!«
»Metaphysik, mein Lieber. Das haben mir die Ärzte verboten, das kann mein Magen nicht verdauen.«
»Ihnen ist nicht zu helfen. Lassen wir das. Sie sind ein Glückspilz! Diese herrliche Aussicht bei Ihnen, man kann sich nicht satt sehen! Sie leben immer hier und merken das gar nicht.«
Es war schmerzhaft, auf den Fluß zu blicken. Er spiegelte die Sonne, bog und streckte sich wie eine Blechplatte. Plötzlich gingen Falten darüber hin. Eine schwere Fähre mit Pferden, Fuhrwerken, Mushiks und ihren Frauen war von diesem Ufer abgestoßen.
»Denken Sie nur, noch nicht mal sechs«, sagte Woskoboinikow. »Schauen Sie, der Schnellzug aus Sysran. Er kommt kurz nach fünf hier durch.«
In der Ferne fuhr ein blitzsauberer, blaugelber Zug von rechts nach links über die Ebene, durch die Entfernung stark verkleinert. Die beiden Männer bemerkten auf einmal, daß er hielt. Über der Lokomotive wölkte weißer Dampf aufwärts. Ein Weilchen später drangen Alarmpfiffe zu ihnen.
»Merkwürdig«, sagte Woskoboinikow. »Da stimmt was nicht. Er hält sonst nicht in der sumpfigen Gegend dort. Da ist was passiert. Kommen Sie, wir trinken Tee.«
6
Nika war weder im Garten noch im Hause. Jura konnte sich denken, daß er versteckt bleiben wollte, denn es war ihm langweilig mit ihnen, und Jura war für ihn kein Gefährte. Sein Onkel und Woskoboinikow hatten sich auf die Terrasse zurückgezogen, um zu arbeiten, und es Jura überlassen, ziellos ums Haus zu schlendern.
War das schön hier! Immer wieder erklang der klare, aus drei Tönen bestehende Pfiff des Pirols, dazwischen lagen Pausen, damit der feuchte, gleichsam einer Hirtenflöte entlockte Laut die Umgebung gänzlich durchdrang. Der in der Luft stehende Blumenduft wurde von der Hitze auf die Beete niedergedrückt. Wie das an Antibes und Bordighera erinnerte! Jura drehte sich immerfort nach rechts und nach links. Über den Lichtungen schwebte, eine Gehörhalluzination, die Stimme seiner Mutter in den melodischen Trillern der Vögel und im Summen der Bienen. Jura zuckte immer wieder zusammen, weil ihn dünkte, daß die Mutter ihn riefe.
Er ging zu der Schlucht und stieg hinunter. Aus dem lichten und sauberen Wald, der die obere Hälfte der Schlucht bedeckte, gelangte er in das Erlengestrüpp auf ihrem Grund.
Feuchte Finsternis, Windbruch und Moder, wenig Blumen. Die gegliederten Stengel des Schachtelhalms erinnerten an die Stäbe mit ägyptischen Ornamenten in seiner bebilderten Heiligen Schrift.
Jura wurde immer trauriger. Ihm war zum Weinen. Er kniete nieder und brach in Tränen aus.
»Engel Gottes, mein heiliger Beschützer«, betete er, »stärke meinen Verstand, auf daß ich den rechten Weg finde, und sage meiner Mutter, daß es mir hier gut geht, damit sie sich keine Sorgen macht. Wenn es ein Weiterleben nach dem Tode gibt, du mein Gott, so lasse meine Mutter ein ins Paradies, wo die Antlitze der Heiligen und Märtyrer in hellem Licht erstrahlen. Meine Mutter war so gut, und es kann nicht sein, daß sie eine Sünderin war. Erbarme dich ihrer, du mein Gott, und gib, daß sie nicht leiden muß. Mutter«, rief er in herzzerreißendem Weh zum Himmel wie zu einer neuerschienenen Heiligen, und plötzlich fiel er zu Boden und verlor das Bewußtsein.
Er lag nicht lange ohne Bewußtsein. Als er wieder zu sich kam, hörte er von oben den Onkel rufen. Er antwortete und stieg hinauf. Plötzlich fiel ihm ein: Er hatte nicht für seinen verschollenen Vater gebetet, wie seine Mutter es ihn gelehrt hatte.
Aber ihm war so wohl nach der Ohnmacht, daß er sich von diesem Gefühl der Leichtigkeit nicht trennen mochte und Angst hatte, es zu verlieren. Und er dachte, es sei nicht weiter schlimm, wenn er für den Vater ein andermal betete.
Er kann warten. Er wird’s überstehen, so etwa dachte Jura. Er konnte sich überhaupt nicht an den Vater erinnern.
7
Im Zug, in einem Abteil zweiter Klasse, reiste mit seinem Vater, einem Rechtsanwalt aus Orenburg, Mischa Gordon, der das Gymnasium besuchte, ein elfjähriger Junge mit nachdenklichem Gesicht und großen schwarzen Augen. Der Vater hatte eine Anstellung in Moskau angenommen, und der Junge sollte in Moskau aufs Gymnasium gehen. Seine Mutter und die Schwestern waren längst dort und kümmerten sich um die Einrichtung der Wohnung.
Sohn und Vater waren schon den dritten Tag unterwegs.
An ihnen vorüber flog, in Wolken heißen, von der Sonne kalkweiß gefärbten Staubs gehüllt, Rußland, flogen Felder und Steppen, Städte und Dörfer. Über die Landstraßen zogen Fuhrwerke, bogen schwerfällig zu den Bahnübergängen ab, und aus dem dahinrasenden Zug hatte man den Eindruck, daß die Fuhrwerke stillstünden und die Pferde die Hufe auf der Stelle höben und senkten.
Auf den großen Haltepunkten stürmten die Fahrgäste wie besessen ins Restaurant, und die sinkende Sonne hinter den Bäumen des Bahnhofsgartens streifte ihre Beine und die Wagenräder.
Alle Bewegungen auf der Welt sind im einzelnen nüchtern berechnet, in ihrer Gesamtheit aber unbewußt trunken von dem allgemeinen Strom des Lebens, der sie vereint. Die Menschen mühen und rackern sich ab, in Bewegung gesetzt vom Mechanismus ihrer eigenen Sorgen. Aber die Mechanismen würden nicht funktioniert haben, wäre nicht ihr Hauptregulator eine tief in ihnen sitzende Sorglosigkeit. Diese Sorglosigkeit kommt durch das Gefühl der Verbundenheit aller menschlichen Existenzen, von der Zuversicht, daß die eine in die andere übergeht, von dem Glücksgefühl darüber, daß alles, was geschieht, sich nicht nur auf der Erde vollzieht, in der die Toten begraben werden, sondern noch auf einer anderen Ebene, was die einen das Reich Gottes, die anderen Geschichte und dritte noch anders nennen.
Von dieser Regel bildete der Junge eine für ihn bittere und belastende Ausnahme. Seine Triebfeder blieb das Gefühl der Besorgnis, und kein Gefühl der Unbekümmertheit erleichterte und veredelte ihn. Er wußte um diesen seinen ererbten Charakterzug und suchte mit ängstlichem Argwohn seine Anzeichen. Dieser Zug machte ihm Kummer. Er erniedrigte ihn.
Seit er denken konnte, hatte er nie aufgehört, sich darüber zu wundern, daß jemand, der die gleichen Arme und Beine, die gleiche Sprache und die gleichen Gewohnheiten hat, ganz anders sein kann als alle anderen und noch dazu so, daß nur wenige ihn mögen und er nicht geliebt wird. Es ging über seinen Verstand, daß ein Mensch, der schlechter ist als andere, sich nicht durch eigene Bemühungen ändern und bessern kann. Was bedeutete es, ein Jude zu sein? Wozu gab es so etwas? Was belohnte oder rechtfertigte diese waffenlose Herausforderung, die nichts als Leid brachte?
Wenn er sich an seinen Vater wandte, um eine Antwort zu bekommen, erklärte ihm dieser, seine Frage sei in ihrem Ausgangspunkt absurd und so könne man nicht denken, aber er bot nichts anderes an, was Mischa durch seinen tiefen Sinn angezogen und verpflichtet hätte, sich schweigend ins Unabänderliche zu fügen.
Vater und Mutter ausschließend, empfand Mischa allmählich völlige Verachtung für die Erwachsenen, die eine Suppe eingerührt hatten, die sie nicht auszulöffeln vermochten. Er war überzeugt, all dies entwirren zu können, wenn er erst einmal erwachsen wäre.
Auch jetzt hätte niemand sagen mögen, daß sein Vater falsch gehandelt habe, als er diesem Verrückten hinterherrannte auf die Plattform und daß er den Zug nicht hätte zum Halten bringen sollen, als der Mann ihn heftig zurückstieß, die Wagentür aufriß und sich bei voller Fahrt kopfüber hinausstürzte, so wie Badende vom Steg ins Wasser springen.
Da aber die Notbremse nicht irgendwer, sondern Grigori Gordon gezogen hatte, war er der Grund, daß der Zug so unerklärlich lange stand.
Niemand kannte die Ursache für die Verzögerung. Die einen sagten, durch den plötzlichen Halt seien die Druckluftbremsen beschädigt worden, andere behaupteten, der Zug stehe auf einer Steigung, die die Lokomotive ohne Anlauf nicht bewältige. Noch andere verbreiteten das Gerücht, der Selbstmörder sei ein angesehener Mann gewesen, daher verlange sein Anwalt, der mit ihm im Zug reise, daß von der nächsten Station Kologriwowka Zeugen geholt werden müßten, damit ein Protokoll aufgesetzt werden könne. Daher sei der Gehilfe des Lokführers auf den Telegrafenmast gestiegen. Die Draisine sei gewiß schon unterwegs.
Im Waggon roch es ein wenig nach den Toiletten, und man versuchte, dem mit Kölnischwasser abzuhelfen, und es roch nach gebratenen Hühnern, die, in schmutziges Fettpapier gewickelt, schon einen leichten Stich hatten. Die Damen puderten sich, wischten sich die Hände mit einem Tuch und unterhielten sich mit knarrenden tiefen Stimmen. Es waren grauhaarige Damen aus Petersburg, die von dem Gemisch aus Lokomotivenruß und Schminke dunkle Zigeunergesichter hatten. Wenn sie an Gordons Abteil vorüberkamen, die eckigen Schultern in Überwürfe gehüllt, und die Enge des Ganges in eine Quelle neuer Koketterie verwandelten, schloß Mischa aus ihren eingekniffenen Lippen, daß sie zischten: »Ach, ich bitte Sie, wir sind doch so sensibel! Wir sind besondere Menschen! Wir gehören zur Intelligenz! Wir können das nicht ertragen!«
Die Leiche des Selbstmörders lag am Bahndamm im Gras. Ein Streifen geronnenen Blutes zog sich, ein scharfes Mal, dunkel über Stirn und Augen, wie um das Gesicht mit einem Kreuz durchzustreichen. Das Blut schien nicht sein Blut, nicht aus ihm herausgeflossen, sondern von fremder Hand aufgetragen worden zu sein wie ein Pflaster oder ein angetrockneter Schlammspritzer oder wie ein feuchtes Birkenblatt.
Das Häuflein Neugieriger und Mitfühlender um die Leiche wechselte ständig. Neben dem Toten stand finster und ausdruckslos sein Freund und Reisegefährte, der dicke und hochmütige Advokat, ein rassiges Tier in schweißnassem Hemd. Er litt unter der Hitze und fächelte sich mit seinem weichen Hut Luft zu. Auf alle Fragen zischte er unfreundlich, ohne sich umzudrehen, die Schultern hochziehend: »Alkoholiker. Sieht man das nicht? Typische Folge des Säuferwahnsinns.«
Zu dem Leichnam trat zwei- oder dreimal eine magere Frau im Wollkleid und mit einem Spitzenkopftuch. Sie war Witwe und Mutter zweier Lokführer, die alte Tiwersina, die mit ihren beiden Schwiegertöchtern in der dritten Klasse auf Freifahrtkarten reiste. Die stillen, in ihre Tücher gewickelten Frauen folgten ihr schweigend wie zwei Ordensschwestern ihrer Äbtissin. Die Gruppe flößte Achtung ein. Man machte ihr Platz.
Der Mann von Frau Tiwersina war bei einem Eisenbahnunglück lebendigen Leibes verbrannt. Sie blieb ein paar Schritte vor der Leiche stehen, so daß sie sie durch die Menge sehen konnte, und schien seufzend Vergleiche anzustellen. Wie es jedem bei der Geburt geschrieben steht, schien sie zu sagen. Bei dem einen ist es Gottes Wille, aber den hier hat eben eine Laune gepackt, er hat vom üppigen Leben den Verstand verloren.
Sämtliche Reisende des Zuges hatten den Leichnam in Augenschein genommen und kehrten in ihren Waggon zurück, da sie fürchteten, bestohlen zu werden.
Sobald sie auf die Böschung gesprungen waren, sich die Beine vertreten, Blumen gepflückt und ein paar Schritte getan hatten, überkam sie das Gefühl, die Gegend hier wäre erst infolge des Halts entstanden, und die sumpfige Wiese mit den Bülten, den breiten Fluß, das schöne Haus und die Kirche auf dem gegenüberliegenden Hochufer gäbe es gar nicht ohne das Unglück.
Sogar die Sonne, die ebenfalls ein hiesiges Zubehör zu sein schien, beleuchtete abendlich schüchtern die Szene bei den Schienen, näherte sich ihr gleichsam ängstlich, wie eine Kuh, die aus einer in der Nähe weidenden Herde zum Bahndamm kommt, um sich die Menschen anzusehen.
Mischa war erschüttert von dem Geschehnis und weinte im ersten Moment vor Schreck und Mitleid. Während der langen Reise hatte sich der Selbstmörder ein paarmal zu ihnen ins Abteil gesetzt und sich stundenlang mit seinem Vater unterhalten. Er hatte gesagt, daß er sich in der moralischen Lauterkeit und Klarheit ihrer Welt innerlich erhole, und den Vater nach verschiedenen juristischen Feinheiten und Problemen auf dem Gebiet von Wechseln und Schenkurkunden, Bankrotten und Fälschungen gefragt. »Ach so?« hatte er Gordons Erklärungen bestaunt. »Sie verfügen über gnädigere Verordnungen. Mein Anwalt hat andere Informationen. Er sieht diese Dinge viel finsterer.«
Jedesmal, wenn sich dieser nervöse Mensch beruhigt hatte, kam sein Anwalt und Reisegefährte aus der ersten Klasse und holte ihn ab, um im Speisewagen Champagner mit ihm zu trinken. Es war der dicke, freche, glattrasierte und stutzerhafte Advokat, der jetzt bei der Leiche stand und sich über nichts auf der Welt wunderte. Man war das Gefühl nicht losgeworden, daß die ständige Erregung seines Klienten ihm in irgendeiner Hinsicht gelegen kam.
Der Vater hatte gesagt, der Mann sei ein bekannter Geldsack, ein gutmütiger Liederjan und nicht mehr voll zurechnungsfähig. Ohne sich von Mischas Anwesenheit beirren zu lassen, hatte der Mann von seinem Sohn erzählt, der mit Mischa gleichaltrig sei, und von seiner verstorbenen Frau, dann kam er auf seine zweite Familie zu sprechen, die er gleichfalls verlassen habe. Da schien ihm ein neuer Einfall zu kommen, er erbleichte vor Entsetzen, redete wirr und versank in Gedanken.
Für Mischa bekundete er eine unerklärliche, vermutlich gespielte und vielleicht nicht für ihn bestimmte Zärtlichkeit. Alle Augenblicke schenkte er ihm etwas, ging zu diesem Zweck auf den großen Bahnstationen in den Wartesaal erster Klasse, wo in Buchständen Spiele und Abbildungen der örtlichen Sehenswürdigkeiten angeboten wurden.
Er trank unaufhörlich und beklagte sich, schon seit drei Monaten nicht schlafen zu können, und wenn er mal für kurze Zeit nüchtern sei, habe er Schmerzen, die ein normaler Mensch sich nicht vorstellen könne.
Kurz vor seinem Tod kam er zu ihnen ins Abteil gelaufen, ergriff Gordons Hand, wollte etwas sagen, brachte aber nichts heraus, sondern lief hinaus und stürzte sich aus dem Zug.
Mischa betrachtete die kleine Sammlung von Mineralien aus dem Ural in einer Holzschachtel, das letzte Geschenk des Toten. Plötzlich geriet alles in Bewegung. Auf dem zweiten Gleis näherte sich dem Zug eine Draisine. Ihr entstiegen ein Untersuchungsrichter mit Kokarde an der Mütze, ein Arzt und zwei Polizisten. Ihre Stimmen klangen kühl und sachlich. Sie stellten Fragen, notierten etwas. Zwei Zugschaffner und die beiden Polizisten trugen den Toten, im Sand ausrutschend, ungeschickt die Böschung hinauf. Eine Frau heulte los. Die Leute wurden in die Wagen gebeten, dann ertönte ein Pfiff. Der Zug setzte sich in Bewegung.
8
Das hat mir gerade noch gefehlt! dachte Nika ärgerlich und hastete durchs Zimmer. Die Stimmen der Gäste näherten sich. Der Rückzug war abgeschnitten. Im Schlafzimmer standen zwei Betten, das von Woskoboinikow und seins, Nikas. Ohne lange zu überlegen, kroch er unter das zweite Bett.
Er hörte, wie sie in den anderen Zimmern nach ihm suchten und ihn riefen und sich über sein Verschwinden wunderten. Dann kamen sie ins Schlafzimmer.
»Was soll man machen«, sagte Wedenjapin, »geh spazieren, Jura, vielleicht findet er sich später wieder, dein Kamerad, dann könnt ihr spielen.« Sie sprachen ein Weilchen über die Unruhen an den Universitäten von Petersburg und Moskau, zwangen Nika, an die zwanzig Minuten in seiner dummen, demütigenden Lage auszuharren, und traten schließlich auf die Terrasse. Leise öffnete Nika das Fenster, sprang hinaus und ging in den Park.
Er hatte die letzte Nacht nicht geschlafen und wußte heute nicht wohin mit sich. Bald würde er vierzehn Jahre. Er hatte es satt, ein Kind zu sein. Heute morgen hatte er in aller Frühe das Haus verlassen. Die Sonne ging auf, und auf der Erde im Park lag der lange, taunasse, verschlungene Schatten der Bäume. Dieser war nicht schwarz, sondern dunkelgrau wie durchnäßter Filz. Der betäubende Duft des Morgens schien von diesem feuchten Schatten auszugehen, der längliche Lichtflecke hatte, wie die Finger eines kleinen Mädchens.
Plötzlich floß ein Rinnsal Quecksilber, ebenso blank wie die Tautropfen im Gras, ein paar Schritt von ihm vorüber. Es floß und floß, und die Erde saugte es nicht ein. Auf einmal schnellte es zur Seite und verschwand. Es war eine Haselnatter. Nika zuckte zusammen.
Er war ein sonderbarer Junge. Wenn er erregt war, pflegte er laut mit sich selbst zu sprechen. Wie seine Mutter hegte er eine Neigung für Erhabenes und Paradoxes.
Wie schön es auf der Welt ist! dachte er. Aber warum tut das immer so weh? Den Herrgott gibt es natürlich. Doch wenn es ihn gibt, dann bin ich es. Ich werde ihr jetzt gebieten, dachte er mit Blick auf eine Espe, durch die von unten bis oben ein Zittern ging und deren feuchtschimmernde Blätter aus Blech gestanzt zu sein schienen, ich werde ihr jetzt befehlen … Und mit einer wahnsinnigen Anstrengung aller seiner Kräfte befahl er ihr, nicht flüsternd, sondern mit seinem ganzen Wesen, seinem ganzen Sein denkend und wünschend: Stehe still! Und gehorsam erstarrte der Baum in Reglosigkeit. Nika lachte vor Freude und stürmte, so schnell er konnte, zum Fluß, um zu baden.
Sein Vater, der Terrorist Dementi Dudorow, verbüßte seine Haftstrafe in der Zwangsarbeit, zu der er auf allerhöchsten Erlaß begnadigt worden war; das Urteil hatte auf Tod durch den Strang gelautet. Seine Mutter, die dem georgischen Fürstengeschlecht Eristow entstammte, war eine launische und noch junge schöne Frau, die sich ewig für irgend etwas begeisterte – für Meutereien, Meuterer, ausgefallene Theorien, berühmte Maler, arme Pechvögel.
Sie vergötterte Nika und machte aus seinem Vornamen Innokenti unzählige zärtliche und unsinnige Kosenamen wie Inotschek oder Notschenka, und sie schleppte ihn mitunter nach Tiflis, um ihn der Verwandtschaft vorzuführen. Am meisten beeindruckt hatte ihn dort ein ausladender Baum im Hof des Hauses, in dem sie wohnten. Es war ein ungefüger tropischer Riese. Mit seinen Blättern wie Elefantenohren beschattete er den Hof vor dem glühenden südlichen Himmel. Nika wollte es nicht in den Kopf, daß dieser Baum eine Pflanze war und nicht ein Tier.
Es war für den Jungen gefährlich, den furchtbaren Namen seines Vaters zu tragen. Woskoboinikow hatte mit Zustimmung der Mutter Nina Galaktionowna an höchster Stelle den Antrag gestellt, daß Nika ihren Familiennamen führen durfte.
Während er unterm Bett lag, empört über den Lauf der Dinge auf der Welt, hatte er unter anderm darüber nachgedacht. Wer war dieser Woskoboinikow, daß er seine Einmischung so weit trieb? Der konnte eine Lektion gebrauchen!
Und dann diese Nadja! Hatte sie etwa das Recht, die Nase hoch zu tragen und mit ihm zu reden wie mit einem kleinen Kind, bloß weil sie schon fünfzehn war? Er würde es ihr zeigen! Ich hasse sie, wiederholte er mehrmals für sich. Ich bringe sie um! Ich lade sie zu einer Bootsfahrt ein, dann stoße ich sie ins Wasser.
Seine Mutter schien ihm auch nicht besser zu sein. Natürlich hatte sie ihn und Woskoboinikow beschwindelt, als sie abreiste. Sie war keineswegs im Kaukasus, sondern hatte schlicht und einfach auf dem nächsten Eisenbahnknotenpunkt einen Zug nach Norden genommen und schoß in Petersburg mit den Studenten auf die Polizei. Er konnte ja ruhig in diesem blöden Loch bei lebendigem Leibe verfaulen. Aber er würde sie alle überlisten. Er würde Nadja ertränken, das Gymnasium verlassen und zu seinem Vater nach Sibirien abhauen, um dort einen Aufstand zu entfachen.
Der Teich war am Rand dicht mit Wasserlilien bewachsen. Das Boot drang mit trockenem Rascheln durch dieses Dickicht. In dessen Lücken trat das Teichwasser hervor wie Melonensaft im dreieckigen Anschnitt der Frucht.
Der Junge und das Mädchen pflückten Wasserlilien. Beide griffen nach demselben Stengel, der straff wie Gummi war und sich nicht abreißen ließ. Er zog sie einander näher, ihre Köpfe stießen zusammen. Eine Hakenstange schien das Boot zum Ufer zu ziehen. Die Stengel verflochten sich, wurden kürzer, die weißen Blüten mit dem blutiggelben Inneren sanken unter die Oberfläche und tauchten, voll Wasser gelaufen, wieder auf.
Nadja und Nika pflückten weiterhin Blüten, das Boot neigte sich immer mehr, die beiden lagen nebeneinander auf der geneigten Bordwand.
»Ich habe das Lernen satt«, sagte Nika. »Es wird Zeit, mit dem Leben anzufangen, Geld zu verdienen, unter Menschen zu kommen.«
»Ich wollte dich grade bitten, mir die quadratischen Gleichungen zu erklären. In Algebra bin ich so schwach, daß ich beinahe die Prüfung hätte wiederholen müssen.«
Nika argwöhnte in diesen Worten einen verborgenen Seitenhieb. Natürlich wollte sie ihn zurechtweisen und ihn daran erinnern, daß er noch klein war. Quadratische Gleichungen! Er hatte von der Algebra noch keinen blassen Schimmer.
Ohne zu zeigen, wie verletzt er war, fragte er gespielt gleichmütig und begriff im selben Moment, wie dumm das war: »Wenn du groß bist, wen heiratest du dann?«
»Oh, das ist noch so lange hin. Wahrscheinlich gar keinen. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht.«
»Bilde dir bitte nicht ein, daß mich das sehr interessiert.«
»Warum fragst du dann?«
»Du bist dumm.«
Sie begannen sich zu zanken. Nika erinnerte sich an seinen Frauenhaß von heute morgen. Er drohte Nadja, sie zu ertränken, wenn sie nicht mit ihren Frechheiten aufhöre. »Versuch’s doch«, sagte Nadja. Er packte sie um die Taille. Sie rangen miteinander, verloren das Gleichgewicht und fielen ins Wasser.
Beide konnten schwimmen, aber die Wasserlilien schlangen sich um ihre Arme und Beine, und sie hatten noch keinen Grund. Endlich gelangten sie, im Schlamm einsinkend, ans Ufer. Wasser troff aus ihren Schuhen und Taschen. Besonders Nika war erschöpft.
Wäre das früher passiert, in diesem Frühjahr etwa, dann hätten die beiden, nach solch einer Bootsfahrt pitschnaß dasitzend, bestimmt gelärmt, geschimpft oder gelacht.
Jetzt aber schwiegen sie und wagten kaum zu atmen, bedrückt von der Sinnlosigkeit des Vorfalls. Nadja war entrüstet und haderte stumm, Nika dagegen tat der ganze Körper weh, als hätte man ihn mit einem Knüppel auf Arme und Beine geschlagen und ihm die Rippen gebrochen.
Endlich sagte Nadja leise, wie eine Erwachsene: »Idiot!«, und er sagte gleichfalls wie ein Erwachsener: »Verzeih mir!«
Sie gingen zum Hause und hinterließen eine nasse Spur wie zwei Wasserfässer. Ihr Weg führte eine staubige Steigung hinan, die von Schlangen wimmelte, es war nicht weit von der Stelle, wo Nika am Morgen die Haselnatter gesehen hatte.
Er erinnerte sich an die verzauberte Erhabenheit der Nacht, an den Morgen und an seine Allmacht, als er nach seinem Willen der Natur gebot. Was würde ich ihr jetzt befehlen? dachte er. Was wünsche ich mir am allermeisten? Am liebsten wäre er noch einmal mit Nadja in den Teich gefallen, und er hätte viel darum gegeben, zu erfahren, ob das noch einmal geschehen würde.
Zweiter TeilEin Mädchen aus anderen Kreisen
1
Der Krieg mit Japan war noch nicht zu Ende. Unerwartet jedoch traten andere Ereignisse in den Vordergrund. Revolutionäre Wellen gingen über Rußland hin, eine höher und unglaublicher als die andere.
Um diese Zeit reiste die Witwe eines belgischen Ingenieurs, die russifizierte Französin Amalia Karlowna Guichard, mit ihren beiden Kindern, dem Sohn Rodion und der Tochter Lara, vom Ural nach Moskau. Den Sohn gab sie ins Kadettenkorps, die Tochter in ein Mädchengymnasium; diese kam zufällig in dieselbe Klasse, die auch Nadja Kologriwowa besuchte.
Madame Guichard hatte von ihrem Mann Ersparnisse in Form von Wertpapieren, die früher gestiegen waren, jetzt aber zu fallen begannen. Um das Dahinschmelzen ihrer Mittel zu stoppen und nicht mit den Händen im Schoß dazusitzen, erwarb sie ein kleines Geschäft, die Schneiderwerkstatt Lewizkaja unweit des Triumphbogens, sie kaufte es den Erben der Schneiderin ab mitsamt dem Recht, den Firmennamen beizubehalten, mitsamt dem Kundenkreis sowie den Modistinnen und Lehrlingen.
Madame Guichard hatte diesen Kauf auf den Rat des Advokaten Komarowski getätigt, der ein Freund ihres Mannes und auch ihr eine Stütze war, ein kaltblütiger Handelsmensch, der das Geschäftsleben in Rußland kannte wie seine fünf Finger. Mit ihm hatte sie wegen des Umzugs korrespondiert, er holte sie vom Bahnhof ab und fuhr mit ihnen durch ganz Moskau zu dem Hotel »Tschernogorija« in der Orushejny-Gasse, wo er für sie ein Zimmer reserviert hatte. Er hatte ihr auch empfohlen, Rodion ins Kadettenkorps und Lara ins Gymnasium zu geben, und er scherzte unaufmerksam mit dem Jungen und sah das Mädchen so an, daß es errötete.
2
Bevor sie in die kleine Dreizimmerwohnung neben der Schneiderei zogen, wohnten sie einen Monat im »Tschernogorija«.
Dies war die verrufenste Gegend von Moskau, die Gegend der Kutscher und Spelunken; ganze Straßen lebten von der Prostitution, es war das Elendsviertel der »Verlorenen«.
Die Kinder wunderten sich nicht über den Schmutz in den Zimmern, über die Wanzen und die ärmlichen Möbel. Seit dem Tode ihres Vaters lebte die Mutter in der ewigen Angst zu verarmen. Rodion und Lara hörten immer wieder, daß sie am Rande des Abgrunds stünden, und hatten sich daran gewöhnt. Sie wußten, daß sie keine Kinder der Straße waren, doch tief in ihnen saß, wie bei Waisenhauskindern, die Scheu vor den Reichen.
Ein lebendiges Beispiel für diese Angst gab ihnen die Mutter. Sie war eine üppige Blondine um die Fünfunddreißig, deren Herzanfälle mit Anwandlungen von Dummheit wechselten. Sie war schrecklich feige und hatte vor den Männern eine Todesangst. Eben deshalb, vor Schreck und Verwirrung, fiel sie aus einer Umarmung in die nächste.
Sie bewohnten im »Tschernogorija« das Zimmer dreiundzwanzig, und nebenan in der Vierundzwanzig wohnte, seit das Hotel bestand, der Violoncellist Tyschkewitsch, ein leicht schwitzender, kahlköpfiger, gutmütiger Mensch, der eine Perücke trug und die Hände wie betend zu falten und an die Brust zu drücken pflegte, wenn er jemanden von etwas zu überzeugen suchte, und verdrehte, den Kopf im Nacken, gefühlvoll die Augen, wenn er in einer Gesellschaft auftrat oder ein Konzert gab. Er war selten zu Hause und hielt sich tagelang im Bolschoi-Theater oder im Konservatorium auf. Die Nachbarn lernten sich kennen. Wechselseitige Gefälligkeiten brachten sie einander näher.
Da die Kinder Madame Guichard während der Besuche Komarowskis manchmal störten, überließ ihr Tyschkewitsch, wenn er ging, den Schlüssel seines Zimmers, damit sie den Freund dort empfangen konnte. Bald hatte sie sich an seine Opferbereitschaft so gewöhnt, daß sie ein paarmal tränenüberströmt bei ihm klopfte und ihn um Schutz vor ihrem Gönner bat.
3
Das Haus war ebenerdig und lag unweit der Twerskaja-Straße. Man spürte die Nähe des Brester Bahnhofs. Gleich nebenan befanden sich das Bahngelände, die Dienstwohnungen der Angestellten, die Lokomotivendepots und die Speicher.
Hier war Olja Djomina zu Hause, ein gescheites Mädchen, Nichte eines Angestellten am Moskauer Güterbahnhof.
Sie war ein begabter Lehrling. Die ehemalige Prinzipalin Lewizkaja hatte sie bevorzugt, und auch die Neue zog sie zu sich heran. Olja mochte Lara sehr.
In der Schneiderwerkstatt blieb nach dem Besitzerwechsel alles beim alten. Die Nähmaschinen rotierten wie wahnsinnig unter den Fußbewegungen oder fliegenden Händen der müden Schneiderinnen. Andere nähten geräuschlos, auf dem Tisch sitzend, und führten die Hand mit der Nadel und dem langen Faden immer wieder zur Seite. Der Fußboden war mit Stoffresten übersät. Man mußte laut sprechen, um das Rattern der Nähmaschinen und die schmetternden Triller des Kanarienvogels Kirill Modestowitsch zu übertönen; dieser saß in seinem Käfig im Fenstergewölbe, und die frühere Herrin hatte das Geheimnis seines Namens mit ins Grab genommen.
Im Empfangssalon umstanden die Damen als malerische Gruppe den Tisch mit den Modejournalen. Einige saßen auch, stützten die Ellbogen auf und imitierten dabei die Posen, die sie auf den Abbildungen sahen. Sie betrachteten die Modelle und berieten sich über die Schnitte. An einem anderen Tisch saß auf dem Direktricenplatz Madame Guichards Assistentin, die Chefzuschneiderin Faina Fetissowa, eine knochige Frau mit Warzen auf den eingesunkenen schlaffen Wangen.
Sie hielt eine beinerne Zigarettenspitze zwischen den gelben Zähnen, blinzelte mit den gelben Augen, stieß einen gelben Rauchstrom aus Mund und Nase und notierte in einem Heft die Maße, die Quittungsnummern, die Adressen und die Wünsche der sich drängenden Kundinnen.
Madame Guichard war neu in der Schneiderei und hatte keine Erfahrung. Sie fühlte sich noch nicht als vollwertige Prinzipalin. Aber auf ihr Personal konnte sie sich verlassen und auf Faina Fetissowa ebenso. Gleichwohl war es für sie eine sorgenvolle Zeit. Sie hatte Angst, an die Zukunft zu denken. Immer wieder packte sie Verzweiflung. Alles fiel ihr aus den Händen.
Komarowski besuchte sie häufig. Wenn er durch die Werkstatt zu den Wohnräumen ging und im Vorübergehen die sich umkleidenden Modenärrinnen erschreckte, die bei seinem Erscheinen hinter einen Wandschirm flüchteten und seine hemdsärmeligen Scherze von dort kokett parierten, flüsterten die Schneiderinnen spöttisch und mißbilligend hinter ihm her: »Schon wieder.« – »Ihr Kerl.« – »Amalias Liebhaber.« – »Dieser Bulle.« – »Frauenverderber.«
Noch mehr haßten sie seine Bulldogge Jack, die er manchmal an der Leine mitbrachte und die ihn mit schnellen Sprüngen hinter sich herzog, so daß er aus dem Tritt kam und mit vorgestreckten Armen hinter dem Hund herstolperte wie ein Blinder hinter seinem Führer.
Einmal im Frühjahr biß die Bulldogge Lara ins Bein und zerriß ihr den Strumpf.
»Ich bringe ihn um, diesen Teufel«, flüsterte Olja Djomina heiser Lara ins Ohr.
»Ja, der Köter ist wirklich widerlich. Aber wie willst du das machen, du Dummchen?«
»Still, nicht so laut, ich sag’s Ihnen. Bei Ihrer Frau Mutter liegen doch solche Ostereier aus Stein auf der Kommode …«
»Ja, aus Marmor und Kristall.«
»Genau, die meine ich. Ich sag’s Ihnen ins Ohr, kommen Sie näher. Man muß sie mit Speck einreiben, dann bleibt der Geruch hängen, der räudige Köter verschlingt sie, dieser Satan, dieses Ungetüm, und Schluß! Dann streckt er alle viere von sich! Von dem Glas!«
Lara lachte und dachte neidisch: Das Mädchen lebt in Armut und muß arbeiten. Die Kinder aus dem Volk entwickeln sich früh. Doch wieviel Unverdorbenes und Kindliches sie noch an sich hat. Die Eier, Jack – wo hat sie das her? Aber warum muß ich alles sehen und unter allem leiden?
4
Er ist doch Mamas – wie heißt das gleich … Er ist doch ihr … Scheußliche Wörter, ich mag sie nicht wiederholen. Aber warum sieht er mich dann mit solchen Augen an? Ich bin ihre Tochter!
Sie war knapp über sechzehn, doch schon ein vollentwickeltes junges Mädchen. Sie wurde auf achtzehn und darüber geschätzt, hatte einen klaren Verstand und einen umgänglichen Charakter und war sehr hübsch.
Sie und ihr Bruder wußten, daß sie alles im Leben aus eigener Kraft erreichen mußten. Im Gegensatz zu den Nichtstuern und Wohlversorgten hatten sie nicht die Zeit, frühzeitig Gerissenheit anzustreben und theoretisch Dinge auszuschnüffeln, die sie praktisch noch nicht berührten. Nur das Überflüssige war schmutzig. Lara war das reinste Wesen auf der Welt.
Die Geschwister kannten den Preis aller Dinge und wußten das Erreichte zu schätzen. Sie mußten einen guten Ruf haben, um sich durchzusetzen. Lara war eine gute Schülerin, nicht aus abstraktem Hang zum Wissen, sondern weil sie, um vom Schulgeld befreit zu werden, eine gute Schülerin sein und gut lernen mußte. Ebenso gut, wie sie lernte, wusch sie das Geschirr, half in der Werkstatt und erledigte die Aufträge ihrer Mutter. Ihre Bewegungen waren lautlos und harmonisch, und alles an ihr – die unmerkliche Flinkheit der Bewegungen, ihre Figur, ihre Stimme, ihre grauen Augen und ihre blonden Haare – paßte zueinander.
Es war ein Sonntag Mitte Juli. An Feiertagen konnte man morgens ein wenig länger im Bett bleiben. Lara lag auf dem Rücken, die Hände unterm Kopf.
In der Werkstatt herrschte ungewohnte Stille. Das Fenster zur Straße stand offen. Lara hörte, wie eine vorüberpolternde Droschke vom Straßenpflaster abkam und mit den Rädern in die Pferdebahnschiene geriet, denn das derbe Rattern ging über in ein leichtes Gleiten des Rades wie durch Öl. Ich sollte noch ein bißchen schlafen, dachte sie. Der Stadtlärm wirkte einschläfernd wie ein Wiegenlied.
Lara spürte beim Liegen ihren Körper an zwei Stellen – der linken Schulterrundung und dem rechten großen Zeh. Schulter und Fuß also, alles übrige war mehr oder weniger ihr Ich, ihre Seele oder ihr Wesen, in harmonische Formen gefügt und erwartungsvoll der Zukunft entgegenstrebend.
Ich muß einschlafen, dachte sie und stellte sich die Sonnenseite der Karetny-Reihe zu dieser Stunde vor, die Schuppen der Equipagenunternehmen mit den gewaltigen Fahrzeugen, die auf sauber gefegtem Boden zum Verkauf standen, das geschliffene Glas der Kutschenlaternen, die ausgestopften Bären, das pulsierende Leben. Ein Stückchen weiter unten – Lara malte es sich aus – exerzierten die Dragoner im Hof der Snamenskije-Kasernen, gehorsame Pferde gingen im Kreis, die Dragoner sprangen mit Anlauf in den Sattel und ritten Schritt, Trab und Galopp. An die Umfriedung des Kasernements drängten sich offenen Mundes Kinderfrauen und Ammen mit Kindern.
Noch weiter unten, dachte Lara, da ist die Petrowka, sind die Petrowskije-Linien. »Ich bitte Sie, Lara! Wie kommen Sie darauf? Ich möchte Ihnen nur meine Wohnung zeigen. Zumal es gleich um die Ecke ist.«
Olga, die kleine Tochter seiner Bekannten in der Karetny-Reihe, hatte Geburtstag. Aus diesem Anlaß vergnügten sich die Erwachsenen bei Tanz und Champagner. Er hatte Mama mitnehmen wollen, aber sie konnte nicht, sie fühlte sich krank. Darum sagte sie: »Nehmen Sie Lara mit. Sie ermahnen mich ja dauernd, ich soll auf sie aufpassen. Heute können Sie das tun.« Und er hatte auf sie aufgepaßt, das konnte man wohl sagen! Hahaha!
Ein Walzer, das war wirklich etwas Verrücktes! Drehen, drehen, an nichts denken. Während die Musik spielte, verging eine Ewigkeit, wie das Leben in Romanen. Kaum aber hörte sie auf, hatte man das Empfinden von etwas Skandalösem, als wäre man mit kaltem Wasser übergossen oder splitternackt überrascht worden. Doch ließ man sich diese Freiheiten gefallen, um vor den anderen anzugeben und zu zeigen, wie erwachsen man schon war.
Lara hätte nie gedacht, daß er so gut tanzen konnte. Was hatte er doch für kluge Hände, wie sicher umfaßte er ihre Taille! Aber so küssen würde sie sich nie wieder lassen. Sie hatte nicht geahnt, daß sich in den Lippen eines anderen soviel Schamlosigkeit bündeln konnte, wenn sie so lange auf die eigenen gepreßt wurden.
Schluß mit den Dummheiten. Ein für allemal. Nie wieder die Einfalt spielen, nie wieder sanft tun, nie wieder schamhaft den Blick senken. Sonst nahm das noch ein schlimmes Ende. Dicht neben ihr war die schreckliche Linie, übertrat sie die, so stürzte sie in den Abgrund. Nicht mehr ans Tanzen denken. Darin lag alles Übel. Beherzt ablehnen. Schwindeln, sie könnte nicht tanzen oder hätte sich das Bein gebrochen.
5
Im Herbst kam es auf den Strecken des Moskauer Eisenbahnnetzes zu Unruhen. Auf der Strecke Moskau–Kasan streikten die Eisenbahner. Die Moskau–Brester Strecke sollte folgen. Der Streikbeschluß war gefaßt, aber das Komitee konnte sich über den Tag nicht einigen. Alle Eisenbahner wußten von dem Streikbeschluß, und es bedurfte nur noch eines äußeren Anlasses, um ihn eigenmächtig in Kraft zu setzen.
Es war ein kalter, unfreundlicher Morgen Anfang Oktober, Zahltag für die Eisenbahner. Aus der Buchhaltung kamen lange keine Informationen. Dann erschien im Büro ein Junge mit der Kontroll- und Lohnliste sowie einem Stoß Arbeitsbücher, die einbehalten worden waren, um einen Lohnabzug vorzunehmen. Die Auszahlung begann. Über den freien Platz, der den Bahnhof, die Werkstätten, das Lokomotivendepot, die Lagerhäuser und die Gleise von den Holzhäusern der Verwaltung trennte, zog sich eine endlose Schlange von Zugbegleitern, Weichenstellern, Schlossern und ihren Gehilfen und Putzfrauen vom Waggonpark.
Es roch nach dem Beginn des städtischen Winters, nach zertrampelten Ahornblättern, geschmolzenem Schnee, Lokomotivenqualm und warmem Roggenbrot, das im Keller des Bahnhofsrestaurants soeben aus dem Backofen gezogen wurde. Züge liefen ein und fuhren ab. Sie wurden zusammengestellt und auseinandergenommen, wobei die Rangierer mit eingerollten und entfalteten Fähnchen winkten. In allen Tonarten tönten die Signalhörner der Wächter, die Trillerpfeifen der Rangierer und die Baßsirenen der Lokomotiven. Rauchsäulen stiegen in unendlichen Schwaden gen Himmel. Lokomotiven standen zur Abfahrt bereit, sie verbrühten die kalten Winterwolken mit siedend heißem Dampf.
Längs des Bahndamms gingen der Streckenleiter Fuflygin, Ingenieur für Verkehrswege, und der Streckenmeister des Bahnhofsbereichs Pawel Antipow auf und ab. Dieser enervierte den Instandsetzungsdienst mit Beschwerden über das Material, das für die Erneuerung der Gleise angeliefert worden war. Der Stahl sei nicht elastisch genug. Die Schienen hätten die Spannungs- und Bruchtests nicht ausgehalten und müßten nach seiner Erfahrung bei Frost brechen. Die Verwaltung nahm Antipows Klagen gleichmütig auf. Irgendwer verdiente an den Lieferungen.
Fuflygin trug einen offenen teuren Pelzmantel mit den Eisenbahnertressen und darunter einen neuen Zivilanzug aus Cheviot. Er schritt vorsichtig die Böschung entlang und warf immer wieder verliebte Blicke auf den Jackettsaum, die scharfen Bügelfalten der Hose und die eleganten Schuhe.
Antipows Worte gingen bei ihm zum einen Ohr hinein und zum anderen hinaus. Er dachte an seine eigenen Angelegenheiten, zog immer wieder die Taschenuhr, warf einen Blick darauf und war sichtlich in Eile.
»Gewiß, gewiß, mein Bester«, unterbrach er ungeduldig Antipow, »aber das gilt doch nur für Hauptstrecken oder stark befahrene Abschnitte. Und was ist das hier? Abstell- und Kopfgleise voller Kletten und Brennesseln, schlimmstenfalls Verschiebegleise für Leerwaggons und Ausweichstellen für die Rangierloks. Und da regst du dich auf! So was Verrücktes! Das ist doch ganz was anderes, hier könnte man auch Holzschienen verlegen.«
Fuflygin sah nach der Uhr, klappte den Deckel zu und blickte in die Ferne, wo die Chaussee die Bahngleise überquerte. In der Chausseebiegung zeigte sich eine Kutsche. Es war sein eigenes Gespann. Seine Frau kam ihn abholen. Der Kutscher hielt die Pferde fast am Bahndamm an, zügelte sie ständig und redete mit hohem Frauenstimmchen auf sie ein wie eine Kinderfrau auf plärrende Gören, da sie vor der Eisenbahn scheuten. Im Fond der Kutsche saß, lässig in die Kissen geschmiegt, eine schöne Dame.
»Na, mein Lieber, ein andermal«, sagte der Streckenleiter mit einer wegwerfenden Handbewegung, »ich habe jetzt andere Sorgen als deine Beschwerden. Es gibt Wichtigeres.« Das Ehepaar rollte davon.
6
Drei oder vier Stunden später, kurz vor der Dämmerung, wuchsen abseits der Landstraße auf dem Feld zwei Gestalten aus der Erde, die vorher nicht zu sehen gewesen waren, und gingen, sich oftmals umblickend, rasch davon. Es waren Antipow und Tiwersin.
»Komm rasch«, sagte Tiwersin. »Ich hab keine Bange, daß uns Spitzel aufspüren, aber ich fürchte, die andern machen mit dem Hin und Her Schluß, kommen aus der Erdhütte und holen uns ein. Ich kann sie nicht mehr sehen. Wenn alle so zaudern, hat es keinen Zweck, überhaupt was zu unternehmen. Dann ist auch das Komitee sinnlos. Wozu mit dem Feuer spielen und sich in ein Mauseloch verkriechen! Du bist mir auch so einer, du unterstützt diesen Quark mit der Strecke Moskau–Petersburg.«
»Meine Darja hat Bauchtyphus. Ich muß sie ins Krankenhaus bringen. So lange ist mit mir nichts anzufangen.«
»Heute soll Zahltag sein. Ich geh jetzt ins Büro. Wäre heute nicht die Lohnzahlung, bei Gott, ich würde auf euch alle pfeifen und auf eigene Faust ganz schnell Schluß machen mit dem Hin und Her.«
»Und wie, wenn ich fragen darf?«
»Ganz einfach. Ich geh in den Kesselraum, gebe das Signal mit der Sirene, und fertig.«
Sie verabschiedeten sich und gingen auseinander.
Tiwersin stapfte auf dem Gleis in Richtung der Stadt. Ihm entgegen kamen eine Menge Leute, die im Büro ihren Lohn abgeholt hatten. Er schätzte, daß die Lohnzahlung auf dem Bahnhofsgelände bald zu Ende sein mußte.
Die Dämmerung begann. Auf dem freien Platz vor dem Büro standen Arbeiter herum, die nichts zu tun hatten, beschienen von den Bürolaternen. Bei der Einfahrt zu dem Platz hielt Fuflygins Kutsche. Frau Fuflygina saß in der gleichen Pose darin, als wäre sie seit dem Morgen noch keinmal ausgestiegen. Sie wartete auf ihren Mann, der im Büro sein Geld abholen wollte.
Auf einmal fiel nasser Schneeregen. Der Kutscher kletterte vom Bock, um das Lederverdeck zu schließen. Während er, einen Fuß gegen die Rückwand gestemmt, die Stangen auseinanderzog, betrachtete Frau Fuflygina den silberperligen wäßrigen Brei, der im Licht der Bürolaternen glitzerte. Ihr verträumter Blick glitt starr über die Arbeiter hinweg, als könnte er notfalls unbeschadet durch sie hindurchgehen wie durch den Nebel oder den Sprühregen.
Tiwersin fing diesen Blick zufällig auf. Er war unangenehm berührt, darum trat er, ohne sich vor ihr zu verbeugen, zurück und beschloß, seinen Lohn etwas später zu holen, um nicht im Büro mit ihrem Mann zusammenzutreffen. Er ging in den schwächer beleuchteten Bereich der Werkstätten, wo schwarz die Drehscheibe mit den auseinanderführenden Gleisen zum Lokomotivendepot lag.
»Tiwersin! Kiprian!« riefen ein paar Stimmen aus der Dunkelheit. Vor der Tür der Werkstatt stand ein Häuflein Leute. Drinnen brüllte jemand, und man hörte ein Kind weinen. »Kiprian Saweljewitsch, helfen Sie dem Jungen«, sagte eine Frau aus der Gruppe.
Der alte Meister Pjotr Chudolejew verprügelte nach alter Gewohnheit wieder einmal sein Opfer, den minderjährigen Lehrling Jussup.
Chudolejew war nicht immer der Peiniger seiner Lehrlinge, der Säufer und Schläger gewesen. Einstmals hatten die Töchter von Kaufleuten und Popen der Moskauer Manufakturviertel dem stattlichen Gesellen verliebte Blicke zugeworfen. Aber Tiwersins Mutter, die damals vor dem Abschluß der Diözesanschule stand und um die er sich bemühte, gab ihm einen Korb und heiratete seinen Kumpel, den Lokmeister Saweli Tiwersin.
Im sechsten Jahr ihrer Witwenschaft nach Tiwersins grauenhaftem Tod (er verbrannte 1888 beim Zusammenstoß zweier Züge, der damals viel Aufsehen erregte) erneuerte Chudolejew seine Werbung, und wieder gab ihm Marfa Tiwersina einen Korb. Seither trank Chudolejew und wütete gegen alle Welt, der er die Schuld gab an seinen heutigen Mißhelligkeiten.
Jussup war der Sohn Himasetdins, des Hausmeisters in dem Haus, in dem Tiwersin wohnte. Er nahm den Jungen unter seine Obhut. Das trug ihm die Feindseligkeit Chudolejews ein.
»Wie hältst du die Feile, du Asiat«, brüllte Chudolejew, zerrte Jussup an den Haaren und prügelte auf ihn ein. »Feilt man denn so den Grat von den Gußstücken? Du verdirbst mir ja die ganze Arbeit, du Tataren-Balg, Allah-Mullah-Schlitzauge!«
»Au, ich tu’s nie wieder, Onkelchen, au, ich tu’s nie wieder, au, tut weh!«