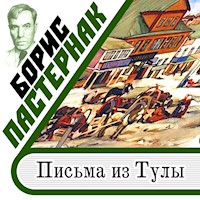9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Das unbekannte Werk im Schatten von ›Doktor Shiwago‹ - zum 125. Geburtstag von Boris Pasternak am 10.02.2015 Als 1958 ›Doktor Shiwago‹ mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, fehlte einer: sein Schöpfer. Boris Pasternak wurde von den russischen Behörden die Ausreise verwehrt, sein Autor blieb im Dunkeln. Dabei erzählt Pasternaks Leben das gesamte letzte Jahrhundert: Als 16jähriger spielte er Skrjabin vor, er studierte in Marburg Philosophie, wechselte Briefe mit Rilke und war mit Zwetajewa, Majakowski und Mandelstam befreundet. Im Gegensatz zu ihnen überlebte er den stalinistischen Terror und rächte sich im ›Doktor Shiwago‹. - In einer dreibändigen Ausgabe seiner Erzählungen, Essays und Gedichte stellen wir das unbekannt gebliebene Werk eines der größten Dichter Russlands vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Boris Pasternak
Meine Schwester – das Leben
Werkausgabe Band1. Gedichte, Erzählungen, Briefe
FISCHER E-Books
Inhalt
Gedichte
Anfangszeit
übersetzt von Christine Fischer
Im Februar gilt: Tinte weinen
Und lauthals schreiben, ungehemmt,
Solang der Schneematsch grollt und schäumend
Als rabenschwarzer Frühling brennt.
Die Kutsche: ein paar Münzen geben,
Durch Glockenton und Räderruf
Dorthin enteilen, wo im Regen
Verstummt die Tintentränenflut.
Wo Krähen, Birnen gleich und Kohlen,
Von Bäumen stürzen und als Schwall
In Pfützen landen; ganz verstohlen
Versinkt im Auge trockne Qual.
Sie schwärzt die aufgetauten Stellen,
Von Schreien ist der Wind durchkämmt,
Aus Zufall nur, doch stetig quellen
Gedichte – lauthals, ungehemmt.
1912
Es streut, wie Bronzestaub die Schwärze,
Der Garten Käfer aus im Traum.
Schon hängen dort mit mir und Kerze
Die Welten aufgeblüht im Baum.
Wie in noch unerhörten Glauben
Geh ich hinüber in die Nacht,
Zur grauen Pappel, deren Haube
Den Mondessaum kaum sichtbar macht,
Zum Teich, sich heimlich offenbarend,
Zum Apfelhain, dem leisen Meer,
Zum pfahlgestützt erbauten Garten:
Er trägt den Himmel vor sich her.
1912
Heut wird das Leid erfüllt, an dem er krankt –
So hatten Treffen es mir ausersehen.
So sank die Dämmerung auf jede Bank,
So träumte ich: ein Fenster, Azaleen …
So war die Auffahrt meiner Freunde hier,
So waren dieses einen Hauses Namen,
Wo unten sich die Trauer traf mit mir;
So war der Marsch, aus dem wir wiederkamen.
Die Avantgarde versuchte dies und das;
Im Müll der Höfe ging dahin das Leben,
Dem Frühling wurde alle Schuld gegeben:
Zur Abendandacht schnitt der März das Gras.
Welch reichen Nutzen brachten uns die Zweige:
Sie ließen Dächer wachsen, die so tief
Wie Brücken sich zu unsern Füßen neigten.
1911/1928
Sobald das Lyra-Labyrinth
Des Dichters Blick durchmisst,
Geschieht es, dass der Indus links
Und rechts der Euphrat fließt.
Im Raum, der ihn von jenem trennt,
Erwächst, entsetzlich schlicht,
Der Garten, den man Eden nennt,
Mit Stämmen, dicht an dicht.
Schon überragt ein Baum den Gast,
Grüßt rauschend ihn: »Mein Sohn!
Mich und die Meinen traf die Axt –
Und keiner blieb verschont.
Ich bin das Licht, ich ganz allein,
Von dem der Schatten fällt.
Ich bin Zenit, bin Lebenskeim
Und Anbeginn der Welt.«
1913/1928
Traum
Vom Herbst im matten Fenster träumt’ ich heute,
Von Freunden und von dir, von Lärm und Scherz,
Und wie der Falke fällt zur sichern Beute,
So sank zu deinen Händen hin mein Herz.
Die Zeit verging; sie alterte, ertaubte,
Der Rahmen glänzte in der Abendglut;
Sie kam vom Garten her, dem halb entlaubten,
Das Glas zu netzen mit Septemberblut.
Die Zeit verging; sie alterte. Es taute
Des Sessels Seide knisternd, wie aus Eis.
Du wurdest still … es starben hin die Laute …
Des Traumes Glockenton verhallte leis.
Ich wachte auf. Doch wie der Herbst war dunkel
Das Morgenlicht. Und ferne trug der Wind,
Wie gelbe Halme, die an Fuhren funkeln,
Die Schar der Birken bis zum Himmel hin.
1913/1928
Ich wuchs, wie Ganymed getragen
Von Regenwetter, Wind und Traum.
Zu Flügeln wurden Not und Klagen –
Sie lösten mich vom Erdensaum.
Ich wuchs heran … und Abendschleier
Umwaberten, umwehten mich.
Ein Kelch voll Wein war mir Begleiter;
Im Fensterglas zerbrach das Licht.
Ich wuchs … die Glut war mir genommen,
Als mich des Adlers Arm umfing.
Vorbei die Zeit, in der dein Omen,
Du Liebe, über mir erschien.
Ein Himmel nur, darin wir beide?
Die Höhe lockt mich immerzu …
Ein Schwanenlied noch vor dem Scheiden;
Gelehnt an Adlerschultern – du.
1913/1928
Alle ziehn ihre Mäntel heut an,
Rühren achtlos an Tropfengebilde.
Von den Menschen hat niemand erkannt,
Welcher Durst mich nach Regen erfüllte.
So verdreht ist das Laub, so verwirrt,
Dass der Himbeerstrauch silberhell schimmert.
Meine nördliche Schönheit – gleich dir
Wirkt die Sonne, die Sonne bekümmert.
Alle ziehn ihre Mäntel heut an;
Unser Leben nimmt keinerlei Schaden.
Doch ersetzen wird niemand den Trank,
Der so reich ist an nebligen Schwaden.
1913/1928
Sie werden wach am frühen Morgen
(Noch Kinder bis zu jener Nacht),
Verkrümmt vom Stich der neuen Sorgen
Sind ihre Lenden – ganz erstarrt.
Und selbst Tatarenrufe wecken
Nur schwer die Hinterhöfe auf;
Das Paar erkennt vertraute Strecken,
Des altbekannten Weges Lauf.
Es sieht den Regen, der verloren
Aus Norden kommt, graubraun wie Rost,
Den Himmel über Bergwerkstoren,
Theatern, Türmen, Schlachthof, Post,
Sieht Zeichen, Abdrücke von Sohlen,
Die ihren ersten Schritt getan;
Es hört: So ist es euch befohlen,
Folgt nur dem Muster – und fangt an.
Die zwei durchmessen, wie erwartet,
Den weiten Raum, noch ungespurt;
Geraspelt und aus blauer Farbe
Entstehn ein Landstrich, eine Furt.
1913/1928
Der Bahnhof
Mein Bahnhof – ein Safe, schwer entflammbar,
Der Trennung, Begegnung beschert;
Gebieter und Freund, ich bin dankbar
Für deinen unschätzbaren Wert.
Ein Schal wärmte manchmal mein Leben,
Zur Abfahrt bereit stand der Zug;
Sein Harpyen-Maul schnaufte bebend,
Die Sicht nahm uns dampfende Glut.
Noch saßen zusammen wir beide;
Wir fanden uns, lösten uns – aus.
Leb wohl, es ist Zeit, meine Freude!
Herr Schaffner, ich spring schon hinaus.
Der westliche Himmel schien gröber –
Nur Bahnschwellen, Regen und Not:
Er krallte sich fest mit Gestöber,
Vom Sturz vor die Puffer bedroht.
Horch, wieder ein Pfiff … er wird leiser …
Ein zweiter gibt Antwort … verstummt …
Der Zug rast davon auf den Gleisen
Als tauber und buckliger Sturm.
Die Dämmerung will nicht verweilen;
Dem Rauch nach, dem schwindenden Licht
Enteilen der Wind und die Weiten –
Ach, wäre mit ihnen auch ich!
1913/1928
Venedig
Mich weckte, als der Morgen graute,
Ein Schnippchen aus dem Fensterglas.
Ich sah Venedigs stolze Bauten
Im Wasser aufgelöst und nass.
Welch Stille! Doch im Traum bezwungen
War ich von einem Schrei – denn er
Glich einem Zeichen, das verklungen:
Der Himmel ängstigte sich sehr.
Als Sternbild Skorpion, mit Zacken,
Bei Mandolinen, längst verstummt,
Entfloh der Schrei, von ferne klagend,
Wahrscheinlich einem Frauenmund.
Es wurde still. Als schwarze Gabel
Erwuchs in tiefer Nacht ein Pfahl,
Und wie ein Flüchtling sah sich zaghaft,
Schief grinsend um der Prachtkanal.
Aus Hunger strömten widerstrebend
Und ziellos Wellen hin und her.
Die Gondeln schärften, stetig sägend,
Am Tau ihr seitliches Gewehr.
Sehr fern dem Ort, wo Boote baden,
Durchdrang das Licht den Rest des Traums:
Venedig stürzte vom Gestade
Venezianisch in den Schaum.
1913/1928
Der Winter
Sanft berührt meine Wange den Winter,
Der sich einrollt wie Schnecken im Haus;
»Auf die Plätze, wer meutert, nach hinten!«
Chaos herrscht ringsumher, Saus und Braus.
Wie das wogende Meer sind Romane,
Wie ein Flechtwerk, ein glänzendes Band;
Doch wann tritt man in Kreise, nichts ahnend,
Wann ins Leben? Beschreibt ein Roman
Bald das plötzliche Ende, bald Spiele,
Tut er Lachen und Tanzen uns kund?
Wie im wogenden Meer folgt die Stille
Unerwartet – wer wüsste den Grund?
Was vernehm ich? Das Rauschen der Muschel?
Flüstern Zimmer im Haus ungestört?
Widersetzt sich dem Schatten erst tuschelnd,
Dann laut krachend die Flamme im Herd?
Schon beginnt auch der Abzug zu klagen;
Nur ein Blick, und das Weinen fängt an.
Durch das nächtliche Schnarchen der Wagen
Jagt in waberndem Dunst das Gespann.
Vorerst ungepflückt kriechen die Splitter
Über Fenster und Simse wie Gischt.
Vitriol in den Gläsern schmeckt bitter:
Sag, was ist nur gewesen? – Ach, nichts!
1913/1928
Feste
Den Tuberosenkelch trink ich, des Herbstes Bläue,
Ich trink Verlassensein, den Strahl aus heißem Erz,
Den Kelch aus Abend, Nacht, Begegnung stets aufs Neue,
Den Kelch der Strophenflut trink ich, den bittern Schmerz.
Du Kunst, du leerer Dunst – wir sind dem Trunk ergeben,
Und Krieg erklären wir der sichern Nüchternheit.
Uns schenkt der Nachtwind ein, den Träume wirr beleben,
Doch leider werden sie nur selten Wirklichkeit.
Das Erbe und den Tod seh ich mit uns sich laben,
Schon trifft das erste Licht die Wipfel, es wird Zeit:
Im Zwieback hat sich tief der Anapäst vergraben,
Und Aschenputtel tauscht unmerklich fast ihr Kleid.
Die Böden sind gefegt, kein Krümel lässt sich blicken,
Es atmet rein der Vers, gleich einem Kinderkuss,
Und Aschenputtel läuft zur Kutsche – wird es glücken?
Bleibt ihr kein Groschen mehr, so geht sie heim zu Fuß.
1913/1928
Erstanden im Geräusch der Rhomben,
Der Plätze vor dem Morgenlicht,
Verharrt mein Lied, versteckt in Plomben
Aus Regenfluten, dicht an dicht.
Wenns aufklart, bin ich nicht zu sehen
Bei allen, die vertrocknet sind.
Denn mich durchnässten die Ideen:
Im Norden schlief ich schon als Kind.
Er liegt im Dunkel, gänzlich gleichend
Dem Mund, den ein Gedicht beschwert,
Er blickt von Schwellen trüb und schweigend,
Ist wie die Nacht, die nichts erklärt.
Und dies Subjekt, das Ängste weckte,
Das einzig ihren Grund erahnt,
Der Namenlose, Unentdeckte –
Er lieh mich irgendwo als Pfand.
1913/1928
Winternacht
Nicht von Sternen kann der Tag gerettet werden,
Und der Schatten hebt Dreikönigsschleier nicht;
Kraftlos weht der Rauch, denn Winter herrscht auf Erden,
Häuser kauern sich zusammen, dicht an dicht.
Die Laternen sind wie Backwerk, auch die Dächer;
Schwarz ragt aus dem Schnee nur dieses Haus empor;
Ich bin Herr darin, bewohne die Gemächer
Ganz allein – ich ließ den Schüler heim zuvor.
Kein Besuch kommt jetzt: geschlossen die Portiere,
Holprig das Trottoir, die Treppe zugeschneit.
Still, Erinnerung! Verschmilz mit mir, belehre
Und bekehre mich: Wir beide sind vereint.
Nur von ihr sprichst du? Das soll mich nicht verletzen …
Wer hat zeitig sie auf meine Spur gebracht?
Der Impuls schlug ein, doch an die Überreste
Hab ich, ihr sei Dank, bis heute nicht gedacht.
Holprig das Trottoir, mit weiß verzweigten Pfaden,
Starren Flaschen gleicht das nackte, schwarze Eis.
Backwerk leuchtet hell, und käuzchenhafte Schwaden
Stecken scheu die Köpfe in ihr Federkleid.
1913/1928
Inschrift im Buch von Petrarca
Gedunkelt sind die Fundamente,
Und Staub umhüllt den Goldbesatz;
Verzeiht: Das Himmelszelt verblasst;
Schon halb verglüht ist das Trecento.
Ein Feiertag, Siesta-Zeit:
Gebeugt auf weiße Fensterbretter,
Seht ihr im Staub Petrarcas Blätter –
Die Welt sinkt in Vergessenheit.
Und Wetterleuchten fällt von Westen
In ewige Kanzonennacht,
Wie einst des Himmels Purpurpracht
Auf seine Heimatstadt Arezzo.
1914
aus Über den Barrieren
übersetzt von Christine Fischer
Winterhimmel
Eisschollen ähnlich, dem Nebel entrissen,
Sind die Gestirne zum Stillstand gebracht;
Während die Läufer kopfstehen müssen,
Trinkt mit der Eisbahn die klangvolle Nacht.
Langsam, lauf langsamer im Getümmel:
Aus der Bewegung geschnittener Schritt.
Knirschende Kufe – in Norwegens Himmel,
Dicht an der Krümmung, als Sternbild geritzt.
Lüfte, in eisernem Eise gefangen!
Läufer! Dort muss alles gleichgültig sein!
Auch, dass die Nacht kommt mit Augen wie Schlangen,
Auch diese Nacht, dieser Dominostein;
Dass, wie die Zunge bewusstloser Hunde,
Frostig der Mond sich zur Klammer verbiegt,
Dass, wie bei Falschmünzern, stetig im Munde
Lava gefriert und den Atem besiegt.
1915
Seele
Du Freigelassne in der Erinnerung,
Doch in der Vergessenheit – Häftling der Zeit!
Die meisten betrachten die Seele als Pilgerin;
Ich seh sie als Schatten, der farblos verbleicht.
Versunkne, in steinernen Versen begräbt man dich,
Ertrunkne, von Staub bist du gänzlich umhüllt;
Wie früher Komtess Tarakanowa schlägst du dich,
Wenn Februar am Ravelin überquillt!
Du Einprägsame! Du pochst allzu flehentlich,
Beschwörst selbst die Zeit, wie man Wächter beschwört;
Gefallene Jahre: wie Herbstblätter wehen sie
Ans Strauchwerk der vielen Kalender verstört.
1915
Nicht wie jeder, nicht Woche für Woche,
Zweimal nur in der heutigen Zeit
Bat ich dich: Sprich sie einzeln, gebrochen,
Sprich die Worte des Schaffens erneut.
Unerträglich ist dir zu verweben
Offenbarung mit Zwang und Gewalt.
Sag, wie könnte ich unbeschwert leben
Auf der Erde – sie nährt uns mit Salz?
1915
Die entfesselte Stimme
Zum Stadtplatz, ins Mitternachtsdunkel,
Zum Abgrund, so schneeweiß, so schlampig …
Ihm droht – dem nicht Sichtbaren – »Kutscher!« –
Der Sturz von der Rampe, der Rampe
In lodernde Mitternachtstiefe.
Die Nacht ihrer Küsse durchdringend,
Aus Schwärze gelötet: »Zu Hilfe!«
Ertönt meine Stimme, versinkend.
Im Zweikampf den Schneesturm bezwingend,
Die lauteste Laute besiegend
Schwimmt sie – meine eigene Stimme –
An steinhartem Zaum aus dem Trüben …
1915
Eisgang
Noch wagt von frischer junger Saat
Der Frühlingsboden nicht zu träumen,
Wenn aus dem Schnee sein Kehlkopf ragt,
Um schwarz das Ufer zu umsäumen.
Das Rot betrinkt sich an der Bucht.
Man muss mit Fleisch den Abend reißen
Aus diesem Sumpf. Die Weite sucht
Im bösen Norden Fleisch als Speise.
Am Sonnenball erstickt sie fast,
Sie schleppt ihn mit sich über Moose,
Schlägt gegen Eis die schwere Last,
Zupft sie wie Lachs, so zart und rosig.
Bis Mittag tröpfelt es und taut;
Dann wird das Land vom Frost zerknittert:
Die Schlacht der Eisschollen dröhnt laut,
Die Splitter stechen sich erbittert.
Und keine Seele. Röcheln bloß,
Geklirr voll Sehnsucht, Messerwetzen,
Die Schollen im Zusammenstoß –
Und knirschend kauen ihre Lefzen.
1916/1928
Der Frühling
1
Verschwommene Tupfen, zerflossene Kerzen
An Zweige geklebt: Geschäftig
Erzeugt der April pubertierende Gärten;
Des Waldes Repliken sind kräftig.
Der Wald wird bedrängt von gefiederten Kehlen
Und fühlt, wie ein Büffel, die Schlinge.
So muss mancher Held durch Sonaten sich quälen,
Die stählerne Orgel bezwingen.
O Dichtung, wie griechische Schwämme erfüllt dich
Die Nässe. Zu klebrigen Schatten,
Zu tropfenden Pflanzen, auf Bänke hin will ich
Dich legen im wuchernden Garten.
Noch trägst du Gewänder für rauschende Feste,
Noch stürzt du in Tiefen das Wetter.
Doch kommt erst die Dunkelheit, schöpf ich das Letzte
Aus dir – für die durstigen Blätter.
2
Der Frühling! … Fahrt nicht heute
Zur Stadt! Wie Möwen, gellend laut,
Schreit auf die wilde Meute
Des Eises, das jetzt schneller taut.
Der Erde, Erde Wasserkraft
Ist wellengleich zu spüren.
Die Straßen, sonst so flatterhaft,
Sind dunkel, weil sie frieren.
Gleich einem Streichholz glimmen,
Im Schluckauf sich verlierend,
Der Hain, die Tram – verschwimmen
Und flattern, weil sie frieren.
Ein Krug, gefüllt mit blauem Eis
Und schäumendem Gefieder –
Schon wird euch furchtbar schlecht. Geheizt
Wird dieses Haus mit Liedern.
Denkt nicht an jene, habt sie satt,
Die sich beim Angeln wähnen:
Es zieht die Sünde durch die Stadt,
Gefolgt von nichts als Tränen.
3
Könnt ihr nur den Schmutz erfassen?
Seht, wie feucht die Erde ist!
Spielt im Graben nicht das Wasser
Wie ein Pferd im eignen Mist?
Nähren sich nicht selbstvergessen
Vögel hoch am Himmelszelt
Vom Zitroneneis der Messen,
Das durch Sonnenhalme fällt?
Schau dich sorgsam um – du siehst es:
Endlos, bis zur Abendglut,
Baden Moskau und selbst Kitesh
In der hellen, blauen Flut.
Scheinen Dächer dir nicht gläsern,
Ziseliert und kristallin?
Schindeln sind gewiegt von Gräsern,
Tage ziehn ins Dunkel hin.
Unsre Stadt – ein Sumpfgelände:
Letzter Schnee wird umgestülpt,
Wenn der Februar am Ende
Sich am Sprit verschluckt und rülpst.
An der weißen Flamme leiden
Nur die Speicher, fast schon blind,
Wenn, wie Vögel in den Zweigen,
Schwerelos die Lüfte sind.
Jetzt verlierst du deinen Namen.
Viele stellen dir ein Bein.
Deine Freundin ist gegangen,
Doch auch du bist nicht allein.
1914
Schwalben
Den Schwalben des Zwielichtes wird es zu schwer,
Die Kühle zu zähmen, die Bläue:
Sie bricht aus den Kehlen, sie strömt mehr und mehr,
Sie sprudelt hervor stets aufs Neue.
Die Schwalben des Zwielichtes jubeln entzückt;
Nichts bleibt, nur der lange entbehrte,
Der selige Siegesruf: Ach, welches Glück –
Seht, übergeschwappt ist die Erde!
Wie siedendes Wasser, wie weißlicher Schaum
Verzieht sich die Feuchtigkeit schniefend …
Seht her, für die Erde bleibt übrig kein Raum
Vom Himmelssaum bis in die Tiefen.
1915
Echo
Ein Vogellied braucht jede Nacht,
Ein Gefäß brauchen sprudelnde Tiefen;
Wer weiß, ob sich Sterne mit Macht
Aus Liedern in Lieder ergießen?
Wie herrlich die Nachtigall singt:
Darüber die Mitternachtsstunde,
Darunter die Wurzel; es klingt
Im Wurzelgeflecht bis zum Grunde.
Wenn Wipfel der Birken im Wald
Voll Anmut noch regungslos bleiben,
Klirrt eisern das Lied mit Gewalt
Am Stumpf und beendet das Schweigen.
Die Trauer tropft leise vom Stahl,
Im Schlamm wird das Dunkel zerfließen;
Vom Beet sieht man her ohne Zahl,
Betrachtet entlegene Wiesen.
1915
Drei Varianten
1
Ein Tag, dessen winzigste Einzelheit
Die Waage vor dir offenbart,
Das Schnalzen des munteren Eichkätzchens,
Die Wälder mit duftendem Harz.
Ermattet stehn Kraft sich erhoffende,
Tief schlafende Wipfel vereint;
Im schuppigen Dickicht quillt tropfender,
Quillt rinnender Schweiß lange Zeit.
2
Den Gärten wird es schlecht vor Stille,
Die Pfade wirbeln auf, erzürnt
Wie heftigste Orkane – wilder
Als jede Wolkenwand sich türmt.
Es riecht, bevor die Wetter toben,
Der Garten aus dem trocknen Mund
Nach Nesseln, Dächern, Ängsten, Moder,
Und Tiergebrüll erfüllt das Rund.
3
Überm Strauchwerk in den Lüften
Tost es. Gärten schlucken lechzend
Feuchte Nesseln, reich an Düften
Nach Gewittersturm, nach Schätzen.
Müde stöhnen noch die Äste.
Lücken mehren sich am Himmel.
Über blauende Moräste
Staksen Vögel ins Getümmel.
Solch ein Glanz mag Lippen gleichen,
Die noch keine Hand berührte;
Weidenruten, Laub der Eichen,
Spuren, die zur Tränke führen …
1914
Nach dem Regen
Noch drängelt am Fenster das welkende Laub,
Noch liegt auf den Wegen der Himmel, der Wüterich;
Doch welch eine Stille! … Auch wenn mans kaum glaubt –
Sogar die Gespräche sind anders und gütiger.
Am Anfang war alles mit Chaos durchsetzt,
So dass sich die Bäume im Garten entblätterten …
Zuerst fiel nur Regen, doch Hagel zuletzt;
Zum Vordach, vom Schuppen aus, stürzten die Wetter hin.
Jetzt atmest du niemals genug von der Kraft,
Und weil an den Rinden die Adern gerissen sind,
Erinnern die Lüfte an Soda im Saft;
Sie spielen mit Pappeln, gebogen aus Bitternis.
Wie Badende frösteln Balkone; am Glas
Verdunstet das rinnende Wasser, das Schwaden formt,
Und eisumhüllt schimmert die Beere im Gras,
Verwandelt in nährendes Salz ist das Hagelkorn.
Von Spinnweben gleitet der Sonnenstrahl müd
Hinab in die Nesseln; doch scheint es, nicht lange mehr,
Bis dieses Stück Kohle von neuem erglüht
Und Wälder als leuchtender Bogen umspannen wird.
1915/1928
Improvisation
Ich fütterte wieder den Tastenschwarm –
Da schwirrten die Flügel in rauschendem Toben,
Ich streckte die Zehen, ich reckte den Arm,
Es rieb sich die Nacht am Ellenbogen.
Wie dunkel es war! Wie ruhlos die Flut
Der Wellen. – »Ich liebe euch«, rief ich die Vögel.
Sie wollten nicht sterben, sie forderten Blut
Mit schwärzlichen, gellenden, kraftvollen Schnäbeln.
Wie ruhlos die Flut! Und wie dunkel es war!
Der Mitternachtsteer ließ die Seerosen lodern.
Den Kahn höhlten Wellen, so emsig, so klar …
Die Vogelschar nagte am Ellenbogen.
Am Rachen des Deichs spielte nächtliche Flut.
Die Vogelbrut klagte, dass Hunger sie quäle –
Und fordern die Weibchen in Wirklichkeit Blut,
Tönt lauthals noch immer die biegsame Kehle.
1915
Marburg
Ich bebte, von innerem Feuer verzehrt.
Ich litt: Einen Antrag versuchte ich heute –
Zu lange gezögert, jetzt ist es zu spät!
Sie weinte. Das war meine heiligste Freude.
Ich trat auf den Platz, ganz befreit von der Last,
Und fühlte mich beinah wie nochmals geboren.
Dem kleinsten Detail war ich gleichgültig fast:
Kurz lebte es auf – schon für immer verloren.
Die Straße schien braun von des Bürgersteigs Glut,
Zum Himmel empor blickte schiefer und wilder
Der Kopfstein. Der Wind war ein Ruderer, schlug
In unsre Gesichter. All dies waren Bilder.
Doch wie dem auch sei, ich vermied jedes Mal
Sie anzusehn, merkte nicht, wenn sie mich grüßten.
Mir war all ihr Reichtum so restlos egal;
Ich stürzte hinaus, um nicht weinen zu müssen.
Der schmeichelnde Alte, mein eigner Instinkt,
War kaum zu ertragen als steter Begleiter.
Er dachte: »Das ist nur ein launisches, unreifes Kind –
Ein Pech aber auch! Ich bewache ihn weiter.«
Da sprach der Instinkt: »Tu sofort einen Schritt.«
Der weise Scholastiker führte mich wieder
Durch Schilfrohr, durch niemals erkundetes Ried
Aus glühenden Bäumen, aus Sehnsucht, aus Flieder.
»Geh anfangs gemächlich, dann holst du schnell auf.«
So sah vom Zenit eine andere Sonne
Auf meinen ganz neuen, sehr langsamen Lauf,
Als wär ich vom fernsten Planeten gekommen.
Geblendet die einen. Den anderen schien
Das Dunkel so tief, dass es nie sich erhellen wird …
Die Kükenschar hüpfte zu Dahlien hin,
Zur zirpenden Uhr des Libellenlieds.
Die Marburger Dächer verschwammen, gestreift
Vom gleißenden Auge des Mittags (es blinzelt nicht);
Und irgendwer hielt schon die Armbrust bereit,
Ein anderer wollte zum Jahrmarkt, weil Pfingsten ist.
Vergilbender Sand aß an Wolken sich satt,
Es spielte die Luft mit den Brauen der Handwerker.
Der Himmel verklebte und fiel auf ein Blatt
Des Krautes, das Blutungen stillen kann – Arnika.
Ich kannte dich gründlich, vom Kopf bis zum Fuß,
Wie in der Provinz seinen Shakespeare ein Mime spricht;
Ich trug dich im Herzen, das war mir bewusst,
Ich schwankte, ich hatte dich gänzlich verinnerlicht.
Ich sink vor dir nieder, ich möchte das Eis,
Den Nebel und alles, was sichtbar ist, fassen –
(Wie schön du bist!) Stürme ziehn auf, mir wird heiß –
Was sagst du? Besinn dich! Verloren. Verlassen.
Hier wohnte einst Luther … und dort … Brüder Grimm.
Nur stachlige Dächer, ein Friedhof mit Bäumen …
Erinnerungstrunken zieht alles dahin,
Und dennoch – sie leben, die Bilder aus Träumen …
Die Fäden der Liebe! Gib acht, sie entschweben!
Du bist allzu mächtig, Elite der Affen,
Und liest vor den mystischen Toren des Lebens
Die Schilderung dessen, durch den du erschaffen.
Einst gründeten Ritter das uralte Nest,
Dann folgte die Pest. Doch die Monster von heute
Sind Flüge und Züge, ein Klirren zuletzt,
Welch glühende, summende, wabernde Meute!
Ich geh morgen nicht mehr zu ihnen – das Nein
Ist mehr als ein Abschied. Was kann ich erwarten?
Das Gas noch bezahlen, danach bin ich frei?
Was mag aus mir werden, ihr steinernen Platten?
Der Nebel teilt Decken fast überall aus,
Legt je einen Mond zu den Rahmen der Fenster hin.
Die Sehnsucht ist Gast vieler Bücher im Haus,
Nimmt Platz auf dem Sofa, wird selber zur Leserin.
Was ängstigt mich so? Ach, ich kenn die Grammatiken
Der Schlaflosigkeit: Daher rette ich mich.
Wem gleicht der Verstand? Nur dem Mond der Romantiker –
Ein seltsamer Freund, denn ich fasse ihn nicht.
Die Nächte beginnen mit mir eine Schachpartie,
Sobald das Parkett hell im Mondlicht erstrahlt.
Die Fenster stehn offen, es duften Akazien,
Im Hintergrund wacht noch die Lust, grau und alt.
Die Pappel ist König. Als Schlafloser spiele ich …
Zur Königin Nachtigall will meine Hand.
Figuren entschwinden ins Dunkel, das siegreich ist –
Doch ich hab das Antlitz des Morgens erkannt.
1916/1928
Meine Schwester – das Leben
Sommer 1917
übersetzt von Elke Erb
Es braust der Wald, am Himmel zieh’n
Des Sturmes Donnerflüge,
Da mal’ ich in die Wetter hin,
O Mädchen, deine Züge
Nikolaus Lenau
Dem Dämon zum Gedenken
Er kam oft in der Nacht
Von Tamara aus eisblauen Wänden,
Und sein Flügel gab acht
Auf des Albtraums Geräusch, auf sein Ende.
Nicht beweint, nicht vereint
Sind die Nackten mit blutigen Schrammen,
Und es fügte der Stein
An der Kirche sich wieder zusammen.
Wie ein buckliger Wicht
Stand der Schatten am Gitter, verzagend.
Die Surná wagte nicht
Nach der Fürstin das Lämpchen zu fragen.
Doch das Funkeln brach los –
Haar wie Phosphor erglühend, erschauernd …
Unbemerkt vom Koloss
Lag der Kaukasus, silbern vor Trauer.
Zum Gesims kam er leis,
Zupfte ruhlos am flauschigen Linnen,
Schwor bei Gipfeln und Eis:
Schlaf’! Ich komme zurück als Lawine.
übersetzt von Christine Fischer
Zum Gedenken an einen Dämon
Er kam her über Nacht
Von Tamaras Gletscher- und Almblau.
Seines Flügelpaars Takt
Schwang zu Stöhnen und Stille den Albtraum
Der nicht schluchzte, nicht rang
Die entblößten, gepeitschten, zerschrammten.
Und die Platte nicht sprang
Dem Grab beim georgischen Tempel.
Wie die Bucklige schief,
Kroch der Schatten nicht unter dem Gitter.
Nicht beim Öllämpchen rief
Die Surná nach der Fürstin, erstickend.
Doch das Phosphorlicht
Brach im Haar zu knisternden Schauern.
Der Koloss hörte nicht,
Wie der Kaukasus grau steht vor Trauern.
Vor dem Fenster der Eid,
Ihr geschworen, den Burnus durchfrierend:
Schlaf! – beim ewigen Eis,
Zurück kehre ich als Lawine.
Ist’s nicht Zeit, dass die Vögel singen
Über diese Verse
Ich zerstoße sie auf dem Bürgersteig
Mit Glas halb, halb mit Sonnensplit.
Die winters dem Plafond ich zeig,
Die feuchten Winkel lesen mit.
Da deklamiert das Dachgeschoss,
Neigt Rahmen erst und Winter sich.
Auf zum Gesims springt das Gesocks –
Die Narrheit, Not und Zeichenschrift.
Den Sturm begrenzt nicht Mondesfrist.
Das Ende, den Beginn deckt Schnee.
Plötzlich weiß ich: die Sonne ist;
Ein anderes Licht längst, das ich seh.
Weihnachten blickt: ein Dohlenkind,
Und ein recht ausgelassener Tag
Eröffnet viel von dem im Sinn,
Was fern, mir und der Liebsten, lag.
Mit vorgehaltener Hand, im Schal,
Ruf ich durchs Klappfenster: He, ihr
Da draußen, Kinder, sagt doch mal –
Welches Jahrtausend haben wir?
Wer bahnte zu der Tür den Pfad
Dem Loch, verstopft von Graupen roh,
Als ich mit Byron rauchend saß
Und als ich trank mit Edgar Poe?
Als zum Darjal, dem Freund gleich traut,
Ich fand, zu Hölle, Zeughaus und
Das Leben, wie Lermontows bebenden Laut,
In Wehmut tauchte, wie den Mund.
Schwermut
Als Epigraph, dies Buch besiegelnd,
Die Wüsten zischten,
Löwengebrüll, zur Reveille der Tiger
Hin zog es Kipling.
Da klaffte, dürr, die grausige Quelle,
Des Sehnens Nacktheit.
Sich wiegend, glättend, eisige Felle,
Und zähneklappernd.
Jetzt wiegen sie sich weiterlebend
Als Verse ranglos,
Trotten in Tau und Wiesennebel,
Träumen dem Ganges.
Das Frühlicht, kalte, giftige Schleiche,
Kriecht in die Löcher.
Im Dschungel Totenmessen-Feuchte,
Des Weihrauchs Röcheln.
Du bist meine Schwester – das Leben, bist heute
Der Regen des Frühlings auf jedem Gesicht;
Und hochnäsig blicken die Kneifer der Leute,
Die schlangengleich beißen aus Höflichkeitspflicht.
Die Älteren wissen der Gründe so viele.
Dein Grund ist ganz sicher, ganz sicher nur Spaß:
Wenns blitzt, schimmern Blicke und Rasen fast lila,
Der Horizont duftet resedenhaft nass.
Im Mai fährst du Bahn und willst Fahrpläne lesen,
Den Schilfdorfer Zweig hast du stets in der Hand;
Die Bibel ist niemals dir wichtig gewesen
Und niemals das Sofa, nach Stürmen, voll Sand.
Da stören die Bremsen mit Jaulen und Quietschen
Die schlafenden Dörfler im Krähwinkelrausch,
Und flüchtig erheben sich Köpfe von Pritschen,
Sein Mitleid mit mir drückt ein Sonnenstrahl aus.
Das Klingeln (das dritte) ist kaum zu erkennen,
Entschuldigend tönt es – nicht hier, nein, noch fern.
Gardinen durchsickert das nächtliche Brennen,
Die Steppe stürzt Stufen hinab bis zum Stern.
Sie blinzeln und zwinkern, sie schlafen mit Wonne,
Die Liebste, die Fata Morgana, sie träumt …
Doch ist durch die Plattform, die Türen, entronnen
Mein Herz – in die endlose Steppe gestreut.
übersetzt von Christine Fischer
Meine Schwester – du Leben und heute als Regen
Versprengt auf alle, ein Frühlingsborn.
Doch die mit Berlocken und eitelem Ekel,
Sie beißen höflich, wie Ottern im Korn.
Die Älteren werden wohl Gründe haben.
Unstrittig – vernunftlos ist deine Vernunft,
Dass violett im Gewitter sind Augen und Rasen,
Und der Horizont – feuchter Reseden Duft.
Dass du, reisend im Mai, im Fahrplan tüftelnd
Auf der Strecke Kamyschin liest im Coupé,
Grandioser sein Text als die Heilige Schrift ist
Und die staub-und-sturm-schwarzen Kanapees.
Dass, da mit Gekläff die Bremse stockt, rammelnd
Auf friedliche Ländler im Krähwinkelwein,
Man schaut – ist’s schon meiner – von den Polstern zum Bahnsteig,
Und die Sonne, die sinkt, mir ihr Beileid bezeigt.
Seinem dritten Spritzer nach fortschwimmt das Glöckchen,
Ganz Entschuldigung es: Bedaure, der nicht.
Zum Stern stürzt die Steppe sich von dem Treppchen,
Und die rauchende Nacht untern Vorhang schlich.
Zwar blinzelnd und nickend, doch schläft es sich süß so,
Und als Fata Morgana die Liebste erträumt,
Zur Zeit, da das Herz, auf die Plattformen fließend,
Waggontüren in der Steppe verstreut.
Der weinende Garten
Der schreckliche! – Tropft und will wissen ja,
Ob er auf der Welt allein ist,
– Knautscht den Zweig an das Fenster, wie Spitzen da –
Oder ob ein Zeuge dabei ist.
Doch würgt die großporige Erde
Vernehmlich an der Schwere der Schwellungen,
Und man hört – augusthaft – von ferne,
Die Mitternacht wird in den Feldern reif.
Kein Laut. Und auch keine Lauscher.
Sich vergewissernd der Leere,
Greift er zum Alten, rinnt rauschend
Vom Dach, in die Rinnen, sie querend.
Ich berühre die Lippen, will hören,
Ob ich auf der Welt allein bin,
Drauf und dran, mich in Schluchzen zu lösen, –
Oder ob ein Zeuge dabei ist.
Doch still. Nicht ein Blättchen, das raschelt.
Kein Deut, kein Zeichen, nur grauses
Schlucken und Plätschern in Schlappschuhn
Und Tränen und Seufzer der Pausen.
Der Spiegel
Im Trumeau steigt der Dampf einer Tasse Kakao,
Der Tüll schaukelt und geradezu
Den Weg in den Garten, in Windbruch und Chaos
Zur Schaukel hin läuft der Trumeau.
Dort schinden die Kiefern die Luft bis zum Wabern
Mit Harz, in dem Treiben dort sucht
Ihre Brille die Palisade im Grase,
Dort liest der Schatten ein Buch.
Und ins Dunkel, nach hinten, hinters Pförtchen zur Steppe,
Wo der Duft der Schlafkräuter harrt,
Rieselt den Weg lang in den Ästchen und Schnecken
Der blinkende, glühende Quarz.
Der riesige Garten im Saale schüttert
Ins Glas – das er nicht einmal schrammt!
Als sei über alles Kollodium geglitten
Vom Pult bis zum Rauschen im Stamm.
Alles hatte, so schien es, die Flut des Spiegels
Übergossen mit nicht tauendem Eis,
Dass nicht bitter der Ast sei, nicht dufte der Flieder
– Unverdeckt die Hypnose allein.
Eine Welt ohne Maß irrt im Mesmerismus,
Und der Wind nur verbindet noch,
Was ins Leben stürzt und sich bricht im Prisma
Und in Tränen zu spielen frohlockt.
Nicht ersprengbar die Seele wie der Salpeter,
Nicht ergrabbar der Seele Schatz.
Der riesige Garten im Spiegel bewegt sich
In das Glas – das er nicht einmal kratzt.
Ich kann dort, in dieser hypnotischen Heimat,
Die Augen nicht zuwehn mit Staub.
So kriechen nach dem Regen Schnecken den Schleimpfad
– Als Statuen-Augäpfel im Laub.
Das Wasser rauscht an den Ohren, und, zwitschernd,
Ein Zeisig hüpft auf den Zeh’n.
Zerdrücke dreist Blaubeeren auf ihren Lippen,
Du wirst sie nicht trunken sehn.
Der riesige Garten im Saale zittert,
Zeigt dem Spiegel die Faust und rast
Zu ihm auf der Schaukel, hascht, tatscht, beschmiert, rüttelt
Den Trumeau – und zerbricht nicht das Glas!
Ein Mädchen
An der Brust des Felsens, dieses Recken,
nächtigte ein goldenes Wölkchen.
Von Garten und Schaukel, perlicke-perlocke:
Ein Zweig läuft ins Spiegelglas.
Riesig, nah, mit smaragdenen Tropfen
Oben auf seinem spitzigen Quast.
Verdeckt von dem Zweig, seiner wirren Verrücktheit,
Verschwunden des Gartens Gewog.
Trautes du, gartengroß, doch im Charakter –
Die Schwester! Ein zweiter Trumeau!
Doch nun, da man dieses Zweiglein hereinträgt,
In der Vase es stellt zum Trumeau:
Wer, rätselt der, will mir Augen weinen
Mit der menschlichen Kerker-Ruh?
Du, in den Wind dich setzend, prüfst:
Ist nicht der Vögel Zeit
Zu singen? – der benetzt ist wie
Ein Spätzchen, Fliederzweig!
Die Tropfen groß, manschettenknopfschwer,
Der Garten blitzt, ein Fluss,
So blendend, blaue Tränen tropft er,
Tränenmillion, die floss.
Den aufzog meine Sehnsucht mir –
Du ließest Dornen schaun –
Fing neu heut Nacht zu leben an
Mit Düften und Geraun.
Bis früh am Fenster rüttelte er,
Der Laden zitterte,
Auf einmal feucht durchglitt das Kleid
Ein Hauch von Bitternis.
Von wundersamer Zeiten-Reih
Und Namen aufgeweckt,
Fängt er den Tag von heute weiß
Im Anemonenblick.
Der Regen
Aufschrift auf dem »Buch der Steppe«
Sie ist bei mir. Spiel, reg dich auf,
Gieß, lachend, greif ins Düster, reiß,
Ertränke, fließ als Epigraph
Der Liebe, die dir gleicht.
Schwing, Pendel, Seidenspinner du,
Stoß dich am Fenster ab.
Umwinde, rinne, binde zu,
Was jetzt noch Helle hat.
Nacht mittags, schüttend – kämme sie!
Den Schotter – schlämme ihn!
Und – baumweis, Bäume, Stämme ziehn
In Schläfe, Aug, Jasmin.
Hosianna, ägyptische Finsternis!
Es lacht, Zusammenprall – Fall!
Und plötzlich aus tausend Kliniken
Entlassen – so roch’s überall.
Jetzt laufen wir und zupfen ihn,
Als klagten hundert Gitarrn,
Den von dem Lindendunst geputzten, den
Garten-Sankt-Gotthard.
Buch der Steppe
Est-il possible, – le fût-il?
Verlaine
Bis zu all dem war Winter
In den Spitzen der Gardinen
Hausen Krähn.
Frost und Graun sind auch in ihnen
Schon gesät.
Da umkreist Oktober schauernd,
Da der Graus
Kroch heran auf seinen Klauen
Hoch ins Haus.
Ob es Stöhnen, ob es Bitten
Krächzend reih,
Dem Oktober als ein Knüppel