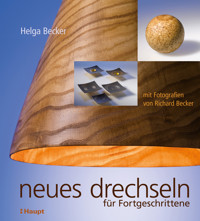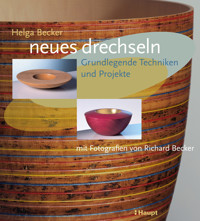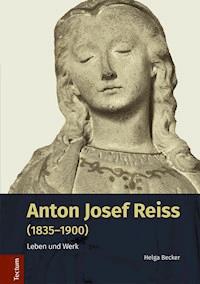Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Frau Nägele
- Sprache: Deutsch
Frau Nägele, die schwäbische Miss Marple, ist sich sicher: Der Öchsle hat sich nie und nimmer selbst in der eigenen Rotweinmaische umgebracht. »Der wär jo schee bled!« Vielmehr wittert ihre kriminalistische Spürnase ein Verbrechen in der High Society der schwäbischen Kleinstadt. Mit Scharfsinn mischt sich die Schlabbergosch unter die feinen Leut und versucht, mit eigenwilligen Methoden das Netz aus Affären und Kumpanei zu entwirren. Als weitere Leichen auftauchen und eine alte Geschichte ans Licht kommt, ist Frau Nägele in ihrem Element. Mit gefährlichen Folgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helga Becker
Domm gloffa!
Frau Nägele ermittelt
Zum Buch
»Nie im Läba!« Elvira Nägele ist überzeugt, dass der Öchsle sein Leben nicht selbst in einem seiner Gärbottiche auf dem eigenen Weingut beendet hat. Das wäre ja »schad um die Maische«! Sofort wittert sie ein Kapitalverbrechen – sehr zum Leidwesen von Kommissar Lauer. Doch die schwäbische Miss Marple ist nicht zu stoppen. Mit ihrer unvergleichlichen kriminalistischen Expertise aus Funk und Fernsehen und einem sicheren Gespür für Fettnäpfchen nimmt sie sich dem Fall an. Natürlich nicht aus Neugier, rein aus Interesse! Die Spur führt schnurstracks in die »High Society« der schwäbischen Kleinstadt, in der ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit schlummert. Während die Schlabbergosch versucht, das Durcheinander aus Lieb- und Seilschaften zu entwirren, tauchen weitere Leichen auf. Die Hobbyermittlerin ist mit ihren eigenwilligen Methoden und der Unterstützung ihrer skurrilen Familie dem Kommissar allerdings einen Schritt voraus, nicht nur beim Bottwartal-Marathon. Mit gefährlichen Folgen.
Helga Becker, geboren 1958 in Murr an der Murr, ist Mutter von zwei Töchtern. Mit ihrem Mann, dem Fotografen Richard Becker, lebt sie im Bottwartal, in der Nähe von Ludwigsburg. Nach dem Abitur und einer kaufmännischen Lehre war sie als Stadtarchivarin in ihrem Heimatort Steinheim an der Murr tätig. Ihre lebhafte Fantasie, ihr schwäbischer Humor und viel Lokalkolorit bilden die Grundlage für ihre Krimikomödien rund um die Hobbyermittlerin Frau Nägele. Mit ihrer Kultfigur tourt Helga Becker auch als schwäbische Kabarettistin und Sängerin durchs Ländle.
www.frau-naegele.de
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Ricarda Dück
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Richard Becker
ISBN 978-3-7349-3100-0
Widmung
Für meinen geliebten Mann Richard – den BMVÄ!
Prolog
An einem Mittwoch Ende September
»A scheener Dag. A arg scheener Dag«, murmelt der alte Festus und schaut zufrieden in die Runde. Alle, die am Ort etwas gelten oder etwas gelten wollen, waren gekommen. Manche kann er gut leiden, manche weniger und einige gar nicht. Aber das ist heute egal. Er fühlt sich wohl.
Kaffee und Kuchen haben sie schon hinter sich. Melanie, die junge Löwenwirtin, hatte ihm wie selbstverständlich seine große Bechertasse hingestellt. »Opa Festus« steht drauf. Dabei ist er nur der adoptierte Großvater von Melanies Kindern Lea, Emma und Lara. Aber das spielt keine Rolle. Es sind seine »Mädla« und die haben ihm die Tasse zum Geburtstag geschenkt. Gerührt hatte er Melanies Hand ergriffen, denn nur dank ihr kann er seinen Lebensabend hier im Gasthaus verbringen, nachdem die alte, kaltherzige Löwenwirtin letztes Jahr verstorben ist.
Nach dem Kaffee wird das Service gegen Weingläser getauscht und die Stimmung lockert sich merklich. Die Gäste unterhalten sich lebhaft, aber verstehen kann Festus das Wenigste, denn seit einiger Zeit hört er nicht mehr so gut. Da es ihm Schwierigkeiten bereitet, einzelnen Gesprächen zu folgen, richtet er den Blick nach innen und versinkt in seiner eigenen Gedankenwelt.
Ich sitze Festus, wie Wilhelm Blank von allen genannt wird, gegenüber und beobachte ihn schon einige Zeit. Er summt und murmelt leise vor sich hin.
»Festus, was singsch denn?«, erkundige ich mich und berühre ihn über den Tisch hinweg am Arm, damit er auf mich aufmerksam wird.
Der alte Mann hebt den Kopf und schaut mich verwirrt an. Es dauert eine Weile, bis er realisiert, wo er ist und wer ihn angesprochen hat. Ich wiederhole meine Frage etwas lauter und Festus lächelt.
»Am Brunnen vor dem Tore«, antwortet er und erklärt, dass man das Volkslied früher oft und gerne angestimmt hat, wenn man in der Wirtschaft oder zum Wandern zusammengekommen war. Er beklagt, dass heutzutage kaum noch gesungen wird und die Verse nicht mehr bekannt sind.
»I kenn se no gut«, sagen Vater und sein Freund Emil fast gleichzeitig.
Sie sitzen mit meiner Mutter Barbara und Alfa bei uns am Tisch. Emil war lang Mitglied im Gesangsverein und Vater, der passionierte Fußballer, erzählt, dass nach den Spielen ebenfalls immer gerne Lieder geschmettert wurden.
»Was denn zum Beispiel?«, möchte ich wissen.
»Mädle, ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite«, trällert Festus leise und nacheinander beteiligt sich die gesamte Runde.
»Mädle, ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite, i hab di gar so gern, i kann di leide«, gebe ich ebenfalls zum Besten, immerhin kenne ich die alten Lieder noch aus meiner Kindheit.
Mutter schlägt als Nächstes D’ Bäure hot d’ Katz verlora vor, und auch dieses Stück ist allen vertraut. Am Nebentisch spitzt jetzt der eine oder andere Gast die Ohren und stimmt vorsichtig mit ein. Immer mehr schließen sich an, und so singt schließlich die gesamte Gesellschaft nicht nur das Lied vom verschwundenen Kätzchen, sondern direkt im Anschluss Uff dr Schwäbscha Eisabahna und Muss i denn zum Städtele hinaus.
Nur Benni und David, zwei junge Kerle, sitzen etwas abseits und bleiben stumm. Sie können offensichtlich mit den althergebrachten Versen nicht viel anfangen. Zudem ist Benni kein Hiesiger. Alfa hingegen, Vaters Freund, der Anfang der Siebzigerjahre als Gastarbeiter nach Steinheim kam und blieb, möchte seinen Teil beitragen und intoniert mit einer schönen Tenorstimme ein neapolitanisches Volksstück. Andächtig lauschen alle dem Text, obwohl niemand ein Wort versteht. Dafür steigen alle gefühlvoll beim Refrain mit ein: »Santa Lucia, Santa Lucia!«
Der 85-jährige Festus blüht mit jedem Lied zusehends auf und kaum ist eins verklungen, beginnt er schon das nächste: Rot ist der Wein, Die kleine Kneipe in unserer Straße und Griechischer Wein. Der alte Mann freut sich, dass alle einstimmen. Er wächst über sich hinaus und singt, was das Zeug hält …
Als er jedoch mit leuchtenden Augen So ein Tag, so wunderschön wie heute schmettert, kippt die Stimmung von einer Sekunde auf die andere. Meine Güte, allen wird bewusst, dass wir uns ja nicht auf einer Geburtstagsfeier befinden, sondern auf der Beerdigung von Edmund Kraut, Wengerter und Gemeinderat am Ort!
Beschämt setzten sich alle, die zum Schunkeln aufgestanden waren, wieder hin, und Senta, Edmunds Witwe, von reichlich Wein und frohem Gesang in bester Laune, schluchzt plötzlich herzergreifend auf und hält sich schnell ein Taschentuch vor die Nase.
Festus schaut mich erschrocken an, aber ich gebe ihm mit einem Augenzwinkern und erhobenem Daumen zu verstehen: alles gut. Er antwortet mit einem kleinen Lächeln. Für ihn war es wirklich ein schöner Tag. A arg scheener Dag.
Kapitel 1
An einem Samstag Anfang September
Ausnahmsweise habe ich den Wochenendeinkauf erledigt. Sonst macht das ja der BMVÄ, der »beschte Ma von älle«,und das ist meiner. Heute hilft der allerdings beim Standaufbau auf dem Hoffest beim Weingut Kraut. Und das geht mir gehörig gegen den Strich. Also das Einkaufen, nicht das Hoffest. Ich hasse es, wenn ich mich am Samstag durch die Läden und Marktstände quälen muss. Jetzt bin ich jedoch ziemlich stolz auf mich, denn mit einem Fünfundzwanzigkilosack Kartoffeln und fünf Hokkaidokürbissen habe ich zwei Schnäppchen gemacht. Beides war im Sonderangebot und da kann ich als Schwäbin schlecht nein sagen, auch wenn die Menge locker drei Monate reichen wird. Beim Metzger Weller habe ich noch je fünf Dosen Leber-, Schinken- und Bauernbratwurst mitgenommen. Die kann man gut lagern, hat er gesagt. Und man weiß ja nicht, ob mal unverhofft Besuch kommt. Ob sechzig Eier dann nicht doch etwas zu viel sind, frage ich mich allerdings schon. Aber der BMVÄ, der Koch im Hause Nägele, wird schon eine Verwendung dafür finden. Ansonsten springt Mutter ein, die ebenfalls eine ausgezeichnete Köchin ist und bei Familienfesten gegen ihren Schwiegersohn in den Küchenring steigt.
Meine Einkäufe müssen nun erst mal verstaut werden. Und da ich nicht nur gerne spare, sondern zudem optimiere, versuche ich, alles mit möglichst wenig Gängen vom Auto ins Haus zu tragen. Auf eine Kiste Sprudel lege ich deshalb den Kartoffelsack und darauf noch zwei der Kürbisse, merke jedoch gleich, dass ich das Gewicht maximal zwei Meter weit transportieren kann. Die Kürbisse bleiben folglich fürs Erste im Kofferraum und ich schleppe den übrig gebliebenen Stapel zur Eingangstür.
Auf halbem Weg werfe ich einen kurzen Blick zum Nachbargebäude, in dem meine Eltern wohnen. Davor entdecke ich meine Mutter Barbara, die mir mit wilden Armbewegungen zu verstehen gibt, dass ich sofort rüberkommen soll. Sie ist ganz grün im Gesicht. Und ich erkenne sofort: ein Notfall.
Vor Aufregung setze ich meine Last unsanft ab, dabei fällt der Sack von der Kiste runter, platzt auf, und fünfundzwanzig Kilo Kartoffeln kullern über die Bodenplatten. Egal jetzt, nichts wie rüber. Magen-Darm, fährt es mir durch den Kopf, und ich mache mich auf unschöne Gerüche im Haus gefasst.
Die Tür steht offen, Mutter ist allerdings verschwunden.
»Mutter?«, rufe ich durch den Flur.
Keine Reaktion. Aber wenigstens riecht es recht gut.
»Mutti?«
Immer noch nichts.
»Mutti-hi, wo bisch denn?«
Alarmiert gehe ich in die Küche, und da steht sie und verpackt in aller Ruhe Kleingebäck in Tütchen. Von wegen Magen-Darm! Sie hat eine grüne Gesichtsmaske aufgelegt. Ich bin sprachlos, und das will bei mir etwas heißen.
»Sag amol, goht’s no?«, pfeife ich sie schließlich an. »I hab denkt, dass weiß Gott was mit dir los isch!«
Statt zu antworten, greift sie zu Notizzettel und Stift, weil sie mit der Maske nicht reden kann. Oder will. Sie hält mir das Papier vor die Nase. »Was soll mit mir sein?«, steht darauf. »Das Gebäck ist fertig und kann zum Kraut.«
Was? Ich fürchte, es geht um Leben und Tod, und dabei soll ich den Lieferdienst für sie übernehmen?
»Mutter, du machsch mich fertig!«
»Kannsch glei mitnemma, wenn’s pressiert«, nuschelt sie und wedelt mit den Händen Richtung Tür.
»Noi, des pressiert gwiess net«, entgegne ich bestimmt. »I brauch z’erscht en Kaffee.«
Den Gedanken an die verstreuten Kartoffeln vor unserem Haus verdränge ich. Die müssen warten.
Mutter bedient die Kaffeemaschine, und ich nehme mir je ein Stückle vom süßen und vom salzigen Gebäck, das sie für das Hoffest auf dem Krauthof vorbereitet hat. Während der Kaffee läuft, verschwindet sie im Bad. Ich gieße mir eine Tasse ein und lass es mir derweil schmecken. Verdient habe ich mir das redlich.
Als sie zurückkehrt, sieht meine Barbara Lieselotte Krämer wie das blühende Leben aus. Zart geschminkt, mit rosigen Wangen, frisch getuschten Wimpern, einem Hauch von Lidschatten und sogar die Haare sind toupiert. Jetzt erst bemerke ich ihre heutige Garderobe. Sie trägt eine Schlaghose mit einem wilden Rautenmuster in poppigen Farben. Darüber ein pinkfarbenes halblanges Oberteil mit Trompetenärmeln, das ihr kleines Bäuchlein super kaschiert, ihre schlanken Beine aber »bis nuff« sehen lässt. Dazu ebenfalls pinkfarbene Pantöffelchen mit Lederriemchen und tailliertem Absatz.
Original Siebziger, denke ich.
»Original Siebziger«, sagt sie. »Passt mir noch.«
Sie mustert mich kritisch von oben bis unten.
»Ja, Mutter, ich mach wieder mehr Sport«, brumme ich, bevor sie mich mit den kleinen Fettpölsterchen um meine Hüften aufziehen kann. »Ich mach seit einiger Zeit Walking und geschtern hab ich a neue Jogginghos kauft.«
»Für dich?«, fragt sie und grinst.
»Ja, freilich für mich! Und nächscht Woch goht’s los.«
»Was?«
»Mein Spezialtraining für die Walking-Tour beim Bottwartal-Marathon.«
»Du? Beim Marathon? Ich lach mich kaputt!«, kreischt sie und bricht in helles Gelächter aus. »Do benn ich echt g’schbannt!«
Damit lässt Mutter das Thema zum Glück auf sich beruhen. Plötzlich fällt mir ein, dass die Kartoffeln noch immer vor meiner Haustür liegen, und ich springe auf.
Mutter hält mich am Arm zurück und zeigt auf den großen Wäschekorb mit den Gebäcktütchen. »Net vergässa!«
Wie könnt’ ich das vergessen …
»Bis heut Obend«, fügt sie hinzu und tätschelt mir die Wange. »Flieg net na mit dem schwera Korb.«
Danke für den Tipp!
Als ich ins Freie trete, kommt gerade Simon, unser siebzehnjähriges Nesthäkchen, aus unserem Haus. Anstatt mir den schweren Korb abzunehmen, gibt er mir den Rat, auf die verstreuten Kartoffeln auf dem Boden achtzugeben, und verschwindet ums Eck, bevor ich etwas erwidern kann. Auch nett.
Da mein Kofferraum noch vom größten Teil der Einkäufe belegt ist, jongliere ich Mutters riesigen Wäschekorb zunächst zu uns hinüber. Immer darauf bedacht, nicht auf eine Kartoffel zu treten. Wenigstens hat mein Sohn die Tür offen gelassen, und ich muss nicht nach dem Schlüssel kramen. Mit letzter Kraft stelle ich die Last an der Garderobe ab. Meine Kondition ist aktuell tatsächlich nicht optimal, merke ich und weiß, dass ich unbedingt was tun muss. Allerdings nicht jetzt. Jetzt müssen vor allem die Milchprodukte gerettet werden, die schon bedenklich lange ungekühlt im Auto liegen.
Ich stürme folglich wieder hinaus, und schneller als gedacht erreiche ich den Wagen, denn ich habe trotz aller gut gemeinter Warnungen eine Sekunde lang vergessen, dass der Weg dorthin mit Kartoffeln gepflastert ist. Ein falscher Schritt, mir zieht es die Beine weg, und wie auf einem Kugellager gleite ich mit dem Allerwertesten über die Erdäpfel in Richtung Auto. Gut, gleiten ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, eher hoppeln, und die eine oder andere Kartoffel wird unter meinem Gewicht zerquetscht. Na ja, ein bisschen Verlust gibt es immer, aber knapp zwanzig von den ursprünglich fünfundzwanzig Kilo kann ich nach meiner unsanften Landung schließlich noch retten.
Wegen meines geprellten Steißbeins werfe ich im Bad vorsichtshalber ein paar Arnica-Globuli ein und transportiere dann die restlichen Einkäufe in homöopathischen Portionen ins Haus. Dann verpacke ich Mutters Gebäck in kleinere Kartons und bringe sie ins Auto. Danach dusche ich ausgiebig, probiere zig Outfitvarianten an und mache es mir den restlichen Nachmittag mit einem Krimi auf dem Sofa bequem, bis der BMVÄ heimkommt. Ein Piccolo leistet mir dabei Gesellschaft. Da der gute Mann mehr Zeit benötigt als gedacht, gönne ich mir ein zweites Piccolöchen und hole eine Tüte des Hoffestgebäcks aus dem Wagen wieder herein. Beides ist leer, als der BMVÄ endlich eintrifft.
Dass ich mich für den Abend auf dem Weingut schön gemacht habe, bemerkt er gar nicht, denn er sprintet gleich nach oben ins Bad. Wenig später kommt er frisch geduscht in Jeans und in seinem Lieblingshemd herunter. Mein Lieblingshemd ist das allerdings nicht, aber ich sage lieber nichts. Stattdessen mahnt er mich zur Eile. Mich, die ich schon stundenlang auf ihn und unseren Aufbruch warte! Promilletechnisch wäre es klüger, zum Weinfest zu laufen, doch ich muss ja Mutters Ware transportieren, deshalb nehmen wir das Auto.
Der Aussiedlerhof liegt eingebettet zwischen den Weinberghängen des Höpfigheimer Königsbergs, die hinter dem Gehöft ansteigen, und Streuobstwiesen, die sich zu beiden Seiten des Zufahrtssträßchens ausbreiten. In den Siebzigerjahren hatte der Senior, Eugen Kraut, hier draußen neben Ackerbau noch eine kleine Schweinemast und eine Obstbrennerei betrieben, nachdem er aus der Ortsmitte ausgesiedelt war. Als sein Sohn Edmund den Krauthof übernahm, gestaltete der gelernte Weinbautechniker ihn zum Weingut um. Mit neuen Vermarktungsstrategien, zu denen unter anderem meine Weinbergführungen als Reblaus gehören, erschloss er sich gute Absatzmöglichkeiten und etablierte das Unternehmen im hart umkämpften Winzergewerbe. Das Wohnhaus wurde in den letzten Jahren modernisiert und in einem zweistöckigen Anbau sind nun zwei hübsche Ferienappartements untergebracht.
Im großen Hof zwischen Wohngebäude und neuer Wein-Lounge wurden für das heutige Fest lange Reihen von Biertischgarnituren aufgestellt, und als wir dort eintreffen, ist schon jede Menge los. Am mobilen Probierstand stehen erste Kunden Schlange, und Tom, unser Ältester, baut mit seinen Kumpels auf der improvisierten Bühne gerade die Anlage für die Band auf. Die örtliche Prominenz hat sich auf der Terrasse vor der Lounge an runden Tischen mit bequemen Stühlen niedergelassen. Das schöne Wetter, das uns schon seit Tagen mit Temperaturen weit über zwanzig Grad verwöhnt, hat die Luft aufgeheizt und erzeugt ein angenehmes Sommerfeeling, obwohl die ersten Septembertage schon hinter uns liegen.
Der BMVÄ hilft mir, die Gebäcktüten zum Stand der Sportvereinsjugend zu tragen. Der Verkauf soll Geld in die Kasse der neuen Tanzgruppe spülen, der sich unser Simon vor Kurzem angeschlossen hat. Leider lernen die keine Standardtänze, wie ich mir das erhofft habe, sondern Hip-Hop. Na ja, immer noch besser, als den ganzen Tag am Handy oder vor der Glotze zu hängen. Ich bin gespannt, wie viele der Tütchen während des Fests verkauft und wie viele davon die jugendlichen Helfer verputzen.
Simon greift auf alle Fälle gleich mal zu, kaum dass wir den Korb abgestellt haben. »Hey, Benni, mechsch mol probiera?«, wendet er sich an einen jungen Mann, der gerade an die Theke tritt.
Der kommt der Aufforderung gerne nach. »Mmh, leiwand!«, murmelt er kauend.
»Noi, kei Leinwand, Käsefüßla!«, erklärt Simon und schüttelt den Kopf.
Im Gegensatz zu meinem Sohn ist mir der Begriff »leiwand« für etwas Gutes geläufig. Ich erkundige mich deshalb bei Simons Bekanntem, ob er aus Österreich komme, und er nickt mit vollem Mund.
»Ich komme aus Telfs, das ist in der Nähe von Innsbruck«, erläutert er, nachdem er heruntergeschluckt hat.
»Und wie gefällt es Ihnen bei uns?«, mache ich ein bisschen Small Talk.
»Gut. Ich bin seit Anfang Juli hier auf dem Hof. Wir können uns aber gerne duzen, wie man es bei uns daheim macht. Ich bin der Benni.«
»Ich bin die Elvira und des isch dr BMVÄ«, stelle ich uns Nägeles vor.
Benni schaut irritiert vom BMVÄ zu mir und zurück.
»I benn dr Elvira ihr Ma«, hilft meine bessere Hälfte.
»Dr beschte Ma von älle, BMVÄ, verschdohsch?«, füge ich hinzu und lächle meinen Gatten an.
Dem scheint das ein bisschen peinlich zu sein.
»Machsch du hier Urlaub oder schaffsch du beim Öchsle?«, erkundigt sich der BMVÄ schnell, um von sich abzulenken.
»Er meint den Edmund«, erkläre ich schnell, damit der Benni weiß, wer mit Öchsle gemeint ist. »Des leitet sich von der Maßeinheit ab, mit dem der Zuckergehalt in den Trauben gemessen wird, und weil der Edmund …«
»… schon immer gern Wein trinkt, nennt man ihn Öchsle«, unterbricht mich Simon und schaut mich genervt an. »Der Benni weiß des schon, Mutter! Und Vatter: Ja, er schafft beim Öchsle.«
»Ja, ich schaff beim Öchsle«, wiederholt Benni und grinst. »Und über die Weinlese bleib ich auf alle Fälle. Am 1. Oktober fängt allerdings mein Studium in Stuttgart an. Dann kommt es darauf an, ob ich hier wohnen bleibe.«
»Uff was kommt’s a? Uff die Mietpreise in Stuttgart?«
»Auch.«
»Uff was no?«, hake ich nach, weil es mich halt interessiert, ungeachtet dessen, dass der BMVÄ mich mit dem Ellbogen in die Seite stupst.
»Na ja, man wird sehen, wie sich die Dinge hier entwickeln«, antwortet Benni ausweichend. »Ich muss! Man sieht sich.« Er zeigt mit einer großen Geste über den Hof zum Weinprobierstand und geht mit schnellen Schritten hinüber.
Da Simon inzwischen in sein erstes Verkaufsgespräch mit einer älteren Dame verwickelt ist, ziehe ich mit dem BMVÄ weiter, um nach einem Sitzplatz zu suchen. Gerne hätte ich mich auf einem der bequemen Stühle auf der Terrasse niedergelassen, aber die High Society hat sie allesamt in Beschlag genommen. Also suchen wir die langen Reihen der Biertische ab.
»Huhu!«, höre ich einen schrillen Ruf, den ich zunächst übergehe, weil ich die Quelle sofort erkenne. »Huhu, Elvira! Bei ons gibt’s Platz«, beharrt die bekannte Stimme, begleitet von wild fuchtelnden Armen, und der BMVÄ und ich können das Signal nicht mehr ignorieren, weil der halbe Hof schon zu uns herüberschaut.
»Ja, Mutter, isch gut, mir kommed jo scho.«
Begeistert bin ich nicht, dass wir bei den Senioren sitzen sollen, allerdings muss das ja nicht den gesamten Abend so bleiben.
Ungefragt werde ich zwischen meiner Mutter und ihrer Freundin Martha auf die Bank gedrückt und komme mir wieder vor wie ein Kind. Dem BMVÄ wird am anderen Tischende sein Platz neben Vater zugewiesen. Er grinst zu mir herüber und ich verdrehe die Augen. Dann will Mutter die Essensbestellung für mich aufgeben, ohne sich vorher nach meinen Wünschen zu erkundigen, aber ich lege ein entschiedenes Veto ein.
»Nein, Mutter, ich will keine Pommes mit Ketchup und ein Fanta! Ich möcht einen gegrillten Bauch mit Kartoffelsalat und a Viertele Riesling!«
»Von mir aus!« Sie dreht sich weg, richtet das Wort an Martha und lässt mich beleidigt links liegen.
Auch gut. Dadurch habe ich Zeit, die anderen Gäste zu beobachten, und merke, dass ich strategisch sogar ziemlich günstig sitze. Nahe am Weinprobierstand, mit gutem Blick auf die Terrasse vor der Lounge, denn falls dort ein Platz frei werden sollte, kann ich gleich rüber spurten. Und zu den Toiletten ist es ebenfalls nicht weit. Von meinem Standort aus kann ich zudem gut im Auge behalten, wer kommt, wer geht, wer mit wem spricht, wer wie oft an den Stand oder aufs Klo geht. Ich kriege mit, wer sich hübsch gemacht oder sogar aufgebrezelt hat.
Von meinem Kontrollpunkt sehe ich sofort meine Freundinnen Waltraud und Erika, als sie auf dem Hof eintreffen. Waltraud, die Apothekerin, ist in wallende Bioware gehüllt, um die gut zwanzig Kilo Übergewicht zu kaschieren, die sie sich im Laufe der Jahre mit Agar-Agar-Gummibärchen und Dinkelschrot-Brezelchen angefuttert hat. Ihre lockigen Haare sind frisch gefärbt, das erkenne ich sofort. Erika, ihres Zeichens Friseurmeisterin, hat diesmal wohl einen Hauch Kastanie einfließen lassen, denn in der Sonne schimmern Waltrauds Strähnen leicht rötlich. Schön eigentlich. Ja, Erika hat’s drauf. Bei anderen. Sie selbst trägt aktuell eine asymmetrische Kurzhaarfrisur. Die eine Seite abrasiert und blondiert, auf der anderen Seite prangt ein pinkfarbener, stufig geschnittener Pony. Ich rümpfe unwillkürlich die Nase. Wem’s g’fällt! Im Grunde einerlei, denn aus beruflichen Gründen wechselt Erika die Frisuren sowieso wie ich meine Krimilektüre. Auf alle Fälle ist sie wie immer schick angezogen. Heute trägt sie ein eng anliegendes Kleid mit großem Blumenmuster. Das modelliert nicht nur ihren Hintern, sondern auch ihren Riesenbusen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie man zu so einer Oberweite kommen kann. Ohne Silikoneinlagen oder Brustvergrößerung, wohlgemerkt.
Die Mädels schauen sich suchend um, und jetzt bin ich diejenige, die am Seniorentisch wedelt, um die beiden auf mich aufmerksam zu machen. Da sie mich jedoch nicht bemerken, stehe ich auf und möchte gerade ein Bein über die Bierbank heben, als mich eine Hand unsanft nach unten zieht.
»Z’erscht wird gässa! Du kannsch nachher zu deine Freundinna.«
Dreimal darf man raten, wer das war.
Ich setze gerade zu einer saftigen Tirade an, da kommt die Bedienung, klemmt sich zwischen Mutter und mich und stellt mein Essen und das Viertele vor mir auf den Tisch. Ohne Worte nehme ich wieder Platz, muss jedoch ein paarmal tief durchatmen, bevor ich mich um Speis und Trank kümmern kann.
»Die Mädla laufet net weg«, sagt Mutter und beißt herzhaft in ihre Rote Wurst.
Schnell schiebe ich eine große Gabel voll Kartoffelsalat in den Mund, um nicht ausfällig zu werden. Genervt schaue ich zum anderen Ende der langen Tafel und sehe, dass der BMVÄ inzwischen mit Maultaschen in der Brühe und einem Viertele Rotwein versorgt ist. Simon hat am Gebäckstand schon wieder eins von Mutters Käsefüßchen im Mund und Tom entdecke ich mit einem Leberwurstbrot am Weinprobierstand. So weit, so gut. Alle meine Lieben sind erst mal versorgt. Wobei Leonie, unsere Tochter, fehlt. Die ist gerade mit ihrem Freund Jonas während eines Auslandssemesters in London und versäumt den jährlichen Pflichttermin auf dem Krauthof.
Eine Stunde später sind nahezu alle Plätze im Hof und auf der Terrasse besetzt. Sogar in der großen Scheune, die der Öchsle zu einem schönen Veranstaltungsraum ausgebaut hat und die in regelmäßigen Abständen als Besenwirtschaft dient, kann man nur wenige Lücken ausmachen und um den Weinprobierstand hat sich mittlerweile eine Menschentraube gebildet.
Ich durfte mit Mutters Segen inzwischen meinen Sitzplatz verlassen und stehe mit Waltraud und Erika an der Bar, die in der Lounge eingerichtet wurde. Wir schlürfen Aperol Spritz aus dicken Strohhalmen, während wir tratschen. Erika gibt Benni, der aktuell an der Bar aushilft, ein Zeichen für eine weitere Runde.
»Sofort!«, ruft der herüber. »Wir sind gerade ein bisschen knapp an Personal.«
Das liegt unter anderem an Edmunds Frau Senta – oder Checky, wie sie von allen genannt wird, weil sie immer alles checkt, vor allem im Internet. Statt zu arbeiten, hält sie hier und da ein Schwätzchen und flirtet mit den jungen Männern. Aufgetakelt flaniert sie auf dem Hof herum, als wäre sie Kandidatin bei Germany’s Next Topmodel. Das regt uns richtig auf.
»Mit em Schaffa hat’s die net!«, murmelt Erika.
»Der Öchsle tut mir leid.« Waltraud zieht eine Grimasse. »Dem hätte ich eine nettere Frau gegönnt. Doch woher nehmen und nicht stehlen, gell?« Sie grinst.
Ich beobachte Checky, wie sie sich gerade von ihrem Gatten am Probierstand ein Glas Weißwein einschenken lässt. Der faucht sie böse an und zeigt auf die Menschenschlange, die sich gebildet hat. Aber Checky verzieht nur das Gesicht und stolziert mit ihrem Gläschen weiter.
»Schad, dass des mit der Lissy net klappt hat«, knurre ich.
Die Mädels nicken zustimmend.
Und jetzt muss man wissen, dass die Lissy mein Bäsle ist. Also meine Cousine. Cousine zweiten Grades, um genau zu sein. Also die Nichte von meinem Großonkel Albert seiner zweiten Frau ihrer Tante. Oder so. Auf alle Fälle ist die Lissy die geschiedene Frau vom Öchsle und die Mutter seines Sohns David. Die hätte so gut auf den Hof gepasst, aber da kam ein anderer dazwischen. Dann war der Öchsle wieder solo, aber in einen Betrieb wie den Krauthof gehört halt eine Frau und da haben Öchsles Kumpels ihn mit der Checky verkuppelt, die damals ebenfalls gerade solo war. Achtung: solo, mit Kind und zu allem Überfluss auch noch eine Hochdeutsche.
Die Checky schlendert mittlerweile mit ihrem Gläschen von Tisch zu Tisch, von der Terrasse in die Besenscheune, vom Weinprobierstand in die Lounge und lässt sich als gut gelaunte Festwirtin feiern. Sie schäkert rum, aber schaffen tut die nix. Gar nix.
Und da wir Öchsles Angetraute genau beobachten, merken wir sofort, als ihre Stimmung von einer Sekunde auf die andere kippt, und zwar als die Lissy mit ihrem neuen Mann Frank und mit David auf den Hof kommt. Der Festwirtin fällt nicht nur fast das Weinglas aus der Hand, sondern auch das Kinn herunter, und wie von der Tarantel gestochen verschwindet sie im Wohnhaus. Der Öchsle hingegen freut sich über den Besuch, und er und seine Exfrau nehmen sich sogar in den Arm, bevor sich Lissy und ihr Frank am Weinprobierstand anstellen.
»Au, au, wenn des die Checky sieht!« Erika verzieht das Gesicht. »Ich sag’s euch, wo die Liebe hinfällt …!«, fügt sie verschwörerisch hinzu.
Waltraud und ich erkennen an ihrem Tonfall, dass da noch eine Geschichte auf uns wartet, und beugen uns verschwörerisch zu Erika rüber. Die erklärt daraufhin, dass sie ja vor Kurzem wegen ihrer Rückenprobleme zur Reha in Bad Urach war. Klar, die muss als Friseuse … äh … Friseurmeisterin den ganzen Tag stehen. Immer gerne auf High Heels, um die männlichen Kunden zu beeindrucken. Dabei wundere ich mich, welcher Mann sich für Schuhe interessiert, wenn er im Friseurstuhl einen Atombusen im Nacken spürt. Genützt haben ihr weder die waffenscheinverdächtigen Schuhe noch ihre tiefen Ausschnitte. Die Erika ist nach wie vor ledig … Auf alle Fälle berichtet sie uns jetzt, dass sie es sich in den Thermalquellen in Bad Urach gut gehen hat lassen. Und dort hat sie doch tatsächlich die Rosi entdeckt, die Roswitha Leibinger, Frau vom Bankchef bei uns am Ort, dem Jürgen Leibinger.
»Aber die hat mich nicht g’säh. Und wissed ihr, warum nicht?«
Erika schaut uns herausfordernd an, doch Waltraud und ich kennen die Antwort natürlich nicht und ziehen nur ratlos die Schultern nach oben.
»Die hatte bloß Auga für ihren Kurschatta!«, flüstert sie uns zu.
»Ach was? Erzähl!«
Waltraud und ich platzen vor Neugier. Erika lässt uns eine Weile zappeln, doch nachdem wir ihr einen weiteren Aperol in Aussicht gestellt haben, erfahren wir, dass sie die Rosi quasi undercover beobachtet hat. Und die Ermittlungsergebnisse waren eindeutig. Die Gattin vom Bankchef hat eine Affäre! Erika legt uns sogar Beweisfotos auf ihrem Handy vor, auf denen Rosi und ein attraktiver Mann in einem Café abgelichtet sind. Gegenseitig füttern sie sich mit Schwarzwälder Kirschtorte. Auf einem anderen Bild gehen sie Hand in Hand durch das Städtchen spazieren. Sogar bis ins Kino ist Erika den beiden gefolgt.
»Wenn des ihr Jürgen wüsst …!« Erika steckt das Telefon wieder ein und nimmt einen großen Schluck von ihrem Aperol. Abrupt setzt sie das Glas wieder ab und reißt die Augen auf. »Des gibt’s doch net!«
Waltraud und ich folgen ihrem Blick über den Hof, sehen jedoch nur das Menschengewimmel, das vorhin schon geherrscht hat. Bevor wir fragen können, was los ist, eilt Erika geduckt zum Weinprobierstand hinüber und taucht dahinter ab. Versteckt die sich etwa? Dann sehen wir, wie ihr Riesenbusen hinter der Holzfassade der Theke hervorlugt. Also, wenn sie unentdeckt bleiben will, ist das der falsche Weg! Allmählich schiebt sich auch der Rest von Erika um die Ecke, und wir vermuten, dass sie die Männer observiert, die in der Schlange stehen. Waltraud und ich sind etwas ratlos und beschließen, zu unserer Freundin rüberzugehen, jedoch nicht, ohne vorher unsere Gläser zu leeren. Waltraud kümmert sich gleich noch um Erikas Aperol. Nachdem wir zu unserer Freundin gestoßen sind, stellt die uns dicht nebeneinander vor sich auf, um uns offensichtlich als Sichtschutz zu nutzen.
Mit gesenktem Kopf und vorgehaltener Hand raunt sie uns etwas zu. Da wir sie nicht verstehen, beugen wir uns zu ihr hinunter, bis sich unsere Köpfe berühren.
»Des isch er!«, hören wir jetzt zwar, können mit dieser Information aber nichts anfangen.
Gleichzeitig merken wir, dass wir wohl für die umstehenden Gäste ein seltsames Bild abgeben, so mit Kopf nach unten und dem Hintern in der Luft. Deshalb richten wir uns schnell auf und blicken rundum in amüsierte Gesichter. Eins gehört meinem BMVÄ.
»Mause, was machet ihr denn?«, fragt er und kugelt sich vor Lachen.
Offenbar liegt sein Alkoholspiegel nicht mehr bei null, sonst würde er in der Öffentlichkeit nicht meinen Kosenamen benutzen. Da haben wir eine feste Abmachung. Das darf er nur, wenn wir unter uns sind. Und ja, früher hat er mich sogar »Mäusle« genannt. Aber das Tierchen ist mittlerweile ausgewachsen.
»Gymnastik, siehsch doch!«, entgegne ich gereizt. »Ond du?«
»I hab glei Dienst am Grill. Mr sieht sich!«, erwidert er grinsend und schlendert mit einem Gläschen Rotwein in der Hand in Richtung Essensausgabe.
Ich wende mich wieder Erika zu, die sich nach wie vor hinter uns in Deckung hält.
»Des isch er«, flüstert sie noch mal.
»Wer isch was?«, zische ich.
»Der dort, wo beim Öchsle grad zahlt, in der enga Jeans und dem hellgrüna T-Shirt.«
»Was ist mit dem?« Waltraud flüstert auch.
»Des isch er.«
»Mensch, Erika, des isch wer?!«
»Der Kurschatta!«
»Von dr Rosi?«
»Noi, meiner!«
»Echt jetzt?«
Erika rollt mit den Augen. »Natürlich nicht meiner! Der Rosi ihrer. Grad mach ich’s Maul zu!«
Waltraud und ich sehen uns den Kerl an. Von einem Schatten kann gar keine Rede sein! Groß gewachsen, schlank. Sein T-Shirt spannt über muskulösen Oberarmen. Grau melierte Haare, gebräunte Haut. Mitte fünfzig.
»Wow!« Waltraud hat sich als Erste gefangen. »Ein Bild von einem Mann. Aber warum muss denn so ein Adonis zur Kur?«
»Heiratsschwindler!«, höre ich Erika murmeln.
Den Blick kann ich ihr nicht zuwenden, der hängt immer noch am knackigen Hintern des Kurschattens. Doch ich merke an ihrem Tonfall, dass es eher der Neid auf Rosi ist, der aus ihr spricht und weniger das Wissen um eine gut begründete Tatsache.
Wir starren noch eine Weile zu Mister Universum hinüber, da taucht plötzlich auch die Rosi auf. Mit federnden Schritten kommt sie von der Terrasse zum Stand herüber. Ihr Gang lässt keine Beschwerden erkennen, die eine Kur notwendig machen würden. Sie ist schlank und sieht sehr gut aus, das muss ihr unser Neid lassen. Zu ihrer fliederfarbenen Edeljogginghose mit Gummizügen an Bund und Knöcheln trägt sie weiße Sneaker und einen ebenfalls weißen Hoodie. Der Kurschatten entdeckt sie gleich und winkt ihr zu. Kurz schaut Rosi zurück zur Terrasse, wo ihr Jürgen mit zwei Kumpels und deren Frauen an einem großen runden Tisch sitzt. Rosi registriert, dass ihr Mann sie wachsam im Blick behält, deshalb erwidert sie die Begrüßung von ihrem Kurschatten nicht, sondern geht stattdessen mit einem leichten Kopfnicken, aber lächelnd an ihm vorbei und bestellt bei Öchsle ein Gläschen Sauvignon. Mister Universum tritt neben sie und entscheidet sich für ein Glas Lemberger. Wie zufällig stehen sie nebeneinander und wechseln ein paar Worte.
Von Weitem wirkt das völlig unverfänglich, wir Insiderinnen wissen allerdings sofort Bescheid, was läuft. Wir stehen strategisch derart geschickt, dass wir alles beobachten und mithören können, ohne dass Rosi auf uns aufmerksam wird.
»Hallo, Achim, schön, dass du da bisch«, flötet sie.
»Achim heißt er«, erklärt Waltraud unnötigerweise.
»Hallo, meine Schöne, wie könnte ich deine Einladung ausschlagen.«
»Ein Hochdeutscher!«, wispert Erika.
»Ja, ein hochdeutscher, schmalzender Achim«, zische ich genervt zurück. »Senn doch mol ruhig!«
»Da drüben sitzt mein Mann, der im hellblauen Hemd«, erklärt Rosi ihrem Kurschatten. »Wir müssen vorsichtig sein.«
»Alles klar. Aber ein bisschen reden und auf einen schönen Abend anstoßen, wird schon drin sein, oder?«
Die Rosi nickt, und beide nehmen ihre Bestellung vom Öchsle entgegen und lassen die Gläser klirren.
»Schön hier, gell?«, säuselt Rosi, nachdem sie einen Schluck genommen hat.
»Ja, aber das Schönste bist du.« Der Achim lächelt, schaut seine Angebetete dabei jedoch nicht an, um ihrem Mann keinen Grund zum Misstrauen zu geben.
Rosis Wangen verfärben sich rosig und sie senkt schnell den Blick. Dann trinken beide einen Schluck aus ihrem Glas. Sie tauschen weiter kleine Komplimente aus und dazwischen lässt die Rosi das eine oder andere Wort über das Weingut fallen und untermalt ihre Worte mit entsprechenden deutlichen Gesten. Die ist gewieft. Auf diese Weise kann sie ihrem Gatten nachher weismachen, dass der Schmalz-Achim sich nach dem Krauthof erkundigt hat.Wir jedoch bemerken, dass sich die beiden immer wieder wie zufällig berühren, und einmal greift ihr der Achim ganz schnell an den Po. Das hab ich genau gesehen!
Damit wir noch eine Weile observieren können, ohne aufzufallen, wollen wir Mädels uns auch Wein bestellen, allerdings kommt unser Entschluss zu spät, denn gerade sind die Fußballer eingetroffen. Nach ihrem extra für heute anberaumtem Sondertraining laufen sie geschlossen auf dem Hoffest auf. Zwei Dutzend durstige Männer müssen abgefertigt werden, und der Öchsle kommt ordentlich ins Schwitzen.
Den beiden Turteltauben wird es am Stand zu turbulent, deshalb schlendern sie zur Besenscheune hinüber, und Rosis Handbewegungen erwecken den Eindruck, als würde sie ein architektonisches Highlight erklären. Uns allerdings kann sie nicht täuschen! Und schon verschwindet das Pärchen im Gebäude. Aber nicht nur meine Mädels und ich vermuten, dass die Touristennummer eine Finte ist, auch dem Jürgen schwant etwas. Rasch steht er auf, eilt seiner Frau hinterher und betritt ebenfalls die Scheune. Kurz überlegen wir, ob wir ihnen folgen sollen. Aber wir haben genug mitgekriegt, was da läuft. Und letztlich ist das ein Problem zwischen der Rosi und ihrem Mann.
Wir starten also noch mal einen Versuch, ein Gläschen Wein zu ergattern, und haben Glück, denn die meisten Fußballer sind bereits versorgt, weil Lissy jetzt gemeinsam mit dem Öchsle tatkräftig den Weinprobierstand betreibt.
»Wo isch denn die Checky?«, frag ich sie, doch die Lissy winkt nur ab.
Während sie uns einschenkt, bemerke ich, wie nah der Öchsle bei meinem Bäsle steht und sie von der Seite anlächelt. Fast vergisst er, dass Kundschaft wartet.
»Armer Kerl«, flüstert mir Waltraud ins Ohr. »Hoffentlich ist der Frank nicht eifersüchtig, sonst gibt’s heut noch mal einen Streit.« Sie deutet mit dem Kopf zuerst auf den Weingutbesitzer, danach auf die Scheune.
Kaum lassen wir uns den ausgezeichneten Riesling schmecken, kommt Benni von der Lounge herüber. »Hi, Chef, der David und der Frank helfen drüben an der Bar. Das geht sich gut aus. Ich hol mir eine Jause und füll dann die Vorräte auf.«
Der junge Mann genießt seine kleine Verschnaufpause und setzt sich mit einem Teller Pommes und einer Cola auf die Bühnenkante. Er unterhält sich mit den Musikern, die die letzten Kabel ziehen und ihre Instrumente vorbereiten. Währenddessen wandert sein Blick auffallend oft zur Terrasse, wo sich die Hautevolee des Orts an einem großen Tisch versammelt hat. Dorthin kehrt auch der Jürgen gerade zurück. Seine Rosi zieht er ruppig an der Hand hinter sich her. Während in der illustren Runde Hochstimmung herrscht, knirscht es bei den beiden gewaltig. Das kann man auf hundert Meter erkennen, unter anderem, weil der Herr Bankchef leicht derangiert aussieht.
Ich kombiniere blitzschnell und fordere die Mädels auf, mir in die Besenscheune zu folgen, um mal nach dem Kurschatten zu schauen. Als wir gerade die Tür öffnen wollen, tritt er ins Freie und rauscht über den Hof zur Einfahrt. Hinter ihm erscheint zu meiner großen Überraschung der Kälble, unser Ortspolizist, und der verfolgt den Abgang mit Argusaugen.
»Der hat es eilig.« Waltraud grinst uns an.
Der schöne Schmalz-Achim läuft direkt an uns vorbei, deshalb sehen wir, dass sein T-Shirt am Kragen aufgerissen und seine Wange unterhalb des linken Auges rot angelaufen ist.
»Au, au, do hat’s Hieb gäbba!«, nuschle ich in mein Weingläschen und die Mädels nicken.
Mein Blick schweift zum Tisch der Steinheimer High Society hinüber. Der Jürgen fixiert die Rosi so scharf, dass die sich nicht traut, ihrem Lover hinterherzuschauen. Die anderen vier haben die Köpfe zusammengesteckt, tuscheln und grinsen.
»Tisch!«, reißt mich Waltrauds Schrei plötzlich aus den Gedanken.
Am Nebentisch der Leibingers und Konsorten sind zwei ältere Ehepaare im Begriff zu gehen. Fasziniert beobachte ich, wie Waltraud den Turbo zündet und ihre gut 125 Kilo Lebendgewicht von einer Sekunde auf die andere beschleunigt, als sie unsere Chance wittert. Ich renne ebenfalls los und zerre Erika, die sich von Lissy gerade noch ein Gläschen Wein einschenken lassen wollte, hinter mir her. Auch andere Gäste haben den frei werdenden Tisch entdeckt, aber Waltraud umklammert bereits die Lehne eines Gartenstuhls und baut sich zu ihrer vollen Größe auf. Grimmig sieht sie die Konkurrenten an. Ich hechte auf den zweiten Stuhl und lege die Beine auf den dritten. Erika wirft schon von Weitem ihr Jeans-Jäckchen auf den letzten freien Platz. Damit gehört der Tisch uns!
Dass wir endlich gemütlich sitzen können, freut uns ebenso sehr wie die Tatsache, dass unser neuer Standort strategisch äußerst günstig liegt. Denn jetzt übersehen wir das Fest nicht nur von höherer Warte, sondern hören zudem zwangs- und beiläufig, was die feinen Leute am Nebentisch besprechen.
Wobei, nicht alle am Tisch erweisen sich als gesprächig. Zwischen Rosi und ihrem Mann herrscht seit einer Weile eisiges Schweigen. Aber seine Busenfreunde unterhalten sich lautstark über die bevorstehenden Kommunalwahlen. Rolf Weller, seines Zeichens der Metzgermeister, bei dem ich heute die Wurstdosen stapelweise gekauft habe, untermauert seine Absicht, Stimmenkönig und damit Vizeschultes zu werden. An den Fingern zählt er, vom Weingenuss schon leicht lispelnd, die Punkte auf, die seiner Meinung nach für ihn sprechen: Er ist bereits seit zig Jahren Mitglied im Gemeinderat, er führt am Ort eine gut gehende Metzgerei, er sponsert die örtlichen Vereine. Mit dem vierten Finger kommt seine Auflistung allerdings ins Stocken. Das könnte daran liegen, dass er keine weiteren Verdienste um seinen Heimatort aufweisen kann, oder er kann nicht über drei hinauszählen.
»Vereine!« Der Stuckateurmeister Matthias Ranzer, genannt Gips, greift den letzten Punkt seines Kumpels auf. »Das ischt das Stichwort. Do zähl ich meinerseits auf deine Unterstützung bei der Vorstandswahl vom Sportverein. Diesmol will ich den Poschta! Do kannsch du deine Kundschaft gern a bissle … einstimmen. Und wenn des klappt und ich Vorstand bin, mach i bei meinen Kunden Wahlkampf für dich.«
So läuft das also. Eine Hand wäscht die andere, nicht nur in der großen Politik, nein, auch in unserem kleinen Kaff. Die Herren der lokalen High Society versammeln in ihren Betrieben genug Kundschaft, um bei der Meinungsbildung im Ort ein entscheidendes Wörtchen mitzureden. Die beiden Kumpane lachen auf, klatschen sich ab und beschließen, ihren Deal an der Bar mit etwas Hochprozentigem zu besiegeln.
»Gohsch mit?«, fragt der Rolf noch den Jürgen, allerdings mehr pro forma.
Denn dass dem Dritten im Bunde die Lust auf einen feuchtfröhlichen Abend vergangen ist, erkennt man schon von Weitem. Der gehörnte Ehemann winkt deshalb ab, packt die Rosi wieder am Handgelenk und zieht sie Richtung Parkplatz davon.
Kopfschüttelnd schauen wir dem Bankchef und seiner Holden hinterher, bevor die Conny und die Mäggi ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken. Beide Frauen haben bislang schweigend am Tisch gesessen und den Ausführungen ihrer Männer gelauscht. Wobei, die Conny gehört ja nur noch so halb zum Gips.
»Der immer, mit seim Vizeschultes, als ob’s nix Wichtigeres gäb im Läba«, hören wir Mäggi Weller über ihren Gatten sagen. Sie beschwert sich, dass sie den Laden schmeißen muss, damit der Herr Metzgermeister im Rampenlicht stehen kann.
»Selber schuld, Mäggi! Lass dir doch net älles g’falla!«, erwidert Conny. »Setz dich doch amol durch!«
»Des sagt sich so leicht«, entgegnet die Metzgersfrau und winkt ab.
»So mutig wie die Conny sind halt nicht alle«, raunt mir Waltraud zu.
Ja, die Constanze Weckerle ist schon eine Art Kolibri bei uns am Ort, da sind wir Mädels uns einig. Die junge Frau hatte früh erkannt, dass ihr der zehn Jahre ältere Matthias Ranzer einiges bieten konnte. Der Juniorchef des am Ort etablierten Stuckateurbetriebs fuhr ein Porsche-Cabrio und sein Geldbeutel war immer gut gefüllt. Das fand Conny recht anziehend. Sein gutes Aussehen und dass er gut tanzen konnte, kamen als netter Bonus obendrauf. Dass der Gips in Bezug auf das weibliche Geschlecht jedoch grundsätzlich kein Kostverächter war, erkannte sie auch. Doch irgendwie schaffte sie es, ihn mit ihren eigenen Reizen zu überzeugen, sodass Gips sie Hals über Kopf heiratete. Mit gerade einmal achtzehn Jahren wurde Constanze Weckerle-Ranzer die Juniorchefin des florierenden Betriebs und nach dem Tod des Schwiegervaters, der zwölf Jahre vergeblich auf einen Enkelsohn gewartet hat, ist sie zur Gesellschafterin und Chefin der Profi-Stuck-Ranzer GmbH aufgestiegen.
Hinter der Fassade allerdings bröckelt es. Denn Gips’ Mitgliedschaften im Tennisklub, bei der Freiwilligen Feuerwehr und beim lokalen Sportverein und nicht zuletzt die Auszeiten, die er sich mit seinen Kumpels gönnt, brachten ihm seit jeher neben geschäftlichen auch einige amouröse Beziehungen ein, die Conny nicht verborgen geblieben waren. Irgendwann wusste nicht nur sie, sondern jeder im Ort, dass Matthias Ranzer kein Kostverächter war. Im Laufe der Zeit begann Conny, sich selbst Freiheiten herauszunehmen. Auf spontanen Wellness- und Schönheitswochenenden oder Shoppingtrips nach Hamburg, London und L. A. verwöhnt sie sich nicht nur mit kosmetischen Veränderungen, extravaganten Frisuren und stylischen Outfits, sondern auch mit dem einen oder anderen Liebhaber. In einem hübsch renovierten Fachwerkgebäude am Marktplatz, einer von mehreren Immobilien, die sich die Ranzers im Laufe der Jahrzehnte unter den Nagel gerissen haben, hat sie sich zudem einen kleinen Laden eingerichtet, als ein nettes Hobby. An drei Tagen in der Woche verkauft sie in »Connys Glamour« Dekoartikel, Postkarten und anderen Schnickschnack. Waltraud vermutet ja, dass das Geschäft nur als Abschreibungsobjekt dient, denn von ihrer Apotheke aus, die genau gegenüber liegt, kann sie gut beobachten, wer bei Conny ein- und ausgeht. Und Waltraud ist sich sicher, dass der Umsatz an Prosecco, den die Stuckateursgattin mit ihren Freundinnen Rosi und Checky generiert, weit über dem der Dekoartikel liegt …
»Wenn er no net so viel trenka dät!«, reißen mich Mäggis klagende Worte aus meinen Gedanken. »Des merket sicherlich au schon die Kunda!«
Die Conny verdreht die Augen und steht genervt auf. Offenbar möchte sie den restlichen Abend nicht damit verbringen, sich Mäggis Nörgeleien anzuhören. Umso mehr, weil die konservative Metzgersfrau nicht zu ihren Freundinnen zählt.
»Tschau!«, ruft sie Mäggi kurz zu und schlendert zum Weinprobierstand, wo sie mit großem Hallo von einigen Männern der Freiwilligen Feuerwehr empfangen wird.
Die zurückgelassene Mäggi setzt sich aufrecht in ihren Stuhl und versucht zu lächeln, damit ja niemand registriert, dass sie sich wie das fünfte Rad am Wagen fühlt. Waltraud, Erika und ich merken es sehr wohl. Wir überlegen, ob wir sie an unseren Tisch einladen sollen, damit sie nicht einsam herumsitzen muss, doch in dem Moment steht sie auf, nickt uns zu, geht eilends über den Hof und macht sich allein auf den Heimweg.
»Elvira, darf ich bitten?«
Unvermittelt steht der Kälble bei uns am Tisch. Er schaut mich an. Ich schau ihn an. Er trägt keine Uniform, ist demnach nicht im Dienst. Dennoch steckt seine verspiegelte Ray-Ban-Sonnenbrillenkopie im gegelten Blondhaar, wie immer, wenn er Streife fährt und lässig einen Arm ins offene Fenster legt. Zur engen schwarzen Jeanshose trägt er heute ein tailliertes geblümtes Hemd. Die obersten Knöpfe sind geöffnet. Vor der haarlosen Brust baumelt eine dicke Panzerkette. Im Vergleich zu dem, was man sonst von ihm gewohnt ist, sieht er heute fast passabel aus. Aber halt nur fast.
Ich lehne seine Aufforderung zum Tanz mit einem entschiedenen Hinweis auf eine Fußverletzung dankend ab.
Enttäuscht wandern seine Augen kurz zu Waltraud und rücken dann schnell weiter zu Erika, vor der er sich verbeugt. »Darf ich bitten?«
Sie zögert und sieht mich hilflos an, ich allerdings grinse stumm.
»Du, Kälble …«, setzt sie an. Doch bevor sie ihm einen Korb geben kann, zieht der eine Medaille aus der Hosentasche und hält sie Erika vor die Nase. »Erster Platz beim Swing-Turnier des TC Ludwigsburg …«, liest sie vor.