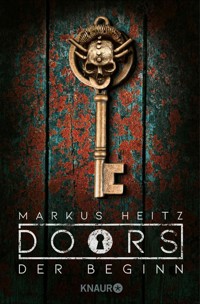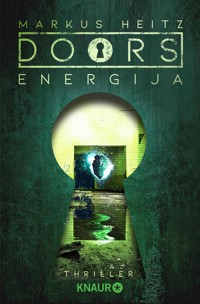
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Doors-Serie Staffel 2
- Sprache: Deutsch
"DOORS" - das neue Buchkonzept von SPIEGEL-Bestseller-Autor Markus Heitz geht in die zweite Runde! Auch in der zweiten Staffel wirst du wieder vor die Wahl gestellt: Am Ende der kurzen Pilotfolge "Drei Sekunden" bieten sich dir drei Möglichkeiten, dich zu entscheiden: drei Bücher, drei alternative Geschichten – welche Wahl wirst du treffen? Du hast dich für "DOORS – ENERGIJA" entschieden? Dann begleite die junge Russin Milana, die versucht, den rätselhaften Tod ihres Vaters aufzuklären, und bald selbst in tödliche Gefahr gerät: Als Milanas Vater bei einer Explosion in einem experimentellen Fusionsreaktor ums Leben kommt, stellt sie auf eigene Faust Nachforschungen an. Der Wissenschaftler hat Aufzeichnungen zu einem seltsamen Stein versteckt, der aus Splittern eines unbekannten Metalls zusammengefügt werden soll. Um das Rätsel seines Todes zu lösen, müsse Milana durch eine besondere Tür. Weswegen und wo befindet sie sich? Aber der internationale Konzern, für den ihr Vater arbeitete, unternimmt alles, um das Geheimnis der Splitter zu bewahren. Schon ist die junge Russin in größter Gefahr, bei der ihr ein Hacker namens Nótt plötzlich beisteht. Wer ist die Person? Wohin führt die Tür - und was lauert dahinter? Milana ist entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen… Bisher erschienen: DOORS - Staffel 1 DOORS - Der Beginn DOORS ! - Blutfeld DOORS X - Dämmerung DOORS ? - Kolonie DOORS - Staffel 2 DOORS - Drei Sekunden DOORS - ENERGIJA DOORS - WÄCHTER DOORS - VORSEHUNG
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Markus Heitz
DOORSENERGIJA
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als Milanas Vater bei einer Explosion in einem experimentellen Reaktor ums Leben kommt, stellt sie auf eigene Faust Nachforschungen an. Der Wissenschaftler hat Aufzeichnungen zu einem rätselhaften Stein versteckt, der aus Splittern eines unbekannten Metalls zusammengefügt werden soll. Eine übermächtige Energie scheint durch ihre Fusion frei zu werden, und ein internationaler Konzern möchte sich genau dies zunutze machen. Schon ist die junge Russin in größter Gefahr, in der ihr ein Hacker namens Nótt zur Seite steht. Und der führt sie zu einer geheimnisvollen Tür …
Inhaltsübersicht
Intro
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Nachklang
Wenn Sie erfahren wollen, welche tödliche Entdeckung die Hackerin Suna Levent macht, lesen Sie von Beginn an.Wenn Sie den Professor Sergej Nikitin warnen wollen, beginnen Sie bei Kapitel 1.
Intro
Deutschland, Frankfurt am Main, Spätsommer
Der Vorteil an der Frankfurter Freßgass war, dass sich niemand über Menschen in einem Café wunderte, die zwei Smartphones, einen Tabletcomputer und einen Laptop auf dem Tischchen deponierten. Im Schatten der Banktürme gehörte es zum Alltagsbild.
Auch die Bluetooth-Sprecheinrichtung im rechten Ohr von Suna Levent war in Mainhattan normal. Sie lauschte den Dankesworten ihres Gesprächsteilnehmers, der Aberhunderte Kilometer entfernt in seinem Büro saß und via Internet über eine sichere Leitung auf Englisch mit ihr redete, während sie die braunen Augen wechselweise auf die Displays richtete. Der gravierende Unterschied zu anderen Leuten in Frankfurt bestand darin, dass es in diesem Gespräch nicht um Bankgeschäfte ging.
»Um es nochmals zu betonen: bester Stoff, den Sie geschickt haben«, sagte der Mann.
Suna grinste. »Habe ich Ihnen doch gesagt, Takahashi-san.«
Die junge Deutschtürkin, der man ihre Volljährigkeit zu ihrem eigenen Bedauern nicht ansah, nippte an ihrem schwarzen Kaffee, in den sie Kardamom, Zimt, Nelken, Pfeffer, Piment und Muskatnuss gestreut hatte. Sie führte die Gewürze stets mit sich.
»Wie sind Sie da rangekommen, Miss Levent?«
»Hat lange gedauert, bis ich einen Hersteller dafür fand.« Suna beobachtete die Anzeigen, auf denen beständig neue Infos aus dem Internet und dem Darknet erschienen. In ihrem Anzug und dem weißen Hemd mit dem locker gebundenen Schlips wirkte sie wie eine Praktikantin eines Investmentbüros. Die abgeranzten Sneakers brachen das Bild jedoch. »Verraten Sie mir: Was hat am meisten geknallt?«
»Bei mir oder meinen Freunden?«
»Beides. Damit ich weiß, was ich Ihnen als Nächstes schicken kann.«
»Waldmeister«, lautete die Antwort. »Auch das Toffee-Salzkaramell war extrem gut. So was wie Ihre Schaumküsse findet man in Tokio nicht.«
»Immer wieder eine Freude. Sie sehen, ich lege das Geld aus dem Stipendium Ihrer Stiftung gut an. Die kleine Firma fertigt die besten an. Ich mag die mit flüssigem Kern am liebsten.« Suna lehnte sich vor, öffnete ein Befehlsfenster und änderte den Suchalgorithmus von einem ihrer selbst geschriebenen Stöberprogramme. Dieses nannte sie Akilli ihtiyar, nach einem türkischen Märchen. »Ich habe ein paar Neuigkeiten für Sie, Takahashi-san.«
»Oh, sehr gut.«
»Die Berichte sende ich Ihnen vom neuen Spot, also in etwa« – Suna blickte auf die eingeblendete Uhr – »einer halben Stunde. Aber ich wollte schon mal sagen, dass ich meine Schätzchen verbessert habe.« Stolz schwang in ihrer Stimme mit.
»Könnten Sie das ausführen?«
»Sagen wir, ich komme jetzt in die Chatverläufe nicht weniger Kommunikationsanbieter und lasse dort nach Ihren Stichworten suchen. Inland und Ausland. Und auch Videoverbindungen, wobei die Spracherkennung bei der Auswertung noch Schwierigkeiten macht. Je nach Sprache.« Suna trank vom Kaffee und gab zwei weitere Stück Zucker hinein. Wie gerne hätte sie einen Vanilleschaumkuss gegessen. Mit flüssigem Kern. »Aber es funktioniert nicht schlecht. Die Filter reagieren inzwischen auf Ark, Arkus, Meteoritgestein, Particulae und Particula, Tür, Durchgang und die anderen Parameter, die ich von Ihnen bekommen habe, Takahashi-san.«
Suna wusste, dass ihr Tun hochgradig illegal war: das Ausspionieren von digitaler Kommunikation, wie es die CIA, der MI6, das chinesische Ministerium für Staatssicherheit, der FSB und so ziemlich jeder Geheimdienst der Welt tat. Sunas Software trojanerte sich in legale und illegale Behörden, suchte mit deren Rechnerfarmen nach den vorgegebenen Schlagworten und prüfte im nächsten Schritt autonom, ob sie miteinander in Beziehung standen.
Dafür bekam Suna als Lohn ein sogenanntes Stipendium von der Kadoguchi-Stiftung, offiziell für ihr Studium. Bei zehntausend Euro pro Monat ein schönes Sümmchen, plus Gratifikationen bei zusätzlichen Leistungen. Steuerfrei.
Suna betrachtete es als Testlauf ihrer Software, die später Behörden und illegale Rechnerzentren von Regierungen nutzen würden. Abgesehen davon klangen die Suchworte Türen, Meteoriten, Ark, Particulae weder gefährlich noch terroristisch. Mehr nach Esoterikspinnern und niedlichen Weltverschwörern.
»Ich bin auf eine Sache im CERN gestoßen, Takahashi-san.« Suna vergrößerte die Anzeige, um sie besser lesen zu können. »Sie wissen, was das europäische Forschungszentrum in der Schweiz macht?«
»Sicherlich, Miss Levent. Physikalische Grundlagenforschung auf allerhöchstem Niveau.« Takahashi klang angespannt. »Der Unfall?«
»Ja. Nur dass es womöglich kein Unfall war. Jemand schreibt in einem Chat, dass es unverantwortlich gewesen sei, das Fragment mit Teilchen zu beschießen, ohne die Beteiligten in der Anlage zu warnen.« Suna überflog den Nachrichtenverlauf. »Die erwartete Detonation des Particula sei glimpflich verlaufen. Der andere Teilnehmer des Chats wiederum geht von Sabotage aus.«
»Sehr gut, Miss Levent! Bitte alle Details dazu an uns. Was noch?«
»Einen toten Museumswächter in London, während der langen Nacht der Museen, in der Ägyptischen Abteilung«, las Suna vom nächsten Artikel auf dem Monitor ab. »Ein nicht benannter Augenzeuge behauptet, es habe etwas mit dem Sarkophagdeckel zu tun. Die unglückselige Mumie wird das Exponat genannt. Ziemlich abgefahrene Sachen. Wie in den alten Gruselfilmen.«
»Wieso reagierte Ihr Suchprogramm darauf?«
»Weil im Bericht steht, dass der Augenzeuge auf Steine aus der Sonne, also Meteoriten, aufmerksam machte, die angeblich im Deckel dieses Sarkophags eingelassen sind.«
»Ist der Deckel verschwunden?«
»Dazu steht hier nichts.« Suna hatte sich abgewöhnt, diese wirren Meldungen in Einklang bringen zu wollen. Sollte Takahashi selbst schauen, was davon für ihn zusammenpasste. »Und natürlich berichtete ein Junge vom Fluch einer altägyptischen Priesterin, der dabei eine Rolle spielt.«
»Natürlich.« Takahashi lachte. »Fehlen noch lebendige Mumien.«
»Solange es keine Zombies sind. Mumien sind cool.« Sunas Blicke wanderten auf den Monitor des Laptops. Neue Fenster waren aufgepoppt. »Takahashi-san, eben kamen noch zwei Sachen rein.«
»Lassen Sie hören, Miss Levent.«
»Es ist die Rede von einem Professor Sergej Nikitin, der in Cadarache Versuche mit Particulae vornehmen soll, damit jemand anderes weiter an Lithos arbeiten kann. Im Jules-Horowitz-Reaktor.« Suna prüfte in einem neuen Tab, wovon die Rede war. »Das ist ein Materialtestreaktor, der noch gar nicht in Betrieb ist. In Südfrankreich. Eigentlich startet er erst 2021.«
»Anscheinend läuft er bereits«, fügte Takahashi an. »Spannend.«
»Jedenfalls ist der Wortlaut der Nachricht recht unfreundlich. Scheint, als stünde der Professor kurz vor dem Rauswurf.« Suna leerte den Kaffee mit einem großen Schluck, das Gewürzpulver verteilte sich auf ihrer Zunge. »Dann habe ich noch einen Wilhelm Pastinak. Er soll den Schlüssel zu einem Ark haben, durch das, was er bei sich zu Hause eingelagert hat.« Sie las die Nachricht erneut und verstand nichts davon. »Ich lass das jetzt mal. Da kommt ein Dialog, der nach Kochrezept klingt. Verfasst ist das Original auf Russisch. Hab ich von einem Programm übersetzen lassen. Keine Ahnung, wie genau das ist.«
»Ich kümmere mich darum, Miss Levent.«
»In einer halben Stunde haben Sie alles. Ich bin hier schon zu lange im Hotspot.«
»Fühlen Sie sich verfolgt?«
Suna zögerte. »Nur von meinem psychotischen Ex. Weswegen fragen Sie?«
»Nur so. Man … weiß ja nie.«
Suna runzelte die Stirn. »Ich kann mir denken, dass es nicht ganz so harmlos ist, was mich die Stiftung suchen lässt, auch wenn ich nicht verstehe, was es soll.«
»Sie müssen sich keine Sorgen machen.«
Nervös schaute sich Suna um. »Oder liegt es an der Kadoguchi-Stiftung? Haben Sie Stress mit irgendwelchen Behörden? Steuerfahndung? Werden Sie observiert?«
Takahashi lachte. »Nein, da ist nichts.«
»Nun ja, die Struktur Ihrer Einrichtung ist nicht ohne. Letztlich führt die Finanzierung über Umwege zum Konsortium der Van-Dam-Familie.« Suna hatte sich informiert. »Dann der Name der Stiftung: Kadoguchi. Dass das Wort Portal oder Tor bedeutet und ich meine Spürprogramme nach Türen suchen lasse, ist vielleicht kein Zufall. Was meinen Sie?«
Schweigen.
»Takahashi-san?«
»Ich würde Ihnen raten, nicht die Hand zu beißen, die Sie füttert, Miss Levent«, sprach Takahashi kühl. »Halten Sie sich an Ihren Auftrag, und senden Sie mir bitte die Berichte. Richten Sie Ihre Programme vorerst auf Herrn Pastinak und Professor Nikitin. Mehr müssen Sie nicht tun. Und sollten Sie auch nicht. Einen guten Tag.« Der Mann legte auf.
Suna hob die Augenbrauen. »Wow«, murmelte sie. So kannte sie den kontrollierten Japaner nicht. Innerhalb weniger Sekunden hatte sie den Eindruck bekommen, in üble Scheiße geraten zu sein. Ganz ohne ihren psychotischen Ex-Freund.
Zur Nervosität gesellte sich Paranoia, die ihr als Hackerin bekannt war; mal unterschwellig, mal ausgeprägt, bis hin zu Phasen mit akuten Schüben und Angststörungen, bei denen Suna sich tagelang in ihrer Wohnung verschanzte oder sich rund um die Uhr mit dem ÖPNV bewegte, um kein leichtes, stehendes Ziel zu sein.
Schnell weiter. Hastig legte sie die neuen Suchparameter für Akilli ihtiyar fest, raffte die Smartphones an sich, packte Tablet und Laptop weg. Mit wenigen Handgriffen waren die Ladekabel der Powerbank angeschlossen, damit den Geräten unterwegs nicht der Saft ausging. Sie platzierte das Geld für den Kaffee auf den Tisch und verließ das Café.
Auf dem Weg zum nächsten Hotspot sah Suna sich immer wieder um, nutzte Scheiben und reflektierende Oberflächen, um hinter sich zu blicken.
Noch wusste sie nicht, was es mit den Particulae auf sich hatte, im regulären Netz fand sie nichts darüber. Dank ihrer anderweitig gewonnenen Erkenntnisse nahm sie an, dass es sich dabei um extraterrestrisches Gesteinsmaterial handelte. Offenbar gab es verschiedene Interessenten dafür; wer genau und wofür, war ihr nicht klar.
Mit den Meldungen über CERN und den Forschungsreaktor im französischen Cadarache, der offiziell noch nicht lief, erreichten die Infos einen neuen Level.
»Du hättest es Takahashi nicht sagen sollen«, schimpfte Suna leise vor sich hin und bog in eine Nebenstraße der Freßgass ab. In der Öffentlichkeit kamen ihre Selbstgespräche selten gut an, aber sie halfen ihr beim Nachdenken und Verarbeiten. »Da hast du dich mal schön selbst reingeritten.«
In den Spionagefilmen wurden Hacker und Mitwisser ausgeschaltet, wenn sie vom Plan und ihrem Auftrag abwichen. Ihr Puls stieg, Schweiß brach ihr aus und rann unter dem Hemd hinab.
»Scheiße.« Suna griff in ihre Jacke und nahm einen Blister mit Beruhigungstabletten heraus. Sie würden sie körperlich träge machen, aber die guten Medikamente gegen Panikattacken stellten sie gedanklich kalt.
»Erledige deinen Job«, raunte Suna. In einer ruhigeren Gasse ging sie in die Hocke, lehnte sich mit dem Rücken an die Mauer, nahm den Laptop heraus und loggte sich in das offene WLAN ein, um den Router von Frieda Illmann zu nutzen, die offenbar hinter dieser Wand wohnte. »Mach einfach deinen Job. Nicht einmischen. Hab ich dir immer gesagt.«
Mit den hastig ausgepackten Smartphones ging sie in zwei weitere, schlecht gesicherte WLAN von Bewohnern der Straße, Peter Uschmann und Theo Reuters, verband ihr Tablet damit und schaute, welche Neuigkeiten ihre emsigen Programme farmten.
Die Leute bemerkten nicht, dass Suna auf ihre Netzwerke zugriff und was über ihre Router und durch ihre Leitungen rann, bis sie möglicherweise eines Tages Besuch bekamen von dem Netzanbieter oder einem Sicherheitsteam. Das kam davon, wenn man die Passwörter nie änderte.
Während sie den Bericht an Takahashi fertig machte und eine Entschuldigung formulierte, flogen weitere Informationen herein. Zu Wilhelm Pastinak.
Sunas Finger kamen jäh auf der Laptoptastatur zum Erliegen. Sie starrte mit offenem Mund auf die Anweisung, die sie abgefangen hatte.
Auf dem Display blinkte in Englisch:
Bringt den alten Pastinak zum Schweigen!
Und das Umfeld ebenso.
Alles abgreifen, was ihr dort findet.
Auf Aufzeichnungen zu Türen achten.
Prämisse: Keine Particulae zurücklassen.
Suna blinzelte, eine Hitzewelle rollte durch sie. Wurde sie soeben Zeugin eines Mordauftrages?
»Scheiße. So eine beschissene Scheiße!« Aus einer simplen Beobachterin war plötzlich jemand geworden, der entscheiden konnte, was als Nächstes geschah. Das ging weit über das hinaus, was die Stiftung von ihr verlangte.
Was mache ich jetzt?
Es wäre ihr ein Leichtes, Wilhelm Pastinak zu kontaktieren und zu warnen – aber mit welcher Begründung? Dass sie aus Versehen die Nachricht erhalten hatte, glaubte ihr kein Mensch.
Eine weitere ging ein.
Lithos in Gefahr.
Liquidierung von Nikitin nötig.
Unfallverschleierung einleiten. Heute noch.
Bei Nachfragen: Liquidierung jeder betreffenden Person.
Code: Nachtschwarz.
Autorisierung: For The Uniform
»Ihr wollt mich doch verarschen«, wisperte Suna. »Das … das kann nicht sein!«
Sicher steckte Takahashi dahinter, um ihr eine Lektion zu erteilen und ihr indirekt zu drohen. Nein, das ist zu abwegig.
Aber sollten es ernst gemeinte Befehle sein, wurden zwei Menschen mit ihrem Wissen eliminiert. Das machte sie zur Beteiligten.
»Fuck!«, rief sie und starrte das Display an. »Was soll die Scheiße? Ich will nicht mit reingezogen werden!«
Sunas eigenes Smartphone klingelte, der Rufton meldete ihren Kumpel Egon. Sie betätigte die Annahme über die Bluetooth-Verbindung.
»Was?«, blaffte sie. »Ich hab jetzt echt keine Zeit für Schaumkuss –«
»Jemand hat im Darknet ein Kopfgeld auf Nótt ausgesetzt«, unterbrach er sie. »Gerade eben!«
Suna gab einen Laut von sich, der zwischen Hilflosigkeit und Wahnsinn schwankte. Nótt. Das war ihr Hackerinname. Noch so ein Märchen- und Mythending. »Verarsch mich nicht, Alter. Ich hack dir deinen Spieleaccount tot, wenn –«
»Eine Million Euro. Für deinen Tod. Und wer deine Daten besorgen kann, sämtliche Daten«, fuhr Egon fort, »bekommt noch eine obendrauf.«
»Was heißt für meinen Tod? Kaltstellen und –«
»Nótt steht auf der Abschussliste, Suna! Einer echten, beschissenen Abschussliste! Es ist nicht irgendeine Drohung, um dich einzuschüchtern«, redete Egon aufgeregt weiter. »Was hast du gemacht? Wo bist du reingeraten? Welchem Arschloch bist du auf die Füße getreten? FSB? CIA? MI6? Mossad?«
Suna warf sich zwei weitere Pillen ein, um die Panik zu dämpfen, auch wenn sie damit mehr oder weniger zu einem Faultier werden würde. Was war der Auslöser? Ihre Nachforschungen für die Kadoguchi-Stiftung konnten es keinesfalls sein, dafür war die Liste der Suchbegriffe zu banal, zu harmlos. Es ging weder um Staatsgeheimnisse noch Bankzugänge oder Aktienmanipulationen. Sondern nur um Dreckstüren. Und elende Particulae – was immer das war. Oder sind das in Wahrheit irgendwelche Regierungscodewörter?
Dann fiel ihr noch eine Möglichkeit ein.
»Mein Ex. Irgendeine Scheiße von meinem Ex«, sprach Suna. Ihre Kehle und der Mund waren trockener als die Sahara. »Er kann diesen Kack angezettelt haben. Wie soll das Geld bezahlt werden?«
»Über Netcoins.« Im Hintergrund klapperte er auf einer Tastatur. »Der Aufruf verbreitet sich extrem schnell. Zwei Leute haben sich bereits gemeldet, die den Job machen wollen. Ex-Söldner. Nótt hat kaum Freunde, ne? Weißte selbst.« Egon senkte die Stimme. »Suna, sobald sie persönliche Daten von dir finden, bist du –«
»Das war so klar!« Aus dem Schatten einer Mülltonne trat ein junger Mann, den Suna bestens kannte. Orangefarbene Jeans zu weißen Shirts trug nur einer in ihrem Umfeld. »Immer noch die alte Hotspot-WLAN-Route. Es ist so leicht, dich zu finden.«
»Scheiße, der auch noch«, flüsterte sie. »Egon?«
»Ja?«
»Finde raus, wer das Kopfgeld aussetzte. Ich ruf dich gleich wieder an.« Suna beendete die Verbindung und erhob sich langsam, blieb dabei mit dem Rücken gegen die Hauswand gelehnt und hielt das Tablet in der Hand.
Ihre Finger flogen über die digitale Tastatur und setzten warnende Mails auf: eine an die Schreinerei von Wilhelm Pastinak, eine an die persönliche Website von Professor Nikitin. Sollten die Männer selbst entscheiden, was zu tun war.
Ohne aufzublicken, fragte Suna: »Was willst du, Stefan?«
Mit einem langen Schritt stand der dunkelblonde junge Mann vor ihr und nahm ihr das Tablet weg, bevor sie die Mails absenden konnte. »Schau mich gefälligst an, dumme Bitch!«
Sie ballte die Hände zu Fäusten und sah ihren einstigen Liebhaber an. Sie hatte ihn bereits nach einem Monat abgeschossen, weil er ihr nachgeschnüffelt und versucht hatte, an ihre Daten zu kommen. An ihre Programme. Er hatte an Nótts Geheimnisse und Wissen herangewollt, über die Gefühle der Frau. Der älteste Trojaner der Welt.
»Gib es mir zurück.« Sie entdeckte Abschürfungen, Prellungen und Blutergüsse in seinem eigentlich ansprechenden Gesicht. »Was ist mit –«
»Das waren Freunde von dir!«, schrie er sie an. »Du feiges Stück! Hetzt mir deine Türken-Assis auf den Hals.«
»Ich? Nein, ich …« Suna grabschte nach dem Pad. »Los, her damit!«
Stefan zog das Gerät weg und verpasste ihr eine Ohrfeige, die Suna zur Seite warf und auf die Knie fallen ließ. »Sie hatten sich maskiert, die Dönerficker. Der eine wurde von den Wichsern Xatar genannt. Wie der Türsteher vom Shishaversum. Dein guter Kollegah.«
Suna sah wütend zu ihm auf. »Ich hatte damit nichts zu tun.« Sie wich seinem ersten Tritt aus. Die Schuhspitze streifte die Wand, Putz bröckelte ab. »Bist du irre? Du –«
Der zweite Tritt traf sie in die Seite. Unwillkürlich krümmte sie sich und hielt sich die brennenden Rippen. Das Atmen tat weh, Tränen schossen ihr in die Augen.
»Das bezahlst du mit Schmerzen«, brüllte er und zertrampelte ihre Tasche. »Wie konnte ich dich mal geil finden, hä?« Knackend barsten die Smartphones und der Laptop unter der Wucht und dem Gewicht.
»Nein!«, rief Suna und wollte sich über die Computertasche werfen. Aber es war zu spät. Der stechende Geruch von sich zersetzenden Akkus und der Rauch verrieten, dass die zerstörte Powerbank durch eine Spannungsspitze eine Katastrophe angerichtet hatte.
»Und wenn sie dich im Krankenhaus zusammenflicken, wirst du an mich denken.« Stefan zog ein Klappmesser. »Und wenn du mir deine Kümmel-Assis wieder schickst, bringe ich dich um. Mir scheißegal, was du denen vorlügst.« Er machte einen Schritt auf sie zu und ließ den Tabletcomputer achtlos fallen, der halb aus seiner Hülle rutschte. »Du kannst sagen, du wärst mit dem Gesicht durch eine Glasscheibe gefallen.«
Suna stemmte sich hustend in eine sitzende Position. Sie hatte Xatar einmal von Stefan erzählt und was er mit ihr abgezogen hatte. »Ich wusste nicht, dass er losgeht und dich verprügelt.« Sie betastete ihre Seite. »Aber gerade wünsche ich mir, er hätte dir die Eier abgerissen.«
Stefan rammte ihr das Knie ins Gesicht.
Suna konnte sich eben noch wegdrehen, das Knie traf sie daher nicht frontal auf die Nase, sondern seitlich am Kopf und warf die junge Deutschtürkin gegen die Wand.
Eine Platzwunde tat sich auf. Benommenheit breitete sich gnädig in ihrem Denken aus. Sie sah Stefan undeutlich, schmeckte ihr eigenes Blut im Mund. Die Lippe war gerissen, und sie hatte sich auf die Zunge gebissen. Sie war ihm hoffnungslos unterlegen.
»Hey, Sie!«, erklang unvermittelt eine Frauenstimme. »Was machen Sie da?«
Stefan wandte sich um. »Geht Sie nichts an. Verschwinden Sie.«
»Ist das ein Messer in Ihrer Hand?«
»Verpiss dich!« Stefan hob den Arm und ließ die Klinge im Licht aufleuchten. »Und nicht die Bullen rufen.«
»Werde ich nicht.« Die unscheinbare Frau kam mutig näher – und zog eine Pistole unter dem Kurzmantel hervor. »Ganz sicher nicht.«
»Mit der Schreckschusswaffe machst du mir –«, setzte Stefan an.
Es knallte zweimal.
Suna sah das Shirt auf Stefans Rücken zucken, dann entstand dort ein centgroßes Loch, an dessen ausgefransten Rändern Blut haftete. Roter Sprühnebel verteilte sich hinter ihm, darüber schoss eine armlange Fontäne aus dem Hinterkopf. Leise prasselte das Rot auf den Asphalt.
Zuerst regte sich Stefan nicht. Dann verlor er das Messer und fiel steif wie ein Stück Holz rückwärts um und schlug auf der Straße auf. Es roch nach frischem Blut.
Suna wollte schreien, vor Angst, vor Grauen und um Hilfe. Doch aus ihrem geöffneten Mund drang nur ein leises, heiseres Fiepen.
Die Frau in Alltagskleidung kam näher und warf einen Blick auf die offene Tasche und die zerstörten Elektrogeräte. Sie ging vor Suna in die Hocke, um auf Augenhöhe mit der Verletzten zu sein. Sie war etwa vierzig, die halblangen blonden Haare hatte sie im Pferdeschwanz nach hinten gebunden. Aus dem Lauf ihrer Halbautomatik stieg gräulicher Rauch, die abgefeuerte Waffe hielt sie lässig in der Rechten. »Suna Levent?«
»Nein. Nein, das bin ich nicht«, stieß Suna aus und atmete hektisch, trotz der brennenden Rippen. »Das ist eine Verwechslung.«
»Was wissen Sie über die Türen?«
»Welche –«
»Particulae? Das Ark-Projekt?«, hakte ihre Retterin nach. »Cadarache. Versuche mit Particulae. Lithos. Jules-Horowitz-Reaktor. CERN. Schreinermeister Pastinak.«
»Keine Ahnung. Wirklich, keine Ahnung! Es ist eine Verwechslung.« Suna hasste das Zittern, das sich über ihren Körper ausbreitete. »Sie müssen mich –«
»Aber Sie sind doch Nótt?«
»Ich weiß nicht, von wem Sie sprechen.«
»Sie haben Erkundigungen eingezogen.« Die Frau blickte auf die qualmende Computertasche. »Schade, dass das alles nur noch Schrott ist. Sonst hätte ich die Wahrheit gleich vor Augen gehabt.«
Sie weiß nicht, dass das Tablet unbeschädigt ist. Suna sah ihre Chance, Nikitin und Pastinak doch noch zu warnen. Das Auftauchen der Killerin bewies, dass nichts von dem, wonach sie gesucht hatte, harmlos war. Suna hasste Takahashi und die Stiftung aus ganzem Herzen dafür, sie in diese Lage gebracht zu haben. »Ich bin nicht Sundra Lovend oder wen immer Sie suchen.«
Die Frau lächelte kalt, knapp und müde. »Netter Versuch, Kleines.« Die Mündung schwenkte hoch und richtete sich auf die Stirn der Hackerin. »Tut mir leid. Wissen schützt vor Strafe nicht. Den Rest lasse ich mir von deinem Freund Egon erklären. Er weiß gewiss, wie ich an dein Back-up komme. Oder deinen Cloudspeicher.«
Die wird mich abknallen! Suna stieß sich mit ganzer Kraft von der Wand ab und warf die Frau um.
Fluchend ging die Killerin zu Boden. Krachend löste sich ein Schuss und verfehlte Suna um Zentimeter.
Suna hechtete nach Stefans Messer und packte es, schleuderte es mit einem Schrei nach der Frau und versuchte dann, das Tablet unter der Leiche ihres Ex-Freundes herauszuziehen.
Die Klinge wirbelte durch die Luft und traf überraschend präzise den zur Abwehr erhobenen Unterarm der Killerin, was die Frau zum Aufschreien brachte. Die Finger gaben die Pistole frei, sie klapperte auf die Straße. »Fuck! Team Alpha, greift sie euch!«
Sie ist nicht allein! Suna bekam das Tablet nicht unter Stefans totem schwerem Körper hervorgezogen. Die Hülle hatte sich verkantet. Blut verteilte sich über das geborstene Display, füllte die Sprünge und Risse. Sie erkannte zwei offene E-Mail-Fenster.
Ein weiterer Schuss krachte, neben Suna platzte ein Stück Mauer ab.
Die Killerin tastete mit ihrem unverletzten Arm nach der verlorenen Pistole. »Das war es für dich, Nótt!«
Schritte verrieten, dass das alarmierte Team anrückte. In etwa drei Sekunden wären die Leute hier.
Die Zeit reichte allerhöchstens aus, um eine Mail auf den Weg zu schicken – aber an wen?
Professor oder Schreinermeister?
Und wenn sie stattdessen die Flucht ergriff? Drei Sekunden Vorsprung waren entscheidend. Lebenswichtig.
»So eine Scheiße!«
Nikitin und der Reaktor, der offiziell noch gar nicht lief und Experimente mit etwas namens Lithos machte?
Pastinak und seine Türen mit Particulae samt Aufzeichnungen?
Oder ihre eigene Sicherheit, um dem Mysterium auf den Grund zu gehen, das zu ihrem Kopfgeld geführt hatte?
Die Schritte näherten sich rasend schnell.
Die Killerin bekam ihre verlorene Pistole zu greifen.
Sunas drei Sekunden waren fast um.
Eine Entscheidung musste getroffen werden.
Eine Entscheidung auf Leben und Tod …
Kapitel I
Frankreich, Saint-Paul-lez-Durance, Spätsommer
Sergej Nikitin schlenderte mit einer Kippe im Mund und in seinen bequemen Sachen durch das verschlafene Dörfchen, das in der Nähe seiner Arbeitsstätte lag und etwa neunhundert Einwohner hatte. Im Kernforschungszentrum Cadarache, wo der 58-jährige Russe seiner Tätigkeit nachging, waren mehr als fünfmal so viele Menschen aus allen möglichen Nationen beschäftigt.
Der warme Wind strich durch Sergejs prächtigen Schnauzbart und wirbelte den Rauch davon. Der Professor mochte es, durch die geschwungenen Straßen und entlang des großen Kanals zu flanieren, immer wieder abzubiegen und dabei über alles Mögliche nachzudenken. Hier hatte er seine Ruhe. Die Häuser mit den hellbraunen, sandfarbenen Wänden und den rosarotbraunen Ziegeln, wie sie für Südfrankreich üblich waren, besah er sich gerne, weil sie nichts Technisches, nichts Stählernes und nichts Reaktorhaftes an sich hatten. Eine andere Welt, in der er immer darauf achtete, nicht in Jogginghosen unterwegs zu sein. Es gab schon genug Russen, die das Klischee erfüllten.
Meistens entfernten sich seine Gedanken bei seinen Streifzügen schnell von den Ergebnissen des Tages, raus aus Tabellen, Zahlen und Kurvenverläufen, weg von Berechnungen, Gleichungen und Zerfallswerten.
Tief atmete Sergej die gute Luft ein, spazierte mit hinter dem Rücken verschränkten Händen umher. Er dachte über die letzten Jahre nach, die ihm Ruhm und Anerkennung als Kernphysiker gebracht hatten. Neuerdings gab es jedoch Ärger, hinter den Fassaden des Forschungszentrums, oben in den Vorstandsetagen, wohin seine Blicke nicht reichten.
Und das beunruhigte Sergej. Enorm.
Sein Smartphone klingelte, die eingespeicherte Melodie verriet die Anruferin. Sergej ließ die Zigarette aus dem Mund fallen und trat sie aus, dann zog er das Handy aus seiner Hosentasche und nahm den Anruf entgegen. »Privjet, Mila.«
»Privjet, Batjuschka!«, grüßte ihn Milana, seine Tochter, Managerin einer Eventagentur in Moskau und Sankt Petersburg, die ihr steigendes Vermögen damit verdiente, reichen Menschen snobistische Veranstaltungen zu ermöglichen. »Der Wind rauscht übers Mikro. Schleichst du wieder durch den Ort?«
»Genau. Heute ist das Pétanque-Turnier. Das lasse ich mir nicht entgehen.« Er hob das Filterstück auf, das aus geknicktem Karton bestand. Umweltverschmutzung lag ihm nicht.
»Die Leute halten dich bestimmt für einen Spanner.« Milana lachte neckend. »Keiner aus dem Forschungszentrum geht ins Dorf, oder?«
»Doch«, log Sergej. »Viele.«
Er bog in das Sträßchen ab, das ihn auf den Platz vor dem Bürgermeisteramt führte, dem gegenüber eine kleine Bar samt Café lag, die sich passenderweise, wenn auch wenig einfallsreich Bar de la Mairie nannte. »Was gibt’s Neues in Sankt Petersburg?« Von Weitem erkannte er die Einheimischen, die sich auf Wein, Zigaretten und einen Happen im Schatten der Bäume versammelt hatten. Französische Musik drang aus den Boxen, Jean Gabin sang ein Lied über einen Spaziergang am Wasser. Gelegentlich erklang das metallische Klacken, wenn die geworfenen Pétanque-Kugeln gegeneinanderschlugen. »Ich vermisse die Stadt.«
»Ich bin in Moskau, Batjuschka. Deinen Enkel besuchen.«
»Deinen Sohn, meinst du.« Sergej konnte die Verärgerung kaum aus der Stimme nehmen und rieb sich über den Schnauzer, weil er den Eindruck hatte, die Haare sträubten sich vor Aufregung.
»Damit kriege ich dich immer. Verzeih«, erwiderte sie und lachte. »Ja, meinen wundervollen Sohn. Ilja geht es gut. Groß ist er geworden, und er fragt immer nach dir.«
»Kam mein Geschenk an?«
»Kam es. Er ruft dich noch an, um sich zu bedanken.« Milana klang nicht bedrückt, obgleich sie seit der Trennung von ihrem Lebensgefährten vor drei Jahren ihren Sohn nur ein-, zweimal im Monat sah. Ihre Arbeit für ihre Agentur ließ ihr kaum Zeit für ihre Familie, was auch der Grund für die Trennung gewesen war.
Sergej hatte das Ende der Beziehung zwischen ihr und Aleksander schwer zugesetzt. Er mochte den unkomplizierten Kerl, aber letztlich war er zu schlicht für seine schlaue, anspruchsvolle Milana. So sah es zumindest Sergej. Seine Tochter hingegen meinte, man habe sich auseinandergelebt.
»Alles gut bei dir, da unten in Südfrankreich?«
Milana mied das Thema Kind und Familie, und weil Sergej nicht streiten wollte, sparte er es aus. »Habe ich mich jemals über das Wetter beschwert?«
Er nickte in die Runde der Einheimischen und hob die Hand, als er den Außenbereich der Bar erreichte, und sein Gruß wurde freundlich erwidert. Man kannte sich. Sergej setzte sich an den Rand, solange er telefonierte. Der rote Plastikstuhl war noch warm von der Tageshitze. »Ihr könnt mich ja mal besuchen. Du und Ilja.«
»Gibt es da unten reiche Russen, denen ich meine Agenturleistungen anbieten kann?«
»In Saint-Tropez bestimmt. Das ist nicht so weit entfernt.«
Sergej bekam von Denise, der freundlichen Bedienung, wie immer einen Rotwein gebracht, in einem dickwandigen Wasserglas, und der vergorene Rebensaft schmeckte großartig. Mit Gesten bestellte er einen Croque Monsieur, und Denise zog nach einem Zwinkern und einem tonlosen Bien sûr lächelnd davon.
»Und in deinem Zentrum?«, fragte Milana.
»Nein. Wie auch? Wir sind arme Forscher.« Ein leises Ping sagte ihm, dass er eine E-Mail erhalten hatte. Auf seine Privatadresse.
»Dann überleg ich mir das noch mal. Du bist aber jederzeit in Sankt Petersburg willkommen. Oder in Moskau. Was dir lieber ist.«
»Da. An Weihnachten. Vorher komme ich nicht weg.« Sergej zögerte. »Sag mal …«
»Ja?«
»Ach, nichts.«
Milana lachte auf. »Oh, das bedeutet, dass etwas nicht stimmt. Als hätte ich es gespürt.«
»Nein, mit mir ist alles in Ordnung, aber …« Wieder stockte er und langte nach dem Wein, trank einen Schluck. Es war nicht rechtens, sie damit zu belasten. Hineinzuziehen.
Dabei fiel sein Blick auf zwei Männer in leichten weißen Polohemden und grauen Bermudas, Sonnenbrillen vor den Augen und Basecaps darüber. Wie ausgebrochene Amerikaner, die nicht in diese Region passen wollten. Sie telefonierten beide, die Gesichter waren ihm zugewandt. Wohin genau sie blickten, blieb hinter den verspiegelten Gläsern verborgen.
»Aber?«, hakte seine Tochter leicht besorgt ein. »Was ist, Batjuschka?«
Sergej musste sie ablenken. »Ist … bei dir alles klar? Und mit Ilja? Ich meine, so ein Junge in dem Alter, der hat schon Flausen im Kopf, oder? Erzähl mir doch, was er anstellt, wenn er bei dir ist.«
Milana schwieg für wenige Sekunden, in denen sich ein Arbeitskollege vom Nachbartisch löste und mit einem Bier auf Sergej zusteuerte; in der anderen Hand hielt er einen Rucksack, prall gefüllt wie für eine Tagestour. Er war um die vierzig, trug eine beigefarbene Jogginghose und ein schwarzes Shirt. Sergej kannte ihn vom Sport und aus der Kantine, doch ihm fiel der Name nicht ein.
»Hallo, Professor, ich –«
Sergej hob abwehrend die freie Hand. »Moment.«
»Bist du in Schwierigkeiten? Du weißt, ich habe Kontakte. Bis hoch in die russische Regierung«, begann Milana.
»Es ist dringend«, sagte der namenlose jüngere Kollege und setzte sich ungeachtet des privaten Telefongesprächs, nahm einen großen Schluck vom Bier. Er schwitzte mehr, als es bei der Hitze angemessen war. Aufregung? Angst? Ungeduld? Der Rucksack landete zwischen seinen Füßen. »Es geht um Lithos, Professor.«
Sergej erstarrte. »Mila, ich rufe dich wieder an. Sei nicht böse, es ist was Berufliches dazwischengekommen. Poka!« Er legte auf und bekam in der gleichen Sekunde die eingegangene Mail auf dem Display angezeigt.
Als Absender stand ein üblicher Spamname: STAVROS WACHTEL.
Der Betreff der Nachricht lautete: ES GEHT UM IHR LEBEN, PROFESSOR.
Grummelnd steckte Sergej das Gerät ein. Penisverlängerungen waren nicht lebensentscheidend. Ärgerlich, dass es die Mail durch seine eigentlich recht gewieften Servereinstellungen gegen unerwünschte Werbung geschafft hatte.
»Was soll das sein? Lithos?«, fragte er den Mann vor sich. »Verzeihung, mir ist Ihr Name entfallen.«
Der Mann nickte langsam. »Doktor André Petit, wissenschaftlicher Assistent von Professorin White-Spelling.«
Sergej sah Petit eindringlich an. »White-Spelling forscht in der Phébus-Anlage, richtig?«
»Ja, aber das tut nichts zur Sache. Wichtiger ist, was sie nach Dienstschluss macht.« Petit zog sein Smartphone aus der Jogginghose und wischte darauf herum. »Im Jules-Horowitz-Reaktor.«
Endlich fand er, was er suchte, und hielt Sergej den kleinen Bildschirm hin. Ein verwischtes Foto von einem Ausdruck voller Zeichen und Zahlen wurde sichtbar, auf dem unter anderem Lithos geschrieben stand. Und geheim.
»Kann nicht sein. Der ist noch nicht einsatzbereit«, sagte Sergej kühl. Er durfte sich nichts anmerken lassen.
»Doch, ist er. Jemand tut Dinge darin. Und es geht um Lithos.« Petit versuchte, das Foto zu vergrößern, aber die Schrift wurde dadurch unleserlich. »Merde! Das sind die Beweise für meine Geschichte.«
Sergej ahnte eine Falle: Man hatte den jüngeren Kollegen losgeschickt, damit er sich verriet. Offenlegte, wie viel er in Erfahrung gebracht hatte, obwohl es ihn nichts anging. Vermutlich war Petit sogar verwanzt.
Er umfasste das Glas Rotwein und machte Anstalten, sich zu erheben. »Ich werde beim Pétanque –«
Petit griff seinen Arm. »Professor! Die wollen Sie umbringen«, zischte er. »Und mich auch.«
»Gewiss nicht.« Sergej hatte Mühe, seine Reaktion unter Kontrolle zu halten.
»Ich habe es gehört. White-Spelling telefonierte, während ich unbemerkt in der Nähe stand«, haspelte Petit. »Sie sprach mit jemandem, zu dem sie sagte, dass ich und Sie wegmüssten. Weil wir etwas über Lithos herausgefunden hätten.« Er hob das leere Bierglas hoch, um Denise zu zeigen, dass er noch eins wollte. Brauchte.
Sergej behielt seine Taktik bei. »Aha. Und was soll Lithos sein?«
Petit fuhr sich mit einer Hand über das verschwitzte, glatt rasierte Gesicht. »Ich habe keine Ahnung.«
»Aber Sie haben –«
»Es sind nur rudimentäre Sachen. Es geht um irgendwas, was sie zusammenbauen. Und dass es Strahlung gibt. Und dass die Strahlung alles übertrifft, was sie kennen«, ratterte Petit. »Die Experimente dazu finden im Jules-Horowitz-Reaktor statt.«
»Der noch nicht fertig ist.«
»Verdammt, Professor! Er ist fertig. Sie behaupten nur, dass er nicht fertig ist.« Petit bekam das Bier und trank es in einem Zug weg, um bei Denise sofort Nachschub zu ordern. Erneut nahm er sein Smartphone. »Etwas geht in der Anlage vor. Ich sah zwei Lastwagen ohne Aufschrift, die ins Reaktorgebäude fuhren. Was haben die reingebracht?«
Sergej blickte zu den beiden auffälligen Männern in Polohemd und Bermudashorts, deren Sonnenbrillen ihm zugewandt waren. »Da wissen Sie mehr als ich, Monsieur.«
»Und was wissen Sie? Womit haben Sie sich den Tod eingefangen? Wie umfangreich ist Ihr Wissen über Lithos?« Petits Augen wurden groß. »Haben … Haben Sie da etwa mitgearbeitet?«
Das Gerede über sein Ableben machte Sergej nervös. Er hätte sich weniger gewundert, wenn sich das Ganze in Russland zugetragen hätte, wo durchaus Menschen verschwanden, entweder im Gefängnis oder für immer. Aber in Westeuropa? In einem offiziellen Forschungszentrum? Der Jules-Horowitz-Reaktor war für Materialtests vorgesehen. Jemand testete eine neue Komponentenverbindung. Inoffiziell. Verbotenerweise, sofern es stimmte, was Petit von sich gab.
»Scheiß drauf«, murmelte Petit und nahm das dritte Bier. Nach einem langen Zug fummelte er sich eine Zigarette in den rechten Mundwinkel und inhalierte tief. »Dann sagen Sie mir eben nichts.« Er deutete mit dem glimmenden Ende in Richtung der Forschungseinheit, der Rauch verwischte in der Luft. »Viel Spaß in Cadarache. Ich geh bestimmt nicht mehr hin.« Er pochte gegen den Rucksack.
Nun war Sergej verwundert. »Sie kündigen?«
»Nie mehr setze ich einen Fuß hinter den Zaun dort. Ich haue ab, Professor. Das sind meine Biere auf die Freiheit.«
»Und wie …?«
Petit paffte schnell. »Erst mal nach Belgien, und dort, wenn ich in Sicherheit bin, gehe ich zur Polizei und zur Regierung. Das muss offiziell gemacht werden. Jemand muss nachschauen, was die im Jules-Horowitz-Reaktor treiben. Sind Sie dabei, Professor?«
Sergej war komplett verunsichert. Was, wenn Petit keine Falle war? Wenn er ihn wirklich warnen wollte? Plötzlich erinnerte er sich an die Mail, die er bekommen hatte, in der ihn jemand vor dem Tod warnte. Zu viele Zufälle. »Ich –«
»Monsieur le professeur«, hallte eine Frauenstimme über den winzigen Platz. »Vas-y! Das Turnier beginnt. Wir brauchen Ihre ruhige Hand beim Pétanque.«
Aufmunternder Beifall erklang von den übrigen Teilnehmern, und die heitere Musik wurde lauter gedreht.
»Gehen Sie nur. Und denken Sie an mich, wenn Sie später nach Cadarache zurückkehren.« Petit warf einen Zehner auf den Tisch und erhob sich; sein Schweiß hinterließ feuchte Spuren auf dem Plastikstuhl. »Wir sehen uns bestimmt wieder. Spätestens, wenn die Behörden einrücken, um Untersuchungen anzustellen.« Er paffte nochmals, als wollte er sich einnebeln und unsichtbar werden. »Spielen Sie Ihr einfältiges Spielchen weiter, Professor. Ich weiß, dass Sie etwas über Lithos rausgefunden haben. Und andere wissen es auch. Das ist Ihr Problem.« Dann warf er sich den Rucksack an einem Träger über den Rücken und stürzte davon, fiel fast über den roten Plastikstuhl und verschwand in einer Seitenstraße.
Kaum bewegte sich Petit weg vom Bürgermeisteramt und der Öffentlichkeit, standen die zwei Bermudaträger auf und folgten ihm.
»Monsieur le professeur!«, rief man erneut nach ihm.
»Un moment, s’il vous plaît.« Sergej stemmte sich aus dem Stuhl und hastete den Männern nach. »Ich bin gleich wieder da.« Sollte Petit in Schwierigkeiten kommen, wollte er ihm beistehen und danach mit ihm sprechen. Über Lithos. Vermutlich wäre es wirklich besser, wenn eine Regierung davon erfuhr sowie Milana, die Beziehungen zur besten Regierung von allen unterhielt.
Sergej bog ab und sah, wie die beiden Polohemdenträger fast zu Petit aufgeschlossen hatten, der gerade über einen Zebrastreifen ging; einer telefonierte, der andere setzte die Sonnenbrille ab und hob die Hand, um auf sich aufmerksam zu machen.
»Vorsicht!«, rief Sergej. »Monsieur Petit!«
Der Mann drehte sich überrascht zu ihm um. Die zwei Verfolger direkt hinter ihm ebenfalls.
In diesem Moment schoss ein weißer Lastwagen die Straße entlang. Er erfasste Petit und einen der Bermudahosenmänner, der andere machte gerade rechtzeitig einen Hüpfer zurück und entging so dem Tod aus Blech und Plastik.
Die Körper flogen meterweit durch die Luft.
Petit prallte in zwei Meter Höhe an eine Wand, sein Kopf zersprang an den Steinen. Der Verfolger knallte gegen einen Laternenmast und kippte in verbogener Haltung zurück auf die Fahrbahn.
Der Lastwagen hielt nicht an.
»Scheiße!«, schrie der andere Polohemdträger und rannte los, um nach Petit zu sehen.
Dabei übersah er den zweiten Transporter, der um die Kurve donnerte und aufs Trottoir steuerte.
Der Mann wurde von der Front erwischt und aufschreiend zu Boden gedrückt. Die Reifen überrollten ihn, bis sich ein Arm in einer Achse verfing und er mehrere Meter mitgeschleift wurde, bevor er als blutiges Bündel auf dem Asphalt liegen blieb; eine breite rote Bahn führte zur Leiche. Auch dieser Wagen brauste davon.
Sergej starrte auf die drei Toten, alle grausamst zugerichtet, mit offenen Wunden und verbogenen Gliedmaßen, herausspritzendem Blut. Der unglückselige Petit hatte ein Gesicht, dessen einstige Form man nur erahnen konnte.
Niemand schien die Morde bemerkt zu haben. Vom kleinen Platz erklang die Musik von Jean Gabin, das Lachen der Spielerinnen und Spieler sowie das Klacken der Pétanque-Kugeln.
»Lithos«, murmelte Sergej fassungslos und fühlte Übelkeit in sich aufsteigen.
Natürlich hing es mit Lithos zusammen. Die weißen Transporter, die Petit erwähnt hatte. Die beiden toten Männer in den Poloshirts hatten den Doktor zu beschützen versucht.
Sergej wurde schlagartig schlecht, er musste sich an der Wand abstützen. Die Welt drehte sich um ihn, er atmete tief durch und rang gegen die kommende Ohnmacht.
Er suchte das Smartphone heraus, um den Rettungsdienst anzurufen.
Dabei sah er wieder die E-Mail, die ihn vor seinem Tod warnte.
Mit dem nächsten Ausatmen wurden seine Knie weich, und Sergej rutschte auf den Boden.
Russland, Moskau, Spätsommer
Milana Nikitin hielt ihr Computerpad in der Hand und hakte auf ihrer digitalen Liste ab, was bereits erledigt war. Die Blicke ihrer blauen Augen schweiften aufmerksam über die Kleinigkeiten im größten Saal des Hotel Metropol, in dem bald zweihundert reiche Russinnen und Russen einen exquisiten Abend verbringen würden.
Kristalllüster, Champagnerflaschen in silbernen Eisbottichen, verschiedene Kaviardosen, Weißbrot und Brioche, zwei Dutzend unterschiedliche Wodkasorten, eine exklusiver als die andere, Blumensträuße und Gestecke, deren Geruch betörte – alles prüfte die blonde Endzwanzigerin mit strengem Blick.
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wuselten in einheitlicher Kleidung umher, richteten und deckten ein, legten letzte Hand an die Deko, die Tontechnik machte einen Soundcheck. Nichts durfte schiefgehen, weil – so hatte ihr ein Kremlspatz gezwitschert – es sein könnte, dass sich eine hochrangige Persönlichkeit aus dem Zentrum der Macht einfand. Ein Boost für ihre Karriere oder ein rascher Absturz und ausbleibende Aufträge. Dieser Abend entschied über die kommenden Jahre.
»Vladi«, rief Milana ihren Chefconcierge über ihr Bluetooth-Headset.
»Ja, Stalina?«
Sie musste grinsen. Ihr autoritärer Ruf war legendär, und ihr Auftreten in einem anthrazitfarbenen Kostüm mit Krawatte und sportlicher Undercut-Frisur unterstützte die Strenge. »Die Falten der Tischdecken gefallen mir nicht. Lass sie nachziehen und nimm Sprühstärke oder Haarspray, damit sie glatt werden.«
»Sehr wohl.«
»Sind die Akrobaten da?«
»Schon in der Garderobe.« Pjotr, der knapp zwanzig Meter weiter stand und sich mit den Technikern wegen der Pyroelemente unterhielt, wandte sich zu ihr um. »Entspann dich. Alles ist charascho.«
»Ich entscheide, ob alles charascho ist. Noch sieht es zu fünfzig Prozent danach aus.« Milana schenkte ihm ein halbherziges Lächeln. Lob kam immer erst am Schluss. »Du weißt, wie entscheidend das für meine Agentur ist. Geht es mir gut, geht es euch gut.«
»Sehr wohl, Stalina.« Pjotr salutierte über die Distanz und wandte sich den Tontechnikern zu.
Milana zögerte, den Punkt Tischtuch abzuhaken. Nach der Abnahme, entschied sie und markierte den Posten mit Rot auf dem Display. Vieles war nicht mehr im kritischen Bereich, und sie hatte noch zwei Stunden. Sollte kein Meteorit vom Himmel fallen und in den Saal rauschen oder das Hotel Metropol plötzlich abbrennen, stand die Veranstaltung.
Lass es den Präsidenten heute Abend sein. Milana prüfte den Raum erneut mit Blicken, ohne sich zu rühren, während die Angestellten um sie herum eilten, trugen, wischten, polierten und arrangierten.
Ein Telefonanruf, die Nummer war ihr bekannt. Das Zollamt?
Da sie gelegentlich für ihre Kunden und Veranstaltungen Waren aus dem Ausland bestellte, musste sie öfter vorstellig werden, um die Papiere und Nachweise zu erbringen und die Zusatzkosten zu bezahlen. Sie erwartete allerdings keine Lieferung.
»Neveroyatno No Pravda Events, was kann ich für Sie tun?«
»Guten Tag. Mein Name ist Leutnant Frolow. Spreche ich mit Milana Sergejewna Nikitin?« Der Mann sprach wesentlich weicher und freundlicher, als es bei den Behörden üblich war. Das machte sie neugierig.
»Das tun Sie, Leutnant.«
Der Zöllner räusperte sich. »Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass es ein Problem mit der Einfuhr der sterblichen Überreste Ihres Vaters gibt, Frau Nikitin.«
Milana legte die Stirn in Falten, was sich wegen des frisch gespritzten Botox seltsam anfühlte. »Das muss ein Missverständnis sein, Leutnant Frolow.«
»Nein, ich fürchte nicht.«
»Aber mein Vater ist nicht tot.«
»Einen Augenblick.« Im Hintergrund raschelte Papier, elektronisches Piepsen und Klackern einer Tastatur erklang. »Professor Sergej Alexandrowitsch Nikitin, geboren am 29. Januar 1961 in Sankt Petersburg? Verheiratet mit Ekaterina Sergejrowna Nikitin?«
In Milanas Eingeweiden wurde es kühl. »Eine Verwechslung, offensichtlich.«
»Aber es ist Ihre Telefonnummer angegeben, um Kontakt bei Problemen aufzunehmen«, erwiderte Frolow freundlich. »Nochmals, es tut mir sehr leid, Frau Nikitin. Noch mehr, dass ich es wohl bin, der Sie vom Ableben Ihres Vaters in Kenntnis setzt. Mein Beileid.«
Milana musste sich setzen. »Das verstehe ich nicht. Wir haben doch noch telefoniert. Und …« Sie langte mit einer Hand an die rechte Schläfe. Tot? Sie weigerte sich, dem Mann zu glauben. Unentwegt hämmerte es in ihrem Verstand: Irrtum, Irrtum, Irrtum.
»So leid mir das Ganze tut, Frau Nikitin«, begann Frolow. »Es bleibt das Problem mit der Einfuhr.«
Milana begriff nicht, was soeben geschah. Mitten in den Vorbereitungen für das wichtigste Event in der Karriere ihres Unternehmens krachte dieser Anruf wie ein T-34 durch ein Puppenhaus. »Sagen Sie bitte, dass es ein makabrer Telefonstreich ist, Leutnant.«
»Nein, wirklich nicht! Gott soll mich strafen, täte ich Ihnen so etwas an!« Erneut raschelte Papier. »Bei Ihrer Mutter nahm keiner ab. Ich fürchte, sie weiß auch nichts.«
»Meine Mutter ist dement. Und in einem Heim. Sie wäre Ihnen keine Hilfe.« Es gab niemanden, auf den Milana diese Aufgabe übertragen konnte. Ein Ruck ging durch ihren Körper, ihre Haltung straffte sich. Sie war Stalina. Sie war Problemlöserin. »Gut, es ist, wie es ist.« Wenn sie eines draufhatte, dann Schwierigkeiten ausmerzen. Seien sie noch so schmerzhaft. Sie konnte nicht weg, die Vorbereitungen im Hotel Metropol mussten überwacht werden. »Wo liegt das Problem?«