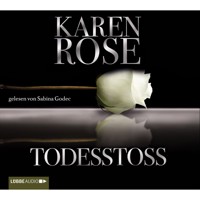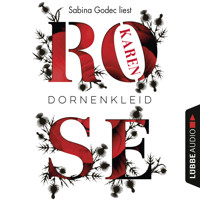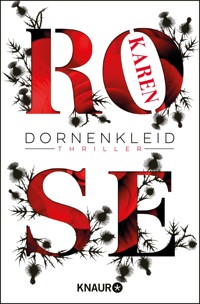
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dornen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein packender Thriller über die dunkelsten Abgründe der menschlichen Seele, der unter die Haut geht. In »Dornenkleid«, dem 2. Buch der Dornen-Thriller-Reihe, beschert Karen Rose einen nervenzerfetzend spannenden Trip in menschliche Abgründe. Ein Thriller, der unter die Haut geht und einen atemlos zurücklässt. Die amerikanische Bestseller-Autorin verbindet pure Spannung immer mit einer Prise Romantik. Cincinnati, Ohio: Der Journalist Marcus O'Bannion ermittelt mit Detective Scarlett Bishop in dem brutalen Mord an einer jungen Philippinerin, die von einem skrupellosen Menschenhändler-Ring als Sex-Sklavin in die USA gelockt wurde. Um ihr Kartell zu verteidigen, gehen die Verbrecher über Leichen. Marcus und die hübsche Scarlett, die anfangs nicht ahnen, wie tief der Strudel aus Gewalt, Sex und Drogen reicht, müssen bald alle Register ziehen, um die Bande zu stoppen, denn auch für sie beginnt ein Kampf um Leben und Tod. Die SPIEGEL-Bestsellerautorin Karen Rose verbindet gekonnt nervenaufreibende Spannung mit einer fesselnden Liebesgeschichte. Ein Pageturner, der alle Fans von Romantic Suspense und Psychothrillern von der ersten bis zur letzten Seite in Atem hält. Die Dornen-Thriller-Serie, die in Cincinnati, Ohio, spielt, ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Dornenmädchen (FBI-Agent Deacon Novak und Faith Corcoran) - Dornenkleid (Marcus O'Bannion und Detective Scarlett Bishop) - Dornenspiel (FBI-Agent Griffin »Decker« Davenport und FBI-Agentin Kate Coppola) - Dornenherz (Detective Adam Kimble und Meredith Fallon) - Dornenpakt (Dr. Dani Novak und Diesel Kennedy)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1145
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Karen Rose
Dornenkleid
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Winter
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein Schuss fällt in der Dunkelheit. Vor Marcus O’Bannions Augen bricht eine junge Frau zusammen. Ihr Name ist Tala. Über Wochen hat er sie ermutigt, sich ihm anzuvertrauen. Weil sie verzweifelt wirkte. Weil sie offensichtlich misshandelt wurde und Marcus ihr helfen wollte. Sie stirbt in seinen Armen.
Marcus, ein Journalist und Ex-Soldat, schwört sich, ihren Mörder zu finden. Gemeinsam mit Detective Scarlett Bishop, der einzigen Polizistin, der er vertraut, legt er sich mit übermächtigen Gegnern an.
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Epilog
Dank
Karen Rose bei Knaur
Eine Liste aller Karen-Rose-Romane in chronologischer Reihenfolge:
Verzeichnis der auftretenden Figuren in den Romanen von Karen Rose
Für den Seestern: Cheryl, Chris, Kathy, Susan und Sheila. Danke für eure Freundschaft, eure Unterstützung und – nicht zu vergessen! – das viele Wörterzählen!
Und für Martin. Ich liebe dich.
Prolog
Wo bleibt er denn? Er hat doch versprochen zu kommen.
Tala rang die aufsteigende Panik nieder und blickte sich verstohlen um. Weit und breit nur Leute aus dieser Gegend, die ihren Geschäften nachgingen. Geschäfte, die zu dieser Nachtzeit wohl kaum legal waren.
Niemand achtete auf sie. Niemand war ihr gefolgt. Zumindest hoffte sie das.
Gib ihm noch eine Minute. Nur noch eine. Angstvoll zog sie sich in den Schatten zurück. Sie musste zurückkehren, ehe jemandem auffiel, dass sie sich davongestohlen hatte.
Denn wenn man sie erwischte … wäre alles aus. Sie hatte nicht nur ihr, sondern auch das Leben ihrer Familie aufs Spiel gesetzt. Dennoch war sie das Risiko eingegangen. Das Baby war es wert.
Für das Baby hätte sie alles getan. Dieses winzige, fröhlich krähende Lebewesen konnte noch nicht wissen, wie schlecht die Welt war. Tala hätte ihre Seele verkauft, um es vor der Hölle zu bewahren, in der sie lebte, seit sie vierzehn Jahre alt war.
Das lag nun drei Jahre zurück. Drei Jahre, in denen sie ein halbes Leben gealtert war. Drei Jahre, die den Augen ihrer Mutter das Leuchten genommen und ihren einst so stolzen Vater in einen Schatten seiner selbst verwandelt hatten. Die Furcht um ihre Kinder hatte die Eltern gelähmt: Sie konnten nichts tun. Das war Tala bewusst. Aber ihr war auch bewusst, dass es so nicht weitergehen konnte. Also hatte sie sich in Geduld gefasst und auf den richtigen Augenblick gewartet.
Und nun war er da. Einen besseren Augenblick würde es nicht geben. Bitte komm doch. Bitte!
Als sie Schritte hinter sich hörte, fuhr sie herum. Panisch versuchte sie, in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Ihr Herz begann zu rasen. Ein großer Mann kam auf sie zu. Tala ballte die Fäuste und verlagerte ihr Gewicht, um notfalls fliehen zu können.
Er näherte sich langsam, vorsichtig und hob die Hände, die Innenflächen nach außen. »Ich bin’s. Ich tu dir nichts.«
Beim Klang seiner Stimme kam ihr Herz zur Ruhe. Diese Stimme war so wunderschön. Als sie ihn damals im Park hatte singen hören, war sie wie gebannt stehen geblieben und hatte gelauscht. Sie hatte diesen albernen Hund ausgeführt, dessen Halsband allein ihre Familie ein Jahr lang hätte ernähren können. Seine Stimme war rein wie die eines Engels gewesen und hatte sie zu Tränen gerührt.
Obwohl sie später dafür bitter bezahlt hatte, blieb sie auch beim nächsten Mal stehen und die ganze folgende Woche, jeden Abend wieder. Das Risiko war es wert. Bald darauf war sie erneut erwischt worden, und diesmal fiel die Strafe sogar noch härter aus.
Dennoch konnte sie einfach nicht anders. Sein Gesang zog sie an und machte sie unvorsichtig. Ihn anzusprechen wagte sie jedoch nicht, nicht einmal, als er sich umdrehte, sie entdeckte und fragte, warum sie weinte.
Sie hatte kein einziges Wort gesagt. Bis jetzt.
Und sie hoffte inständig, dass sie nicht den schlimmsten Fehler ihres Lebens beging.
»Ja«, flüsterte sie. »Ich bin hier.«
Er kam näher, doch sein Gesicht lag noch im Schatten. »Ich bin Marcus«, sagte er schlicht. »Bitte sag mir, warum du weinst.«
Marcus. Sie mochte den Namen. Und, ja, sie vertraute seiner Stimme. Doch nun, da sie vor ihm stand, war ihre Zunge plötzlich wie gelähmt. Sie wich zurück. »Es … es tut mir leid. Ich kann nicht.«
»Geh nicht. Bitte.« Er trat einen Schritt näher auf sie zu, die Hände noch immer erhoben, so dass sie sie sehen konnte. »Wie heißt du?«
Sie schluckte. »Tala.«
Ein kleines aufmunterndes Lächeln erschien auf seinen Lippen. »Ein hübscher Name. Warum weinst du, Tala?«
»Warum weinen Sie?«, gab sie seine Frage zurück, denn sie hatte seine Tränen gesehen, als er sich unbeobachtet geglaubt hatte.
Sein Lächeln verblasste. »Ich habe meinen Bruder verloren. Er wurde ermordet. Er war erst siebzehn.«
Sie schluckte. »Ich auch. Ich bin auch siebzehn.«
Er nickte. »Darf ich dir helfen, Tala?«
»Ich … ich habe kein Geld.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich will kein Geld von dir.«
Oh, dachte sie, als sie plötzlich begriff. Furcht packte sie, und sie wich unwillkürlich einen weiteren Schritt zurück. Doch dann blieb sie stehen, hob das Kinn, lächelte und streckte die Hand nach dem Bund seiner schwarzen Jeans aus. »Ich verstehe«, sagte sie mit rauchiger Stimme. »Jetzt weiß ich, was Sie brauchen.«
Er blinzelte schockiert und machte einen Riesenschritt rückwärts. »Nein! Nicht doch. Du verstehst mich falsch. Ich will nichts von dir. Ich will dir nur helfen.«
Tala ließ die Hände an die Seiten sinken. »Aber warum? Warum wollen Sie mir helfen? Sie kennen mich doch gar nicht.«
Erneut schüttelte er den Kopf. Traurig diesmal. »Spielt das denn eine Rolle?«, murmelte er, dann atmete er hörbar aus. »Warum weinst du, Tala?«
Seine Stimme schien bis in ihre Seele vorzudringen, und plötzlich brannten Tränen in ihren Augen. »Es ist zu gefährlich«, flüsterte sie. »Meine Familie muss sterben, wenn man mich hier erwischt.«
Seine dunklen Brauen zogen sich zusammen. »Warum? Vor wem hast du Angst?«
»Vor dem Mann und seiner Frau. Ich …« Beschämt wandte sie den Blick ab. »Wir gehören ihnen.«
Marcus presste die Kiefer zusammen, und seine Augen verengten sich zu Schlitzen. »Was soll das heißen? Wem gehört ihr?«
Aus dem Augenwinkel sah sie etwas Metallisches im Mondlicht aufleuchten, doch sie reagierte einen Sekundenbruchteil zu spät. Ein Lichtblitz, ein Krachen, der reißende Schmerz in ihrem Bauch, Asphalt, der ihre Haut aufschürfte …
»Tala!«, brüllte Marcus, aber seine Stimme war schon weit weg. Viel zu weit weg. »Stirb nicht, verdammt! Du darfst jetzt nicht sterben!«
Nein, sie wollte nicht sterben. Sie hatte doch noch gar nicht gelebt. Aber ihre Familie … Er musste sie schützen. Unter größter Anstrengung öffnete sie den Mund. »Hilf Mala …« Ihre Lippen bewegten sich, aber kein Laut drang darüber. Sag es ihm. Du musst es ihm sagen. Sie riss sich zusammen, rang nach Luft und stieß das Wort hervor. »Malaya.«
Und dann zerriss eine zweite Detonation die Luft, und etwas Schweres stürzte auf sie. Marcus! Man hatte auch auf ihn geschossen. Wieder rang sie nach Luft, aber es ging nicht mehr.
Jetzt muss ich sterben. Ihre Familie musste sterben. Und der Mann, der Marcus hieß, auch.
1. Kapitel
Detective Scarlett Bishop ließ ihre Jacke absichtlich im Auto liegen. Einerseits war es so heiß und stickig, dass es vollkommen indiskutabel war, mehr Stoff am Leib zu tragen als unbedingt nötig. Andererseits aber war es ihr wichtig, dass man die Waffe in ihrem Schulterholster sehen konnte – am besten schon von weitem.
Ihr stand heute Nacht nicht der Sinn nach Ärger.
Stirnrunzelnd sah sie sich um. Die Straße war wie ausgestorben. Normalerweise wimmelte es hier von Dealern und Prostituierten, und dass jetzt keine einzige Menschenseele zu sehen war, gefiel ihr gar nicht. Etwas hatte das übliche Volk vertrieben, und was immer es gewesen war – etwas Gutes ganz sicher nicht.
Von dem Mann, der sie angerufen und gebeten hatte, allein zu kommen, fehlte jede Spur. Unter normalen Umständen hätte sie das misstrauisch genug gemacht, um Verstärkung anzufordern. Doch auch wenn sie es niemandem eingestehen würde, hatte es sie gründlich aus der Bahn geworfen, nach so langer Zeit seine Stimme zu hören. Obwohl er sie aus dem Tiefschlaf gerissen hatte, war sie sofort hellwach gewesen. Neun Monate lang hatten sie kein Wort miteinander gesprochen. Wozu auch? Sie konnte ihm und seiner Familie ja doch nur in Erinnerung rufen, was sie verloren hatten.
Eben jedoch hatte er sie angerufen. »Könnten Sie sich mit mir treffen? Allein? So bald wie möglich?«
»Und wieso?«
»Es ist … wichtig.«
»Also gut«, hatte sie geantwortet. »Und wo?« Doch da hatte er bereits aufgelegt. Eine Sekunde später war eine SMS eingegangen, in der er ihr diese Straßenecke genannt hatte.
Sein letzter Anruf vor Monaten hatte sie zu vier Leichen geführt. Also hatte sie sich, ohne zu zögern, auf den Weg gemacht.
Aber wo war er?
Die einzigen sichtbaren Lebewesen auf der Straße waren zwei ältere Obdachlose, die sie mit unverhohlener Neugier beobachteten. Sie hatten ihr Nachtlager im Eingang eines mit Brettern vernagelten Hauses aufgeschlagen. Scarlett holte zwei Wasserflaschen aus dem Kofferraum ihres Wagens und überquerte die Straße. Sie kannte Tommy und Edna seit vielen Jahren. Die beiden hatten ihre gesamte Habe in einem Einkaufswagen verstaut und waren meistens hier anzutreffen.
Sie reichte den beiden die Flaschen. »Heiß heute«, sagte sie freundlich.
»Und wie«, antwortete Tommy. Seine Zähne blitzten in seinem dunkelhäutigen Gesicht auf, als er sich mit dem Schraubverschluss abmühte. »Was machen Sie denn so spätnachts noch hier draußen, Miss Scarlett?«, fragte er und zog ihren Namen mahnend in die Länge.
Scarlett schüttelte nachsichtig den Kopf und blickte die Straße entlang. Noch immer keine Spur von ihrem Anrufer. »Und Sie? Was machen Sie bei dieser Hitze hier draußen? Sie wissen ganz genau, dass das nicht gut für Ihr Herz ist.«
Tommy seufzte theatralisch. »Ach, mein Herz ist sowieso kaputt. Sie haben’s mir schon längst gebrochen, Miss Scarlett. Denken Sie doch noch mal über meinen Antrag nach.«
Scarlett grinste. Tommy war ein Schlitzohr, aber sie mochte ihn. »Das würde Ihrem Herzen auch nicht bekommen. Sie verkraften mich gar nicht.«
Tommys Lachen war von jahrelangem Kettenrauchen heiser. »Da haben Sie allerdings recht.« Warnend hob er den Zeigefinger. »Und sagen Sie mir jetzt bloß nicht, ich soll zur Meadow gehen. Da war ich diese Woche schon dreimal. Die kleine Hübsche – Dr. Dani – hat gesagt, ich bin fit wie’n Turnschuh.«
Die Siebzigjährige neben ihm schnaubte. Edna lebte schon so lange auf den Straßen Cincinnatis, wie Scarlett Polizistin war. »Der Kerl redet nur Schrott, aber das stimmt wenigstens – er war letzte Woche in der Meadow. Allerdings nur einmal.«
Scarlett zog die Brauen hoch. »Und hat Dr. Dani tatsächlich behauptet, er sei fit wie ein Turnschuh?«
Edna zuckte die Achseln. »Wie’n ausgelatschter vielleicht.«
Die Meadow war eine städtische Notunterkunft mit angeschlossener Klinik. »Die kleine Hübsche«, Dr. Danika Novak, Ärztin der Notfallambulanz und Schwester von Scarletts Partner Deacon, arbeitete in der Einrichtung und hatte inzwischen fast ihren gesamten Freundeskreis in ehrenamtliche Tätigkeiten eingebunden. Auch Scarlett.
Scarlett schüttelte den Kopf, ließ das Thema aber fallen. Es hatte keinen Sinn. In den vergangenen Jahren hatte sie Edna und Tommy schon mehrmals in Wohnheimen untergebracht, doch die beiden kehrten immer wieder auf die Straße zurück. Was ihrer Gesundheit nicht guttat, Scarletts Ermittlungen aber häufig nützte. Wer die ganze Nacht draußen war, bekam viel mit.
Wieder blickte Scarlett die Straße auf und ab. »Hat es heute Nacht hier irgendwo Ärger gegeben?«
Edna steckte die Wasserflasche in die Tasche ihres Kittels, den sie niemals abzulegen schien, und zeigte nach links. »Vielleicht sollten Sie mal drei Straßen weiter schauen, Herzchen. Da wurde geschossen. Dreimal.«
Scarletts Herz stolperte. »Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt?«
»Sie haben nicht danach gefragt«, erwiderte Edna mit einem Schulterzucken.
»Hier knallt es öfter«, fügte Tommy hinzu. »Wir scheren uns nicht drum, solange niemand auf uns schießt.«
Scarlett unterdrückte ihre aufkommende Verärgerung. »Wann war das?«
»Erst vor ein paar Minuten«, sagte Tommy. »Aber ich weiß es nicht genau. Hab keine Uhr.« Den letzten Satz brüllte er ihr hinterher, da Scarlett bereits losgelaufen war.
Ihr Telefon hatte vor dreizehn Minuten geklingelt. Wenn man auf ihn geschossen hatte, war er vielleicht jetzt schon tot. Bitte nicht! Bitte lass ihn nicht tot sein.
Schlitternd kam sie zum Stehen, als sie die Gasse erreicht hatte und augenblicklich die reglose Gestalt am Boden sah. Das ist er nicht! Das Opfer war zu klein für einen Mann seiner Statur.
Die Waffe in der einen, die Taschenlampe in der anderen Hand, näherte sie sich vorsichtig der Gestalt. Eine Frau, offenbar asiatischer Herkunft. Wer war sie? Und wo war er? Sie leuchtete mit der Lampe in die Gasse, doch niemand sonst war zu sehen.
Scarlett ging neben der Gestalt in die Hocke, und schlagartig sank ihr der Mut. Das Opfer war ein junges Mädchen. Es lag auf dem Rücken und starrte mit weit geöffneten Augen blicklos in den Himmel. Scarlett legte die Taschenlampe auf die Straße, so dass der Strahl auf das Gesicht des Opfers gerichtet war, und zog sich einen Handschuh über die Linke, ohne die Waffe in der Rechten abzulegen.
Sie drückte der jungen Frau zwei Finger an den Hals, fühlte jedoch keinen Puls, was sie nicht überraschte. Lange war sie allerdings nicht tot – die Haut war noch warm.
Der Bauch der Frau war entblößt; jemand hatte das weiße Polohemd unterhalb der Rippen abgetrennt. Eine Kugel war ein paar Zentimeter unter ihrem Brustbein eingedrungen, doch gemessen an dem ausgetretenen Blut, war die Wunde vermutlich nicht unmittelbar tödlich gewesen. Als Todesursache kam sehr viel wahrscheinlicher das kleine Loch in der linken Schläfe in Frage; die Austrittswunde hinter dem rechten Ohr hatte die Größe von Scarletts Faust.
Die Kleine war sehr hübsch gewesen, bevor ihr jemand ein Stück aus dem Kopf geschossen hatte.
Aber er ist es nicht gewesen. Das konnte Scarlett nicht glauben. Du willst es bloß nicht glauben. Na schön, dann eben so. Aber das änderte nichts. Und wo war er?
Sie griff nach der Taschenlampe und leuchtete den Körper des Mädchens ab. Neben der Hüfte lag ein blutdurchtränkter zusammengeknüllter Stofffetzen; jemand hatte mit dem abgeschnittenen T-Shirt das Blut stillen wollen.
»Er hat versucht, dich zu retten«, murmelte Scarlett.
»Leider vergeblich.«
Ihr Kopf fuhr hoch. Er war hier. Der Mann, der seit Monaten ihre Gedanken, ihre Träume beherrschte. Der Mann, der sie nun schon zum zweiten Mal aus heiterem Himmel zu einem Tatort in einem Mordfall gerufen hatte.
Marcus O’Bannion.
Die Waffe in der einen Hand, die Taschenlampe in der anderen, erhob sie sich, drehte sich um und richtete den Lichtstrahl auf die tiefen Schatten der Hausmauern. Er war ganz in Schwarz gekleidet und lehnte mit vor der Brust verschränkten Armen an einer Hauswand. Sein Gesicht war unter dem Schirm einer Baseballkappe verborgen, sein Blick zu Boden gerichtet.
Doch als er nun den Kopf hob, geriet ihr Herz erneut ins Stolpern. Sein Gesicht war aschfahl, seine Miene grimmig. Ohne zu blinzeln, sah er in den Schein der Lampe.
Sie hatte ihn nicht kommen hören, hatte nicht einmal geahnt, dass er dort stand. Nicht viele Menschen konnten sich so lautlos bewegen wie er. Sie wusste, dass er eine Weile beim Militär gewesen war, und was immer er im Dienste für Onkel Sam getan hatte, seine Ausbildung war anscheinend gründlich gewesen.
»Wo kommen Sie denn so plötzlich her?«, fragte Scarlett ruhig, obwohl ihr Puls heftig in ihrer Kehle pochte.
»Von dort drüben«, antwortete er und deutete mit dem Kopf in die Richtung, aus der sie gekommen war.
»Okay – und wieso?«
»Ich bin dem Kerl nachgerannt, der das getan hat«, sagte er tonlos und deutete diesmal mit dem Kopf auf das Mädchen.
Er hatte sich fast nicht bewegt. Scarlett trat einen Schritt auf ihn zu. Aus der Nähe konnte sie sehen, dass er den Rücken krümmte und die Schultern hochzog. Feine Linien zeichneten sich um seine Mundwinkel ab. Er hatte Schmerzen. »Sind Sie verletzt?«
»Nein. Nicht wirklich.«
»Was ist passiert?«
Er blinzelte noch immer nicht. Sein Blick blieb unbeirrt auf das Mädchen gerichtet. »Sie waren sehr schnell hier.«
»Ich wohne in der Nähe.«
Endlich sah er sie an, und sie zog scharf die Luft ein. Genau wie beim ersten Mal war sie wie elektrisiert. Damals hatte er schwer verletzt auf einer Trage gelegen, weil er versucht hatte, das Leben einer Frau zu retten, die er nicht einmal gekannt hatte. Doch trotz seines schlechten Zustands hatten seine Augen – und seine Stimme – sie schlagartig hellwach gemacht und in ihren Bann gezogen. Heute Nacht war es nicht anders.
»Ich weiß«, sagte er leise.
Überrascht kniff sie die Augen zusammen. Bei ihren kurzen Gesprächen damals im Krankenhaus war es nie um etwas so Persönliches gegangen wie um eine Privatadresse. »Was ist passiert? Und wer ist das Mädchen?«
»Das weiß ich nicht. Zumindest nicht genau. Sie hieß Tala.«
»Tala – und weiter?«
»Keine Ahnung. So weit sind wir nicht gekommen.« Er neigte den Kopf, als in der Ferne Sirenen erklangen. »Endlich«, murmelte er.
»Haben Sie die Cops gerufen?«
»Ja. Vor fünf Minuten. Da hat sie noch gelebt.« Er stieß sich von der Wand ab und richtete sich vorsichtig zu voller Größe auf, und Scarlett war erneut überrascht. Mit ihren eins achtundsiebzig musste sie selten aufblicken, um einem Mann in die Augen zu sehen, aber bei ihm schon.
Und erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie ihn noch nie hatte stehen sehen. Bei ihrer ersten Begegnung hatte er auf der Trage gelegen, im Krankenhaus dann im Bett, und an der Beerdigung seines Bruders hatte er im Rollstuhl teilgenommen.
Die Sirenen wurden lauter. »Schnell«, sagte sie. »Erzählen Sie mir, was passiert ist.«
»Sie hat mich gebeten, mich mit ihr zu treffen.«
Scarlett zog die Brauen hoch. »Sie hat Sie gebeten? Sich hier mit ihr zu treffen? Mitten in der Nacht?«
Er nickte knapp. »Das hat mich auch erstaunt. Wir haben uns noch nie zuvor hier getroffen.«
O-kay … »Und wo haben Sie sich bisher getroffen, Marcus?«, fragte sie leise. Vorsichtig.
Seine Augen verengten sich, und er presste die Kiefer zusammen. »Es war nicht so etwas.«
Ihre verdeckte Andeutung hatte ihn verärgert. Tja, Pech für ihn. Er war ein erwachsener Mann, der sich mitten in der Nacht mit einer sehr jungen Frau getroffen hatte. Einer sehr jungen Frau, die nun tot war. »Dann sagen Sie mir doch, was es war.«
»Ich habe sie ein paarmal mit ihrem Hund im Park gesehen, ganz in der Nähe meiner Wohnung. Sie hat immer geweint. Ich habe sie mehrmals darauf angesprochen, aber sie hat mir nie geantwortet, obwohl ihr anzumerken war, dass sie es furchtbar gerne getan hätte. Heute Abend bekam ich eine SMS, in der sie mich bat, mich hier mit ihr zu treffen, die ich auch an Sie weitergeleitet habe. Ich habe Sie angerufen, weil ich dachte, das Mädchen brauchte vielleicht … Schutz. Ich wusste, dass Sie ihm helfen würden.«
Sie gab sich Mühe, seine Worte nicht zu nah an sich herankommen zu lassen. »Aber offensichtlich ist etwas schiefgelaufen.«
»Ja. Offensichtlich«, sagte er verbittert. »Sobald sie zu reden begann, fiel ein Schuss.«
»Die erste Kugel traf sie in den Bauch, richtig?«
»Ja. Ich rannte zum Ende der Gasse.« Er deutete in die entsprechende Richtung. »Aber der Schütze war schon fort. Dann rief ich die Polizei, rannte zurück und versuchte, die Blutung zu stoppen.« Ein Muskel in seinem Kiefer begann zu zucken. »Ich hoffte, dass Sie noch vor den Cops hier eintreffen würden. Ich wollte Sie rasch ins Bild setzen und dann wieder verschwinden.« Er zögerte. »Es war mir klar, dass jeder denken würde, was Sie gerade gedacht haben.«
»War sie eine Prostituierte, Marcus?«, fragte sie geradeheraus.
Er sah ihr direkt in die Augen. »Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie in Schwierigkeiten steckte.«
Er sagte die Wahrheit, dessen war Scarlett sich sicher, aber nicht die ganze. Irgendetwas behielt er für sich, etwas Wichtiges, das spürte sie. »Wie hat sie Kontakt mit Ihnen aufgenommen?«
»Ich habe meine Karte auf der Parkbank liegenlassen.«
Sie zog die Brauen zusammen. »Wieso das? Wieso haben Sie sie ihr nicht einfach gegeben?«
»Weil sie mir nie nah genug kam. Sie hielt immer mindestens zehn Meter Abstand.« Er presste die Lippen zu einem Strich zusammen, und Zorn glomm in seinen dunklen Augen auf. »Und weil sie bei unserer letzten Begegnung humpelte. Sie trug eine Sonnenbrille – mit großen Gläsern. Sie waren allerdings nicht groß genug, um die Prellung an der Wange zu verbergen.«
Scarlett begriff, was er ihr sagen wollte. »Sie ist also misshandelt worden.«
»So sah es in meinen Augen zumindest aus. Als ich sie das letzte Mal sah, sagte ich kein Wort. Ich hielt nur mein Kärtchen hoch, steckte es dann zwischen die Latten der Bank und ging.«
»Wann war das?«
»Gestern Nachmittag. Gegen drei.«
»Okay. Man hat ihr also in den Bauch geschossen, und Sie wollten die Blutung stoppen. Was geschah dann?«
Er sah zur Seite. »Der Mörder muss um uns herumgeschlichen sein. Ich redete auf sie ein, um zu verhindern, dass sie ohnmächtig wurde, bevor Hilfe eintraf, und achtete deshalb nicht auf meine Umgebung. Plötzlich war er hinter uns.« Sein Kehlkopf arbeitete, als er schwer schluckte. »Ich hätte besser aufpassen müssen. Er schoss erst auf mich, dann auf … sie.«
Scarlett holte tief Luft. »Er hat auf Sie geschossen? Wo hat er Sie getroffen?«
»In den Rücken.« Er machte eine wegwerfende Handbewegung, als wäre das keine große Sache. »Aber ich trage eine Schutzweste.«
»Eine Schutzweste«, wiederholte sie kühl, obwohl die Erleichterung ihr Herz höherschlagen ließ. Die Größe der Austrittswunde im Schädel des Opfers deutete auf eine großkalibrige Waffe hin, die aus nächster Nähe abgefeuert worden war. Hätte Marcus keine Weste getragen, hätte sich Scarlett jetzt ein ganz anderes Bild geboten. »Hatten Sie eine gewalttätige Auseinandersetzung erwartet?«
»Nein. Ganz bestimmt nicht. Aber ich trage inzwischen immer eine Weste.«
»Warum das?«, fragte sie.
Überraschenderweise wurde er rot. »Meine Mutter hat mich darum gebeten.«
Das glaubte Scarlett ihm unbesehen. Marcus’ Mutter hatte vor neun Monaten ihren jüngsten Sohn verloren und um ein Haar auch Marcus und seinen Bruder Stone. Dass eine Mutter ihrem Kind ein solches Versprechen abnahm, war nur verständlich.
Blieb allerdings die Frage, wieso seine Mutter davon ausging, er könne noch einmal Ziel eines Anschlags werden. Ihre Haut fing an zu kribbeln, wie immer, wenn ihre Instinkte erwachten, und sie nahm sich vor, der Frage später nachzugehen. »Und weiter?«
»Die Wucht des Projektils warf mich nach vorn. Ich stürzte auf sie.« Er berührte seine Brust und streckte Scarlett den Finger entgegen. Er war dunkelrot. Das schwarze T-Shirt hatte den Fleck verborgen. »Das Blut des Mädchens. Als ich wieder Luft bekam, stemmte ich mich hoch und sah … und sah, dass er sie in die Schläfe geschossen hatte. Ich rappelte mich auf und versuchte, ihn zu erwischen, aber es war niemand mehr zu sehen. Also lief ich einmal um den Block, doch die Schüsse hatten alle von der Straße vertrieben.«
»Also sind Sie zurückgekommen, um auf mich zu warten?«
Er zuckte die Schultern. »Um auf irgendwen zu warten. Auf Sie, den Notarzt oder die Polizei.«
Die in diesem Moment eintraf. Mit quietschenden Reifen kam der Streifenwagen an der Einmündung der Gasse zum Stehen. Zwei Polizisten sprangen heraus und sahen sich suchend um.
Scarlett blickte flüchtig zu ihnen hinüber. Sie brauchte unbedingt noch eine Antwort, bevor die beiden Polizisten sich zu ihnen gesellten. »Sie sagten eben, als sie noch lebte, wollten Sie gehen, sobald ich eintraf. Obwohl sie tot war, sind Sie zurückgekommen. Warum? Erste Hilfe brauchte sie ja nicht mehr, aber der Schütze hätte ebenfalls zurückkehren können. Warum sind Sie das Risiko eingegangen, dass er ein weiteres Mal auf Sie schießt?«
Er blickte auf das tote Mädchen hinab. Seine Miene war ausdruckslos. »Ich wollte sie nicht allein hier zurücklassen.«
Keuchend warf Drake Connor einen Blick über die Schulter, sprang auf der Beifahrerseite in den wartenden Wagen und zog die Tür zu. »Fahr!« Er lehnte sich in den kühlen Luftstrom, der aus der Klimaanlage drang, und versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Wäre er vergangenes Jahr im Wettkampf so gerannt wie eben, würden sich die Pokale in seinem Regal drängen.
Stirnrunzelnd gab Stephanie Gas. »Wo ist sie? Und wieso bist du so verschwitzt?«
Sie kamen viel zu langsam voran. »Fahr doch, verdammt noch mal!« Er packte Stephanies Knie und drückte es herunter, so dass der Mercedes mit quietschenden Reifen einen Satz nach vorn machte.
»Sag mal, spinnst du?« Stephanie trat auf die Bremse, bis sie wieder im Schneckentempo dahinkrochen. »Willst du, dass man uns verhaftet? Wo ist sie?«
Er blickte in den Seitenspiegel und hielt nach blinkenden Blaulichtern Ausschau. Ich hätte sie beide sofort abknallen sollen. Noch immer krampfte sich ihm vor Zorn der Magen zusammen. »Noch in der Gasse.«
»Also hatte ich recht«, sagte Stephanie verächtlich. »Ich wusste doch, dass etwas nicht stimmt. Das Miststück hat uns betrogen. Du hättest sie nicht allein losziehen lassen sollen. Wer wusste schon, was sie und Styx anstellen? Er ist hässlich wie die Nacht, aber er hat einfach den besten Stoff weit und breit. Wahrscheinlich hat er sie flachgelegt.«
Nicht Styx und nicht so, wie du meinst, dachte Drake grimmig, aber liegen tut sie. Und das geschieht ihr nur recht. »Ja, wahrscheinlich.«
Stephanie setzte den Blinker und warf ihm einen misstrauischen Blick zu. »Und das regt dich nicht auf? Styx hat doch bestimmt jede Krankheit, die man überhaupt haben kann – nie im Leben ist der sauber. Wenn sie es ihm für den Stoff umsonst macht, sind doch letztlich wir die Leidtragenden.«
»Dann müssen wir uns eben was anderes einfallen lassen«, stieß er hervor. Als Stephanie zum Abbiegen ansetzte, griff er ihr ins Lenkrad. »Was soll das? Wohin willst du?«
Stephanie blinzelte. »Wir müssen sie holen. Wir können sie doch nicht einfach dalassen.«
»Ich sagte, fahr, verdammt noch mal.« Inzwischen konnte man Sirenen hören. »Die Cops sind im Anmarsch. Bring uns von hier weg, aber schnell.«
Stephanie trat so hart auf die Bremse, dass sie beide ruckartig nach vorn schossen, gehalten von den abrupt einrastenden Gurten. »Die Cops? Wieso? Was hast du getan?«
Er begegnete ihren ängstlich aufgerissenen Augen mit einem harten, kalten Blick. »Sie ist tot. Wenn du also nicht im Knast landen willst, dann sieh zu, dass du endlich Gas gibst.«
»Tot?« Stephanies Mund klappte auf und zu wie ein Fischmaul. »Du hast sie umgebracht? Du hast Tala umgebracht?«
»Das habe ich nicht gesagt!« Er wäre nicht so dumm, die Tat zuzugeben. »Trotzdem wird man es uns in die Schuhe schieben. Also fahr endlich nach Hause, oder ich schwöre bei Gott, dass du genauso enden wirst wie sie.«
Mit zitternden Händen lenkte Stephanie den Wagen zurück auf die Spur. »Warum hast du sie umgebracht?«
»Das habe ich nicht gesagt«, wiederholte er in etwas schärferem Ton.
»Also hast du sie gefunden? Und sie war tot?«
»Ja«, log er.
»Hat Styx sie umgebracht?«
»Kann sein. Ja, vermutlich.«
»Oh, mein Gott. Das ist ja schrecklich. Das ist ja … Oh, Gott! Mom und Dad. Sie werden es herausfinden!« Stephanie atmete nun schwer, hyperventilierte fast. »Die bringen mich um.«
»Sie bringen dich nicht um, denn du reißt dich jetzt zusammen. Niemand findet irgendetwas raus.«
»Weil du das sagst?«, schrie sie ihn an. »Sei kein Vollidiot! Das kommt doch in den Nachrichten. Und meine Eltern sehen Nachrichten!«
In ihrem gegenwärtigen Zustand erinnerte Stephanie an ein blinkendes Neonschild, auf dem »Schuldig« stand. Du musst sie beruhigen, dachte er. Atme tief durch. Entschärf die Situation.
»Na und?«, setzte er an. Sein Tonfall klang nun wieder gelassen. Zuversichtlich. Überzeugend sogar. »Sie ist entwischt. Warum sollte jemand auf die Idee kommen, dass du dahintersteckst, sofern du es nicht selbst erzählst? Sie war ein Junkie, sie brauchte ihren Stoff. Sie ist an den falschen Dealer geraten, und der hat sie und ihren Freund abgeknallt. Basta.«
Stephanie verharrte plötzlich ganz still. »Ihren was?«
»Ihren Freund. Sie war nicht allein in der Gasse.«
Sie stieß schaudernd den Atem aus. »Wer war das?«
»Keine Ahnung. Irgendein älterer Kerl.«
»Ein Cop?«
»Nein, glaube ich nicht. Spielt sowieso keine Rolle mehr. Beide sind tot. Die können nichts mehr erzählen.«
»Aber was, wenn …?« Ihre Stimme war kaum mehr als ein Wispern. »Was, wenn er doch ein Cop war? Und sie ihm alles erzählt hat? Vielleicht hat der Cop es an seinen Partner weitergeleitet. Vielleicht wissen sie von meiner Familie. Vielleicht sind die Cops schon …«
»Du solltest dich besser aufs Fahren konzentrieren«, unterbrach er sie mit eiskalter Ruhe. »Wir wollen doch keinen Unfall bauen, nicht wahr?«
»Nein«, flüsterte Stephanie wie in Trance. »Das wollen wir nicht.«
Sie machte aus einer Mücke einen Elefanten. Es war viel wahrscheinlicher, dass Tala tatsächlich anzuschaffen versucht hatte und der Kerl einfach ein Freier gewesen war. Oder sogar ein Zuhälter. Tala hatte viel zu viel Angst gehabt, um auch nur ein Wort zu sagen. Aber für den Fall, dass Stephanies Ängste doch nicht ganz unbegründet waren …
Selbst wenn der Tote kein Bulle gewesen war, mochte es ein Problem geben, falls er jemandem von dem Treffen mit Tala erzählt hatte. Drake musste also herausfinden, wer das Arschloch gewesen war, woher die beiden sich gekannt hatten und ob er über sie gesprochen hatte.
Scarlett Bishop beobachtete ihn.
Unter normalen Umständen hätte er es durchaus genossen, mit nacktem Oberkörper dem anerkennenden Blick einer schönen Frau ausgesetzt zu sein. Aber es handelte sich nicht um normale Umstände, und Scarlett Bishop war keine gewöhnliche schöne Frau. Sondern Detective bei der Mordkommission.
Im Krankenwagen zu sitzen und sich von einem Sanitäter durchchecken zu lassen, war übrigens auch nicht gerade das, was er unter Genuss verstand. Und leider war Scarlett Bishops Blick auch nicht unbedingt anerkennend. Eher wachsam. Besorgt. Misstrauisch sogar.
Denn Scarlett war klug. Und sah mehr, als ihm lieb war. Sie spürte, dass ihm der Schreck in die Glieder gefahren war. Allerdings nicht, weil die Kugel seinem Leben ebenso gut ein Ende hätte bereiten können, sondern weil er sich einen Moment lang genau das gewünscht hatte.
Ich bin müde. Gier, Gewalt, die Perversionen, denen er überall begegnete – er hatte genug davon. Genug von der Hoffnungslosigkeit in den Augen der Opfer, genug davon, immer wieder zu spät zu kommen. Denn selbst wenn es ihm gelänge, jedes einzelne Opfer zu retten, konnte er doch nicht ungeschehen machen, was man ihnen angetan hatte. Und heute Nacht war ihm die Rettung nicht einmal geglückt.
Tala war unterwegs ins Krankenhaus, wo man nur noch offiziell ihren Tod feststellen konnte. Weil sie ihn um Hilfe gebeten hatte. Ich hätte besser aufpassen müssen. Hätte sie beschützen müssen.
Er hatte gewusst, dass man sie misshandelt hatte. Die Angst in ihren Augen war echt gewesen. Sie hat mir vertraut. Und ich habe versagt.
»Ihr Blutdruck ist normal«, sagte der Sanitäter und nahm die Manschette von seinem nackten Oberarm. »Ihr Puls ebenfalls.«
Marcus rang sich ein knappes Nicken ab. »Danke«, brachte er heiser hervor.
»Sie sollten sich aber unbedingt röntgen lassen«, fuhr der Sanitäter fort. »Auch wenn die Weste eine Fleischwunde verhindert hat, könnten doch ein oder zwei Rippen gebrochen sein.«
Aber Marcus kannte seinen Körper gut. »Nicht nötig«, antwortete er ruhig.
Detective Bishop hatte sich endlich wieder dem Tatort zugewandt. Ausgehend von der Stelle, an der Tala gelegen hatte, begann sie in immer größer werdenden Kreisen die Umgebung abzusuchen. Marcus wusste, dass ihrem Blick kaum etwas entging.
Abrupt begab sie sich in die Hocke und beugte sich vor, um in eine Mauerspalte zu blicken, in der sich offenbar allerhand Unrat angesammelt hatte. Dabei rutschte ihr der schwarze geflochtene Zopf über die Schulter, und ungeduldig streifte sie die Handschuhe ab, wickelte den Zopf zu einer Art Acht und befestigte ihn mit irgendeinem Gummiding, das sie aus ihrer Jeanstasche zog, an ihrem Hinterkopf. Ihre Bewegungen waren schnell und effektiv, was ihn nicht weiter überraschte. Der Zopf reichte ihr bis über die Taille; wahrscheinlich kam er ihr oft in die Quere.
Es wäre praktischer gewesen – von sicherer ganz zu schweigen –, wenn sie ihn sich hätte abschneiden lassen. Ein solcher Zopf war eine Schwachstelle, der in einem Nahkampf dem Gegner die Chance bot, sie bewegungsunfähig zu machen.
Einem Liebhaber dagegen bot er die Chance … – Nein. Stopp! Denk nicht einmal dran. Nicht heute. Aber er dachte bereits daran, so, wie er es in den vergangenen neun Monaten viele, viele Male getan hatte.
Rabiat verdrängte er die Bilder aus seinem Kopf und sah zu, wie sie dem Fotografen der Spurensicherung winkte, auf den Asphalt deutete und sich ein frisches Paar Handschuhe überstreifte, während der Mann ein Bild schoss. Sie griff in den Unrat und zog etwas heraus, das im Licht ihrer Taschenlampe aufleuchtete. Eine Patronenhülse. Eine verdammt große Patronenhülse. Kein Wunder, dass mir der Rücken weh tut.
Sie ließ die Hülse in eine Beweismitteltüte fallen, erhob sich und setzte ihre Suche fort. Sie war genau so, wie er sie in Erinnerung hatte. Groß und stolz. Geschmeidig und anmutig. Stark und doch mitfühlend. Zu mitfühlend vielleicht. Ihre Arbeit schien sie aufzufressen. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen, die nicht auf Schlafmangel zurückzuführen waren. Er kannte diesen ruhelosen Blick nur allzu gut. Er sah ihn jeden Morgen im Spiegel.
Sie war sofort gekommen, als er sie angerufen hatte. Genau wie damals. Und genau wie damals spürte er auch jetzt
eine Verbindung zwischen ihnen, die über körperliche Anziehungskraft hinausging – obwohl er diese nicht einmal zu leugnen versuchte. Welcher Art diese Verbindung zu ihr war, hätte er nicht zu sagen vermocht, aber tief in seinem Inneren wusste er, dass Scarlett Bishop verstehen würde.
Was verstehen würde?, fragte er sich scharf. Mich, gab er sich selbst die Antwort. Sie würde mich verstehen. Die Entscheidungen, die er getroffen hatte. Die Geheimnisse, die er bewahrte. Den schmalen Grat, auf dem er sich bewegte, und die Finsternis, die ihn zu sich rief. All das würde sie verstehen. Vielleicht würde sie ihm sogar helfen wollen.
Was exakt der Grund dafür war, warum er sie bisher in Frieden gelassen hatte und das auch weiterhin tun würde. Denn sosehr er sich auch nach Trost sehnte, sie in den Sumpf hineinzuziehen, war absolut indiskutabel.
In diesem Moment gesellte sich ein Mann mit schneeweißem Haar zu Scarlett: Special Agent Deacon Novak, Scarletts Partner bei der Major Case Enforcement Squad, der gemeinschaftlichen Sondereinheit von FBI und der Polizei von Cincinnati. Tatsächlich kannte Marcus Deacon besser als Scarlett, da dieser mit seiner Cousine Faith liiert war. Bei der letzten Familienfeier hatten Faith und Deacon ihre Verlobung bekanntgegeben. Marcus hatte sich für sie gefreut. Deacon schien ein anständiger Kerl zu sein.
Zu anständig, dachte er. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Deacon die blutrünstigen Rachefantasien gutheißen würde, die Marcus’ Verstand fluteten, als er beobachtete, wie der Techniker der Spurensicherung Marker auf dem Asphalt plazierte, wo aus Talas Wunden Blut und Hirnmasse gesickert war.
Sie war erst siebzehn. Und dennoch hatte man sie wie einen räudigen Köter abgeknallt.
Plötzlich erschien ein Klemmbrett mit einem Formular in seinem Blickfeld und versperrte ihm die Sicht auf den Tatort. »Wenn Sie nicht mit in die Ambulanz kommen wollen, müssen Sie mir das hier unterschreiben«, sagte der Sanitäter beinahe vorwurfsvoll.
»Ich weiß, wie sich eine gebrochene Rippe anfühlt«, sagte Marcus. »Da ist nichts, glauben Sie mir.« Ungehalten unterzeichnete er. Als er wieder aufblickte, sah er Bishop mit Deacon an der Seite auf ihn zukommen.
Marcus kam auf die Füße und verkniff sich eine Grimasse. Sein Rücken tat höllisch weh, aber er hatte seinen Stolz. Es war unangenehm genug, dass er kein Hemd trug, während Scarlett und ihr Partner ordentlich bekleidet waren – Deacon sogar in Anzug und Krawatte! –, und es kam absolut nicht in Frage, dass er sitzen blieb und auf sich herabschauen lassen würde.
Scarlett musterte ihn einen Augenblick lang, dann wandte sie sich an den Sanitäter. »Und?«, fragte sie barsch. »Wie lautet die Diagnose?«
»Prellungen und mögliche Rippenbrüche«, antwortete dieser.
Sie zog die Brauen zusammen. »Und warum ist er dann noch nicht unterwegs in die Notaufnahme?«
Der Sanitäter zuckte die Achseln. »Er will nicht.«
»Es ist lediglich eine Prellung«, brummte Marcus. »Kann ich jetzt bitte mein Hemd wiederhaben?«
Ihr Blick schnellte zu seiner bloßen Brust und kehrte sofort wieder zu seinem Gesicht zurück. »Tut mir leid. T-Shirt und Kevlar-Weste sind Beweisstücke«, sagte sie sachlich. »Aber mein Partner hat Ihnen etwas zum Anziehen mitgebracht.«
»Marcus«, sagte Deacon freundlich.
Marcus nickte. »Deacon.«
Deacon hielt ihm ein schlichtes schwarzes T-Shirt hin. »Freut mich, dass man dich nicht auch abgeknallt hat.«
Marcus biss bei der Erinnerung an die drei Schüsse aus nächster Nähe die Zähne zusammen. »Mich auch«, pflichtete er ihm bei. »Das wäre eine noch größere Schweinerei geworden.« Er zog sich das Shirt über den Kopf und stöhnte unwillkürlich, als ein brennender Schmerz von der Schulter bis in seinen Rücken schoss.
»Sie müssen ins Krankenhaus«, sagte Scarlett fest.
»Nein, muss ich nicht.« Marcus holte probeweise tief Luft und bemerkte erleichtert, dass beide Lungenflügel sich aufblähten. »Ich habe für den Rest meines Lebens genug von Krankenhäusern. Und bei gebrochenen Rippen kann man sowieso nichts tun.« Er nickte dem Sanitäter zu. »Aber danke für Ihre Bemühungen.«
»Auf Ihre eigene Verantwortung«, sagte der Mann, stieg ein, warf kopfschüttelnd die Autotür zu und fuhr davon.
Und dann standen sie zu dritt am Ende der Gasse in einer Blase des Schweigens, während die Kriminaltechniker in fünfzehn Metern Entfernung Spuren sicherten. Scarlett und Deacon warteten auf seine Aussage, das wusste er. Er straffte den Rücken und richtete den Blick auf den blutverschmierten Asphalt vor sich. Er musste vorsichtig sein. Er war müde und hatte Schmerzen, aber vor allem war er erfüllt von brodelndem Zorn. In diesem Zustand enthüllte er womöglich mehr, als er durfte.
Konzentrier dich. Sag ihnen nur, was für die Tat relevant ist. Alles andere geht sie nichts an.
Er räusperte sich. »Sie hieß Tala. Sie war erst siebzehn.«
»Tala – und wie weiter?«, fragte Scarlett. Gott sei Dank trug der Mann endlich wieder ein T-Shirt. Nicht auf seine Brust zu starren, hatte einen Großteil ihrer Konzentration in Anspruch genommen, aber nun konnte sie sich wieder ganz seinen Worten widmen. Und meinen verdammten Job machen. Ein Mädchen war zu Tode gekommen und verdiente Gerechtigkeit und nicht die halbgaren Bemühungen einer Polizistin im Hormonrausch.
Scarlett war froh, dass Deacon eingetroffen war. Vorhin mit Marcus O’Bannion allein in der Gasse war es mit ihrer Professionalität nicht weit her gewesen. Emotionen hatten die Führung übernommen, und auf manch eine Regung war sie alles andere als stolz. Herrgott, zuerst war sie eifersüchtig gewesen, weil er sich mit dem Mädchen getroffen hatte. Dann war sie aus demselben Grund enttäuscht von ihm gewesen. Gleichzeitig aber hatte sie sich fast zwanghaft geweigert, auch nur in Erwägung zu ziehen, dass er irgendwelche unlauteren Beweggründe gehabt haben mochte.
Sie wollte einfach von ganzem Herzen daran glauben, dass er ein guter Mensch war – ihr Held.
»Sie hat keinen Nachnamen genannt.« Marcus sah weder sie noch Deacon an, als er antwortete. Er starrte auf die Stelle, an der das Mädchen gestorben war. »Dazu ist sie nicht mehr gekommen.«
»Was hat sie denn noch gesagt?«, fragte Scarlett.
Marcus presste die Kiefer zusammen. »Dass ihre Familie in Gefahr sei. Und dass sie jemandem gehörten. Einem Mann und einer Frau.«
Scarletts Herz wurde schwer.
Deacon fluchte leise. »Was hat sie damit gemeint?«, fragte er.
»Das wollte ich sie gerade fragen, als der erste Schuss fiel und sie zusammenbrach. Das Einzige, was sie noch sagen konnte, waren ›Hilfe‹ und ›Malaya‹. Dann war sie tot.«
»Malaya.« Deacon tippte bereits aufs Display seines Smartphones. »Vielleicht meinte sie das Land. Das heutige Malaysia.«
»Oder sie hat etwas in einer fremden Sprache gesagt«, wandte Marcus ein. »Malaya bedeutet ›Freiheit‹ auf Tagalog.«
»Tagalog«, murmelte Scarlett. »Eine Sprache auf den Philippinen, richtig?« Das würde passen. Das tote Mädchen war südostasiatischer Herkunft.
Marcus nickte knapp.
Deacon warf ihm einen neugierigen Blick zu. »Du sprichst Tagalog?«
»Nein. So heißt auch eine Zeitung in Manila«, antwortete Marcus.
»Woher weißt du das denn?«, fragte Deacon, noch immer eher neugierig als misstrauisch.
Marcus zuckte die Achseln. »Meine Familie ist seit Generationen im Zeitungsgeschäft. Als ich klein war, las mein Großvater noch vor dem Frühstück fünf verschiedene Tageszeitungen. Außerdem sammelte er Titelseiten mit wichtigen oder besonderen Schlagzeilen. Eine stammte aus der Malaya, sie war von dem Tag, an dem Marcos ins Exil ging. Ich wollte damals wissen, worum es ging, und er erklärte mir, dass ›Malaya‹ Freiheit bedeutet.«
»Das wissen Sie noch?«, fragte Scarlett. »Das ist fast dreißig Jahre her. Sie können damals doch höchstens vier oder fünf Jahre alt gewesen sein.«
Wieder ein Achselzucken. »Ich kann mich an fast alles erinnern, was er gesagt hat. Aber dieses Wort war ihm sehr wichtig. Er war im Krieg auf den Philippinen gewesen und hatte sich dort mit einigen Einheimischen angefreundet. Im Gefängnis in Bataan.«
Scarlett und Deacon verzogen gleichzeitig das Gesicht. »Puh«, murmelte Scarlett.
»Ja. ›Malaya‹ war eins der ersten Wörter, die mein Großvater dort lernte.«
»Also was, glauben Sie, hat Tala gemeint?«, fragte Scarlett.
»Ich schätze, sie wollte, dass ich ihrer Familie helfe. Dummerweise habe ich keine Ahnung, wo ihre Familie steckt.«
»Detective Bishop sagte, du seist Tala im Park begegnet«, bemerkte Deacon.
»Das stimmt nicht ganz. Genau genommen bin ich ihr nie wirklich begegnet. Ich habe sie immer nur gesehen, aber sobald ich sie ansprechen wollte, ist sie weggerannt.«
»Wo liegt dieser Park, und wann hast du sie zum ersten Mal dort gesehen?«
»Der Park befindet sich in der Nähe meiner Wohnung. Vor zwei Wochen ist sie mir zum ersten Mal dort aufgefallen. Gegen ein Uhr nachts.«
Scarlett zog überrascht eine Braue hoch. »Sie gehen nachts um eins im Park spazieren?«
»Normalerweise nicht. Meistens eher am Nachmittag, aber weil es in letzter Zeit so heiß war, bin ich damals erst nach Einbruch der Dunkelheit losgezogen, gegen elf.«
»Joggst du?«, wollte Deacon wissen.
»Früher ja. Aber in den letzten neun Monaten nicht mehr.«
Nicht mehr, seit er beinahe getötet worden war, dachte Scarlett, der sich die Ereignisse jenes Tages in die Erinnerung gebrannt hatten. Eine Kugel hatte seine Lunge durchschlagen, als er versucht hatte, ein junges Mädchen vor einem Serienmörder zu schützen.
Marcus wandte sich wieder dem Schauplatz der Tat zu. »Ich besitze eine ältere Hundedame mit dichtem Fell«, fuhr er fort. »Sie hat ein schwaches Herz und leidet unter der Hitze, daher gehe ich manchmal nachts mit ihr spazieren. Vor zwei Wochen hatte ich lange zu tun auf der Arbeit, und es war schon nach eins, als ich nach Hause kam, aber BB musste raus, also gingen wir in den Park. Und weil weit und breit kein Mensch zu sehen war … na ja.« Er zögerte und zuckte verlegen die Achseln. »Ich saß auf der Bank und ließ den Hund schnuppern, als Tala mit einem Pudel an der Leine vorbeikam. Der Hund hatte so eine typische Modeschur, aber es war das Halsband, das mir sofort ins Auge fiel.«
»Wieso? Trug er eins von diesen reflektierenden Dingern?«, wollte Deacon wissen.
Scarlett war an »Weil weit und breit kein Mensch zu sehen war« hängengeblieben. Wie hätte der Satz weitergehen sollen? Kurioserweise war er schon wieder rot geworden. Aber die Frage musste noch warten.
Marcus schüttelte den Kopf. »Nein. Das Halsband war mit Edelsteinen besetzt.«
Scarlett und Deacon starrten ihn verblüfft an. »Mit Edelsteinen?«, wiederholte sie. »Sind Sie sicher? Nicht eher Strass oder Zirkone?«
»Ziemlich sicher. Auf dem Halsband stand das Label – eines der exklusivsten Juweliere Chicagos.« Er nannte ihnen den Namen. »Als ich dort anrief, sagte man mir allerdings, dass man das Modell schon eine Weile nicht mehr verkauft habe, und riet mir, es bei eBay zu versuchen.«
Scarlett blickte düster. »Wieso erstaunt es mich nicht, dass Sie bereits recherchiert haben?«
Marcus zuckte die Achseln. »Zuerst war ich einfach nur entsetzt. Ich meine, wer lässt denn einen Hund mit so was auf die Straße? Und wieso führt ein Mädchen in diesem Alter zu so später Stunde einen Hund im Park aus? In meinem Kopf schrillten sämtliche Alarmglocken, daher stand ich auf und wollte gehen, aber …« Er seufzte. »Sie weinte.«
»Also bist du geblieben?«, hakte Deacon vorsichtig nach.
Marcus bedachte ihn mit einem scharfen Blick. »Nur lange genug, um sie zu fragen, warum sie weine und ob sie Hilfe brauche. Doch sie wandte sich um und rannte einfach davon. Ich versuchte, ihr zu folgen, aber BB kann nicht mehr gut laufen, und bis ich den Hund eingesammelt hatte, war sie bereits fort.«
»Und wann haben Sie sie wiedergesehen?«, fragte Scarlett.
»Gleich in der nächsten Nacht, aber diesmal nicht aus der Nähe. Es war wieder gegen eins, und ich saß auf der Bank und wartete, aber sie hielt Abstand. Sie trug ein weißes Polo-Shirt, und weil der Hund auch weiß war, konnte ich die beiden durch die Bäume sehen. Wieder rief ich sie, und wieder lief sie weg. In der dritten Nacht dann wagte sie sich nah genug heran, dass ich sie weinen sehen konnte.«
Scarlett betrachtete Marcus’ Gesicht eingehend. Er schien etwas zu verheimlichen. »Wieso, denken Sie, hat sie das getan? Warum ist sie näher gekommen?«
Er zögerte, dann verdrehte er die Augen. »Keine Ahnung. Vielleicht weil ich gesungen habe.«
Wieder starrten sie und Deacon ihn an. »Sie haben gesungen?«, wiederholte sie. »So was wie ein Lied?«
Er bedachte sie mit einem finsteren Blick. »Ja, so was wie ein Lied. In der ersten Nacht war ich ganz allein im Park. Das dachte ich zumindest. Wenn ich allein bin, singe ich manchmal. Ich hoffte, sie würde sich vielleicht herantrauen, wenn ich noch einmal singe.«
Faszinierend. Seine Wangen verfärbten sich, und er zog defensiv die Schultern hoch, als fürchte er, dass sie ihn auslachen würde, doch nichts lag ihr ferner. Auch sie hatte sich von Anfang an von seiner Stimme angezogen gefühlt, obwohl sie ihn nur hatte sprechen hören. Dass er eine fantastische Singstimme zu haben schien, überraschte sie nicht.
»Ich singe auch nur, wenn ich allein bin«, sagte sie trocken. »Allerdings, weil mich niemand hören will. Ich nehme an, dass Tala Sie dagegen hören wollte.«
Etwas Steifheit wich aus seinen Schultern. »Ja, ich schätze, das wollte sie.«
»Was hast du denn gesungen?«, fragte Deacon.
Er presste die Lippen zusammen. »Vince Gill. ›Go Rest High on That Mountain‹.«
Scarlett zog scharf die Luft ein, als ihr plötzlich eng in der Brust wurde. Sie hatte dieses Lied schon auf vielen Beerdigungen gehört, und eine davon verfolgte sie bis heute in ihren Alpträumen.
»Ich verstehe«, flüsterte sie und begegnete seinem Blick. Er nickte. Er glaubte ihr.
Deacon sah verwirrt von einem zum anderen. »Ich nicht. Was ist denn das für ein Lied?«
»Ein Country-Song«, erklärte Scarlett, ohne den Blickkontakt zu lösen. »Vince Gill hat ihn für seinen toten Bruder geschrieben. Er wird oft auf Beerdigungen gespielt. Auch auf der von Marcus’ Bruder lief er.« Sie musste schlucken, als ihre Kehle sich zuzog. »Eine gute Wahl.«
Marcus’ Blick flackerte, und sie glaubte darin einen Hauch Dankbarkeit zu erkennen.
Deacon atmete tief durch. Da er bei der Festnahme des Mörders von Marcus’ Bruder schwer verletzt worden war, hatte er an der Beerdigung nicht teilnehmen können, aber er hatte den Leichnam des Siebzehnjährigen gesehen, als man ihn gefunden hatte. Genau wie Scarlett.
Und Marcus ebenfalls. Scarlett hätte sich gewünscht, dass ihm das erspart geblieben wäre. Den Bruder zusammen mit anderen Toten achtlos verscharrt in einer flachen Grube zu entdecken, musste es ihm so viel schwerer gemacht haben, mit dem Verlust zurechtzukommen. Das wusste Scarlett aus eigener Erfahrung.
»Ach so«, sagte Deacon leise. »Dann war es dieses Lied, das Tala anlockte. Hast du mit ihr sprechen können?«
Marcus blickte wieder zu der Stelle, an der die Leiche gelegen hatte. »Nein. Sie hat bis zum heutigen Abend kein Wort gesagt. Ich bin immer wieder gegen eins in den Park gegangen, weil ich hoffte, sie würde mir letztendlich erzählen, wovor sie solche Angst hatte. Irgendwann nahm ich meine Gitarre mit. Ich dachte, sie fände mich vielleicht weniger bedrohlich, wenn ich etwas in den Händen halte, aber das war nicht der Fall. Sie ließ den Hund so nah an mich herankommen, dass ich ihn streicheln konnte, hielt selbst aber immer einen Abstand von acht Metern ein.«
Acht Meter? Scarlett runzelte die Stirn, doch dann begriff sie. »Der Hund war an einer Flexi-Leine, richtig?« Sie wandte sich an Deacon. »Eine Acht-Meter-Leine nimmt man normalerweise für große Hunde. Ich hab auch so eine für Zat.« Fragend sah sie Marcus an. »Konnten Sie die Hundemarke sehen, als Sie das Tier gestreichelt haben?«
»Nein, nur ein Namensschild am Halsband – ›Coco‹ stand darauf –, aber keine Tollwut- oder Steuermarke. Sieben Nächte hintereinander kam Tala in den Park und hörte mir beim Singen zu, dann blieb sie drei Nächte in Folge weg. Ich begann, zusätzlich tagsüber in den Park zu gehen, und das zu ganz verschiedenen Zeiten, aber erst gestern am späten Nachmittag begegneten wir uns wieder. Also ungefähr vor zwölf Stunden.«
»Sie humpelte«, murmelte Scarlett.
Er nickte zornig. »Ja. Und sie sah aus, als ob man sie verprügelt hätte. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es etwas mit mir zu tun haben könnte, weil ich nie bemerkt habe, dass ihr jemand folgte. Jetzt aber denke ich, dass es doch so gewesen sein muss.« Er verzog verbittert die Lippen. »Andernfalls wäre sie wohl noch am Leben.«
»Detective Bishop sagte, dass du deine Karte auf der Bank hast liegenlassen«, fuhr Deacon fort. »Tala hat dir eine SMS geschickt. Können wir die Telefonnummer haben, mit der sie dich kontaktiert hat?«
Marcus reichte Deacon sein Telefon. »Sie bat mich, sie keinesfalls zurückzurufen. Das habe ich auch nicht getan, aber ich habe die Nummer überprüft.«
Deacon blickte finster. »Du hast die Nummer überprüft? Wie hast du das denn hingekriegt?«
»Ich leite eine Tageszeitung, Deacon«, antwortete Marcus nachsichtig. »Ich weiß, wie ich an Informationen gelange.«
Deacon kniff die Augen zusammen. »Und du willst mir vermutlich nichts Genaueres darüber erzählen.«
»Ganz richtig.«
Deacon schien protestieren zu wollen, klappte aber den Mund wieder zu. »Na schön. Was kannst du uns sonst noch sagen?«
Marcus richtete den Blick wieder auf Scarlett und wirkte plötzlich peinlich berührt. »Auf Ihre Frage, ob sie eine Prostituierte war, habe ich geantwortet, ich wüsste es nicht, und das entspricht der Wahrheit. Allerdings hatte sie Erfahrung damit … Männerwünsche zu erfüllen.« Er seufzte. »Als ich ihr meine Hilfe anbot, glaubte sie zuerst, es gehe mir um Geld, und als ich sagte, ich wolle ihr Geld nicht, huschte ein angeekelter Ausdruck über ihr Gesicht. Aber als hätte man einen Schalter umgelegt, verwandelte sie sich plötzlich in eine Verführerin, die mir an die Wäsche wollte.« Seine Kiefer verhärteten sich.
»Du hast gesagt, sie glaubte, dass ihre Familie in Gefahr war. Hat sie Geschwister erwähnt? Freundinnen?«, fragte Deacon. »Können wir eingrenzen, um was für eine Familie es sich handelt? Geht es wirklich um Blutsverwandte oder möglicherweise um Mitgefangene?«
Marcus schüttelte den Kopf. »Sie sagte nur ›meine Familie‹. Mein erster Gedanke war, dass dieser Mann und seine Frau, von denen sie gesprochen hat, sie dazu zwingen, in irgendeinem Sexgewerbe zu arbeiten.«
Scarlett holte das Foto des Opfers, das sie mit ihrem Handy aufgenommen hatte, auf den Bildschirm und zeigte es Deacon. »Das war auch mein erster Gedanke.«
»Jung und hübsch«, stimmte Deacon zu. »Genau der Typ Frau, der beim Menschenhandel besonders gefragt ist. Wie war sie im Park gekleidet? Trug sie etwas Verführerisches? Ich meine, wirkte sie, als habe sie eben mal die Arbeit unterbrochen, um rasch den Hund auszuführen?«
»Sie trug ein Polohemd und eine abgetragene Jeans«, gab er zurück. »Sie sah aus wie ein ganz normaler Teenager.«
»Der einen Hund mit Diamantenhalsband ausführt«, murmelte Deacon. »Tja, offenbar war ihr die Familie – oder wen auch immer sie zu schützen versuchte – ausgesprochen wichtig. Ihre ›Besitzer‹ vertrauten jedenfalls ausreichend auf ihr Druckmittel, um sie mit dem Hund Gassi zu schicken, ohne fürchten zu müssen, dass sie flieht.«
»Hatte sie einen Akzent?«, fragte Scarlett. »Wie war ihr Englisch? Klang es, als lebe sie schon länger in diesem Land?«
»Sie sprach fehlerfrei, hatte aber in der Tat einen Akzent.« Marcus zog eine dunkle Baseballkappe aus seiner hinteren Jeanstasche. »Aber Sie können sich selbst ein Urteil bilden. Ich habe unsere Unterhaltung aufgenommen.« Er zögerte, dann zuckte er die Achseln. »Ich habe jede Begegnung nach der ersten Nacht aufgezeichnet.«
Scarlett starrte auf die Kappe, dann in seine Augen. »Sie haben ein Mikrofon in der Kappe?«
»Sogar eine Kamera. Sie steckt im Rand des Schirms.«
Deacon starrte ihn verblüfft an. »Warum denn das?«
Marcus presste die Kiefer aufeinander. »Ich wollte etwas in der Hand haben, falls man mich in die Falle zu locken versucht.«
Deacon nahm die Kappe, sah ihn aber unverwandt an. »Und wer sollte dich deiner Meinung nach in eine Falle locken wollen, Marcus?«, fragte er leise.
Marcus straffte den Rücken, und seine Miene nahm jene Ausdruckslosigkeit an, die typisch für Soldaten vor einem Verhör war. »Ich weiß es nicht.«
Er klang frustriert, fand sie. Und aufrichtig. Aber vermutlich wollte sie das nur heraushören. »Vielleicht dieselbe Person, wegen der Sie Ihrer Mutter versprechen mussten, nur mit Kevlar-Weste auf die Straße zu gehen?«
2. Kapitel
Vielleicht dieselbe Person, wegen der Sie Ihrer Mutter versprechen mussten, nur mit Kevlar-Weste auf die Straße zu gehen?
Marcus war einen Moment lang sprachlos vor Verblüffung, doch dann musste er beinahe lächeln. Scarlett Bishop entging wirklich wenig. Also sei umso vorsichtiger. Auch um ihretwillen. »Mag sein. Und bevor Sie noch weiter fragen: Nein, ich weiß nicht, wer ›diese Person‹ ist.«
»Aber es gibt jemanden, der dich bedroht?«, fragte Deacon. »Wieso?«
Auch dem Bundesagenten entging nur wenig. Der Verlobte seiner Cousine hatte einen scharfen Verstand, der ihm Respekt abnötigte. Zusammen waren Scarlett und Deacon ein beängstigend gutes Ermittlerteam. Was ein Grund dafür war, warum Marcus die beiden bewusst und beharrlich gemieden hatte, wann immer es ihm möglich gewesen war. »Ich weiß nicht«, wiederholte er.
»Wer wusste sonst noch, dass du heute Nacht hier sein würdest?«, fragte Deacon.
Wieder zog Marcus verblüfft die Brauen zusammen. »Du glaubst, dass ich das Ziel war?«
»Du bist derjenige, der mit Schutzweste und versteckter Kamera hier aufkreuzt«, erwiderte Deacon trocken. »Sag du’s mir.«
Marcus hatte bisher nicht einmal daran gedacht, doch er sah ein, dass er dies durchaus in Erwägung ziehen musste. Schließlich war es nicht das erste Mal, dass es jemand auf ihn abgesehen hatte. Dass er bis vor neun Monaten nie schwer verletzt worden war, grenzte im Grunde an ein Wunder. Und, ja, er kümmerte sich im Augenblick um diverse Projekte, aber keins davon war ein heißes Eisen, das einen derartigen Anschlag erklärt hätte. In der Vergangenheit dagegen … Nun, da hatte es ganz andere Projekte gegeben. Er war schon vielen auf die Füße getreten.
»Ich bin Zeitungsverleger«, sagte er schließlich zögernd. »Meine Leute veröffentlichen Geschichten, über die manch einer nicht besonders glücklich ist. Wir bekommen immer wieder Drohungen, aber die meisten sind nicht wirklich ernst zu nehmen. Nein, ich glaube nicht, dass ich heute Nacht das anvisierte Ziel war.«
»Leider sind wir diejenigen, die das beurteilen müssen«, sagte Scarlett. Sie war nicht mehr sanft und verständnisvoll, sondern wieder durch und durch Polizistin. »Ein Mädchen wurde umgebracht. Falls eine jener ›Drohungen‹ Ursache dafür war, müssen wir davon wissen. Und speisen Sie mich ja nicht mit Quellenschutz ab«, fuhr sie ihm über den Mund, bevor er genau das tun konnte. »Sie haben mich angerufen, weil Sie wussten, dass das Mädchen Hilfe brauchte. Behindern Sie mich jetzt nicht bei meiner Arbeit.«
Sie hatte recht, wie er zugeben musste. Er hatte sie angerufen, hatte sie in diese Sache hineingezogen. »Sie haben es innerhalb der nächsten Stunde auf dem Schreibtisch.«
»Und was genau bekomme ich?«, fragte sie misstrauisch.
»Eine Liste der Drohungen, die bei uns eingegangen sind.« Zumindest die, die er ihr zu zeigen gewillt war. Einige Drohungen waren lächerlich. Um andere hatten sie sich bereits gekümmert. Wieder andere waren zu aufschlussreich. Er würde die auswählen, die ihm keinen Schaden zufügen konnten. »Wie weit soll ich zurückgehen? Sechs Monate? Ein Jahr? Fünf?«
Sie blinzelte. »Sie führen Listen mit Drohungen gegen Sie?«
»Und gegen meine Leute. Meine Büroleiterin macht das, ja. Für alle Fälle.«
Sie warf Deacon einen raschen Blick zu. »Was denkst du? Drei Jahre?«
Deacon zuckte die Achseln. »Warum nicht? Irgendwo müssen wir ja anfangen.« Seine ungewöhnlichen zweifarbigen Augen musterten Marcus kühl. »Ich brauche deine Waffe.«
Marcus war froh, dass er sich unter den angenehmeren Umständen familiärer Zusammenkünfte an Deacons Aussehen hatte gewöhnen können. Deacon hatte wie seine Schwester das Waardenburg-Syndrom, wodurch sein Haar schneeweiß war und seine Iris heterochrom. Sie war zur Hälfte braun, zur Hälfte blau, und zwar exakt mittig geteilt, und der erste Blick warf die meisten Menschen zunächst aus der Bahn. Marcus ging davon aus, dass Deacon diesen Vorteil bei Verhören bewusst einsetzte, um sein Gegenüber zu überrumpeln. Nicht wenige hatten auf diese Art schon Eingeständnisse gemacht, die sie nachher bereut hatten.
Das würde Marcus nicht passieren. »Wie kommst du darauf, dass ich eine Waffe habe?«
Deacon verdrehte die Augen. »Weil du hier mit Kevlar-Weste und versteckter Kamera aufgekreuzt bist«, wiederholte er ungeduldig. »Du verschwendest meine Zeit, Marcus.«
Das entsprach der Wahrheit, wie Marcus sich eingestehen musste, und plötzlich war ihm das unangenehm. Sobald er ihnen die Pistole aushändigte, brauchten sie ihn nicht mehr. Scarlett würde davongehen, um ihre Arbeit zu erledigen, und er bliebe allein zurück. Das ist doch erbärmlich. Reiß dich zusammen.
»Du hast recht.« Er ließ sich auf ein Knie sinken und zog eine SIG in Taschengröße aus seinem Knöchelholster, dann richtete er sich wieder auf und legte die Waffe Deacon in die ausgestreckte Hand.
Deacon schnupperte am Lauf. »Die ist heute Nacht nicht abgefeuert worden.«
»Nein. Ich habe die Waffe zwar gezogen, aber der Schütze war schon fort. Vor zwei Tagen habe ich sie auf dem Schießstand benutzt. Euer Mann von der Spurensicherung hat mich vorhin auf Pulverreste getestet. Negativ.«
Deacon zuckte nicht mit der Wimper. »Du hättest Handschuhe tragen können.«
»Hätte ich. Habe ich aber nicht.« Er blickte verstohlen zu Scarlett, die ihn aufmerksam beobachtete. Und das auf eine Art, die vielleicht nicht hundertprozentig professionell war. Ihm wurde plötzlich warm.
»Und Ihr Messer?«, fragte sie, und ihr kühler Tonfall stand im Kontrast zu der Glut, die er in ihren Augen zu sehen glaubte.
Verdattert blinzelte er. »Mein Messer?«
»Sie haben ihr das T-Shirt abgeschnitten«, erwiderte sie. »Um damit die Blutung zu stoppen. An Ihrem Messer klebt vermutlich Talas Blut. Wo ist es?«
Verärgert über sich selbst, steckte er die Hand in die Tasche und fischte das Klappmesser heraus. »Das will ich aber zurückhaben«, murmelte er, als er es in die geöffnete Beweismitteltüte in ihrer Hand fallen ließ.
Sie hielt die Tüte ins Licht des Scheinwerfers, den die Spurensicherung aufgestellt hatte, um die Waffe zu begutachten. »Nettes Ding.« Sie blickte zu ihm auf. »Armeebestand?«
Wenn sie wusste, dass er gedient hatte, hatte sie ihn offenbar überprüft. Fragte sich nur, wie gründlich.
»Restposten«, sagte er. Die Halbwahrheit ging ihm geschmeidig über die Lippen. Das Messer, das er Bishop überreicht hatte, war tatsächlich dasselbe, das er im Kampf bei sich gehabt hatte. Es hatte ihm schon oft das Leben gerettet, und als sein Einsatz beendet gewesen war, hatte er es seltsamerweise nicht über sich gebracht, sich davon zu trennen. Also hatte er ein identisches Messer gekauft, dieses mitsamt seiner Ausrüstung zurückgegeben und sein altes behalten. Er trug es bei sich, seit er vom Golf zurückgekehrt war. Einfach so. Na klar, red dir das ruhig ein. Also schön: Er brauchte es, um sich daran festzuhalten. Es war sein Trostspender, sein Talisman, seine ganz persönliche Schmusedecke, und er war Manns genug, es sich einzugestehen.
Meistens jedenfalls.
Eine Pistole mit sich zu führen, hatte er sich allerdings erst angewöhnt, als er schon ein paar Monate bei der Zeitung gearbeitet hatte und hier in Cincinnati um einige Feinde reicher geworden war. Die Liste war im Laufe der Jahre beträchtlich angewachsen, aber er bereute nichts von dem, was er getan hatte.
Bis jetzt. Verdammt, er hoffte inständig, dass Tala das eigentliche Ziel des Schützen gewesen war. Er wollte nicht einmal daran denken, dass sie durch seine Schuld zu Tode gekommen war. Gepeinigt blickte er auf. »Sie war doch fast noch ein Kind.«
Scarletts beinah militärisch stramme Haltung entspannte sich. »Im gleichen Alter wie Ihr Bruder Mikhail«, murmelte sie. »Es tut mir so leid, Marcus.«