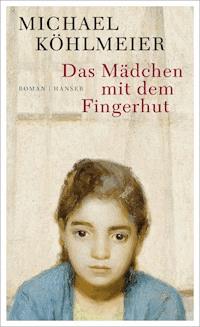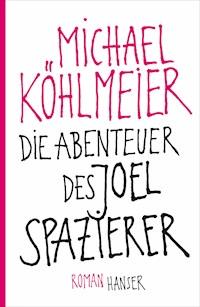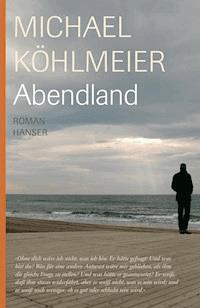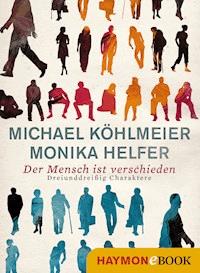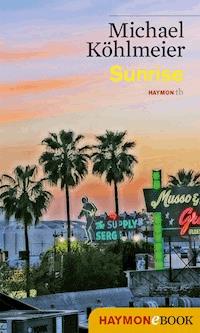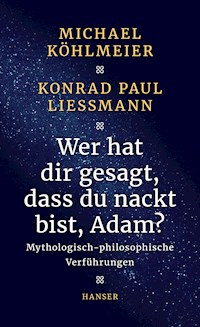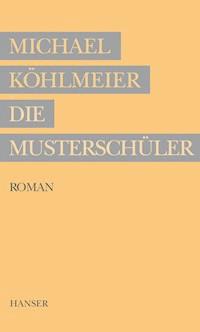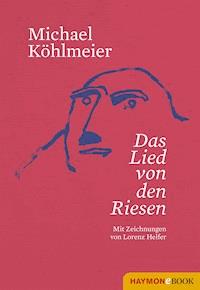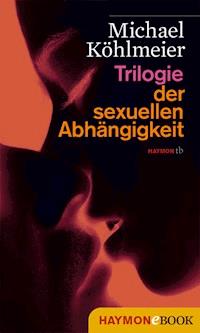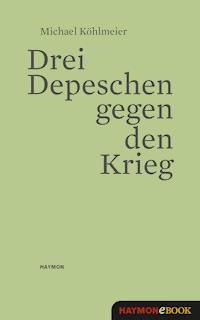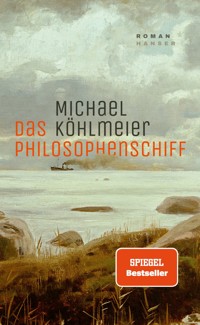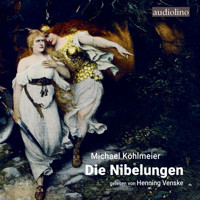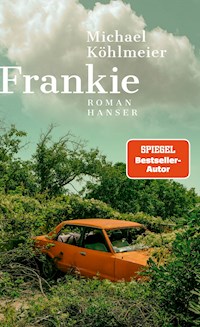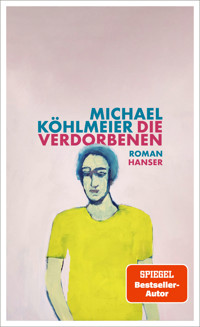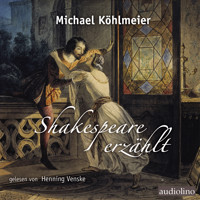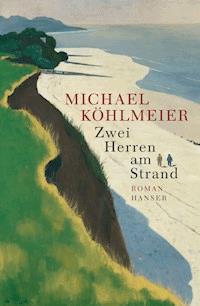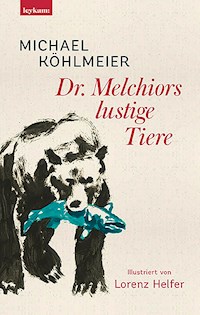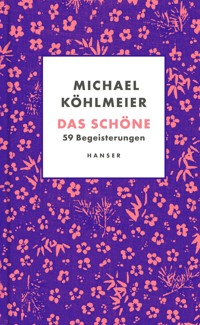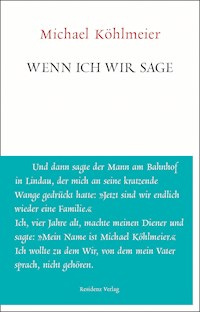Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Buch über das Leben, den Film und die Literatur und über die Geschichten der jahrzehntealten Freunde Robert Dornhelm und Michael Köhlmeier Alles fing an mit Grace Kelly. Sie sprach den Off-Text zu Robert Dornhelms erstem Film, der 1977 für den Oscar nominiert wurde. Alles fing an in einem kleinen Haus, das Dornhelm für Michael Köhlmeier in Hollywood gemietet hatte, damit er Filmstoffe entwickle. Mehr als vierzig Jahre sind sie befreundet, der österreichische Regisseur mit rumänischen Wurzeln und der Schriftsteller. Jetzt haben sie sich 13 Tage lang Zeit genommen, um einander ihre Geschichten zu erzählen, Geschichten zum Weinen komisch und zum Lachen traurig: über Herkunft und Ankunft, über Kapitalisten und Kommunisten, über schöne Mütter und abwesende Väter und immer wieder über Filme, Schauspielerinnen, Bücher. Eine kleine Geschichte des Kinos und eine große Abschweifung des Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Ein Buch über das Leben, den Film und die Literatur und über die Geschichten der jahrzehntealten Freunde Robert Dornhelm und Michael KöhlmeierAlles fing an mit Grace Kelly. Sie sprach den Off-Text zu Robert Dornhelms erstem Film, der 1977 für den Oscar nominiert wurde. Alles fing an in einem kleinen Haus, das Dornhelm für Michael Köhlmeier in Hollywood gemietet hatte, damit er Filmstoffe entwickle.Mehr als vierzig Jahre sind sie befreundet, der österreichische Regisseur mit rumänischen Wurzeln und der Schriftsteller. Jetzt haben sie sich 13 Tage lang Zeit genommen, um einander ihre Geschichten zu erzählen, Geschichten zum Weinen komisch und zum Lachen traurig: über Herkunft und Ankunft, über Kapitalisten und Kommunisten, über schöne Mütter und abwesende Väter und immer wieder über Filme, Schauspielerinnen, Bücher. Eine kleine Geschichte des Kinos und eine große Abschweifung des Lebens.
Michael Köhlmeier
Dornhelm
Roman einer Biografie
Paul Zsolnay Verlag
Nicht fürs Süße, nur fürs Scharfe
und fürs Bittre bin ich da.
Schlag, ihr Leute, nicht die Harfe,
spiel die Ziehharmonika.
Theodor Kramer
ERSTER TAG
»Robert?«
»Micki?«
»Wie lange kennen wir uns schon, Robert?«
»Seit Anfang der achtziger Jahre?«
»Als wir uns kennengelernt haben, hast du gerade Lynn geheiratet.«
»Ja, Anfang der achtziger Jahre.«
»Du hast mir erzählt, dass du am Abend deiner Hochzeit in dem teuren Strandhaus deiner Schwiegermutter in der Colony in Malibu dich in den Jacuzzi gelegt, eine dicke Zigarre angezündet und einen Cognac getrunken hast …«
»Und dann ist mir schlecht geworden. Das habe ich dir erzählt?«
»Hast du, Robert. Ich war das erste Mal in Amerika. Nur in klimatisierten Räumen. Erst am dritten Tag bin ich auf die Straße. Das war in Westhollywood, in einem kleinen Haus …«
»… das Harald und ich gemietet haben. Snowball Productions … damit dort ein Autor Filmstoffe entwickelt … Wir haben große Hoffnungen in dich gesetzt.«
»Wie fangen wir an, Robert?«
»Ich schlage vor, wir reden einfach drauflos.«
»Vom Hundertsten ins Tausendste. Das gefällt mir. Wie man halt so redet. Wie viel Zeit haben wir, Robert?«
»Bis zum 11.«
»Das sind dreizehn Tage.«
»So habe ich es mir ausgerechnet. Dann fliege ich nach Los Angeles zurück.«
»Genügend Zeit. Dann los!«
»Ich würde mit einer heiteren Geschichte beginnen, Micki. Wenn du einen Film drehst oder ein Drehbuch schreibst und du weißt, dass der Film über große Strecken ernst wird, sogar traurig, erschreckend manchmal, weil jedes Leben über große Strecken ernst und traurig ist und manchmal erschreckend, dann bist du gut beraten, wenn du mit etwas Heiterem beginnst.«
»Die Geschichte mit dem Jacuzzi ist doch heiter.«
»Es ist eigentlich keine von den möglichen Geschichten, an die ich denke, die wir als Einstieg erzählen könnten. Die Geschichte, die ich erzählen möchte, hat mit Grace Kelly zu tun. Ich will aber nicht den Eindruck erwecken, dass ich schon gleich am Anfang mit großen Namen um mich werfe. Dass ich angeben will. Sie war eine gute Freundin, und dass sie ein Weltstar war, das hat sicher am Beginn unserer Freundschaft eine Rolle gespielt. Ich war sehr beeindruckt. Aber sie hatte überhaupt keine Allüren. Sie hat mir gleich jede Schüchternheit genommen. Wie ich sie kennengelernt habe, das erzähle ich dir später. Wenn es dich interessiert. Wenn es in dein Buch passt. Das war 1977. Ein Glücksjahr für mich. Mein Einstieg in die internationale Filmszene. Für mich war die Begegnung mit Grace Kelly sehr wichtig. Nicht nur für meine Karriere. Sie war, wie gesagt, eine Freundin, eine wirklich gute Freundin. Und ich glaube, ich war auch ein guter Freund. Kannst du bestätigen, Micki, dass ich zu loyaler Freundschaft neige?«
»Das kann ich bestätigen. Ich sage es gern und laut: Ich kann bestätigen, dass Mr. Robert Dornhelm zu loyaler Freundschaft neigt.«
»Grace Kelly hat den Off-Text zu meinem Film Die Kinder der Theaterstraße gesprochen. Für den Film habe ich dann eine Oscar-Nominierung bekommen. Mein erster Film … Jedenfalls, was ich erzählen will …«
»… den heiteren Opener zu unserem Buch …«
»Ja … Im Jahr 1979, also zwei Jahre später, wurde von der Uno das Jahr des Kindes ausgerufen. Grace Kelly wandte sich an den Produzenten Sam Spiegel. Sie hatte die Idee, einen Film über Wunderkinder zu machen. Sie meinte, ich soll Regie führen. Da schwirrt einem der Kopf! Grace war eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt. Damals hat sie schon nicht mehr gespielt. Sie war Gracia Patricia Grimaldi, Fürstin von Monaco. Sie hat mit Clark Gable gespielt, sie hat den Oscar bekommen für Ein Mädchen vom Lande, da waren ihre Partner Bing Crosby und William Holden. Oder der größte aller Western, Zwölf Uhr mittags, High Noon im Original, an der Seite von Gary Cooper, Regie Fred Zinnemann. Das war das klassische Hollywood! Die große Illusionsfabrik, die selbst eine Illusion war. Wenn die Namen dieser Stars genannt wurden, dann war es, als ob es die in Wirklichkeit gar nicht gäbe, als ob die selbst Figuren aus Filmen wären. Mythische Figuren. Und dann wünscht sich einer dieser Stars, dass der kleine Robert Dornhelm, ein Flüchtlingskind aus Temeswar, Regie bei einem Millionenprojekt führt. Und ein gewisser Sam Spiegel soll den Film produzieren. Wer ist dieser gewisse Sam Spiegel? Grace hat von Sam Spiegel gesprochen, als würde jeder Mensch auf der Welt ihn kennen. Als müsste jeder ihn kennen! Ich habe genickt und begeistert getan. Aber ich kannte Sam Spiegel nicht. Ich wusste nicht, wer er war. Jeder kennt mindestens ein Dutzend Schauspieler und ein Dutzend Schauspielerinnen. Auch Leute, die sich nicht besonders für Film interessieren, die Schauspieler aber kennen sie. Regisseure kennt man schon weniger. Wenn du fragst, wer den Film Casablanca kennt, dann werden die meisten ihn kennen, und die meisten werden sagen, das ist der Film, in dem Humphrey Bogart und Ingrid Bergman spielen. Und dann frag weiter: Wer war der Regisseur? Das wissen dann nur noch wenige.«
»Michael Curtiz.«
»Aber weißt du auch, wer das Drehbuch geschrieben hat?«
»Nein.«
»Micki! Du bist Schriftsteller und weißt nicht, wer das Drehbuch zu einem der bekanntesten Filme aller Zeiten geschrieben hat? Interessierst du dich nicht für die Arbeit deiner Kollegen?«
»Ich werde in mich gehen, Robert, ich verspreche es. Wer hat das Drehbuch geschrieben?«
»Ich weiß es auch nicht. Siehst du. Ich weiß nur, es waren drei Autoren. Es sind meistens drei Autoren. Einer schreibt die Handlung, der zweite die Dialoge, der dritte die Actionszenen.«
»Wie bei unserem Buch. Ich schreibe die Dialoge, du die Handlung …«
»Und wer schreibt die Actionszenen?«
»Wer?«
»Das Leben, Micki, das Leben.«
»Das ist Kitsch.«
»Da hast du recht. Im Übrigen — bitte, eines dürfen wir nicht tun, Micki! Bitte nicht ein Buch schreiben, das den Gesetzen des Drehbuchschreibens folgt. Wir müssen ein Buch schreiben, über das Syd Field entsetzt wäre.«
»Wer ist Syd Field, Robert?«
»Er kennt Syd Field nicht! Meine Güte, Micki, was soll aus dir werden? Du kennst den Papst der Drehbuchtheorie nicht!«
»Ist das furchtbar?«
»Das ist furchtbar! Aber ich bin froh, dass du ihn nicht kennst. Der würde dir jetzt ganz genau sagen, wie du unser Buch schreiben sollst. Anfang, Mittelteil mit Höhepunkt und dann der Schluss. Jean-Luc Godard hat gesagt, eine Geschichte muss einen Anfang, einen Höhepunkt und einen Schluss haben, aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.«
»Weekend von Godard hat mich sehr beeindruckt. Ist das der Film, in dem die Rolling Stones vorkommen?«
»Nein, das ist One Plus One, 1968. Ich gebe Godard recht. Eine Geschichte läuft nicht immer nach diesem klassischen Schema ab. Ein Leben schon gar nicht. Meines nicht.«
»Gibt es ein Leben, das so abläuft?«
»Syd Field würde antworten: In der Erinnerung läuft jede Geschichte so ab. Er würde sagen: Was ist ein Leben? Es ist die Erinnerung daran. Und die Erinnerung wählt aus, und sie wählt nach dramaturgischen Gesichtspunkten aus. Es war einmal. Mister Field würde dir beweisen, dass auch Anna Karenina von Tolstoi und auch Krieg und Frieden und die Odyssee von Homer genau nach diesem Schema aufgebaut sind: Anfang, Mittelteil mit Höhepunkt und Schluss. Und zwar genau in dieser Reihenfolge.«
»Wenn dein Leben ein Film wäre …«
»… wer wäre dann der Produzent? Willst du das fragen? Das frage ich mich auch.«
»Und wer?«
»Eben. Siehst du? Das weiß niemand. Der liebe Gott. Wer war der Produzent von Casablanca? Weißt du das, Micki?«
»Keine Ahnung.«
»Den Produzenten kennt niemand. Dann noch eher den Drehbuchautor. Jeder weiß, es gibt den Produzenten, aber keiner kennt ihn. Jeder weiß, ohne den Produzenten würde es den Film nicht geben, aber keine Seele kennt ihn. Darum verdienen die Produzenten am meisten an einem Film. Das ist Schmerzensgeld. Sam Spiegel war ein interessanter Mann. Einer der größten Produzenten, die Hollywood hervorgebracht hat. Sein Leben ist ein Beispiel dafür, wie Juden auf der Welt herumgetrieben wurden und dabei Karriere machten. Ein polnischer Jude. Eigentlich ein kaiserlich österreich-ungarischer Jude. In Jarosław geboren. Als mir Grace Kelly von ihm erzählte, und dass er den Film über die Wunderkinder produzieren möchte — er war ein guter Freund von ihr, ein Kumpel, wie der Deutsche sagt —, da habe ich mich gleich kundig gemacht. Damit ich mich nicht blamiere. Ich war so etwas von ahnungslos, Micki, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe etliche seiner Filme gekannt, klar. Das schon. Zum Beispiel Die Faust im Nacken mit Marlon Brando. Ich wusste sogar, dass Elia Kazan bei diesem Film Regie geführt hat. Aber wer war der Produzent? Keine Ahnung! Oder Die Brücke am Kwai mit Alec Guinness und William Holden, Regie David Lean. Und natürlich Lawrence von Arabien mit Peter O’Toole und Omar Sharif und Anthony Quinn, Regie ebenfalls David Lean. Aber der Produzent? Keine Ahnung! Stell dir vor, Grace Kelly hätte mir Sam Spiegel vorgestellt und er hätte mich nach seinen Filmen ausgefragt. Und ich hätte geantwortet: Ich weiß nicht. Aber nicht, weil ich die Filme nicht gekannt hätte, sondern weil ich ihn nicht gekannt habe. Die Stadt in Polen, in der Sam Spiegel geboren wurde, die vor dem Ersten Weltkrieg zu Österreich-Ungarn gehörte, die war klein, zwanzigtausend Einwohner, viel mehr nicht, und gut ein Drittel Juden oder sogar mehr. Die Nazis haben dann zehntausend abtransportiert, aus der Stadt und aus der Umgebung, nach Auschwitz oder Majdanek oder Treblinka oder Sobibór. Bis der ganze Bezirk judenfrei war. Was für ein Wort! Aber der Antisemitismus war vorher schon da. Der typische polnische Antisemitismus. Diesbezüglich haben die Nazis nicht viel Überzeugungsarbeit leisten müssen bei der nichtjüdischen Bevölkerung. Du kennst doch Maus von Art Spiegelman, Die Geschichte eines Überlebenden. Den Comic. Die Juden sind Mäuse, die Deutschen Katzen — Katz und Maus, das liegt auf der Hand. Die Amerikaner sind Hunde. Und die Polen, die Polen sind die Schweine. Als der Comic in Polen herauskam, da haben sie Feuer angezündet und die Bücher verbrannt. Ja, einige haben das gemacht. Es gab heftige Diskussionen. Sogar von offizieller Seite ist gegen Art Spiegelman protestiert worden. Die Regierung hat protestiert. Man hat eine Entschuldigung von den Amerikanern gefordert. Wann war das? Weißt du das, Micki?«
»Der Comic ist Ende der neunziger Jahre herausgekommen. Bei uns. In deutscher Übersetzung. Ich erinnere mich sehr genau. Ich habe mir das Buch sofort besorgt.«
»In Amerika früher. Ich weiß nicht, wann in Polen. Über den polnischen Widerstand ist geredet worden in dem Comic. Bezweifelt ja niemand, dass es den gegeben hat. Aber auch unter den polnischen Widerständlern hat es Antisemiten gegeben. Das will man nicht wissen. Das wollte man nicht wissen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Sam Spiegel hat, wie viele andere Juden, schon in jungen Jahren Polen verlassen, lange, bevor die Nazis das Land überfallen haben. Als ich herausgefunden habe, wer er ist, dieser Mann, da war ich beschämt, weil ich gar nichts über ihn wusste. Sam Spiegel ist vor den Antisemiten in seinem Land und später vor Hitler davongerannt, durch ganz Europa, bis hinüber nach Hollywood. Er selber soll gesagt haben, er verdanke seine Karriere Adolf Hitler. Das ist jüdischer Humor, Micki!«
»Angeblich — als Scherz — soll man an der Universität Princeton in New Jersey überlegt haben, auf dem Campus ein Denkmal für Adolf Hitler zu errichten. Schließlich sei es ihm zu verdanken, dass die Elite der deutschen Mathematiker und Physiker nach Princeton übersiedelt sei. Auch ein Scherz. Ein Witz. Albert Einstein lehrte und forschte dort. Hermann Weyl, Emmy Noether …«
»Das hätten sie in Hollywood auch machen können. Die Regisseure Ernst Lubitsch, Wilhelm Dieterle, Fritz Lang, Billy Wilder, Robert Siodmak, Walter Reisch, Helmut Dantine. Schauspieler jede Menge, sind alle vor Hitler nach Hollywood geflohen. Marlene Dietrich. Peter Lorre — Hauptrolle in dem Film M — Eine Stadt sucht einen Mörder. Ich mag den Lorre sehr. Zuerst wollten ihn die Nazis hätscheln, dann haben sie herausgekriegt, dass er Jude ist. Er war ein Lieblingsschauspieler von Goebbels. Sein Schicksal hat mich immer gerührt. Dem Morphium war er verfallen. Goebbels hat gewusst, dass er Jude ist. László Loewenstein hat er geheißen. Dem Goebbels hat gefallen, wie er den Mörder in M spielt. Nach dem Film wollte er Fritz Lang, dem Regisseur, die Leitung des deutschen Films übertragen. Leiter der Reichsfilmstelle oder so etwas. Er wollte ihn überreden, den Schluss von M anders zu gestalten. Dass die Volkswut den Peter Lorre umbringt. Das hätte dem Goebbels gefallen. Und dem Volkskanzler, dem Führer, hätte es auch gefallen. Ein sogenannter demokratischer Schluss. Der Mob als Volk. Das Volk als Mob. Fritz Lang hat zum Goebbels gesagt: Hör zu, du, ich muss einen Tag darüber nachdenken. Und am selben Tag hat er die Koffer gepackt und ist davon. Ich schätze, damit er der Versuchung nicht erliegt. Er hätte bleiben können. Er war kein Jude. Er hätte eine Riesenkarriere unter den Nazis machen können. Hat ja damals keiner gewusst, dass es 1945 aus ist mit denen. Da hat er sich gedacht, ich muss sofort abhauen, sonst ist die Versuchung zu groß. Marlene Dietrich ist schon vorher abgehauen. Auch sie hätte nicht müssen. Eine Vorzeigearierin. Aber sie war nie in Versuchung, den Nazis in den Arsch zu kriechen. Sie nicht.«
»Der Teufel hat einen langen Löffel. Mit dem soll man nicht frühstücken. Kennst du den Spruch, Robert? Das hat meine Mutter immer gesagt.«
»Da hat sie recht gehabt, Micki. Zuerst ist er nach Paris, dann in die USA, der Fritz Lang. Goebbels war ein Fan von seinen Filmen. Metropolis. Das war ganz nach dem Geschmack der Nazis. Und natürlich Die Nibelungen. Angeblich hat Goebbels dem Peter Lorre vorgeschlagen, ihn zum Arier zu machen. Der Bösewicht-Arier sozusagen. Das wollte Lorre aber nicht. Da hat ihm Goebbels geraten, Deutschland zu verlassen. Gutwillig geraten. Er hat ihm sogar angeboten, ihm dabei zu helfen. So ein Fan war er. Lorre hat gesagt: Danke, Herr Minister, aber das kann ich selber. Eine Szene mit den beiden … das könnte ein großartiger Dialog sein … Joseph Goebbels schlägt Peter Lorre vor, ihm bei der Flucht aus Deutschland zu helfen. Mich würde interessieren, wie man jemanden zu einem Arier macht, der keiner ist.«
»Man sagt einfach, du bist einer.«
»Wer sagt das?«
»Der oberste Ariermacher. Den hat es gegeben, ja.«
»Peter Lorre hat auch in Casablanca mitgespielt. In dem Film hat eine ganze Reihe deutscher und österreichischer Emigranten mitgespielt. Paul Henreid hat den Victor László gespielt, den Widerständler, Conrad Veidt den Major Strasser …«
»… Major Strasser vom Dritten Reich! … so wird er im Film immer wieder vorgestellt …«
»… bis er sagt: Warum betonen Sie das Dritte Reich so sehr, warten Sie auf ein viertes?«
»Und Capitaine Louis Renault von der französischen Verwaltung der Stadt antwortet: Ich nehme, was kommt … oder so ähnlich …«
»Conrad Veidt, der arme Mann, hat in Hollywood immer wieder Nazis spielen müssen … Ist von den Nazis abgehauen und hat dann Nazis gespielt. Ähnlich ging es meinem Freund Helmut Dantine, er hatte übrigens auch eine kleine Rolle in Casablanca.«
»Wir schweifen ab, Robert.«
»Das tun wir nicht, Micki! Nein, das tun wir nicht! Wir sprechen über Film! Und Film ist mein Leben. Mein Beruf und mein Leben. Können wir über dich reden, ohne über Literatur zu reden?«
»Du hast recht, Robert. Wieder hast du recht.«
»Wir sprechen über Sam Spiegel, und über Sam Spiegel zu sprechen kann nie eine Abschweifung sein. Auch über Peter Lorre zu sprechen kann keine Abschweifung sein. Erst recht nicht, über Fritz Lang zu sprechen. Wir könnten auch über Marlene Dietrich sprechen, es wäre ganz bestimmt keine Abschweifung. Wir könnten uns am Abend einen Film mit Marlene Dietrich anschauen. Was hältst du davon? Welchen magst du am liebsten, Micki?«
»Eindeutig: Zeugin der Anklage.«
»Den mag ich auch am liebsten. Oder wir schauen uns M an. Was für eine unglaubliche Szene, als Peter Lorre am Ende vor den versammelten Verbrechern der Stadt ein Geständnis ablegt, dass er nicht anders kann, als zu morden … Über diesen Schauspieler zu sprechen kann, nie und nimmer eine Abschweifung sein … Aber gut, Micki, seien wir diszipliniert! Wo waren wir stehengeblieben?«
»Bei dem Film über die Wunderkinder …«
»Als Drehbuchautor hatten sich Grace Kelly und Sam Spiegel Roald Dahl gewünscht. Ich sollte ihn in England besuchen und ihn von unserer Sache überzeugen. Den Unerfahrensten haben sie geschickt! Ich fuhr also nach England. Noch in der offenen Tür sagte Roald Dahl: Ja. Ja, das mach’ ich. Der Agent von Grace, Jay Kantor, hatte bereits mit ihm telefoniert. Er wusste also so ungefähr, worum es ging. Er sagte: Ja, das mache ich … wenn! Wenn was? Wenn ich, und zwar jetzt gleich, noch bevor ich den Mantel ablege, Grace Kelly anrufe und sie frage, ob seine Frau während der Dreharbeiten zu dem Film Bright Leaf eine Affäre mit Gary Cooper gehabt habe. Wie bitte? Ich stand noch in der Tür. Ich wusste nicht, wovon er redet. Nun bat er mich herein, den Mantel ließ ich an. Ich wusste natürlich auch nicht, wer Patricia Neal war. Roald Dahl war mit Patricia Neal verheiratet. Sie war ein Star. Oder war einer gewesen. Der Film Bright Leaf war 1950 herausgekommen. Also mehr als fünfundzwanzig Jahre, zuvor! Da war ich zarte drei Jahre alt gewesen! Regie hat übrigens Michael Curtiz geführt, siehe Casablanca. Offensichtlich hat den lieben Roald Dahl der Gedanke all die Jahre gequält: Hat sie oder hat sie nicht? Wie stellst du dir Gary Cooper mit einer Frau im Bett vor? Wie sollte jemand als Liebhaber je an Gary Cooper heranreichen? Diese Frage hat den Roald Dahl all die Jahre gequält. Er brachte das Telefon an einer langen Schnur und hielt es mir hin. Ich soll anrufen, sagte er. Jetzt! Ich soll Grace Kelly anrufen, sagte er. Sie muss es wissen. Sie war eine Freundin seiner Frau. Ihr hat sie sicher alles erzählt. Auf der Stelle soll ich Grace Kelly anrufen. Sonst könne ich gleich wieder abzischen. Brauche erst gar nicht den Mantel auszuziehen! Also! Den Mantel habe ich eh angelassen …«
»Und? Hast du angerufen, Robert?«
»Die Situation war so grotesk, dass ich zunächst glaubte, der Mann macht einen Scherz mit mir. Die Engländer sind so. Und je reicher ein Engländer, desto exaltierter. Der Mann hat mehr als hundert Millionen Bücher verkauft. Warum macht sich dieser Mann lustig über mich? Ich wurde zornig. Hab mich natürlich zurückgehalten. Aber ich sagte: Warum fragen Sie ihre Frau nicht selbst? Ich rechnete damit, dass er an diesem Punkt in Gelächter ausbricht … oder dass er mich rauswirft. Eines von beiden. Aber es wurde ganz anders. Er sah mich lange an, atmete tief und setzte sich auf einen der Sessel, geschmacklos riesiges Blumenmuster, und auf einmal war er ganz klein. Der Sessel war grauenhaft, ja, aber die Wohnung sonst, die war sehr geschmackvoll eingerichtet. Erlesen! Viel Kunst. Ein kleines Museum der Moderne. Russische Avantgarde. Da war zum Beispiel ein Kandinsky, zwei Meter mal zwei Meter. Dann noch zwei kleinere. Angeblich hat der Hausherr Wassily Kandinsky gekannt. Aber auch ein Bild von Marc Chagall war da. Ein Malewitsch. Den Chagall soll er auch gekannt haben. Ich habe von dem Sessel gesprochen. Ein Ungetüm und hässlich. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, das ist Absicht. Ästhetische Absicht. Verstehst du? Um auf die Schönheit hinzuweisen, musst du einen Kontrast herstellen. Wenn alles schön, nur schön ist, dann geht die Schönheit unter. Ein merkwürdiges Phänomen. Darum der Sessel. Ich denke, ein wirklich großartiges Kunstwerk muss einen Fehler haben, wenigstens einen. Fehler ist das falsche Wort. Such dir ein anderes. Perfekte Kunst ist Kunsthandwerk. Wo war ich stehengeblieben?«
»Du hast Roald Dahl gefragt, warum er nicht selbst seine Frau fragt, ob sie mit Gary Cooper gevögelt hat.«
»So habe ich mich nicht ausgedrückt.«
»Wie?«
»Ich sagte nur: Warum fragen Sie nicht selbst Ihre Frau. Ohne den folgenden Nebensatz.«
»Und?«
»Er sank in sich zusammen. Ich stand neben ihm, immer noch im Mantel. Er immer noch das Telefon in der Hand. Das geht nicht, seufzte er, dann gibt es Streit. Und der Streit hört erst auf, wenn sie weint. So sei er. Er mache die Menschen nieder. Rhetorisch. Vor allem seine Frau mache er rhetorisch nieder. Dann weine sie. Dann breche sie zusammen. Dann sage sie, sie sei nichts wert. Dann sage sie, sie wolle nicht mehr leben. Und sie meine das ernst. Und dann bange er um ihr Leben. Er entschuldige sich, knie vor ihr nieder. Einen Selbstmordversuch habe sie bereits hinter sich. Und er sei schuld … Das sprudelte aus ihm heraus, während ich neben ihm stand. Er hat mir leidgetan. Ein gebrochener Mann. Ich stellte mir vor, wie ihm die Eifersucht in all diesen Jahren zugesetzt haben muss — fünfundzwanzig Jahre! Wie ihn diese Frage gemartert haben muss. Hat sie, oder hat sie nicht? Er kann ja nichts dafür, wie er ist, dachte ich. Er bemüht sich ja. Er hat gelernt, nicht mit seiner Frau zu streiten. Seine Schultern hingen schlaff herunter.«
»Und, Robert? Hast du Grace Kelly angerufen?«
»Ich muss zugeben, ich habe Grace angerufen, ja. Ich fand das Ganze absurd, als wäre ich in einen Film hineingerutscht, in eine Komödie … wie in einem Drehbuch von Woody Allen. Aber ich hatte schließlich einen Auftrag. Grace war auch gleich am Apparat. Sie hat auf meinen Anruf gewartet. Sie hat gefragt: Und? Hat er zugesagt? Schreibt er das Buch? Wie viel verlangt er? Wie viel Zeit braucht er? Wie findet er die Idee? Was sagt er dazu, dass Sam produziert? Ich sagte, Grace, Mr. Dahl möchte mit dir sprechen. Aber Mr. Dahl wollte nicht mit Fürstin Gracia Patricia von Monaco sprechen. Von einem Augenzwinkern zum nächsten war der Mann wieder ein anderer. Er sprang von seinem Sessel auf, die Schultern wieder gerade und kräftig, und fuchtelte mit den Armen. Und schüttelte den Kopf, dass ich meinte, der fällt ihm gleich herunter. Er hat den Hörer mit der Hand abgedeckt und mir ins Ohr geflüstert, ich soll sie fragen und soll gefälligst so fragen, als ob mich das interessiert … mich, den kleinen Robert Dornhelm, nicht ihn, den großen Roald Dahl. Ich soll ihn aus dem Spiel lassen. Ach! Er wollte halt unbedingt wissen, ob seine Frau mit Gary Cooper gevögelt hat oder nicht. Vor wohlgemerkt mehr als fünfundzwanzig Jahren!«
»Was wäre, wenn ja?«
»Was wäre, wenn ja. Was wäre, wenn nein? Ich konnte ihm den Gefallen leider nicht tun. Nein. Ich bin keiner, der Schicksal spielen will. Ich habe es nicht geschafft, Grace das zu fragen. Und ich wollte auch nicht. Sie hätte gedacht, ich habe sie nicht mehr alle. Sie hätte gedacht, ich will sie verarschen. Sie hätte mir diese Frage nicht zugetraut. Und ich selbst traute mir diese Frage auch nicht zu. Außerdem hätte ich einen Lachkrampf gekriegt. Ich habe mich von ihr verabschiedet und aufgelegt. Da hat er sich nahe vor mich hingestellt und gesagt, ich soll mich davonscheren. Hat mit dem Finger am ausgestreckten Arm auf die Tür gezeigt. Der Film ist dann nicht zustande gekommen. Aus anderen Gründen aber. Ich erinnere mich nicht mehr. — Das ist doch eine heitere Geschichte, oder?«
»Unbedingt.«
»Als Opener zu unserem Buch. Aber eigentlich ist es keine heitere Geschichte. Wir machen uns über einen Mann lustig, der erstens nicht mehr lebt und zweitens wirklich gelitten hat.«
»Hast du Grace Kelly später davon erzählt?«
»Ja, habe ich.«
»Und?«
»Sie hat sehr gelacht. Sie sagte, das sei die lustigste Geschichte, die sie je gehört habe. Ich habe ein schlechtes Gewissen … Ich mach’ uns etwas zu essen. Bist du einverstanden, Micki?«
»Sehr gern, Robert.«
»Nur etwas Kaltes. Valentina hat mir Schafkäse aus Rumänien mitgebracht. In Lake eingelegt. Zwei Sorten. Der eine ist eher süß, der andere salzig. Der süße schmeckt ähnlich wie Ricotta. Frischkäse, schau, wie schön weiß. Der süße ist für dich, Micki. Ich weiß, du magst keinen Rotwein. Aber ein Glas musst du probieren! Habe ich aus Frankreich mitgebracht. Einen Bordeaux, Château Canon, 2005. Das ist ein besonderer. Es ist eine Ehre, ihn trinken zu dürfen. Du musst dich vor ihm verneigen. Ich sage nach jedem Schluck: Danke.«
»Ich habe auch etwas mitgebracht, Robert. Ein italienisches Olivenöl. Und einen Birnenessig.«
»Birnenessig?«
»Süß ist der. Sehr gut. Ich verdünne ihn mit Mineralwasser. Das ist besser als Sirup. Gut gegen den Durst.«
»Ob ich den mag?«
»Ich mag ihn. Ich geb’ dir ein bisschen auf einen Löffel.«
»Ist gut, ja. Ich weiß nur nicht, wofür man den verwenden kann. Zum Salat? Schinken gibt es noch. Aber der ist nicht besonders. Aber ich habe eine Wurst aus Rumänien mitgebracht. Schau her! Das rundherum ist Asche. So eine gute kriegst du hier nicht.«
»Appetitlich sieht sie nicht aus.«
»Du bist verdorben von den Supermärkten, Micki! Geräucherten Aal habe ich noch. Aber den willst du nicht. Das weiß ich. Den willst du nicht einmal anschauen. Die Asche hält die Wurst frisch. Probier! Asche ist nicht grausig. Ich schneide sie dir weg. Ich esse die Asche mit. Gut?«
»Gut.«
»Als Buben haben wir ein Feuer gemacht. Aus Tannenreisig und Tannenholz. Sehr harzhaltig.«
»Das war in Temeswar.«
»Ja, in Temeswar. Da sind wir schon aus der Villa meines Großvaters ausquartiert worden. Von den Kommunisten. Und mein Vater war im Gefängnis. Wir wohnten in einem Mietshaus, das meinem Großvater gehört hat, er hatte früher sein Textillager in dem Haus. Bevor er enteignet wurde. Mit meiner Mutter habe ich Ungarisch gesprochen, mit meinem Bruder Deutsch, auf der Straße Russisch, da waren die russischen Besatzungssoldaten mit ihren Familien, viele Buben unter ihnen, und in der Schule Rumänisch … Ich wollte erzählen … wir haben einen großen flachen Stein in die Glut gelegt, bis er glühend heiß war, und dann haben wir einen Schneider oder ein paar Rotschwänzchen gefangen. Kannst du dir das vorstellen? Mit der Hand haben wir sie gefangen. Sie verstecken sich nahe am Rand, das war in der Bega, dem Kanal, und sie denken, sie sind dort sicher, und warten und bewegen sich nicht, da kannst du sie leicht fangen. Langsam mit der Hand ins Wasser eintauchen, alles sehr langsam, ein bisschen musst du dir vorstellen, du wärest selbst ein Fisch, und dann musst du blitzschnell die Hand um sie legen und sie heraus aus dem Wasser werfen. Kannst du einen Fisch ausnehmen?«
»Habe ich noch nie gemacht.«
»Ich kann’s dir zeigen. Wir haben die Fische auf den heißen Stein gelegt. Jede Seite und nicht zu lange. Die sind gleich durch. Frischer geht es nicht. Das ist doch würdevoller, als wenn er tiefgefroren wird und dann im Supermarkt in der Truhe liegt, zu einem Quadrat zusammengepresst und in Plastik eingeschweißt, damit man ihn gut stapeln kann. Wenn wir kein Salz dabeihatten, haben wir den Fisch mit Asche eingerieben. Mit der Asche von dem harzhaltigen Holz. Das ist fast wie Salz. Asche wie die an der Wurst. Das ist besser sogar als Salz. Das ist Wildnis. Etwas Besseres habe ich nie gegessen. Und wenn wir keinen Pfeffer dabeihatten, haben wir Tannennadeln auf den heißen Stein gelegt und geröstet. Das ist sogar hundertmal besser als Pfeffer. Sagte ich ja. In dem Wald bei Temeswar. Da war ich zehn. Du schwärmst immer von Huckleberry Finn und Tom Sawyer, Micki. Die sind auch zehn. Die können einen Fisch ausnehmen, und Fische fangen mit der Hand können sie auch. Warum kannst du das nicht, Micki?«
»Ich kann gut darüber lesen. Das genügt mir. Man hat auch keine stinkigen Finger, wenn man in einem Buch liest, wie wenn man einen Fisch ausnimmt.«
»Wenn einer von uns Buben ein Buch dabeigehabt hätte, dem hätten wir das Buch weggenommen und damit unser Feuer gemacht.«
»Das hättet ihr nicht.«
»Hast recht, das hätten wir nicht. Ich hatte manchmal ein Buch bei mir. Mein Bruder auch, der Peter. Von Anfang an war der Tod dabei …«
»Warum sagst du das, Robert?«
»Ist es nicht so? Er ist doch immer dabei. Ich erinnere mich, da war ich, wie gesagt, zehn, Peter und ich waren fischen, und da war noch einer dabei, der war älter als wir, sechzehn oder schon siebzehn. Dessen älterer Bruder hat sich das Leben genommen. Noch nicht ein Jahr zuvor. Niemand wusste, warum. Wir saßen um das Feuer, nur wir drei. Erst sind noch ein paar Buben dabei gewesen, die sind dann aber gegangen, die mussten heim. Wenn Peter bei mir war, dann hat sich unsere Mutter keine Sorgen gemacht. Als die Sonne untergegangen ist, hat der junge Mann — ja, er war schon ein junger Mann — zu erzählen begonnen. Von seinem Bruder hat er erzählt. Ganz ruhig. Ohne Gefühl, wie ich dachte. Dass er sich aufgehängt hat. Peter hat anfangs noch gesagt, es sei vielleicht keine gute Idee, vor dem Kleinen, also vor mir, darüber zu sprechen. Aber der junge Mann — ich will ihn so nennen, aus Respekt —, der junge Mann hörte nicht auf ihn. Mir kam das unglaublich vor. Dass jemand stirbt, der jung ist, war schon unglaublich, aber dass jemand freiwillig stirbt … Warum sollte man freiwillig sterben wollen? Nicht, dass ich Angst hatte vor dem Thema oder dass ich verwirrt gewesen wäre, ich war neugierig. Ich gebe dem Albert Camus recht: Das einzige philosophische Problem ist der Selbstmord. Ich wusste nicht, was Philosophie ist, wie auch, und was Probleme sind, wusste ich eigentlich auch nicht. Ich wusste, hier gibt es etwas zu lachen, dort gibt es etwas zu weinen, hier fühle ich mich wohl, dort fühle ich mich nicht wohl. Vom Tod hatte ich gehört. Einen Toten gesehen hatte ich noch nicht. Verzeih, Micki, wenn ich so unklar spreche. Ich bin mir über diese Stunden bis heute nicht klargeworden. Ich sagte, ich war neugierig. Ich war neugierig, wie die Geschichte des jungen Mannes weiterging … Ich muss lachen, denn ich glaubte, sie könnte irgendwie noch gut ausgehen. Dass man zwar stirbt, aber nicht, indem man es selbst macht. Dass wir am Schluss, wir drei, also lachen werden, weil der Bruder eben doch nicht gestorben ist … der junge Mann klatscht in die Hände — Hokuspokus! —, und sein Bruder steht neben uns und fragt, ob er auch ein Stück von dem Fisch haben kann. Ich war neugierig — aber auch neugierig, was die Geschichte mit mir machen wird. Das sagt man heute, ich höre oft jemanden sagen, das macht etwas mit mir oder das hat etwas mit mir gemacht … Ich mag diesen Ausdruck nicht. Er ist so zeitgeistig. Er tut so, als ob ich daläge wie ein Stück Holz, und dann geschieht etwas, das macht etwas mit mir. Als ob ich selbst nicht derjenige wäre, der etwas machen kann. Es muss mit mir gemacht werden. Aber damals dachte ich genau das. Wenn diese Geschichte gut ausgeht, dann geschieht etwas mit mir. Wenn sie schlecht ausgeht, geschieht auch etwas mit mir. Aber etwas anderes. So viel hängt von dieser Geschichte ab. Deshalb, dachte ich, drängt Peter so sehr, dass wir gehen. Diese Nähe des Todes … da kann man doch nicht anders als denken, auch zu mir kommt er. Aber wer bin ich? Ich bin der, der ganz fest lebt, und zugleich bin ich der, auf den der Tod schauen kann, in diesem Augenblick, ganz nach seiner Laune. Wie es ihm beliebt. Also bin ich zwei. Einer, neben dem dauernd der Tod steht, und einer, der den Tod nicht kennt. Der Gedanke ist banal, das mag schon sein. Die Empfindung ist es nicht. Das erste Ich ist unsterblich, das zweite kann sterben. Die Figuren im Kino sind unsterblich, die Schauspieler sind es nicht. Du schaust dir den unsterblichen Rick in Casablanca an, aber Humphrey Bogart ist längst tot. Seit jener Nacht ist diese Empfindung immer in mir. Solche Empfindungen machen den Melancholiker aus. Am Morgen, wenn der Serotoninspiegel niedrig steht und sich dein Reservoir erst wieder auffüllen muss, wird diese Empfindung so real, dass mir beinahe ist, als könnte ich den Kameraden neben mir angreifen, den ältesten Kameraden, den im Knochenkostüm … Der Bruder des jungen Mannes war zwanzig, als er sich umgebracht hat. Der junge Mann sagte, er könne nicht verstehen, warum er sich nicht erschossen habe, bei ihnen zu Hause gebe es Waffen, mehrere sogar, ein Gewehr, mindestens drei Pistolen. Munition auch. Ich wusste nichts über ihn, nichts über seine Familie, seine Eltern. Woher die Waffen? Waren es Kommunisten, die gegen die Nazis gekämpft hatten, und daher die Waffen? Oder waren es Nazis, die gegen die Kommunisten gekämpft hatten? Es sei so leicht, sich zu erschießen, sagte der junge Mann. Warum sich aufhängen? Er habe es ausprobiert. Laden und den Lauf in den Mund stecken. Abdrücken. Fertig. Ich fragte, warum in den Mund. Peter sagte, ich soll denselben halten. Aber ich fragte gleich noch einmal: Warum in den Mund? Der junge Mann sagte, weil dann das Kleinhirn garantiert kaputt ist, und ohne Kleinhirn könne der Mensch nicht eine Sekunde lang mehr leben. Und wenn er sich aufhängt, fragte ich. Da könne es sein, sagte der junge Mann, dass man noch bis zu drei Minuten lebt. Warum, denke er, fragte ich, hat sich sein Bruder dann aufgehängt und nicht erschossen. Das eben wisse er nicht, sagte der junge Mann, das eben mache ihm Sorgen. Er wisse nicht, warum überhaupt, und er wisse nicht, warum so. Seit einem Jahr quäle ihn diese Frage. Peter sagte, wir müssen nach Hause. Ich sagte, nein, das stimmt nicht, wir können so lange bleiben, wie wir wollen. Gut, sagte Peter, dann bleib, ich jedenfalls gehe. Verstehst du, Micki, dass so ein Gespräch einen Zehnjährigen interessiert? Ich bin geblieben. Obwohl ich mich nun doch fürchtete. Nicht vor dem Thema. Nicht vor dem jungen Mann. Sondern weil ich ohne Peter nach Hause gehen musste. Ich traute mich nicht zu fragen, ob der junge Mann, wenn ich noch bei ihm bleibe, mich dann nach Hause begleitet. Gefürchtet habe ich mich vor den Hunden. Da gab es Rudel von wilden Hunden, verwilderten Hunden.«
»Du denkst in Filmszenen, Robert?«
»Wie meinst du das, Micki?«
»Bewundernd meine ich es. Du denkst das Leben als Film …«
»Denkst du nicht das Leben als Literatur, Micki?«
»Wäre umgekehrt nicht besser? Die Literatur, der Film, die Kunst sollten doch hinter dem Leben stehen.«
»Lass es nicht moralisch werden, Micki. Das tut der Kunst nicht unbedingt gut. Und oft tut es dem Leben auch nicht gut. Nein, nein, mach dir keine Sorgen. Jeder Beruf hat seine Berufskrankheiten als Folge.«
»Ihr beiden Buben und der junge Mann, die Fische, die Asche. Eine sehr bewegende Szene … die könnte am Beginn eines Films stehen. Der Stein, der in die Glut gelegt wird …«
»Schreib das Drehbuch, Micki!«
»Das kann ich nicht. Ich kann keine Drehbücher schreiben.«
»Hast du aber schon gemacht.«
»Dann korrigiere ich: Ich will keine Drehbücher schreiben.«
ZWEITER TAG — vormittags
»Es tut mir gut, mit dir zu reden, Micki.«
»Mir tut es gut, dir zuzuhören, Robert.«
»Über früher zu reden. Als ich ein Kind war. In Temeswar. Wie es auf dem Markt gerochen hat … der Geruch von frischem Gemüse … wo noch Erde an den Wurzeln hängt … das habe ich besonders gemocht. Erdäpfel, die dreckig waren … Darum mag ich das Wort Erdäpfel gern. Äpfel der Erde. Ist doch schön. Wie es in unserem Haus gerochen hat … Ich meine das schäbige Haus, nicht die Dornhelm-Villa, die ist uns ja weggenommen worden. Ich kann mich gar nicht richtig an die Villa erinnern … ich war zu klein. In Temeswar bin ich geboren. Ich bin ein Rumäne. Jawohl, einer aus dem Land von Dracula! Blut und Erde! Heute bin ich Österreicher. Und lebe in Amerika. Und bin zugleich Amerikaner.«
»Du bist Doppeltstaatsbürger? Und wie fühlt man sich dabei?«
»Unsereiner hat keine Heimat.«
»Das klingt traurig.«
»Nein, nein, Micki! Das ist nicht traurig! Ich meine damit, ich bin an keinen Fleck der Erde gebunden. Erde ist überall gleich. Überall Erde. Einmal schwarze Erde, einmal braune, einmal rote, Lehm ist grau. Immer Erde. Aber die gehört allen. Wenn ich von Heimat sprechen soll, dann meine ich Menschen. Freunde. Freunde wie dich, Micki«.
»Danke, Robert.«
»An Freunden hänge ich, wie andere Menschen an dem Stück Land hängen, auf dem sie leben, auf dem sie geboren wurden. Aber wenn diese Menschen von ihrem Land sprechen, von ihrer Erde, dann glaube ich ihnen nicht, dann meinen sie nicht die Erde, dann meinen sie eine Ideologie. Davor graust es mich.«
»Da habe ich es mit dir, Robert. Reden wir über Menschen. Reden wir über deine Familie. Damals, als du ein Kind warst.«
»Meine Familie — das waren im Wesentlichen meine Mutter, ihre Mutter und mein Großvater väterlicherseits. Und wir Kinder. Peter und ich. Mein Vater war nicht da. Hast du dir das Foto von meiner Mutter angesehen, das ich dir geschickt habe?«
»Eine schöne Frau.«
»Eine sehr schöne und sehr vornehme Frau war sie. Das ist wahr, Micki. Vornehm allerdings auf eine moderne Weise. Und ein fröhlicher Mensch. Man ist auf der Welt, um zu lachen, sagte sie. Ich fühlte mich so wohl, wenn sie am Morgen das Fenster öffnete, den Kopf hob, die Augen schloss und mit einem Lächeln in die Sonne blickte und tief einatmete. Da habe ich gewusst, sie nimmt mich mit in ihren Tag. Vorübergehend arbeitete sie im Krankenhaus. Die Ärzte waren verliebt in sie. Ist es ein Wunder? Obendrein war sie ohne Mann. Der saß im Gefängnis. Oder buckelte im Arbeitslager im Donaudelta. Weil er ein Kapitalist gewesen war, bevor der Segen des Kommunismus über uns ausgesprochen wurde. Genauer: der Sohn eines Kapitalisten. Da kann man schon einmal vorbeischauen — bei einer alleinstehenden Frau, einer hübschen. Auch wenn sie zwei Kinder hat und mit den Ahnen zusammenlebt … eine einsame Frau …«
»Hast du Ahnen gesagt?«
»Wieso? Ja, die Ahnen! Lebende Tote. Bitte, Micki, wieder nicht traurig zu verstehen!«
»Wie soll ich das anders verstehen?«
»Ich meine damit Menschen, die nicht in der Gegenwart leben, sondern in der Vergangenheit. Sie wollen nicht in der Gegenwart leben. Leben aber spielt sich nur in der Gegenwart ab. Mein Großvater hätte sehr gut in der Gegenwart leben können. Er war ein so weltgewandter Mann, den hätten die Kommunisten gut brauchen können. Ein Mann mit Autorität. Und ich wette, es hätte nicht lange gedauert, und sie hätten ihm verziehen, dass er ein reicher Mann gewesen war. Womöglich hätten sie ihm die Villa zurückgegeben. Weil sie ihn gebraucht hätten, diesen großartigen Geschäftsmann. So einen hätte das neue Rumänien dringend nötig gehabt. Als Wirtschaftsminister zum Beispiel. Oder Finanzminister. Aber er wollte nicht. Er wollte in dieser Gegenwart nicht leben. Deshalb sage ich: Ahnen.«
»Deine Mutter war keine lebende Tote.«
»Sie nicht! Um Himmels willen, nein! An einen Herrn Doktor kann ich mich erinnern. Er kam uns besuchen. Am Abend. Er brachte Schokolade mit. Ausländische. Das Stanniolpapier war golden. Das habe ich aufgehoben und geplättet. Und in mein Schulbuch gelegt. Er trug einen Anzug, den Mantel, einen hellen Trenchcoat, hatte er sich über die Schulter gelegt. Das sah lässig aus. Er hat unsere Mutter ausgeführt. Sie hat sich vor dem Spiegel gedreht. Sie kamen erst spät in der Nacht nach Hause. Und haben gekichert. Bei offener Wohnungstür. Ich konnte nicht einschlafen, bevor sie zu Hause war. Aber ich glaube nicht, dass etwas zwischen den beiden war. Er hat ihr den Hof gemacht. Ein schüchterner, aber freundlicher Herr, der gut roch. Meine Mutter hat ihn mir ein paar Tage später im Krankenhaus vorgestellt. So viel Hoffnungslosigkeit war in seinen Augen. Ich war im Zwiespalt. Ich interpretierte die Hoffnungslosigkeit so: Er ist hoffnungslos, weil er die Mami nicht kriegen kann. Darüber freute ich mich. Aber nur einerseits. Andererseits machte es mich selbst hoffnungslos. Unser Vater wird eh nie mehr zurückkommen, dachte ich. Er passt nicht mehr zu uns. Wer so lange im Gefängnis war oder im Lager so schwer arbeiten musste, der passt nicht mehr zu einer so fröhlichen Frau wie unsere Mutter. Da passte der Herr Doktor besser. Der Herr Doktor riecht gut, die Mami riecht gut — wie riecht einer, der im Gefängnis sitzt und im Dreck arbeiten muss? Ich hatte nur vage Erinnerungen an unseren Vater. Und an etwas Schönes erinnerte ich mich nicht. Ich hatte lange Haare, er mochte das nicht gern, und wenn es unbedingt sein musste, dann sollten sie nach hinten gekämmt werden. Das sieht zielstrebig aus. Ich war aber nicht zielstrebig. Es gab jemanden, ich weiß nicht mehr, wer das war, ob einer aus der Verwandtschaft oder sonst ein Mann, der wollte offensichtlich auch, dass meine Haare nach hinten gekämmt sind. Er hat in die Hände gespuckt und mir die Haare über den Kopf nach hinten gestrichen. Ich fand das unendlich ekelhaft. Ich bin gleich in die Küche gerannt und habe mir Wasser über den Kopf fließen lassen. Am liebsten hätte ich dabei gebrüllt. In die Hände spucken und übers Haar streichen, das machen nur die Walachen, hätte mein Vater gesagt.«
»Vielleicht, Robert, war es dieser Herr Doktor, der in die Hände gespuckt hat …«