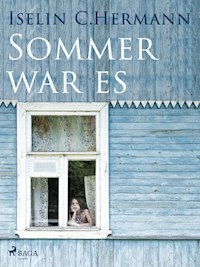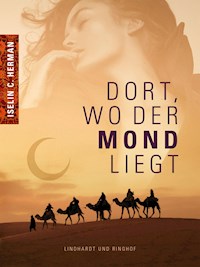
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach ihrem vielbeachteten Erstling, dem Briefroman "Liebe Delphine. Lieber Jean-Luc", führt Iselin C. Hermann den Leser diesmal in eine ferne, faszinierende Welt. Um Sehnsucht und Liebe geht es auch in ihrem neuen Roman, um den Wunsch nach Heimat und Zugehörigkeit - eine Suche mit unerwartetem Ausgang. Als Fremde kehrt Samia, eine amerikanische Journalistin, in das Land zurück, in dem sie geboren wurde, und begibt sich dort auf die Suche nach ihrer Vergangenheit. Die Entscheidung, nach Syrien zu gehen, bedeutet das Ende der Beziehung zu ihrem langjährigen jüdischen Freund Isak, öffnet ihr zugleich aber die Tür zu sich selbst. Zwei weitere Männer treten in ihr Leben: Nadir, mit dem sie eine Affäre beginnt, und Jameel, in den sie sich verliebt. Doch diese Liebe ist mit einem Geheimnis verknüpft. Mit sinnlicher Sprache und einfühlsamem Ton beschreibt Iselin C. Hermann die Reise einer Frau zum eigenen Ich. Ein Roman, der auf hohem Niveau unterhält. Iselin C. Hermann erzählt von Sehnsucht und Liebe, vom Wunsch nach Heimat und Zugehörigkeit - von einer Suche mit unerwartetem Ausgang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Iselin C. Hermann
Dort, wo der Mond liegt
Roman
Aus dem Dänischen vonRegine Elsässer
Lindhardt und Ringhof
Es ist, wie wieder da zu sein. Obwohl ich nicht mehr hier gewesen bin, seit ich sechs Monate alt war, ist es, wie nach Hause zu kommen.
Das Geräusch einer Tür, die sich zu einem bestimmten Zimmer aus der Kindheit öffnet, wird man nie vergessen. Das schleifende Geräusch der Tür zur Küche meiner Großeltern würde ich auf einem Tonband unter Hunderten von sich öffnenden Türen wiedererkennen. Aber die Aufnahme hätte vor langer Zeit gemacht werden müssen, denn den Rahmen und die Scharniere, die, weil sie abgenutzt waren, das schleifende Geräusch verursachten, gibt es nicht mehr, und auch das Küchenmädchen ist tot. Das Geräusch gibt es nur in mir.
Der Flughafen liegt eine knappe Stunde Fahrzeit außerhalb der Stadt, und doch schlug mir der würzige, süße Duft entgegen, als ich aus dem Flugzeug stieg. Ein Duft, den ich wiedererkenne, ohne eine bewußte Erinnerung an ihn zu haben, eine Wahrnehmung, die wie die der schleifenden Tür geruht hat. Ein Traum kann während eines langen und arbeitsreichen Tages völlig verdrängt worden sein und dann plötzlich hell und klar auftauchen, sobald man den Kopf aufs Kissen legt. So geht es mir hier. Obwohl ich keine klare Erinnerung daran habe, hier gewesen zu sein, ist es, wie zurückzukehren.
Es ist Februar und kalt, zumindest hat man das Gefühl, aber es ist viel wärmer als zu Hause, wo das Flugzeug mit Verspätung abflog, weil die Startbahn verschneit war. Hier ist es anders kalt, bis-auf-die-Knochen-kalt, weil nichts geheizt ist. Kohlebecken und Gasheizofen sorgen für eine begrenzte Wärme, ansonsten heißt es warten, bis die Nordhalbkugel sich wieder zur Sonne neigt. Das Frühjahr beginnt in einem Monat, sagen die Leute und machen eine entschuldigende Handbewegung. Januar und Februar muß man einfach ertragen, danach ist diese Zeit vergessen, als ob sie nie wiederkäme.
»Sie müssen nur warten«, sagte der Nachtportier, als ich zähneklappernd herunterkam und um eine zusätzliche Decke bat. »Warten Sie bis August!«
Als ob die Kälte, von der ich gerade eine doppelseitige Lungenentzündung bekomme, konserviert werden könnte, um in der Hitze des Monats August in kleinen Portionen genossen zu werden. Außerdem regnet es heute morgen. »Es regnet«, sage ich. Der Herrgott hat den Stöpsel aus der Badewanne gezogen und die Leute danken ihm auch noch dafür. »Al-hamdu l-illah, Allah sei Dank.« Ich verziehe mich in den Hamidiye Suq, der mit gewölbten, durchlöcherten Wellblechplatten überdacht ist. Sie sind nicht durchgerostet, sondern von der französischen Kolonialmacht perforiert worden, als die syrische Befreiungsarmee 1946 aus der Luft beschossen wurde. In meinem Reiseführer steht nicht, wie der Kampf abgelaufen ist, aber ich stelle mir die stumpfnasigen Flugzeuge vor, Piloten in Ledermützen mit wehenden Ohrenklappen – wie Snoopy auf seiner Hundehütte – und leichten Handfeuerwaffen. Die Franzosen haben verloren, aber die Einschußlöcher sind noch da, groß genug, daß das Tageslicht wie die Strahlen um ein barockes Altargemälde hereinfällt, aber nicht so groß, daß man etwas vom Regen draußen spürt. Hier drinnen ist es warm und trocken, voller Menschen und Waren, Farben. Voller Düfte.
Im Sommer verstärkt die Wärme vielleicht die einzelnen Gerüche, so daß der Wettlauf, wer der stärkste ist, noch erregender wird. Jetzt ist Winter, und doch kann man nur schwer sagen, welcher Geruch am intensivsten ist: die schwarzen Nelken in dem Sack da drüben oder der Kardamom, den sie in den Kaffee tun? Vielleicht übertönt auch das Wort für Kardamom alles: hayel. Ich bitte den Gewürzhändler, den Namen zu wiederholen, der zuerst klingt wie »hell«. Es ist ebenso schwierig zu entscheiden, welches der vielen Gewürze, sorgfältig zu spitzen Pyramiden geformt, optisch den Sieg davonträgt. Der rote Paprika zieht zuerst den Blick auf sich, aber Paprika riecht nicht besonders stark.
»Filfil ahmar«, sagt der alte Mann mit sehr lauter Stimme. Er sieht und hört, daß ich Ausländerin bin, und er wendet sich an mich, als ob ich zu keinem von beiden fähig wäre. Einfache Menschen glauben, daß der Fremde sie verstehen kann, wenn sie ihre Muttersprache nur laut genug sprechen. Er zeigt noch einmal mit seinem dürren Finger auf das Gewürz und wiederholt insistierend »filfil ahmar«, als ob ich ein Idiot wäre, was viele Touristen ja tatsächlich sind. Er kann mir nicht ansehen, daß ich keine Touristin bin. Ich bin Reisende. Und bald habe ich eine Aufenthaltsgenehmigung für sechs Monate – inschallah, so Gott will. Die Wangen des Gewürzhändlers sind eingefallen. Jede Falte hat ihre Geschichte, seine Waren liegen wie feiner Staub in jeder Furche, was sein Gesicht einem Spinngewebe ähneln läßt.
»Filfil«, seine Vogelklaue zeigt zitternd auf den schwarzen Pfeffer, es klingt wie ein Befehl, aber die Stimme ist nicht mehr so laut, jetzt, wo er bemerkt, daß ich ihn verstehe, daß ich sehen und hören und sogar fragen kann: »Schu hada? Was ist das?« Die Mohnsamen sind noch schwärzer als filfil. Die Mohnsamen sind schwarzblau und glänzen.
»Kumin«, der Alte zeigt auf das grüngelbe Pulver, das riecht, wie nur Kumin riechen kann, obwohl ich das Gewürz nicht kenne. Der gelbe Curry ist scharf und grüner als Kumin, Gelbwurz ist auf seine eigene Art gelb. Die Stafette wird weitergegeben an die gelben Fransen im orangefarbenen Safran. Dann wieder filfil, wieder in einem anderen Rotton, und sumah ist hellbraun. Die Zimtrinde rauh und trocken neben dem staubigen, gestoßenen Ingwer. Filfil gibt es auch in Weiß, das wußte ich: weißer Pfeffer, dessen Geruch vage an Terpentinöl erinnert.
In einem grob gewebten Sack mit schwarzer Schrift hat der Vogelvater Tausende von Rosenknospen eingefangen. Rosenknospen, die mit ihren kleinen roten Schnäbeln das traurige Lied zwitschern, daß sie nie zu voller Pracht erblüht sind. Vertrocknet und zart, füllen sie den ganzen Sack des alten Mannes. In fernen, lieblichen Gärten geerntet und gesammelt, bevor sie sich entfaltet haben. Was wiegt schwerer: ein Kilo Blei oder das ungelebte Leben? Die Blumen im Sack daneben sehen aus, als hätten sie nie gelebt, sie sind in bleiches Seidenpapier gewickelt. Die pastellfarbenen Nelken sehen weniger wehmütig aus als die Rosenknospen, weil sie nicht im Puppenstadium geerntet werden – sie haben immerhin geblüht, bevor sie gepflückt wurden, aber so, wie sie daliegen, sind sie nur eine schwache Erinnerung an die Blumen, die sie einmal waren: Karmesinrot ist zu Altrosa verblichen, Chromgelb zu einem vergilbten Elfenbein, und die leuchtend weißen Nelken, die sich einmal im Wind gewiegt haben, liegen jetzt wie ein staubiges Flüstern im Sack des Gewürzhändlers, später werden sie mit kochendem Wasser übergossen werden und so ihre Tage als Blütentee beenden. Rosen und Nelken, die einmal die am stärksten duftenden Blumen im Garten waren, sind jetzt die schwächsten im Spektrum.
Daneben ist ein ähnliches Geschäft, das die gleichen Gewürze auf genau die gleiche Art anbietet: zu kleinen Gipfeln getürmt, daneben ein Sack voller Rosenknospen. Der einzig sichtbare Unterschied ist der Ladenbesitzer, der hier so dick ist, daß zwischen ihm und seinen Regalen kein Platz mehr bleibt. Der Nachbar zur anderen Seite verkauft Schildkrötenpanzer und Fledermäuse, pulverisierte Nashornhörner und Hexenkraft, Kalebassen und Schlangenhäute. Um die Buden stehen die potentiellen Käufer, Männer in weiten Dschellabas, unter denen viel Platz für alles mögliche ist; die nackten Füße stecken in Plastiksandalen, einer von ihnen hat einen kreideweißen Turban auf. Andere tragen ein Jackett über der Dschellaba, wieder andere haben den ganzen Schritt nach Westen gewagt, indem sie in einen Anzug gestiegen sind.
Es ist mein erster Tag hier. Alles ist neu, jeder einzelne Gegenstand, jede einzelne Bewegung, jede Geste hat eine Bedeutung und tritt mit halluzinatorischer Überdeutlichkeit hervor.
»Schu hada?« frage ich und zeige auf eine Flasche mit etwas, das Blütenöl sein könnte.
»Das ist nichts für Sie, gnädige Frau!« sagt der Schildkrötenpanzerschlangenhautverkäufer und nimmt mir die Flasche aus der Hand. Die Röte steigt mir vom Hals übers ganze Gesicht. Ich dachte, man entwächst dem Erröten; ich hoffe es immer noch, es ist so peinlich, auch für denjenigen, der zusehen muß, wie die Maske Feuer fängt.
»Das ist, verstehen Sie, gnädige Frau, ein Spülmittel.«
»Für …?«
»Für Wäsche.«
»Und …?« Die Verblüffung legt sich langsam und der Groschen fällt. Mit so einem Spülmittel brauche ich mich nicht zu befassen, weil Frauen meines Standes dafür Personal haben.
»Hello Lady, welcome to Damascus!« Man sieht mir sogar von hinten an, daß ich hier fremd bin, und dabei hatte ich mir eingebildet, ich sei einheimisch gekleidet: langer, blauer Mantel und ein Schal um den Kopf. Den Schal kann ich auch abnehmen, er rutscht sowieso dauernd herunter. Jede zweite Frau trägt kein Kopftuch. Genau wie die Männer sind die Frauen sehr unterschiedlich gekleidet. Zum Beispiel die Frau da drüben in hellvioletten Hosen, die so eng sind, daß sie wie aufgemalt aussehen, ihre Augen und Lippen sehen auch wie aufgemalt aus, und dann die beiden Frauen, die nebeneinander gehen, und die so zugehängt sind, daß man nicht weiß, ob sie vorwärts oder rückwärts gehen. Die schwarzen Mäntel reichen bis zur Erde und bis hinauf zum Hals, die Hände, das Gesicht, die Haare und der ganze Kopf sind bedeckt wie ein Vogelbauer in der Nacht. Die Welt muß von da drinnen schwarz aussehen, es muß merkwürdig sein, von der Mutter an der behandschuhten Hand geführt zu werden und das Nein auf das Betteln nach Süßigkeiten von einer Stimme aus dem Dunkel zu bekommen.
Es ist mein erster Tag hier. Alles ist neu, und doch ist da ein traumartiges Wiedererkennen und das blubbernde Gefühl, nach Hause gekommen zu sein: gezeugt oben in Abu Rumaneh, geboren im Amerikanischen Krankenhaus von Amman und im Kinderwagen durch den Tischrinpark geschoben. Ich bin nicht mehr hier gewesen, seit ich ein Baby war, und doch erfüllt mich Wiedersehensfreude.
Es gibt zwei Dinge, die ich richtig gut kann, das eine ist, mich zu verirren. Wie nichts verliere ich die Orientierung und verlaufe mich mitten auf einem Fußgängerübergang zu Hause in New York. Ich will nicht behaupten, daß das hier nicht passieren wird oder daß es nicht schon passiert ist, ohne daß ich es gemerkt habe, aber ich habe ein Gefühl für die Anatomie der Stadt, mit der »Geraden Straße« als Aorta mitten hindurch.
Ich bin sicher, die Stadt ist ein Teil von mir, von meinem Aderngeflecht, weil ich hier entstanden bin. Oder bilde ich mir das alles nur ein?
Es blubbert in mir, weil ich wieder hier bin, und weil ich es mir so lange gewünscht habe, so lange dafür gekämpft habe. Seit ich fünf war, wußte ich, daß dies der Ort ist, nach dem ich mich sehne, früher war es nur wie ein Hunger. Seit ich acht war und die »Halbmonde« verstand, bekam der Ort hier Geschmack und Farbe.
»Vater, liest du mir noch einen ›Halbmond‹ vor?« Ich verstand noch nicht, warum auf dem Buch ein Halbmond war. So viele Nächte und so viele Geschichten, da mußte es Vollmond werden, so wie ich ihn einmal direkt vor meinem Fenster gesehen hatte, er war größer als alles andere gewesen, stürzte fast ins Haus und war ganz orange. Ich war total verängstigt, dann schwebte er davon und glitt über den Himmel, weiß, rund und wieder er selbst. So groß und so gefährlich mußten Tausendundeine Nacht sein, »Alf laila wa laila«, brachte mein Vater mir bei zu sagen, und für viele Jahre war es das einzige, was ich auf arabisch sagen konnte. Alf laila wa laila schmeckte gut und nach Mond, wie weißes Weingummi. Aber er lag auch noch, der Halbmond auf dem Umschlag des Buchs. Das war auch merkwürdig. Und Vater erzählte mir, daß der Mond dort, wo ich geboren bin, liegt. Ich war fünfundzwanzig, als ich das Alphabet lernte, und dreißig, als ich Zeit hatte, mich mehr damit zu beschäftigen, und jetzt ergeben die Laute Sinn. Manche allerdings nicht. Es braust in mir, weil der Wunsch, hier zu sein, Wirklichkeit geworden ist. Der Traum, hierher zu kommen und zu arbeiten, ist so lange in mir gereift, daß der Beschluß beinahe nebenbei gefaßt wurde. Aber der Weg vom Beschluß zur Umsetzung wurde untergraben von Isaks Zorn und war mit unseren Auseinandersetzungen gepflastert. Nicht daran denken. Nicht jetzt. Ich will versuchen, möglichst nicht an Isak zu denken. Versuchen, möglichst nicht an zu Hause zu denken. Und nicht an meinen Vater und meine Mutter.
Als ihre Mutter muß ich denken, daß sie wohl intuitiv nach Damaskus fährt, um einzutauchen in die Zeit, als wir glücklich miteinander waren, A. S. und ich. Es war seine erste Stationierung im Ausland, wir stahlen uns oft weg von den Cocktailpartys und fuhren nach Hause nach Abu Rumaneh, wo wir wohnten.
Es ist merkwürdig, aber eine Frau weiß eigentlich immer, wann sie ihr Kind empfangen hat. Von allen Liebesnächten war es genau die eine. Die Augustnächte sind im Nahen Osten brennend heiß. Der Ventilator, den wir an der Dekke hatten und der die Luft durcheinanderwirbelte, war eigentlich mehr aus psychologischen Gründen da; man hatte wenigstens das Gefühl, daß etwas unternommen wurde, um die wahnsinnige Hitze zu vertreiben. In der Nacht, als Samia entstand, lag der Mond leuchtend weiß und hoch über uns, kühl in dieser heißen Nacht. Bevor wir einschliefen, ich lag mit dem Gesicht an seinem schweißfeuchten Hals, flüsterte ich, daß sein neuer Name von jetzt an A. S. sein würde. Ich weiß noch, daß er lächelte, vielleicht weil er sich freute, er hat bestimmt nicht verstanden, was ich meinte, aber als ich vier Tage über die Zeit war, sagte ich zu ihm, A. S. bedeutet »Abu Someone, Vater von jemandem«. In meiner Erinnerung sind die Tage und Nächte, bevor sie geboren wurde, unsere glücklichsten. Voller Erwartung. Meine Familie wollte, daß ich für die Geburt nach Hause käme, aber ich war der Meinung, das Amerikanische Krankenhaus von Amman wäre ausreichend. Vielleicht hatte ich intuitiv Angst, unser Seifenblasenglück könnte zerplatzen, wenn ich zu lange weg wäre. Später mußte ich erfahren, daß es nichts mit physischem Abstand zu tun hat. Geschah es schon gleich nach ihrer Geburt? Ich erinnere mich nicht. Alles nach dem 15. Mai, das ganze folgende Jahr, liegt in völliger Dunkelheit vor mir. Obwohl er an meiner Seite war, hatte ich ihn verloren, meinen Mann.
Sie stellte mich immer als ihren Mann vor, obwohl wir nicht verheiratet waren. Schon als wir uns das erste Mal trafen, wußte ich, daß es ernst war.
Es ist eine dunkle Nacht ohne Mond, und ich kann nicht schlafen. Dort drüben bei Samia ist es schon morgen. Sie ist neun Stunden vor der amerikanischen Zeitrechnung und fast einen halben Tag weiter als ich. Die Tage und Nächte sind neu und unverbraucht, wenn sie zu ihr kommen, die Sekunden, die sie heute morgen eingeatmet hat, sind verbraucht, wenn sie zu mir herüberkommen. Die Zeit kommt wie eine frische Brise über die Levante, dort, wo die Sonne aufgeht, dort, wo sie ist. Um sie ist es hell, und seit vorgestern, seit wir uns verabschiedet haben, bin ich wie von Dunkelheit umgeben. Die Sekunden werden zu Minuten, die Minuten zu Stunden. Ich schaue zu, wie die Zeit vergeht, rot und leuchtend neben dem Bett, rote Zahlen, die goldene Sekunden waren, heute morgen auf der anderen Seite der Erde. Sekunden, die sie mit Handlungen und Erlebnissen gefüllt hat und die jetzt nur gleichgültige, eckige Zahlen sind. Selbst die weiblichste aller Zahlen besteht auf dem Display des Uhrenradios aus zwei übereinandergesetzten Vierecken; die Zeit macht ihre Arbeit neben meinem Bett. Unserem Bett. Bis vor drei Nächten lag sie hier neben mir in unserem Bett. Es ist lange her, daß wir uns geliebt haben, ein halbes Jahr vielleicht. Es muß im August gewesen sein, in dem Monat, in dem der Sommer die angestaute Hitze freigibt und in die herannahende Kälte des Herbstes vorstößt. In so einer Nacht war es, in der die Zukunft von außen herangerollt kam und mit einem gewaltigen Krachen in die Vergangenheit stieß und in der wir uns das letzte Mal liebten. Die Blitze erhellten ihr Gesicht, das unter mir ganz weiß leuchtete. Ich liebte und haßte sie gleichzeitig. Und ebenso heftig. Ich liebte sie, als diejenige, die sie war, und haßte sie für das, was sie wollte. Warum suchte sie sich ausgerechnet ein Land aus, das mir die Einreise verweigert? Ein Land, das im Krieg mit Israel liegt und das nur im Notfall und unter großen Vorbehalten einer Person mit jüdisch klingendem Namen ein Visum gibt? Ich kann das nur als eine Entscheidung gegen mich sehen. Sie wurde nicht von der Zeitung darum gebeten, es war ihre eigene Idee, sie hat der Zeitung vorgeschlagen, eine Serie über Intellektuelle in Syrien und im Libanon zu machen. Sie war wie besessen von ihrem Plan, wie verliebt. Sie sprach von nichts anderem mehr, las und interviewte Leute, die Kontakte dorthin hatten. Ich will überhaupt nicht daran denken, wie oft wir uns deshalb gestritten haben. Ich will überhaupt nicht verstehen, warum sie es macht. Ich will den Weg nicht finden, und ich weiß nicht, wie ich aus dieser Dunkelheit, die mich umgibt, herausfinden soll. Ich sehne mich nach ihr. Und ich bin wütend auf sie. Diese beiden Gefühle stoßen in mir aufeinander, wie bei einem Gewitter, deshalb kann ich nicht schlafen. Ein Elektrisiertsein und ein Zittern im Körper, wie wenn sie mir ins Ohr pustet.
Ich brauche Isak nur ins Ohr zu pusten, dann habe ich ihn. Da war ein merkwürdiges Geräusch in der Leitung, vielleicht hat der Telefonist in der Rezeption mitgehört. Es war unfair, in den Hörer zu pusten, aber ich konnte es nicht lassen, es hatte etwas von einer Peep-Show. War es auch ein Versuch von Wiedergutmachung? Des Glättens? Des Entschuldigens? Um das zu tun, muß einem das, was man getan hat, leid tun, muß man seine Handlung bereuen. Und das tue ich nicht. Deshalb war es gemein von mir, in den Hörer zu pusten. Natürlich bereue ich die unfreundlichen Worte, die vielen harten Sätze, die Kämpfe; die würde ich gerne ungeschehen machen. Aber ich kann nicht um Verzeihung bitten dafür, daß ich endlich hier bin und er dort ist. Es ist lange her, daß ich ihm ins Ohr gepustet habe, und es war gemein, es jetzt zu tun; möchte ich vielleicht, daß er sich nach mir sehnt?
Ich lag im Bett und sehnte mich nach ihr, als sie anrief. Es war Morgen geworden nach einer schlaflosen Nacht. Und sofort, als ich ihre Stimme hörte, sehnte ich mich nicht mehr nach ihr. Ich war wütend, daß ich ihretwegen nicht hatte schlafen können. Mürrisch. Gereizt, weil ihre langen Beine in Straßen umhergingen, die ich nie betreten konnte. Sie erzählt mir, daß alle ihr »welcome« hinterherrufen. Das ist doch klar. Wie naiv ist sie bloß? Da kommt eine große, schlanke Frau aus dem Westen angeflogen, wie ein merkwürdiger Vogel aus einem fremden Land, der außerdem noch nach ihrem Schnabel pfeifen kann, und dann wundert sie sich, daß man ihr »welcome« nachruft! Wie alles in Syrien ist es ein Wunder, nur weil sie dort die ersten sechs Monate ihres Lebens verbracht hat. Davon wird das Land doch nicht heilig! Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so leidenschaftlich war wie sie. Leidenschaftlich oder rabiat, das ist Ansichtssache. Innerlich. Und wenn sie innerlich von etwas erfaßt wird, ist es, als ob ein Lichtkegel auf diesen Gegenstand oder diesen Menschen gerichtet würde. Im Augenblick ist ihr Spot nicht auf mich gerichtet, sondern auf ein fernes Land, wo die Leute ihr »welcome« nachrufen. Es gab ein Echo in der Leitung, und als sie in den Hörer pustete, war es, als würde sie mir zwei Mal ins Ohr pusten. Ich stehe jetzt auf und nehme die längste und kälteste Dusche der Welt. Ich will nicht mehr an sie denken und versuchen, mich nicht nach ihr zu sehnen. Ich will jetzt arbeiten. Ich weiß nicht, ob das ein probates Mittel gegen Sehnsucht ist, aber ich werde es versuchen. Arbeiten, arbeiten und sehen, ob es mir weiterhilft.
Bis auf weiteres wohne ich im Orient Palace Hotel, was der höchste Luxus wäre, wenn es in New York läge und wenn es unterhalten würde. Es ist nichts daran gemacht worden seit es im Jahr 1929 gebaut wurde, und genau deshalb ist es Kult! Reinstes Art déco. Das Orient Palace war das erste Touristenhotel in Damaskus. Vor 1929 mußten die Reisenden noch in einer Karawanserei wohnen, so wie die Händler mit ihren Kamelen es immer gemacht haben. Man hatte einen europäischen Tourismus vor Augen, als das Orient Palace in den wilden Zwanzigern gebaut wurde. Die zwanziger Jahre war nicht nur in den USA wild, sie waren es auch hier, die Frauen warfen den Schleier ab und trugen Gatsbykleider und gingen ins Kino, auch wenn das Aufruhr verursachte und einmal ein Kino angezündet wurde, als Frauen in der Vorstellung waren.
Als ich vor ein paar Tagen hier ankam, bat ich den Taxifahrer am Flughafen, zum Orient Palace zu fahren. Die Dollarzeichen in seinen Augen verwandelten sich langsam in Fragezeichen. Ich zeigte ihm den Namen im »Lonely Planet«-Reiseführer. Er verstand nichts, und als ich ihm den Stadtplan zeigte, verstand er noch weniger. Ein Stadtplan und ein Araber sind zwei unvereinbare Größen. Die Straßen und die Welt sind immer in Bewegung, sind nicht ein für allemal verkartet und verplant. Ich wurde nervös. Konnte er nicht wenigstens lesen? Aber warum sollte er unsere ausgeklügelten Buchstaben lesen können, wo wir Probleme haben, ein D von einem R in ihrem verschlungenen Alphabet zu unterscheiden? Das Orient Palace liegt gegenüber dem Hidschazbahnhof, fand ich schließlich selbst mit Hilfe des Stadtplans heraus, die Dollarzeichen leuchteten wieder in seinen Augen. Es war weit, bis ganz in die Stadt hinein, und als der Preis endlich heruntergehandelt und wir da waren, brachte er nachsichtig heraus: »Funduq asch-Scharq«, Hotel Osten, so heißt es auf arabisch, aber woher soll man das wissen? Der Orient, das sind die Länder im Osten, subjektiv vom Westen aus gesehen, aber wenn man mittendrin ist, ergibt das Wort keinen Sinn. Orient Palace ist ein Name zu Ehren der Reisenden, die mit dem Orient-Expreß bis Aleppo fuhren und dann mit dem Lokalzug weiter bis hierher. Verstaubt und zerknittert traten sie vor den Hidschazbahnhof, umringt von Schafen und Ziegen, sie überquerten die Straße und betraten einen Ort, der ihnen trotz allem vertraut vorgekommen sein muß.
Die breite Marmortreppe führt zu noch mehr Marmor und Größe, blankgeputzten Böden und Räumen, die zwei Stockwerke hoch sind. Das Hotel ist in eine andere Zeit hineingebaut worden, und es gründete auf einer anderen Realität als der, die es heruntergewohnt hat. Der Empfangstresen ist aus einem mahagoniähnlichen Holz, der Mann dahinter sieht aus, als sei er festgewachsen, und die meisten Schlüssel stehen in ihren Schilderhäuschen. In einem kleinen Glaskasten daneben sitzt der Telefonist, der auch das Fax und das Telex bedient. Telex – stammt das nicht aus der Zeit der Phonographen? Verschickt im einundzwanzigsten Jahrhundert überhaupt noch jemand Telexe? Und der glatzköpfige Herr im Glaskasten, ist er ausgestopft? Im großzügigen Vestibül werfen Kristalleuchter ein mattes Licht über die Sofas, wo einmal elegant gekleidete Damen ihren Fünf-Uhr-Tee einnahmen. Jetzt trinken iranische Frauen ein Glas Orangeade unter dem Schleier. Und wo einmal Seidenstrümpfe in Hochhackigen an handgenähten Zweifarbigen in einem dumpfen Slowfox vorbeiglitten, knien jetzt barfüßige Männer mit dem Gesicht gen Mekka. Der Tanzsalon wurde zum Gebetsraum, die anstößige Bar ist geschlossen, Funduq al-Scharq ist jetzt ein Pilgerhotel für shiitische Moslems, die aus dem Iran hierher wallfahren. Wenn man sich die große Reise nach Mekka nicht leisten kann, tut es auch die kleine nach Damaskus. Die Enkelkinder von Mohammed liegen in der Sayida Zeinab Moschee, nicht weit von hier, begraben.
Im hohen Speisesaal steht eine Leiter, die fast bis zur Decke reicht, als ob man die Decke streichen wollte. Die weißen Farbflecke auf der Leiter haben den gleichen gelblichen Ton angenommen wie die Decke. Ob wohl die Farbe oder der Maler zuerst aufgegeben hat? Die Leiter ist stehengeblieben als Mahnmal, daß die Decke einmal gestrichen werden sollte.
Ich habe die Suite bekommen, wo die berühmte Kriminalschriftstellerin einmal gewohnt hat. Ein Hauch ihres verstaubten Rosenparfüms ist noch vorhanden, ebenso wie der Toilettentisch, der dreiflügelige Kleiderschrank und der zehnarmige Kronleuchter unverändert sind. Es scheinen in der Zwischenzeit auch keine Glühbirnen ausgewechselt worden zu sein, es leuchten nur zwei, manchmal auch drei. Die Stühle mit perlmutternen Intarsien im Wohnzimmer sind so groß wie Elefantenkinder, das Sofa gleicht einen ausgewachsenen Nilpferd mit Nackenwülsten, und der faltige Teppichboden zeugt von vergeblichen Versuchen, die Möbel zu verschieben, die Flecken an der Terrassentür von fehlenden Dichtungen. Ich bin sicher, ich bin der einzige Gast in diesem Hotel, der Campari und Arrak im Kühlschrank hat; er brummt wie ein Höhlenbär, und im Innern sieht er aus, als stamme er aus der Eiszeit. Ich gehe in der Suite umher und nenne die Dinge beim Namen.
Unsere Namen, denken wir, werden ein Teil von uns. Ein Araber jedoch ändert seinen Namen nach dem erstgeborenen Sohn. Es bedeutet Prestige und Ansehen, Abu Wael zu sein; Waels Vater und Umm Wael, Waels Mutter. Weniger gut ist natürlich, Abu Lydia zu sein, dieses Modell wählen nur wenige Araber, sie behalten lieber ihren eigenen Namen. Wenn er keine Kinder hat, kann er immer noch, wenn er die ersten grauen Haare bekommt, Abu Ali genannt werden. Wir trafen sogar einmal einen katholischen Mönch, der von den Leuten im Ort Abu Ali genannt wurde, nur um ihm Respekt zu erweisen. Deshalb nannte ich George A. S., in zwei Buchstaben ausgesprochen, als Abkürzung für Abu Someone. A. S. wurde sein Geheimname zwischen uns, später wurde er zur Gewohnheit. Auch für Freunde wurde er A. S., ich wurde jedoch nie Umm Someone; U. S. klang da, wo wir herkamen, zu blöd.
Samia hätte Sami heißen sollen. A. S. war sicher, es würde ein Junge werden. Ich war nicht sicher. Er wünschte es sich so sehr. Ich wußte das, schon gleich, als ich ihn in Atlanta kennenlernte, wo er mit einer Stiefmutter und zwei sehr religiösen Tanten aufwuchs. Ich wußte, er träumte von einem Sohn, dem er eine andere Kindheit geben konnte; von einem Jungen, der Baseball spielte, was er nie gedurft hatte, der den Plattenspieler bekommen würde, den er nie bekam, mit Mädchen tanzte, mit denen er nie hatte tanzen dürfen. Er sagte es nie, aber ich wußte, daß er sich tief im Herzen einen Sohn wünschte. Wie oft habe ich ihn daran erinnern müssen, daß der Mann verantwortlich ist für das Geschlecht des Kindes.
Alles hat ein Geschlecht, ist männlich oder weiblich, und es ist nicht leicht, die Logik darin zu erkennen. Die Körperteile, die es paarweise gibt, sind im Arabischen fast immer weiblich, während die Scheide männlich ist. Die Sprache kennt drei Mengenangaben: Einzahl, Dual und Mehrzahl; die Dinge verändern sich bis zur Unkenntlichkeit, je nachdem, wie viele es davon gibt. Ein Tag heißt yom, drei heißen ayam. Es ist nichts für kleine Kinder, oder richtiger, gerade für sie, sonst lernt man es nie. Und dann werden die Verben nach Geschlecht, Person und Zahl gebeugt. Alles hat einen Namen, ich gehe im Wohnzimmer, im Schlafzimmer umher und benenne die Dinge. Kühlschrank und Nilpferd muß ich im Wörterbuch nachschlagen, Dichtung gebe ich auf, und Nackenwulst versuche ich gar nicht erst zu finden. Ich eigne mir die Suite an, indem ich die Dinge benenne: Türgriff, Steckdose und Wasserhahn schlage ich nach, um sie gleich wieder zu vergessen. Ich stecke den Stöpsel in die Badewanne, drehe jedoch den Hahn nicht auf. Das ist nicht nötig, im Laufe einer Stunde wird sie voll sein, so sehr tropft er. Mit kaltem Wasser. Aber das warme ist so kochend heiß, daß eine kleine Zugabe davon genügt. Solange ich die Wörter übe, kann ich an nichts anderes denken. Umm, abu und habibi – Mutter, Vater und Geliebte – sind Wörter, die ich schon so lange kenne, daß ich sie nicht mehr als fremde Wörter ansehe.