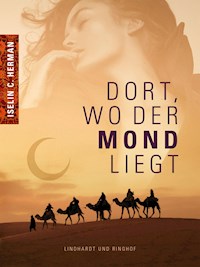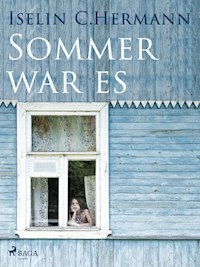
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman spielt im Dänemark der sechziger Jahre. Der Sommer aus der glücklichen Kindheit wird wehmutig neu erlebt und in Erinnerung gebracht. Die fünfjährige Zwetsche wird den Sommer am Hof der Großeltern verbringen. Ein Ort voller Sicherheit und Wärme, aber auch ein Ort voller Abenteuer und Tiere. Doch eine Frage bleibt für das fünfjährige Kind, werden die Eltern wieder kommen um es abzuholen?-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Iselin C. Hermann
Sommer war es
Übersezt von Regine Elsässer
Saga
Sommer war es
Übersezt von Regine Elsässer
Titel der Originalausgabe: Træer sår sig selv
Originalsprache: dem Dänischen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 2004, 2021 Iselin C. Hermann und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726921892
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
»Mein Gott, was ist das nur für ein Hof?«
Die Frage muß immer gestellt werden, wenn wir in die Allee einbiegen, und immer im gleichen fragenden Tonfall, als ob wir nicht ganz genau wüßten, was das für Gebäude sind, die vor unseren Augen erscheinen. Wir müssen beide so tun, als ob wir noch nie im Leben den Gutshof gesehen hätten, der einem Gesicht ähnelt. Ich habe Großmutter noch nie gesagt, daß ich finde, daß das Haupthaus einem Gesicht ähnelt, denn ich weiß, sie würde mich fragen, warum, und dann müßte ich zugeben, daß ich nicht wisse warum, es sei einfach so, bei den meisten Häusern sei das so. Ein ganz kleines Haus mit zwei Fenstern und einer Tür, wenn es das in der Wirklichkeit überhaupt gibt und nicht nur von den langweiligsten Kindern im Kindergarten gemalt wird: Fenster, Tür, Fenster, Schornstein mit Rauch, so ein blödes Haus ähnelt einem Hundekopf. Warum der Hof mich an ein Gesicht erinnert, ist schwer zu sagen, denn er hat zu viele Augen und nur einen Mund. Eins, zwei, drei, vier Fenster auf der einen Seite der Eingangstür und vier auf der anderen Seite, im ersten Stock sind drei Fenster, der Rest ist schwarzes Ziegeldach. Auf der einen Seite des Haupthauses ist die Scheune, auf der anderen der Kuhstall, davor auf dem Hofplatz ist ein rundes Rasenstück mit einer Hecke drum herum. Die Nebengebäude und der Hofplatz gehören zum Körper. Vielleicht finde ich, daß das Haupthaus einem Gesicht ähnelt, weil ich es so gut kenne wie mich selbst. Ich weiß, wie ich aussehe, wenn ich die Haare gewaschen bekommen habe und in ein Handtuch gewickelt auf einem Schemel stehe. Um mich zu sehen, wische ich den Dampf vom Spiegel, obwohl ich das nicht darf, weil es Streifen gibt, und ich muß mich auch nicht im Spiegel anschauen, um zu wissen, wie mein Kopf aussieht. Es ist einfach lustig, wenn Großmutter mit Erstaunen in der Stimme fragt: »Mein Gott, was ist das nur für ein Hof?«, sobald wir in die Allee einbiegen und dem Hof in die Augen schauen.
Dieses Spiel gehört nur uns beiden, Großmutter und mir. Sie spielt es nicht mit den anderen Enkelkindern und auch nicht mit meinem kleinen Bruder. Wenn jemand von den anderen mit im Auto sitzt, dann sagt sie es nur zu mir. Die anderen können es hören, aber sie verstehen es nicht so, wie ich es verstehe. Auch weil ich die Älteste bin und den Hof am längsten kenne. Wie ich auch diejenige bin, die ihr Spiegelbild am längsten kennt.
»Nicht Kopf ... es heißt Gesicht!«
Das geht nie daneben, ich werde jedesmal korrigiert, wenn ich »Kopf« anstelle von »Gesicht« sage, aber nur Erwachsene und Häuser haben Gesichter, Kinder haben Köpfe. Das Gesicht ist die Vorderseite, mit dem tut man so, als ob. Ich habe ein weißes Gesicht, immer, wie der Hof. Wir haben beide dunkle Haare, aber weiter läßt sich nicht beschreiben, wie ein Gesicht aussieht, denn diejenigen, die man gern hat, kann man nicht beschreiben, und die beiden Gesichter, die ich am allerliebsten mag, sind in einem Nebel verschwunden.
»Mein Gott, was ist das nur für ein Hof?«
Es darf nur einmal gesagt werden, wenn wir in die Allee einbiegen. Es ist jedesmal lustig, nur gestern nicht.
Ich saß schräg hinter Großmutter, da, wo ich immer sitze, hinter Großvater, wenn er mitfährt, und sagte kein Wort. Ich mag alles an dem Auto: den Geruch, besonders den Geruch, das Geräusch, den Namen, das Radio, die Farbe. Nur gestern nicht. Die ganze Fahrt war ein einziger langer Versuch, mich zu erinnern, wie sie aussehen, aber es war nicht möglich, den Dampf vom Spiegel zu wischen und Mama zu sehen, wie sie hinter mir steht, wenn ich gebadet habe. Und Papas Gesicht bekomme ich auch nicht hin. Ich kann es nicht. Und dann passierte es wieder, ganz tief im Bauch drehte es sich, wie ein fest ausgewrungener Waschlappen, der Hals schnürte sich um einen sauren Geschmack zusammen, und was aus dem Mund kam, nennt man Weinen. Irgendwie muß es schließlich heißen! Aber es ist viel mehr als Weinen, auch wenn Tränen aus den Augen kommen. Es ist Trauer, Verzweiflung, Unglück und etwas, wofür es in keiner Sprache Wörter gibt.
»Aber meine liebe ...«, und dann sagt sie den Namen, den nur Großmutter benützt und der ganz anders ist als der, mit dem Großvater mich nennt. Und Papa! Und dann ertrinke ich in Tränen und Rotz.
»Aber mein Liebes!«
Sie versucht, erwachsen zu klingen und mit mir zu sprechen, als sei ich es auch. Aber ich bin ja nichts. Nur die, die allein zurückgelassen wurde. Weinen, Trauer, Verzweiflung, Unglück und das, wofür es keine Wörter gibt, kann man nicht mit Wörtern wegwischen. Der Rotz schmeckt süß. Tränen sind salzig, und wenn man nicht mehr weinen kann, bekommt man Schluckauf.
Der Kies knirscht unter den Reifen, einen Moment lang tröstet mich das Geräusch, denn das, was man gut kennt, ist wie eine kühle Hand auf einer fieberheißen Stirn. Der Kies knirscht anders unter den breiten Reifen von Großmutters Auto als unter denen von unserem Volkswagen, damals, als alles noch wie früher war. Mein kleiner Bruder und ich lagen immer hinten in der Gepäckablage, wenn wir kein Gepäck dabeihatten. Die Gepäckablage hatte einen schwarz-weißkarierten Bezug, die Erwachsenen unterhielten sich, Papa fuhr, und Mama redete, wenn sie nicht ihm zuhörte. Das Geräusch unter den Reifen von Großmutters Auto ist ganz anders breit, wir nennen das Auto nicht ohne Grund »den Breiten«. In Wirklichkeit ist es ein Rover, aber von denen gibt es ja viele. Es gibt nur ein Auto auf der Welt, das der Breite heißt, und das ist dieses. Und nur eines, das den Kies so knirschen lassen kann.
Auf dem Hof heißt eigentlich nichts so, wie es in Wirklichkeit heißt. Nur Großvater. Er kann nicht anders heißen. Irgendwie bin ich ein bißchen stolz auf all die Namen, ich weiß nicht, warum. Es ist fast so, als ob der Ort, der Mensch, das Ding, das mehrere Namen hat, dadurch größer, geräumiger, reicher wird. Heimlicher. Den Namen, den Großmutter für mich hat, kennen nur wir beide. Und auch den von Papa! Jetzt hatte ich doch aufgehört zu weinen, wegen des guten Geräuschs unter den Reifen, aber das Weinen pumpte durch den Hals und aus dem Mund, so daß mir der Kopf weh tat.
Die Jungen standen auf der Treppe, wie meistens, wenn sie alle drei zu Hause sind. Hoftölpel, der Jüngste, steht fast immer auf der Treppe, und wenn er mal von zu Hause wegzieht, bekommt der Hof einen anderen Gesichtsausdruck. Die anderen beiden wohnen schon lange nicht mehr zu Hause, schon seit ich auf der Welt bin.
Sie werden alle nicht bei ihren richtigen Namen genannt, und von allen dreien wird nur als von »den Jungen« gesprochen, was sie auch nicht sind, sie sind nämlich erwachsen. Fast. Nicht ganz so erwachsen wie andere in ihrem Alter, denn sie sind nicht ernst, und sie sind noch nicht verheiratet. Das heißt, der mittlere, Østen, heiratete, als er noch sehr jung war, und darüber waren die Großeltern sehr traurig. Dann wurde er geschieden, darüber waren sie sehr froh.
»Sie waren viel zu jung«, sagt Nea und schüttelt den Kopf, während sie meiner Cousine die Windeln wechselt.
Die Jungen haben noch keine Arbeit, sie studieren alle drei Jura, damit sie einmal Arbeit bekommen. Puer, der älteste, studiert schon, solange ich lebe, glaube ich, und noch etwas länger. Hoftölpel hat gerade angefangen.
Wenn die Jungen nicht zu Hause sind und Nea gut gelaunt ist, kommt sie zur Begrüßung auf die Treppe. Wenn die Jungen nicht zu Hause sind und Nea nicht herauskommt, ist das ein schlechtes Zeichen, denn dann ist dicke Luft oder Rauch in der Küche. So nennt Großmutter es und bekommt müde Augen. Aber das stimmt gar nicht, ich bin ganz oft selbst dort gewesen und habe nachgeschaut. Es qualmt nicht und riecht auch nicht; keine Spur von Rauch oder dicker Luft.
Bevor man die Küche betritt, muß man seinen Namen sagen. Wenn man nur so hineinstürmt, packt Lille einen an den Kniekehlen.
Eigentlich heißt er Kuan Jiin, und er ist der dünnere der beiden Pekinesen. Nanki ist der dickere und gutmütigere Hund und heißt eigentlich Nanki Puh. Beide sind ein Geschenk von irgendeinem Gesandten aus dem Land, wo man solche Hunde hat, wo die Menschen den Hunden ähneln und wo man sie auch ißt. Lille und Nanki halten sich meistens in der Küche bei Nea auf, obwohl meine Großeltern sie geschenkt bekommen haben, aber pfui Teufel, Hunde zu essen. Und Pferde. Und Räucherhering.
Lille hat einen Schaden. Daran sind die Jungen schuld, damals war Lille wirklich noch klein, und die Jungen waren noch Jungen. Sie lagen hinter der Tür auf der Lauer und schrien »Buh!«, als Lille kam, und davon hat er einen Schaden. Deswegen muß man immer seinen Namen sagen, wenn man die Küchentür aufmacht. Der Griff ist sehr hoch, die Tür hängt und gibt das schleifende Geräusch von sich, das einfach zur Küchentür dazugehört. Aber hier gibt es keinen Rauch und auch keine dicke Luft, da kann Großmutter sagen, was sie will! Nea steht mit dem Rücken zur Tür und richtet etwas, und obwohl ich laut gesagt habe, daß ich es bin, dreht sie sich nicht um.
»Guten Tag«, sagt sie im gleichen Tonfall, wie wenn der Herr oder die Herrin in die Küche kommen. So nennt sie Großvater und Großmutter, und in der Reihenfolge. Immer zuerst der Herr.
Aber wenn Nea auf der Treppe steht und uns empfängt, dann umarmt sie mich, und das duftet nach Vanille, und das wissen der Herr und die Herrin nicht, denn sie sind noch nie von ihr umarmt worden.
Nea duftet süß nach Vanille und Butterschmalz, alles an ihr ist weich: Ihre Hände, wenn sie mir die Wange streichelt, die Haut auf ihren Armen, wenn sie im Topf rührt, ihre Brüste, die unter der Schürze und unter dem Kittel wogen, wenn sie richtig feste rührt, damit die Soße nicht gerinnt.
Der Herr und die Herrin nennen Nea Signe. Ganz richtig und von Geburt an hieß sie sehr merkwürdig und mann-frau-artig, nämlich Hans Signe, aber das konnte Puer nicht sagen, als er noch klein war, deshalb nennen die Kinder, und alle die einmal Kinder waren, sie Nea. Manchmal, wenn Østen sie necken will, nennt er sie Hans.
Großmutter hatte gerade gesagt: »Aber mein Liebes ...«, und das ganze Unglück, das in mir war, konnte nicht heraus, obwohl ich weinte. Die Tränen und die Geräusche, die aus meinem Mund kamen, nahmen nur ein bißchen Druck weg.
Sie haben nicht mal auf Wiedersehen gesagt!
Vor langer Zeit fuhren wir mit der Straßenbahn zu den anderen Großeltern, Oma und Opa, meine Mutter, mein kleiner Bruder und ich. Mutter war gut gelaunt und hatte meinen Bruder auf dem Schoß. Wir waren alle gut gelaunt, denn bei Oma können wir in der Badewanne baden und Frikadellen auf dem Wannenrand essen. Und aus dem Wasserhahn plätschert jede Menge heißes Wasser. Zu Hause kann man nur das Waschbecken mit lauwarmem Wasser füllen, wenn man Glück hat! Bei Oma machen wir Sauermilchbrösel aus trockenem Roggenbrot, das wir durch den Puppenfleischwolf drehen, und wenn sie weiß, daß ich zu Besuch komme, legt sie ihre Puppe von damals, als sie klein war, auf die Marmorplatte über der Heizung. Der Puppenkopf ist aus Porzellan und wird warm, wie bei einem richtigen Kind.
An diesem Tag vor langer Zeit hat mein Bruder sofort mit dem Puppenfleischwolf losgelegt, und ich habe Karen Margarethe umgezogen. Und dann hat Mama nicht einmal auf Wiedersehen gesagt! Und ich habe sie seither nicht mehr gesehen. Papa auch nicht. Ich habe versucht, die Augen zusammenzukneifen, aber das nützt nichts, auch nicht, sie so lange aufzusperren, bis sie tränen. Ich kann mich nicht an ihre Gesichter erinnern. Als Karen Margarethe alle ihre Kleider an- und wieder ausgezogen bekommen hatte und als eine ganze Wagenladung Sauermilchbrösel gemacht worden war und wir warm und sauber und satt in Omas weichem Bettzeug lagen, da habe ich sie schon vermißt, das tue ich sonst nicht, wenn wir bei Oma sind, weil ihr Bettzeug so gut riecht, und gleichgültig ob es Sommer oder Winter ist, sie stellt immer eine Kerze hinter einen kleinen Weihnachtsbaum aus grünen Pfeifenreinigern mit kleinen Glaskugeln in allen möglichen Farben. Sie hat nicht auf Wiedersehen gesagt!
Der nächste Tag zog sich wie der Haferschleim im Kindergarten. Oma telefonierte, und Oma telefonierte nicht, ich durfte sogar Buchstaben auf ihrer Schreibmaschine schreiben, aber nicht einmal das hat Spaß gemacht. Ich bekomme nur ganz selten die Erlaubnis dazu, weil es immer so endet wie das Spiel mit den flachen Händen, die man übereinanderlegt: im Kuddelmuddel. Die Buchstabenarme kommen falsch über Kreuz, und Oma muß sie vorsichtig wieder auseinanderklauben. Aber sie schimpft nie. Trotzdem war es kein richtiger Oma-Tag. Am Abend schaute Opa über seine Brille, und mit seiner sachlichen, gebrochenen Arztstimme sagte er etwas über ein Flugzeug und über ein Griechenland. Es fühlte sich an, als ob jemand ein Eisenstück an eine Stelle unter meinem Herzen gestoßen hätte und es drehte, immer weiter drehte, und alle Muskeln im ganzen Körper sich anspannten. Und es hilft auch nichts, wenn die Erwachsenen sagen, daß ich die Schultern nicht bis zu den Ohren hochziehen soll!
Mein kleiner Bruder versteht nichts, er ist immer klein und fröhlich und hat runde Backen, die in der Kälte ballonrot werden. Er hat dicke Knie und Grübchen auf den Ellbogen, und runde blaue Augen, und niemand auf der Welt darf ihm weh tun. Als ich noch klein war, bevor er geboren wurde, da wußte ich nicht, daß es etwas geben kann, das sich in einem drin so warm und wichtig anfühlt. Es blühte auf wie eine Feuerblume, als ich ihn das erste Mal sah. Bevor er geboren wurde, war ich die Kleine. Jetzt ist er der Kleine, und er versteht nichts, läuft durch seine Kindheit und ist Omas kleiner, neuer Kupferpfennig. Ich bin die Große. Und wenn die Große dauernd heult, dann heult auch der Kleine, und das ist blöd, denn er weiß ja nicht einmal, warum er heult.
Oma und Opa reden im anderen Zimmer miteinander und glauben, wir hören nicht, worüber sie reden. Dann geht Oma in Opas Büro und wählt eine Nummer. Auf Strümpfen schleiche ich ins Eßzimmer und höre, wie sie bittet, mit der Herrin sprechen zu dürfen. Ich kenne nur einen Menschen, der so bezeichnet wird, und kann mir denken, daß Nea am Telefon war. Es dauert ein bißchen, dann sagt Oma etwas, dann schweigt sie, und dann sagt sie »Du« und »Ja«, dann sagt sie in fragendem Ton Großvaters Vornamen, und dann sagt sie, sie wissen sich keinen Rat mehr.
»Nein, nein, sie will nicht essen und nicht schlafen. Sie fehlen ihr so schrecklich!«
Ich muß mir den Mund zuhalten und in die Hand beißen, damit ich nicht schreie. »Fehlen ihr so schrecklich«, nennt man es so? »Fehlen«, das klingt wie ein stiller, sanfter Sommerregen und nicht so, wie es sich anfühlt. »Schrecklich«, ja, aber »fehlen« ist ganz verkehrt. »Was fehlt ihr denn?« kann Doktor Marcussen fragen, wenn eines der Kinder sich nicht wohl fühlt. Oder Nea sagt manchmal, »es fehlt Geld in der Kasse«, wenn ihre Abrechnung nicht stimmt. »Tut mir leid, dieser Artikel fehlt kurzfristig« sagt der bucklige Tabakhändler fröhlich, wenn ein Kunde in seinen unfreundlichen Laden kommt und er die richtigen Bonbons nicht dahat. Er selbst ist auch unfreundlich und kann Kinder nicht leiden. Ich gehe auf jeden Fall nie zu dem Tabakhändler an der Ecke, wenn es nicht unbedingt sein muß. Und sollten mir Salmiakstangen fehlen, weil ich Lust auf Lakritz habe, dann würde ich meine Zehn-Öre-Münze niemals bei ihm springen lassen!
Wenn einem etwas fehlt, dann hat man etwas nicht, was man finden, bekommen oder kaufen kann, etwas, das irgendwie beschafft werden kann. Aber es tut nicht so schrecklich weh innen drin, daß ich mir den Mund zuhalten muß, um nicht zu schreien.
»Ja«, sagt die Oma erleichtert ins Telefon. »Das habe ich auch gedacht. Ja, der Hof und die Jungen und alles. Nein, nein, unser kleiner Kupferpfennig, der ist so einfach, er kann gerne hierbleiben.«
Ich laufe wieder ins hinterste Zimmer. Mein kleiner Bruder ist einfach, ich bin schwierig. Aber nur bis er es versteht, dann wird er auch schwierig! Er liegt auf dem Boden und sagt ga-ga, die eine Hand unter dem Kopf und die andere auf seinem Traktor, er spuckt, wenn er Motorgeräusche macht. Ich lege mich neben ihn.
»Papa?« sage ich vorsichtig. »Mama?«
Er schaut mich nur mit seinen runden Augen an und steckt mir seine kleinen, dicken Finger in den Mund. Er ist einfach, weil er sie schon vergessen hat.
Großmutter hat mich sogar in Kopenhagen abgeholt. Der Breite in Kopenhagen, das ist ein so merkwürdiger Anblick wie ein Indianer im Supermarkt oder die Palastwache auf einem Acker. Der Breite gehört auf die kleinen Straßen zwischen der Bahnstation und dem Hof, und natürlich nach Helsingör, wo die Großmutter einkauft und wo sie und ich auf dowdy gehen, das nennt sie so, wenn sie und ich uns vergnügen.
Ganz, ganz früher hat einmal ein Prinz im Schloß von Helsingör gewohnt, er war ein bißchen verrückt und hieß Hamlet. Er ist mit einem Totenschädel in der Tasche herumgelaufen, er hat ihn immer wieder mal herausgeholt und mit ihm gesprochen. Sie müssen damals große Taschen gehabt haben, denn auf den Bildern, die es davon gibt, sieht er nicht aus wie ein Schrumpfkopf.
Normalerweise gehen wir erst einkaufen, und dann gehen wir auf dowdy. Sie nimmt mich an der Hand, weil wir in Helsingör sind, wo es Autos gibt, und ich muß immer bei ihr bleiben.
Ding. Dong. Die Türglocke vom Kaffeehändler Hassing klingt, wie es bei ihm riecht: braun und bittersüß.
»Guten Tag Frau Direktor und guten Tag meine Kleine!«
Ich finde es ausgesprochen merkwürdig, daß der Kaffeehändler die Großmutter so nennt. Großvater ist doch der Direktor, wie kann sie dann Frau Direktor sein? Und was, wenn Großvater Müllmann gewesen wäre? Und das mit dem Direktor, das ist er eigentlich nicht, wenn er zu Hause auf dem Hof ist und seine abgetragenen Arbeitskleider anhat, dann ist er hauptsächlich mein Großvater.
»Was können wir heute für Sie tun?«
Der Kaffeehändler Hassing strotzt vor Wohlstand und Freundlichkeit, er nimmt den Deckel von einem großen Glasgefäß. Es ist so groß, weil die Bonbons, die drin sind, die größten Bonbons sind, die ich je gesehen habe. Die Althea-Bonbons schmecken am besten, aber ich mag es nicht, daß Großmutter sie »Halts-Maul-Bonbons« nennt, das Wort paßt nicht in ihren Mund. Merkwürdig, daß sie es nicht selbst hört. Ich grabe in dem Gefäß nach einem Althea-Bonbon. Und ich werde es nie mehr machen! Großmutters Augen blitzen und der Blick bedeutet: »Würdest du das bitte bleibenlassen!« Der Blick ist schrecklich, und man kann ihn nicht mißverstehen. Ich werde zu einem geschmolzenen, schmierigen Klacks auf dem Linoleum von Kaffeehändler Hassing.
»Was ist denn los?« Das Lächeln von Hassing ist ein Briefschlitz in einem viereckigen Gesicht, die Stimme so hellbraun wie sein Kittel. »Möchten wir heute kein Bonbon haben?«
Wie kann er nur so was fragen? Er muß doch sehen, daß dieser Blick mich zu Boden geschleudert hat und ich nur noch mit dem Kopf schütteln kann.
Großmutter kauft gebrannte Mandeln, getrocknete Pflaumen, dunkel gerösteten Java, eingelegten Ingwer, Pomeranzen, dunkle Schokolade und kandierte Veilchen. Alles an ihr ist geröstet, gebrannt, getrocknet und delikat. Die Räder der Kaffeemühle werden von einem großen Gummiriemen angetrieben, und wenn die letzten Bohnen in den Trichter fallen, macht es ein klirrendes Geräusch.
»Kann das kleine Fräulein etwas tragen?« fragt Hassing, und das kann das kleine Fräulein, das Päckchen ist klein und leicht, in Packpapier eingewickelt und sorgfältig kreuz und quer mit einer Schnur zugebunden und mit einem Trageholz versehen, das trocken in meiner Hand liegt.
Ding. Dong. Merkwürdig, daß es nicht andersherum klingt, wenn man den Laden verläßt!
Der Kaufmann Brammer ist weniger viereckig, nicht so groß, aber genauso freundlich, sein Kittel ist blau und paßt zu seiner Nase. Wir reden nicht über das beim Kaffeehändler Hassing, und als Großmutter fünf Flaschen rote Brause verlangt, weiß ich, daß sie mir vergeben hat. Aber als der Kaufmann fragt, ob die kleine Helferin etwas haben möchte, schaue ich doch zur Großmutter hoch, ehe ich mich traue, ja bitte zu sagen. Beim Kaufmann Brammer ist es auch einfacher, die Marienkekse sind alle gleich. Ich nehme natürlich den obersten, und ich darf noch einen für die andere Hand nehmen. Ich muß das Trageholz loslassen, es ist inzwischen klebrig warm und dunkel geworden.
Fleisch und Fisch, Milch und Brot kaufen wir nicht, weil Marinus zweimal pro Woche mit dem Brotauto kommt, das Fischauto von Hornbaek kommt auch, Fleisch haben wir selbst und Milch natürlich auch.
Das Brotauto von Marinus finde ich am besten. Wenn er die Luke öffnet und das Brett vor den Herrlichkeiten herunterklappt, dann sieht er aus wie ein zufriedener Mann. Er hat Roggen und Weiß, wie er es nennt, und er zieht dabei die Luft durch die Zähne ein. »Roggen und Weiß, und was für den süßen Zahn.« Gewürzbrötchen, Zwieback. Schmalzgebäck mit buntem Zucker drauf, Kopenhagener mit weißer oder brauner Glasur, die Bienen wohnen im Wagen. Marinus ist so rund wie sein Auto, allerdings nicht so grün wie das Auto, Marinus sieht aus, als sei er gut über den Winter gekommen.
»Wir sehen uns am Freitag wieder?« Nea hat alles, was auf ihrem Merkzettel steht.
»Ja, wenn ich mich bis dahin nicht zur Ruhe gesetzt habe, es könnte ja sein, daß man alles verkauft und endlich von seinem Geld leben könnte!« Marinus saugt die Luft ein, schlägt die Autotür zu und streckt zum Abschied den Kopf aus dem Fenster. »Ja, dann könnte man vielleicht bis morgen kurz nach Mittag leben!«
Er bringt Nea immer zum Lachen oder zum Lächeln oder dazu, daß sie wenigstens den Mund verzieht.