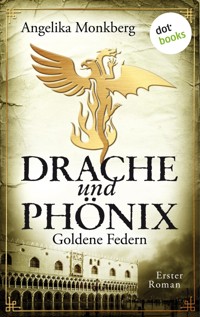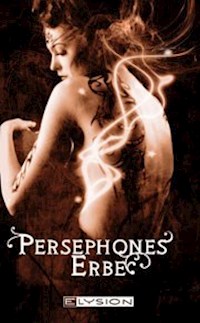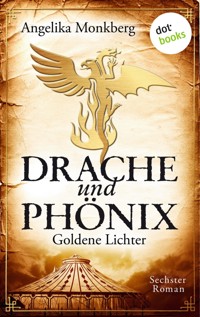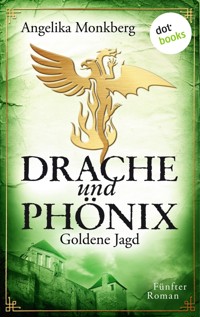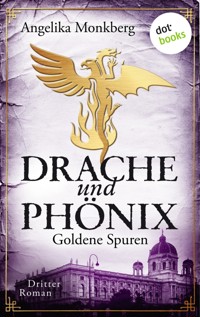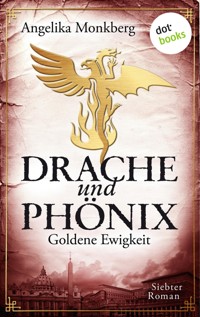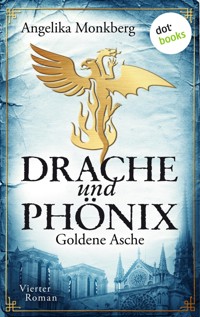
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Drache und Phönix
- Sprache: Deutsch
"War es nicht immer Euer Wunsch, dass die Urne, die die Kaiserin von Napoleon geschenkt bekam, an eine würdige Person weitergegeben wird?" – Jan sagte nichts, denn der Schlag kam zu plötzlich. Er hörte der Duchesse einfach weiter zu. – "Ihre Majestät hat eine Nachfolgerin gefunden, die die goldene Asche hüten wird. Wollt Ihr wissen, wo sie sich befindet?" Frankreich, Ende des 19. Jahrhunderts. Jan Stolnik, der Drache in Menschengestalt, führt das Leben eines Adligen – doch wann immer er die Gelegenheit dazu findet, mischt er sich unerkannt unter die einfachen Arbeiter. Die Hitze der Schmelzöfen lässt ihn für kurze Zeit die unstillbare Sehnsucht nach seiner großen Liebe vergessen, der Phönixdame La Fiametta, deren goldene Asche er immer noch nicht in seinen Besitz bringen konnte. Doch auch andere suchen nach der magischen Urne. Jan macht die Bekanntschaft eines Geheimordens, der Sonnenkreuzler, die von einer mysteriösen verschleierten Dame gelenkt werden. Handelt es sich bei ihr um eine britische Lady, Nachfahrin eines alten Feengeschlechts – oder etwas ganz anderes? Der vierte Band der historischen Fantasysaga, die Jahrhunderte überspannt und von der unsterblichen Liebe des Drachensohnes Jan Stolnik erzählt: spannend, abenteuerlich, faszinierend. Jetzt im eBook: "DRACHE UND PHÖNIX – Vierter Roman: Goldene Asche" von Angelika Monkberg. JETZT BILLIGER KAUFEN – überall, wo es gute eBooks gibt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Für Nina wird ein Traum wahr, als sie nach Rom kommt. Hier, in der Ewigen Stadt, wartet aber nicht nur ein großartiger Job auf sie, sondern auch eine sinnliche Offenbarung: Als Nina von einem Platzregen überrascht wird, flüchtet sie sich durchnässt in ein Luxushotel an der berühmten Spanischen Treppe. Sofort ist ein attraktiver Mann zur Stelle, der ihr zuerst seine Hilfe anbietet – und sie dann auf seinem Zimmer so leidenschaftlich liebt, dass Nina fast die Sinne schwinden. Und dies wird nicht der einzige Höhepunkt sein, den sie in der Villa Medici erleben wird …
Ein provokanter erotischer Roman über eine Frau, die entdeckt, welche Sehnsucht viel zu lang in ihr geschlummert hat.
Über die Autorin:
Aimée Laurent, geboren 1962 in Bielefeld, arbeitete lange in der Werbung und im Marketing, bevor sie die Lust am Schreiben entdeckte. Heute ist sie als freie Redakteurin für Magazine in Deutschland und in der Schweiz tätig. Wenn sie nicht gerade auf Reisen ist, pendelt sie zwischen Hamburg und Berlin und mag sich nicht festlegen, in welcher Stadt es sich nun besser leben lässt.
Bei dotbooks erschienen bereits ihre Romane Die Verführung der Mrs. Jones und Die Zärtlichkeit von Fremden sowie die Geschichtensammlung Nimm mich, wie du willst.
Die Autorin im Internet: www.facebook.com/autorinaimeelaurent
***
Originalausgabe März 2014
Copyright © 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Monika Hofko
Titelbildgestaltung: Nicola Bernhart Feines Grafikdesign, München
Titelbildabbildung: © Nick Freund – Fotolia.com
ISBN 978-3-95520-427-3
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Die wilde Lust der Nina B an:[email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
www.gplus.to/dotbooks
Aimée Laurent
Die wilde Lust der Nina B.
Roman
dotbooks.
Die Vernunft ist des Herzens größte Feindin.
Giacomo Casanova
Kapitel 1
Der Mann erhob sich mit einer eleganten Bewegung und legte die Serviette sorgfältig auf dem Tisch vor sich ab. Er bedachte Nina mit einem entschuldigenden Lächeln, dann straffte er die Schultern und drehte sich um. Sein Gang verriet, dass er wusste, dass sie ihn beobachtete, und Nina wusste, dass er es wusste …
Sie betrachtete ihn, wie er an der Längsseite der Bar entlangschlenderte und die Finger fast zärtlich über die schwarze Glasplatte gleiten ließ. Der Anzug aus tintenblauer Baumwolle saß perfekt und betonte seine schmale Gestalt, die Hose war genau um die paar Millimeter zu kurz geschneidert, um die pinkfarbenen Strümpfe darunter aufblitzen zu lassen. Jetzt blieb er bei dem auffallend attraktiven Barmann stehen und strich sich dabei durch die fast schulterlangen dunkelblonden Haare.
Nina musste unwillkürlich schmunzeln. Ihr Chef war ein Pfau, wie er im Buche stand, aber er lebte seinen Spleen auf eine so natürliche Art, dass er in jeder Gesellschaft schnell zum beliebten Mittelpunkt wurde.
Nun sah er zu ihr herüber, nickte ihr zu, und Nina nickte zurück. Sie nippte an ihrem Wein, dann blickte sie auf ihre Hände; ungeduldig trommelte sie mit den Fingernägeln auf den Tisch. Hoffentlich ließ er sie nicht so lange hier sitzen. Nina atmete tief ein. Ihre alte Unsicherheit kam wieder hoch, sie mochte es einfach nicht, so allein in einem Lokal zu sitzen. Ihr Blick folgte Fabrizios Bewegungen. Er stand immer noch an der Bar. Seine Hand mit dem schweren Siegelring lag jetzt auf der des Barkeepers, und dieser machte keine Anstalten, sie zurückzuziehen.
Nina versuchte, diesen Augenblick der Intimität zwischen den beiden Männern zu ignorieren, aber es gelang ihr nicht. Sie trank noch einen Schluck von dem Primitivo und überlegte, wann sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Es war am Morgen ihres ersten Arbeitstages gewesen. Fabrizio hatte sie an der Haupttreppe des Palazzo Borghese in Empfang genommen und ihr freundlich erklärt, dass er nun ihr Vorgesetzter sei. Der alte Kurator – nun ja. Die Gesundheit. Dann hatte er sie freundschaftlich am Arm gefasst und durch die Ausstellung geschleift – anders ließ sich sein Tempo kaum beschreiben – und ihr sein Heim gezeigt, wie er es nannte: erst die Gemälde im ersten Stock, dann die Skulpturen im Parterre. Nina kannte alle Exponate, hätte zu jedem Stück aus dem Stand ein Referat halten können, doch das schien ihn nicht zu interessieren. Stattdessen redete er die ganze Zeit wie ein Wasserfall, fragte, kommentierte, fragte erneut. Sie begriff schnell, dass er ihr seine Sicht der Dinge verständlich machen wollte, und ließ ihn erzählen. Fabrizio sprach sehr gut Deutsch, aber wenn er nicht schnell genug das passende Wort fand, wechselte er mitten im Satz in seine Muttersprache. Er war ihr auf Anhieb sympathisch, und die aufmerksame Art, wie er zuhörte, und die Art, wie er sie dabei ansah, ließ ihr einen wohligen Schauer nach dem anderen über den Rücken laufen.
Nina seufzte und drehte ihr Weinglas in der Hand. Das hatte nichts zu bedeuten. Mit diesem Blick bedachte er jeden und jede, wie sie nach zwei Wochen Zusammenarbeit wusste, und genau das war auch sein Mittel zum Erfolg: Fabrizio konnte jedem Menschen das Gefühl vermitteln, er sei der Nabel der Welt für ihn.
Nina betrachtete die beiden Männer an der Bar immer noch. Jetzt war es der graumelierte Beau hinter dem Tresen, der die Hand auf die ihres Chefs legte. Nina bemerkte, dass der Barmann ebenfalls einen auffälligen Ring trug – vielleicht war es sogar der gleiche? Die beiden waren ein Paar, wie es aussah, doch das schien hier niemanden zu interessieren.
Nina spielte weiter mit dem Stiel des Weinglases und wusste nicht so recht, was sie nun machen sollte. Fabrizio wollte eigentlich nur kurz den Mann an der Bar begrüßen, wie er gesagt hatte, doch das Ganze schien länger zu dauern. Sie strich sich eine lange braune Haarsträhne hinter das Ohr und sah auf die Uhr. Es war schon nach elf. Seit sie in Rom war, hatte sie nur gearbeitet, von kleinen Spaziergängen durch die Parkanlagen der Villa Borghese einmal abgesehen. Am liebsten hätte sie diesen Abend zu Hause verbracht – sie hatte es noch nicht einmal geschafft, ihrer Zimmerwirtin einen offiziellen Antrittsbesuch abzustatten – und war der Bitte Fabrizios, mit ihm noch eine Kleinigkeit essen zu gehen, nur widerstrebend gefolgt. Aber sie wollte ihn nicht vor den Kopf stoßen, und so waren sie hier in der Trattoria da Enzo gelandet. Wie sich schnell herausstellte, war es das Lieblingsrestaurant des Kurators, und nun wusste Nina auch, warum. Es waren nicht nur die selbstgemachten Linguine con panna, so viel stand fest.
Nina ließ den Blick durch den Raum schweifen, genoss die trubelige Heiterkeit, die hier herrschte. Sie schloss die Augen, hörte auf das Stimmengesurre. Einen Moment lang hatte sie das Gefühl, als wäre sie wieder in Berlin. Dort gab es ein Lokal, das diesem hier sehr ähnlich war. Wenn man hineinkam, rechts die lange Bar, links die dicht an dicht gestellten Tische, Lärm und Kellnergeschrei und an der Tür der charismatische Padrone, der jeden Gast mit Handschlag begrüßte.
Berlin – bis vor kurzem hatte sie dort gelebt und gearbeitet, erst in Mitte, dann in Charlottenburg, wohin die Galerieszene gerade umsiedelte. Wie weit weg das alles war. Sie sah zu Fabrizio hinüber, doch der hatte nur Augen für seinen schönen Freund. Als sie die beiden so betrachtete, wurde ihr bewusst, dass sie sich einsam fühlte. Wieder trommelte sie mit den Nägeln auf den Tisch. Ihre Anspannung wuchs. Außer Fabrizio kannte sie niemanden in Rom, und wenn sie nicht endlich anfing, die Stadt zu erkunden, würde das wohl auch so bleiben … Wie dem auch sei, es war Zeit, zu gehen. Nina nahm ihre Tasche auf den Schoß und suchte nach dem Portemonnaie.
„Nina.“
Erstaunt hob sie den Kopf. Sie hatte Fabrizio nicht kommen sehen.
„Nina, entschuldige. Es war unhöflich, dich hier so sitzen zu lassen, aber du siehst ja – amore.“ Er schaute sie aus großen braunen Augen an. „Markus hat gleich Feierabend, dann kommt er zu uns an den Tisch.“
Nina lächelte und fischte ihre Geldbörse aus der Umhängetasche. Dann stand sie auf und winkte dem Kellner.
„Das ist eine schöne Idee, Fabrizio, aber ich bin hundemüde. Vielleicht darf ich deinen Freund ein anderes Mal kennenlernen?“ Sie sah ihn geradeheraus an und bemerkte die Enttäuschung in seinem Gesicht. Instinktiv berührte sie ihn am Arm.
„Bitte nicht sauer sein, aber ich muss wirklich in die Kiste.“
Der Kellner, der inzwischen an den Tisch getreten war, hielt ihr den Bon hin. Fabrizio kam ihr zuvor und nahm ihn an sich.
„Versprochen? Ein anderes Mal?“
Auf einmal sah er ganz jungenhaft und verletzlich aus. Nina nickte und griff nach ihrem lavendelfarbenen Paschminaschal, dann wandte sie sich zur Tür.
„Nimm dir ein Taxi, es wird gleich regnen“, hörte sie ihn noch rufen, dann war sie auch schon draußen.
***
„So ein elender Mist.“
Völlig durchnässt stand Nina im Foyer des Hotels, in das sie sich geflüchtet hatte. Der Platzregen hatte sie nur wenige Meter vom Restaurant entfernt erwischt.
Suchend blickte sie sich um. Irgendwo mussten hier doch die Toiletten sein … Sie hatte schon viel von der mondänen Villa Medici gehört, aber es wäre ihr nicht im Traum eingefallen, dass ihr erster Besuch in dem weltbekannten Luxushotel an der Spanischen Treppe mit so viel Peinlichkeit verbunden sein könnte. Zum Glück waren nicht allzu viele Gäste da, was wohl auch der Uhrzeit geschuldet war, trotzdem fühlte sich Nina wie auf dem Präsentierteller. Sie brauchte dringend einen Waschraum, wo sie sich …
„Oh nein.“ Nina hatte zwar kein Schild entdeckt, dafür aber ihr Spiegelbild: Das violette Kleid mit dem weiten Rock klebte am Körper, schwarze Rinnsale aus Wimperntusche krochen über die Wangen, und der schöne Schal war völlig ruiniert. Sie sah aus wie eine Vogelscheuche. Wütend stampfte sie mit dem Fuß auf. Als sie ein dumpfes Knack hörte, wusste sie, dass ihr gerade der linke Absatz abgebrochen war. Vorsichtig stieg sie aus den nachtblauen Slingpumps. Sie war sich sicher, nein, sie spürte, dass die Gäste sie neugierig musterten. Na wenn schon.
„Verdammte Scheiße, shit shit shit!“ Sie stampfte noch einmal auf.
„Davon wird der Schuh auch nicht wieder heil, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf.“
Dass der Fremde sie gerade auf Deutsch angesprochen hatte, ließ sie aufmerken. Nina blickte hoch. Sie war den Tränen nah.
„Meine Lieblingspumps“, sagte sie leise. „Donna Karan. Aus New York.“
„Hm.“ Der Mann vor ihr sah sie prüfend an. „Ist denn sonst alles intakt?“
Nina strich sich durch die nassen Haare und warf trotzig den Kopf in den Nacken.
„Abgesehen davon, dass ich mir mein einziges schickes Paar Schuhe ruiniert habe und mir die Mascara in die Mundwinkel läuft – ja.“
„Ist doch mal was anderes, oder?“ Er lächelte ihr aufmunternd zu. Als Nina nichts darauf antwortete, setzte er schnell hinzu:
„Ich weiß was: Ich organisiere Ihnen jetzt einen Föhn, und Sie machen mir die Freude und leisten mir bei einem Drink an der Bar Gesellschaft – wenn alles wieder in Ordnung ist. Na?“
Nina betrachtete den Fremden. Seiner Kleidung nach zu urteilen, war er Geschäftsmann. Grauer Anzug, weißes Hemd, hellblaue Krawatte. Die Haare mittelblond und kurz. Irgendwie sehr ordentlich, sehr verbindlich – und sehr langweilig. Aber hilfsbereit, und das war die Hauptsache.
Als sie nickte, lächelte er ihr zu, dann war er auch schon beim Portier und redete auf ihn ein. Der Blick des Hotelangestellten traf sie hart und unvermittelt und ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, wie unmöglich er die Situation fand. Du mich auch, dachte Nina.
***
„Bitte nehmen Sie doch Platz.“
Nina fühlte sich wie neugeboren. Während hilfreiche Geister Kleid samt Schal getrocknet und aufgebügelt hatten, war eine Angestellte des Hauses so freundlich gewesen, ihr mit etwas Make-up auszuhelfen. Die langen Haare hatte sie im Nacken mit einer Spange locker zusammengefasst, die bernsteinfarbenen Augen strahlten wieder. Nur für ihren beschädigten Pumps hatte man nichts tun können: Der Schuhmacher, der für die Villa Medici tätig war, hatte sein Handy ausgeschaltet.
„Danke.“
Sie ließ sich von ihrer Zufallsbekanntschaft auf den Barhocker helfen, und wie auf Kommando schauten beide auf ihre nackten Füße. Die Nägel waren lackiert: Chanel Rouge Noir, ein Klassiker.
„Tragen Sie immer so dunklen Nagellack?“
Erstaunt sah Nina ihn an.
„Nicht immer, nur so eine Laune“, antwortete sie wahrheitsgemäß.
„Schade.“
Nina schaute ihn aufmerksam an. „Warum?“
Er zuckte die Schultern.
„Vielleicht, weil ich es liebe, wenn eine Frau ganz Frau ist.“„Und dazu braucht es schwarzroten Lack?“ Sie lachte leise auf, es klang heiser und kehlig, als wäre sie erkältet.
„Auch.“
Er lächelte sie aus hellen Augen an und hob sein Glas.
„Mein Name ist Simon – und ich würde gerne du sagen.“
Nina musterte ihn. Seiner Aussprache nach kam er aus dem Norden Deutschlands.
„Simon – aus Hamburg?“ Sie hob ebenfalls ihr Glas und nahm einen kräftigen Schluck. Der Gin Tonic war hervorragend: Malacca Gin und Tonicwater von Fentimans. Auch Simon trank, dann schüttelte er den Kopf.
„Rostock. Aber ich lebe in Frankfurt.“
„Nina. Ich komme aus Berlin“, sagte sie, bevor er fragen konnte.
„Was führt dich in die Ewige Stadt?“, wollte Simon wissen und heftete den Blick auf sie.
Nina spürte die Spannung, die sich gerade zwischen ihnen aufbaute, und zuckte wie beiläufig mit den Schultern. Er nickte und nahm wieder einen Schluck. Nina betrachtete ihn genau. Und sie kam zu dem Schluss: Dieser Typ gefiel ihr.
Als sie nichts sagte, reagierte Simon mit einem fragenden Blick. Nina sammelte sich.
„Job. Karriere. Nenn es, wie du willst.“
„Du hast die Liebe zu spektakulären Auftritten vergessen.“
Nina lächelte, senkte den Blick und rührte in ihrem Longdrinkglas. Sie wusste, dass Simon sie ansah. Und irgendwie gefiel es ihr, seit langer Zeit einmal wieder mit Aufmerksamkeit bedacht zu werden. Sie nahm einen Schluck und ließ nun auch den Blick wandern. Er hatte die Krawatte abgenommen und zwei Knöpfe an seinem Hemd geöffnet. Jetzt sah er schon nicht mehr so spießig aus. Sie schätzte, dass er ungefähr in ihrem Alter war, um die dreißig, aber im Anzug wirkten Männer für gewöhnlich immer älter.
Jetzt legte er seine Hand neben ihre auf den Tresen. Er trug einen Ehering, und Nina wusste, er hatte gerade ihr die Entscheidung überlassen, ob sie ihm näherkommen wollte.
Sie blickte ihn an und bemerkte einen leicht spöttischen Zug um seinen Mund. Er war anscheinend kein geübter Jäger, und war er es doch, so konnte er das wunderbar verbergen. Nina spielte mit ihrem Glas und überlegte. Vor nicht einmal einer Stunde hatte sie Fabrizio und Markus noch um deren Zweisamkeit beneidet. Und nun bekam sie vielleicht wie aus dem Nichts die Chance auf Sex. Nina spürte, dass Simon sie weiter ansah und wohl auf ein Signal wartete. Aus den Augenwinkeln bemerkte sie, wie er unruhig auf seinem Barhocker hin und her rutschte. Keine Frage. Dieser Mann war attraktiv, er war scharf auf sie, und allem Anschein nach stand ihm nicht der Sinn nach langem Geplauder. Aber wie es aussah, hatte er auch nicht den Mut, sie einfach so abzuschleppen.
Nina überlegte. Sollte sie dieser spontanen Lust nachgeben – einfach so? Vielleicht war das, was kommen würde, ja eine totale Katastrophe, vielleicht … Aber vielleicht würde es mir auch einfach nur mal guttun, dachte sie und setzte sich kerzengerade hin. Nina suchte seinen Blick, lächelte. Sie wusste, sie war eine gute Schauspielerin, zumindest in manchen Situationen. Und sie wollte nicht die halbe Nacht an der Bar sitzen. Okay, dachte sie, einen Versuch ist es wert. Nina ließ sich halb vom Barhocker gleiten.
„Ich glaube, ich möchte jetzt ins Bett“, sagte sie so beiläufig wie möglich und trank noch einen Schluck.
„Das ist aber schade“, erwiderte Simon. In seiner Stimme schwang Enttäuschung mit. Nina verbiss sich ein Grinsen. Das war das Signal.
„Wieso?“ Sie blitzte ihn schelmisch an. „Ich dachte, du kommst mit.“
Augenblicklich rutschte Simon vom Barhocker und winkte dem Barmann. Dann drückte er Nina seinen Schlüssel in die Hand.
„Ich gebe dir ein paar Minuten Vorsprung.“ Und er grinste tatsächlich.
***
Nina nahm sich etwas Obst aus einer Schale und ging zum Fenster. Sie hatte heiß geduscht, sich großzügig an der luxuriösen Bodycreme bedient und sich in einen dieser unglaublich dicken Bademäntel gekuschelt, wie sie typisch sind für Luxusherbergen. Es war spät, sehr spät, und nach ihrer forschen Ansage war sie nun doch ein wenig aufgeregt. Es ist immer dasselbe, schalt sie sich. Erst eine große Klappe und dann Angst vor der eigenen Courage … Sie schob sich eine Weintraube in den Mund und zog die Vorhänge zurück, um wenigstens irgendetwas zu tun. Dann blickte sie aus dem Fenster auf die Lichter der nächtlichen Stadt.
Wo er nur blieb? Simon schien zwar schüchtern zu sein, aber er wusste, wie man Situationen wie diese hier spannend machte. Vorsprung geben … Sie lächelte. Ihre erste Bettgeschichte in Rom … in dem Moment betrat Simon den Raum.
Sie hörte ein sachtes Klirren, als er etwas auf dem Tisch abstellte, dann folgten schnelle Schritte, und er kam zu ihr ans Fenster und trat hinter sie.
„Bleib so“, flüsterte er an ihrem Ohr. „Beweg dich nicht. Lass mich ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen.“
Er legte von hinten die Arme um sie und löste langsam den Gürtel ihres Bademantels. Nina hielt den Atem an, wartete, was nun geschehen würde. Simon schob den Frottee auseinander und legte die Hände auf ihre Hüften.
Das fühlt sich ziemlich gut an, stellte Nina fest und erwiderte den Druck seines Körpers an ihrem Rücken. Jetzt glitten seine Hände an ihren Außenseiten entlang, hoch zu den Brüsten, zart umspielte er die kleinen Nippel. Nina seufzte auf. Er schien genießen zu können, war nicht zu gierig, das war gut. Sie legte den Kopf etwas schräg, den Blick weiterhin auf die nächtliche Stadt gerichtet. Simon streifte ihr den Mantel über die Schultern herunter und fasste sie um die Taille.
„Dreh dich um“, forderte er leise. Im nächsten Moment fanden sich ihre Lippen. „Davon träume ich schon den ganzen Abend“, flüsterte er und strich ihr eine Haarsträhne hinters Ohr. Dann trat er einen Schritt zurück und begann, sich auszuziehen, ohne die Augen von ihr zu lassen. Nina begegnete seinem Blick mit wachsender Lust. Dieser Mann gefiel ihr, sehr sogar. Und wie sehr sie ihm gefiel, war unübersehbar. Simon bemerkte ihren Blick und lächelte.
„Komm.“ Er hielt ihr die Hand hin und zog sie aufs Bett. Wieder fanden sich ihre Lippen zu einem langen Kuss. Dann rollte er sich halb auf sie und begann sie zu liebkosen. Von ihrem Hals an erkundete er sie, vorsichtig, behutsam, glitt immer weiter mit seiner Zunge, küsste ihren Nabel, die Scham. „Bitte,“ sagte er nur und schob sacht ihre Schenkel auseinander. Nina verstand und ließ es geschehen.
Seine Berührungen blieben sanft und streichelnd, auch sein Mund hatte nichts Forderndes, als er begann. sie zu lecken und an ihrem Kitzler zu saugen. Nina stöhnte auf. Wie hatte sie solche Zärtlichkeiten vermisst. Ein besonders intensiver Kuss von Simon brachte sie in die Realität zurück. Nina spürte, wie ihr Herz schneller schlug, und zitterte vor Lust. Sie genoss es, dermaßen auf Touren gebracht zu werden, aber allmählich wünschte sie sich mehr von ihrem Gespielen als erregende Küsse. Sie griff in sein Haar und drückte ihn tiefer zwischen ihre Beine, hob ihr Becken an. Doch Simon schien für solche Signale keine Antenne zu haben, im Gegenteil, jetzt hauchte er ihr die Küsse nur noch auf die Haut, strich mit der Zungenspitze ganz sacht an den Innenseiten der Schenkel entlang und verharrte immer wieder, bevor er sie erneut liebkoste. Nina spürte seinen warmen Atem und fühlte sich wie elektrisiert.
„Gefällt es dir?“, fragte er leise und legte den Kopf auf ihren Bauch. Nina stützte sich auf die Ellbogen und sah ihn an. Irgendetwas Lausbubenhaftes war an ihm, sie wusste nur noch nicht genau, was es war …
„Du siehst aus, als könntest du einen Schluck vertragen“, sagte er und stand unvermittelt auf. Nina sah, dass er ein Glas Orangensaft vom Tisch nahm und damit zurück ins Bett kam.
„Frisch gepresst – der Barkeeper hat mich verflucht, glaube ich. Musste meinetwegen die frisch geputzte Maschine noch mal anwerfen.“
Nina trank, der frische, sonnensüße Saft war köstlich. Trotzdem hätte sie sich eher etwas Prickelndes gewünscht.
„Ich habe dabei noch nie O-Saft getrunken“, sagte sie lächelnd und reichte ihm das Glas. Er nahm ebenfalls einen großen Schluck und nickte. „Noch einen Gin Tonic und wir beide können unseren Job morgen vergessen – das wäre nicht so gut.“
Er stellte das Glas beiseite und gab ihr einen langen Kuss.
„Bist du immer so vernünftig?“, wollte Nina wissen und zog ihn an sich.
„Im Job immer, privat – siehst du ja“, meinte er lakonisch und ließ sich in die Kissen fallen. „Und jetzt setz dich auf mein Gesicht, ich möchte dich schmecken, wenn du kommst.“
Bei dieser Aufforderung lief Nina ein kleiner Schauer über den Rücken. Sie fand diese Spielart sehr intim, wobei sie mit dieser Einstellung ziemlich allein dastand, wie sie im Austausch mit ihren Freundinnen einmal erfahren hatte.
„Na komm, ich will deinen schönen Arsch sehen.“
Simon strich mit dem Zeigefinger die Linie des Rückgrats nach, packte sie an den Hüften und zog sie auf sich. Er küsste ihre Pobacken und vergrub seine Zunge tief in ihrer Lusthöhle. Jetzt spürte Nina, wie feucht sie war. Sie legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen. Küssen konnte er wirklich … Sie hob ihr Becken leicht an und fühlte, wie Simon an ihr saugte. Sein Daumen massierte ihren Kitzler, Nina spürte die Erregung wie tausend kleine Stromstöße durch ihren Bauch ziehen. Wieder überlief sie ein Schauer. Simon schien eine endlose Geduld zu haben, obwohl er selbst hoch erregt war. Er trieb sie nicht, reagierte aber auf jede ihrer Bewegungen. Nina schwitzte. Es fiel ihr nicht leicht, sich fallenzulassen beim ersten Mal, aber hier, bei ihm – Nina schrie auf. Der Orgasmus hatte sie völlig überrascht. Anstatt sich wie sonst in warmen Wellen anzukündigen, war er einfach tief in ihr explodiert. Sie japste, schnappte nach Luft, doch Simon hielt sie auf sich und leckte sie weiter. Nina spürte, dass ihre Kehle ganz trocken war vom heftigen Atmen. Sie schluckte schwer, ihre Schenkel zitterten. Und noch einmal! Nina wusste nicht, wie Simon das angestellt hatte. Sie fiepte, spürte, wie es in ihr pulsierte. Jetzt war ihr nicht nur heiß, jetzt glühte sie bis unter die Haarwurzeln. Diese wilde Lust … Nur langsam verebbte das wunderbare Pochen in ihr, und sie genoss jede Welle des Orgasmus, drückte sich fest auf Simons Gesicht, um ihn an ihrem Höhepunkt teilhaben zu lassen. Endlich kam ihr Atem zurück, sie seufzte leise und sank entspannt auf ihm zusammen. Vorsichtig schob Simon sie von sich herunter, so dass sie auf dem Bauch zu liegen kam. Nina schnurrte wie eine Katze, als sie spürte, wie sich ihr Liebhaber zwischen ihre Schenkel hockte. Simon strich ihr durchs Haar, dann drückte er ihr einen Kuss auf die Schulter und zog sie auf die Knie.
„Du hast einen prachtvollen Hintern“, sagte er und gab ihr einen Klaps. Nina warf den Kopf in den Nacken und lachte. Simon stöhnte auf und zog ihre Backen auseinander. Dann drang er in sie ein.
***
Als Nina eine Stunde später das Hotel verließ, begann es bereits zu dämmern. Simon hatte ihr zwar angeboten, sie könne noch bleiben und später mit ihm frühstücken, aber das hatte sie abgelehnt. Das war ihr nicht leichtgefallen, denn dieser Mann hatte etwas an sich, was sie sehr anziehend fand. Aber so wie es gelaufen war, war es gut. und auch wenn der Sex mit ihm wunderschön gewesen war – was sollte sie mit einem verheirateten Mann? In dieser Hinsicht hatte sie ihre Erfahrungen gesammelt, und das Fazit war nicht gerade positiv. Aber sie kannte sich und wusste, wenn sie sich erst einmal in einen Mann verliebt hatte, war ihr der Familienstand völlig gleichgültig. Simon war zumindest fair gewesen und hatte zu keiner Zeit den Versuch gemacht, den unglücklichen Ehemann zu spielen. Vielmehr hatte er durchblicken lassen, dass er öfter in Rom war und dann immer in der Villa Medici logierte. Sie konnte sich gut vorstellen, dass er seinen Kindern zu Hause auch Orangensaft presste, weil das gesünder war als Coca-Cola, und musste schmunzeln, als sie an die Szene im Hotelzimmer dachte. Ein Mann, der eine Frau verführen will und den Barkeeper nötigt, Fruchtsaft zu pressen – das war irgendwie rührend, aber sexy war das nicht. Sondern vernünftig und erwachsen.
Ich hätte an seiner Stelle noch eine Flasche Rosé-Champagner geköpft, ging es Nina durch den Kopf, und wenn ich heute zum Meeting kriechen müsste.
Wie dem auch sei, sie würde diese Nacht in bester Erinnerung behalten. Und nicht nur das. Sie und Simon hatten sich für den nächsten Dienstag verabredet, im Foyer des Hotels. Er hatte sie zum Essen eingeladen, unter der Bedingung, dass sie wieder Rouge Noir aufgelegt hätte, und hatte dabei schelmisch gegrinst. Nina hatte lächelnd zugesagt und sich zugleich fest vorgenommen, nicht hinzugehen. Sie hatte das Gefühl, dass sie sich wider besseres Wissen gerade in eine Liaison hineinmanövrierte, aber den Gedanken daran wollte sie für die nächsten Tage beiseiteschieben. Jetzt musste sie erst einmal zusehen, dass sie ohne Blessuren nach Hause kam, denn mit nackten Füßen durch die Altstadt zu laufen war schon etwas risikoreich. Vorsichtig setzte Nina einen Fuß vor den anderen und genoss den Spaziergang durch die erwachende Stadt. Sie fühlte sich beschwingt und lebendig und dachte an den köstlichen Moment zurück, als er sie nach all der sanften Tändelei hart rangenommen hatte. Sie spürte seine tiefen Stöße immer noch bei jedem Schritt. Das war also mein erstes kleines Abenteuer hier,