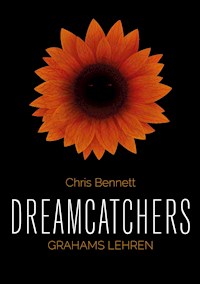
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine verschworene Wohngemeinschaft. Eine alte Tradition. Ein Keller voller Leichen. Seit Tagen hat sich Beatrice Morgans Verlobter nicht gemeldet. In großer Sorge folgt sie ihm nach Nightbow, Kalifornien. Von ihm fehlt jede Spur und die Suche erscheint völlig hoffnungslos. Schnell erkennt sie, dass die Kleinstadt beherrscht wird von Gewalt und Korruption. Und auch die Studenten-WG, bei der er zuletzt wohnte, hütet ein dunkles Geheimnis. Im Laufe ihrer Nachforschungen zeigen sich Beatrice die grässlichen Abgründe hinter dem Verschwinden ihres Verlobten. Zugleich hat die Wohngemeinschaft einen neuen potenziellen Mitbewohner ins Auge gefasst. Doch dieser passt keinesweg in das traditionelle Auswahlschema. Und das hat schreckliche Konsequenzen zur Folge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 692
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Martin Hasler,
mein ältester Freund und großartiger Schreibpartner.
Welch ein Meisterwerk ist der Mensch!
Wie edel durch Vernunft!
Wie unbegrenzt an Fähigkeiten!
In Gestalt und Bewegung wie bedeutend und wunderwürdig!
Im Handeln wie ähnlich einem Engel!
Im Begreifen wie ähnlich einem Gott!
Die Zierde der Welt!
Das Vorbild der Lebendigen!
Hamlet, 2. Akt, 2. Szene
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
KAPITEL 1
Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
Sektion 5
Sektion 6
KAPITEL 2
Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
Sektion 5
Sektion 6
KAPITEL 3
Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
Sektion 5
Sektion 6
Sektion 7
Sektion 8
KAPITEL 4
Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
Sektion 5
Sektion 6
Sektion 7
KAPITEL 5
Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
Sektion 5
Sektion 6
Sektion 7
Sektion 8
Sektion 9
Sektion 10
Sektion 11
Sektion 12
KAPITEL 6
Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
Sektion 5
Sektion 6
Sektion 7
Sektion 8
Sektion 9
KAPITEL 7
Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
Sektion 5
Sektion 6
Sektion 7
Sektion 8
Sektion 9
Sektion 10
KAPITEL 8
Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
Sektion 5
Sektion 6
Sektion 7
Sektion 8
Sektion 9
Sektion 10
KAPITEL 9
Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
Sektion 5
Sektion 6
Sektion 7
EPILOG
PROLOG
Lennard Pestori saß auf einer Bank im Cascade Park in Redding. Die Natur war seine Leidenschaft. Er war ein wahrer Genießer, was das anging. Wirklich zu schätzen gelernt hatte er es aber erst, nachdem er sein frisch abgezahltes Haus verkauft und vom Geld einen nigelnagelneuen Camper gekauft hatte. Seither war er frei, ungebunden und konnte tun und lassen, was immer er wollte.
Er hielt sich nie länger als eine Woche irgendwo auf. Bloß nicht stagnieren und dabei das Gefühl haben, an irgendeinem Ort gefangen zu sein. Seit knapp zehn Jahren genoss er das einfache Vagabundenleben und war inzwischen viel herumgekommen. Die meisten Bundesstaaten hatte er bereist, aktuell hatte es ihn aber zurück nach Kalifornien verschlagen.
Die schönste Zeit verbrachte er auf dem Spielplatz, wenn er den Kids beim Herumtollen zusehen und ihr Lachen hören konnte. Vielleicht lag es daran, dass er keine eigenen Kinder hatte. Dabei hatte er sich immer welche gewünscht. An jedem Geburtstag starb in ihm ein Teil jener Hoffnung. Als er dann die Fünfzig überschritt, war die Vorstellung vom persönlichen Glück gänzlich versiegt.
Als Karolin ihn damals verlassen hatte, warf das sein geordnetes Leben gewaltig aus der Bahn. Schlimmer noch, es ging regelrecht den Bach runter. Er verlor die Frau seiner Träume, mit der er über vierzehn Jahre zusammen gewesen war. Sie war fort von heute auf morgen.
Das veränderte ihn, machte ihn griesgrämig und übellaunig. Nachdem er einem Kollegen das Nasenbein gebrochen hatte, verlor er auch seinen Job. Für seinen Ausraster gab es nicht mal einen Grund, er hatte es einfach getan.
Anschließend hatte er wochenlang daheimgesessen, nichts gegessen und fast vierzig Pfund abgenommen. Nach kürzester Zeit hatte er ausgesehen wie ein zusammengefallener Sack. Er schämte sich für sich selbst. Es musste sich etwas ändern.
Dann entschloss er sich, das Haus zu verkaufen, das ihn ohnehin nur an Karolin erinnerte. Es kam zu einem gewaltigen Schnitt in seinem Leben. Es war, als hätte man eine robuste Dornenranke aus seinem Kopf gezogen. Dank des Campers und der neuen Mobilität konnte er wieder atmen und fühlte sich wieder wie ein Mensch und nicht mehr wie ein stinkender Haufen Hundescheiße.
Er hatte sich aufgerappelt und war dem Schrecken entflohen, den das Schicksal für ihn bereitgehalten hatte. Und er konnte endlich wieder lachen, ganz besonders, wenn die Kinder vor seinen Augen in unverblümter Begeisterung umhertobten, sich jagten und einfach Freude am Leben hatten. Er mochte ihre Sorglosigkeit.
Die Kids vor ihm auf dem Spielplatz buddelten im Sand, schoben ihre Matchbox-Autos durch ihre eigens konstruierten Wüstenmetropolen, schaukelten oder spielten Fangen. Es war toll.
Ein kleines Mädchen schoss immerzu einen Fußball weg und rannte ihm nach. Dabei wirbelten ihre beiden geflochtenen Zöpfe chaotisch hinterher. Zuvor war sie mehrere Runden die gebogene gelbe Rutsche heruntergesaust, doch schnell hatte sie die Lust daran verloren, als andere Kinder es ihr nachmachten. Sie wollte lieber allein spielen, sich abheben von den störenden Raufbolden.
Lennard stellte sich oft vor, wie es wohl wäre, wenn es seine eigenen sein würden. Heute war das kleine Mädchen sein persönlicher Favorit. Alles an ihr war so rein, und ihre leuchtend blauen Augen hatte ihr wohl ein Engel geschenkt.
Schon seit mehreren Stunden saß er auf der Holzbank und beobachtete alles. Die Kinder und ihre Eltern, wie sie kamen und gingen, und die Schönheit des Cascade Parks. Er schloss kurz seine Augen und atmete die süßlichen Gerüche der warmen Frühsommerluft ein. Herrlich!
Mit einem herzlichen Lächeln im Gesicht warf er dem kleinen Mädchen einen langen Blick zu, den sie bemerkte und auch erwiderte. Doch schnell galt dem Fußball wieder ihre ganze Aufmerksamkeit.
Das war nicht schlimm, denn Lennard vergaß stets die Zeit, wenn er sie auf dem Spielplatz verbrachte. Außerdem flüsterte ihm sein Gefühl zu, dass dies ein guter Augenblick war. Er stand von der Holzbank auf und ging unbekümmert zu dem kleinen Mädchen. Er wusste genau, dass die Eltern der anderen Kinder das nicht stören würde, und dass sie sich nicht um das Mädchen sorgten. Vermutlich dachten sie, dass sie zu ihm gehörte.
Der Fußball kullerte in seine Nähe. Er war nie ein großer Sportler gewesen, aber er sah, wie die Kleine einige Meter vor ihm stehen blieb und verunsichert schaute, was er machte. Er ging zum Ball und schoss ihn ihr zurück. Zumindest die Richtung stimmte.
Das brachte ein Lächeln auf ihre Lippen. »Danke«, rief sie ihm zu und flitzte mit dem Ball davon.
Lennard ging weiter, aber nicht dem Mädchen hinterher. Er blieb am Rand des Sandfeldes, auf dem die Schaukeln und Rutsche standen. Die meisten Kinder tummelten sich um die Spielgeräte, das kleine Mädchen hingegen rannte auf der gemähten Wiese dahinter herum.
Lennard kniete sich ins Gras, öffnete die Schnürsenkel seiner Schuhe und schnürte sie gleich darauf wieder zu. Danach hob er einen imaginären Gegenstand neben sich auf. Der Seitenblick zum Mädchen verriet ihm, dass er einen kleinen Teil ihres Interesses geweckt hatte. Er lächelte ein weiteres Mal, kehrte ihr dann aber den Rücken zu und ging zur Holzbank zurück.
Kurz bevor er sich setzen konnte, rollte der Ball knapp neben seine Füße. Er blieb stehen, schaute nach dem Mädchen und bekam einen frechen Blick zugeworfen. Erwartungsvoll legte sie den Kopf schräg.
Lennard zielte erst mit der Hand in ihre Richtung und schoss den Fußball mit etwas Anlauf ein gutes Stück an ihr vorbei. Das brachte ihm ein heiteres Feixen ein.
Er setzte sich wieder und schaute zu, wie die Kleine den Ball holte. Dann dribbelte sie langsam auf ihn zu. Wie ein Fußballprofi führte sie ihn vor sich her, bis sie ihren Fuß darauf stellte und einige Schritte vor Lennard verharrte.
»Du kannst aber nicht gut zielen«, sagte sie in unverblümter Ehrlichkeit und grinste ihn schief an.
»Das habe ich nie gelernt. Magst du es mir beibringen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ein Kind kann einem Erwachsenen doch nichts beibringen. Nein, so geht das nicht.«
»Warum spielst du denn nicht mit den anderen Mädchen?«
»Die wollen nicht. Die finden Fußball blöd.«
»Und die Jungs?«
»Die finde ich blöd.«
Lennard lachte. Kinder waren so einfach gestrickt. Sie wogen nicht ab, schmiedeten keine Pläne und hinterfragten nicht jedes Wort. Er liebte das. Nicht die Naivität, sondern die Nüchternheit, die sie besaßen.
Die Gerichtsprozesse, die er führen musste, einerseits aufgrund der Scheidung und zum anderen wegen der Prügelei am Arbeitsplatz, waren durchtrieben gewesen von Wortklauberei und Spitzfindigkeiten. Jedes noch so kleine Detail, das er erwähnt und jedes Wort, das er ausgesprochen hatte, wurden auf eine überdimensionale Goldwaage gelegt. Alle seine Argumente und Begründungen wurden torpediert und niedergerungen. Noch heute verabscheute er diese Kleinlichkeit, die dazu geführt hatte, dass er beide Verfahren verlor.
»Wie heißt du?«
»Mabel«, antwortete sie. »Und du? Ist das Wort auf deiner Mütze dein Name?«
Lennard nahm das dunkelblaue Basecap vom Kopf und betrachtete den Aufdruck. »Nein, ich heiße nicht Skipper.« Das Wort prangte in weiß-blauen Lettern auf dem Stoff. Er hatte es vor vielen Jahren an einer Tankstelle gekauft und trug es seitdem ständig. »Ich bin Lennard. Wo sind denn deine Eltern?«
»Meine Mommy ist zu Hause. Wir wohnen gleich dort vom.« Mit dem Finger deutete Mabel an Lennard vorbei und zeichnete den Weg nach.
»Und sie lässt dich hier ganz allein spielen? Macht sie sich denn keine Sorgen?«
Mabel zuckte mit den Schultern. »Ich denke nicht. Sie sagt, ich bin schon ein großes Mädchen. Wenn ich pünktlich zum Abendessen daheim bin, schimpft sie nicht mit mir.«
»Und dein Dad findet das in Ordnung?«
»Er ist auf einer langen Reise. Zumindest sagt Mommy das.« Mabel kam näher an ihn heran. Dann hielt sie sich beide Hände seitlich an den Mund und flüsterte ihm zu. »Ich glaube ihr das aber nicht.«
Lennard drehte sich um und schaute in die Ferne des Parks, wo einige Dachfirste zwischen den Baumkronen hervorstachen. Dann richtete er den Blick zurück auf Mabel und beugte sich zu ihr vor. »Willst du mir verraten, was du denkst?«, fragte er mit gedämpfter Stimme.
»Das kann ich nicht. Wenn Mommy das hört, wird sie böse.«
Lennard legte nachdenklich die Hand an sein stoppeliges Kinn. Dann setzte er das Cap wieder auf. »Ich weiß einen Ort, wo sie uns nicht hören wird.«
Mit gespitzten Lippen und großen Augen stand Mabel vor ihm. Sie überlegte kurz und schaute nochmals an ihm vorbei zu den Häusern. »Ich muss aber zum Abendessen zurück sein. Ich will keinen Ärger bekommen.«
Lennard nickte. »Der Ort ist gar nicht weit von hier. Er ist wunderschön und wird dir gefallen.«
Voller Begeisterung nahm Mabel ihren Ball unter den Arm. Ein freudiges Funkeln erhellte ihre Engelsaugen und sie nickte betont. »Wo ist denn dieser Ort?«
»Ich zeige ihn dir, wenn du willst.« Lennard erhob sich von der Parkbank. Er spürte den Blick einiger Eltern auf sich haften, aber sie reagierten nicht weiter, als Mabel nach seiner Hand haschte. Gemeinsam verließen sie den Cascade Park.
Die kleinen, weichen Kinderfinger erwärmten Lennards Herz. Heiter hüpfte sie neben ihm her und schaute mit erwartungsvoller Vorfreude zu ihm auf. Mabel war so ein liebes Kind, so anständig und frei von schlechten Gedanken. Sie konnte es kaum noch erwarten, den geheimen Ort zu sehen, und das Geheimnis über ihren Vater trug sie wie einen schweren Stein in sich. Es war ihr wichtig, sich jemandem anzuvertrauen, das merkte er ganz deutlich.
Zum Glück fragte Mabel ihn nicht nach einem Passwort. In jüngster Vergangenheit war es ihm mehrfach so ergangen und ehe er eine schlagkräftige Antwort parat hatte, rannten die Kinder ängstlich davon. Er hasste jene Mütter, die ihren Kids von klein auf Misstrauen und Angst einredeten und ihnen ein Codewort beibrachten, sollte ein Fremder sie ansprechen. Das war ein wahnsinniger Gräuel. Genau diese Sorte Eltern konnte er nicht leiden. Lennard bevorzugte die vertrauensseligen.
Mabels Mom, sie war ihm sympathisch. Nicht nur wegen ihrer Gutgläubigkeit, sondern auch wegen ihres kleinen Sonnenscheins, der diesen Tag für ihn ganz besonders machte.
KAPITEL 1
–I–
Als Theodore das Bewusstsein wiedererlangte, wusste er sofort, dass er diesen Raum nicht mehr lebend verlassen würde. Vielleicht hatte er zuvor noch eine Chance gehabt, doch jetzt konnte er diesem Schicksal nicht mehr entrinnen. Es war zu spät.
Bevor er die Augen öffnete, spürte er bereits das Unheil, das ihn umgab. Die erste Bewegung seiner Lider verursachte ein fürchterliches Brennen, so derb, dass er den Versuch gleich wieder abbrach. Seine Augenhöhlen wurden von einer zerstörerischen Feuersbrunst heimgesucht, als säße er direkt im tiefsten Schlund der Hölle. Hier trieben nur die bestialischsten aller Geschöpfe ihr Unwesen.
Er wollte nicht mit diesen Monstern gleichgestellt sein.
Er wollte diese abscheuliche Qual nicht länger ertragen.
Er wollte nur seine Freiheit zurück.
Also fasste er neuen Mut. Er zischte die angestaute Luft zwischen seinen Zähnen hervor und befreite sich von dem widerwärtigen Schmerz seiner Augen.
Diesmal gelang es ihm. Er besiegte die Pein und konnte sie offenhalten. Hinter eng zusammengekniffenen Schlitzen lugte er hervor. Ein trüber Rotschleier überlagerte alles und brachte sofort die schrecklichen Erinnerungen an die letzte Tortur zurück.
Mit aller Kraft versuchte er, die grauenhaften Gedanken zu unterdrücken. Er nutzte den größtmöglichen Gegensatz in seinem Verstand dazu, das marternde Brandmal in den entferntesten Abgrund seines Gedächtnisses zu treiben. Die Verbannung dieses tobenden Gedankens, dem jegliche Menschlichkeit fehlte, war alles andere als leicht. Er spürte, wie entschlossen sich das brutale Gefühl der Misshandlung bereits in seinem Gehirn manifestiert hatte. Es kämpfte mit größter Beharrlichkeit gegen die Fesseln seiner Vernunft an und wirkte dabei überaus siegessicher.
Schließlich war es ein Name, der den Gedanken in den bodenlosen Krater der Verdammnis seines Geistes stieß.
Beatrice.
Er liebte sie über alles. Doch wenn ihm nicht irgendwie die Flucht gelang, würde er sie niemals wiedersehen. Nie wieder könnte er ihre sanften Lippen spüren, nie wieder in ihre paradiesblau funkelnden Augen blicken und nie wieder ihre Haut berühren, die so weich war wie eine einzelne Rosenblüte.
Sie kam nicht zu seiner Rettung. Natürlich hätte sie alles Menschenmögliche getan, um ihn vor dem nahenden Tod zu bewahren. Aber sie wusste nicht – und hätte es weiß Gott nicht einmal ahnen können –, dass Theodore in derartigen Schwierigkeiten steckte ...
Schwierigkeiten – das war weit untertrieben. Er befand sich in der Gewalt irgendwelcher Irren, die sich an seinen Schmerzen ergötzten, sich an ihnen labten. Je stärker er litt, desto mehr genossen sie ihr abscheuliches Werk. Nur die besonderen, einzigartigen Erinnerungen an Beatrice hielten seinen zermürbten Verstand noch intakt. Ohne sie wäre er bereits durchgedreht oder hätte längst aufgegeben.
Als Theodore die Augen geöffnet hatte, durchzog das Resultat dieser Schinderei seinen gesamten Körper; weitaus intensiver als noch vor der Ohnmacht. Er wäre an den Schmerzen zugrunde gegangen, hätte er sich nicht auf die schönsten Momente seines Lebens besonnen. Jeden einzelnen davon hatte er mit Beatrice verbracht.
Nachdem Theodore einen Nervenzusammenbruch, einen Hirnkrampf oder was auch immer diese Gedanken der Folter in seinem Gehirn verursachten, erfolgreich abwehren konnte, führte er sich seine missliche Lage vor Augen. Würde es Beatrice nicht geben, hätte er diese Last gar nicht mehr auf sich genommen. Längst hätte er sich seinem Schicksal gebeugt. Aber sie war viel zu wertvoll. Er durfte nicht aufgeben.
Er war bereits seit Tagen in diesem Kellerraum eingesperrt und hatte inzwischen jegliches Zeitgefühl verloren. Es musste spät am Abend sein, womöglich auch schon nachts, aber diese Intuition konnte ebenso falsch sein. Der Raum wurde einzig durch eine alte, billige Schreibtischlampe aus rotem Plastik erhellt. Vor den schmalen Fenstern hingen dicke graue Wollgardinen, die alles Licht von außen abschirmten.
Theodore saß auf einem harten Holzstuhl. Er konnte sich nicht bewegen. Seine Beine waren an denen des Stuhls festgebunden, sein Oberkörper an der Lehne fixiert. Seine Hände hinter dem Rücken gefesselt – alles mit dickem Tau. Zusätzlich war er mit reißfestem Klebeband geknebelt worden. Nur den Kopf konnte er bewegen, zumindest soweit die Schmerzen im Nacken es ihm erlaubten.
In der abgestandenen Luft lag der beißende Geruch von Schweiß und Urin. Ein galliger Geschmack jagte seine Kehle hinauf, der ihn ruckartig aufstoßen ließ. Er musste mehrfach würgen. Im letzten Moment konnte er das Erbrechen von Magensaft und Blut unterbinden und verhinderte somit, dass ein wiedergekäuter Erdbeer-Milchshake seine Mundhöhle hinter dem Klebeband in einen säuerlichen Swimmingpool verwandelte.
Irgendetwas Klebriges haftete auf Theodores Gesicht. Angestrengt schaute er an sich herab und kämpfte gegen die Resignation seines Körpers an. Jede noch so kleine Bewegung forderte extreme Anstrengung. Hose und Poloshirt waren mit Blut beschmiert, und auf dem Boden hatte sich eine dunkelrote Lache in der Größe eines Kochtopfes gebildet.
Präzise wurde ihm mit einem Skalpell in mehrere Venen geschnitten. Es war schrecklich gewesen, als das Blut unaufhörlich aus beiden Unterarmen und Oberschenkeln herausquoll. Eine höllische Todesangst überkam ihn, als ihm bewusst wurde, dass die störende Substanz auf seinem Gesicht ebenfalls Blut war. Inzwischen getrocknet, war es zuvor von seiner Schädeldecke über das Gesicht geströmt. Er hatte ein Dutzend Schläge einstecken müssen. Vielleicht waren es mehr gewesen, aber so viele konnte er noch zählen, bevor er das Bewusstsein verloren hatte.
Er begann, panisch umher zu wackeln, und versuchte krampfhaft, sich zu befreien. Es war zwecklos. Der verdammte Stuhl hielt jeder Krafteinwirkung stand, die Fesseln banden ihn wie einen siamesischen Zwilling an ihm fest. Statt sich aus den Seilen herauszuwinden, wäre der Stuhl durch die unkoordinierten und hektischen Körperbewegungen beinahe umgekippt.
Er hörte nicht auf, denn vielleicht war genau das die Lösung. Die Lehne könnte zerbrechen, wenn sie wuchtig zwischen den Holzdielen und seinem eigenen Körpergewicht zerdrückt würde. Hoffentlich wog er genug, um den Stuhl zu zerschmettern.
An der Wand vor ihm war eine Waffe befestigt. Ein Schwert oder ein Säbel, er hatte es nie genau erkannt und sich auch nicht damit auseinandergesetzt. Ein Lichtspalt schimmerte an der hölzernen Scheide, in der die Waffe steckte. Theodore hatte ihn nicht sofort bemerkt. Erst als auch der Boden stärker vom einfallenden Licht erhellt wurde, stoppte er seinen gehetzten Befreiungsversuch und erstarrte. Jemand hatte den Raum betreten.
Er hörte zwei aufeinanderfolgende Schritte. Dann wurde der Deckenstrahler eingeschaltet und flutete den Keller mit grellem Licht. Als Theodores Augen die Helligkeit aufnahmen, brannten sie noch schlimmer. Doch er zwang sich, sie nicht zu verschließen. Er durfte nicht zurückweichen, musste standhaft bleiben. Das war er Beatrice schuldig.
Die hölzernen Dielen knarzten bei jedem der Schritte, die hinter Theodores Rücken auf ihn zukamen. Die Tür fiel ins Schloss. Kurz danach spürte er einen warmen Atemhauch im Nacken. Ein spöttisches Lachen drang direkt in sein Ohr, und er zuckte zusammen.
»Hübsche Kopfbemalung. Coole Rottöne«, sagte die tiefe Männerstimme.
Greg. Theodore hatte sofort erkannt, dass er es war. Das Klebeband verstümmelte seine Reaktion jedoch zu unverständlichen Lauten. »U v-da-te-Ba-ta-!«.
Greg trat vor Theodore und musterte ihn eindringlich mit seinen dunklen, tief liegenden Augen. Er griff nach dem Rand des braunen Papierstreifens und riss ihn blitzschnell vom einen zum anderen Mundwinkel ab.
Theodore wimmerte und verzog das Gesicht zu einer schmerzerfüllten Fratze. Er sah mehrere Hautstücke seiner Lippen am Klebestreifen haften.
»Was hast du gesagt?«, fragte Greg herausfordernd. Er erkannte wohl an Theodores Blick, dass er mit dem Gedanken spielte, erneut laut aufzuschreien.
Greg neigte sich herunter und war nun auf Augenhöhe mit seinem Gefangenen. Das grelle Licht verlieh den kurzen, pechschwarzen Haaren einen öligen Film und ein bedrohlicher Schatten hüllte sein stoppeliges Kinn. »Du solltest nicht denselben Fehler zweimal machen. Es kann dich niemand hören. Du siehst selbst, was es dir eingebracht hat.« Er deutete auf den Blutfleck unter dem Stuhl. »Willst du das erneut durchmachen, Theo?«
Theodore brauchte keine Sekunde darüber nachzudenken. Schaudernd erinnerte er sich an die Brutalität, mit der Greg auf ihn eingeprügelt hatte. Hastig schüttelte er den Kopf.
Als Theodore sich instinktiv mit der Zunge über die Oberlippe fuhr, folgte ein feuriges Brennen. Er schmeckte warmes Blut, das überall aus den feinen Rissen austrat. Das Entsetzen war ihm deutlich ins Gesicht geschrieben.
»Gut, Theo. Ich frage dich ein letztes Mal: Was hast du genuschelt?«
Wie sehr er diesen Kosenamen hasste. Aber so, wie dieser Dreckskerl ihn jetzt aussprach, war es noch anmaßender als jemals zuvor. Hinzu kam seine ungeheure Angst davor, ihm nicht zu gehorchen. Wenn Greg bemerkte, dass er log, würde die Bestrafung dafür um ein Vielfaches schlimmer ausfallen. »Greg, du verdammter Bastard!«, flüsterte er gerade so laut, dass Greg es hören konnte, und warf seinem Gegenüber dabei einen abscheulichen Blick zu.
»Ich bin enttäuscht.« Greg bäumte sich vor ihm zu seiner vollen Größe auf, dann ging er zum Schreibtisch.
In den letzten Tagen war dieser zu einer Ablage für Folterinstrumente umfunktioniert worden. Sofort meldete sich Theodores Herz und schlug wuchtig gegen seine Brust. Es konnte nichts Gutes verheißen, wenn Greg etwas von dem Tisch holte; das hatte es nie.
Greg schaltete die rote Plastiklampe aus und kam zurück. »Du bist selbst daran schuld, dass es so weit kommen musste, Theo.« Er positionierte sich wieder vor ihm und präsentierte grinsend eine weiße Streichholzschachtel.
»Was hast du vor?«, fragte Theodore. Eigentlich wollte er es gar nicht wissen, doch die Frage brach von allein heraus. Es musste mit unerträglichen Schmerzen Zusammenhängen, so viel war sicher. Und es wurde jedes Mal grässlicher.
»Du hast in unseren Unterlagen herumgeschnüffelt.«
»Das habe ich nicht!«, protestierte Theodore.
»Hast du dich nicht gefragt, was dieses Zeichen bedeutet?«, Greg schob den rechten Ärmel seines schwarzen Shirts hoch zur Schulter und offenbarte seine Oberarm-Tätowierung. »Du kennst es.«
Theodore verstummte vor Furcht, als er das Symbol an Gregs Körper entdeckte. Es wurde totenstill. Nur noch seine hektischen, abgebrochenen Atemzüge schallten durch den Raum. Ein kyrillischer Buchstabe. Ein stark geneigtes großes F. Entsetzt blickte er von der Tätowierung weg.
»Gib es zu, Theo. Du weißt genau, wovon ich spreche.«
»Ich habe dieses Zeichen nicht in irgendwelchen Unterlagen gefunden.«
»Aber du hast es schon gesehen!«, schrie Greg ihm entgegen. Er hatte es an Theodores Reaktion erkannt, in seinem erschrockenen Blick wahrgenommen. Er atmete tief durch. »Nämlich auf dem Körper meiner Schwester.« Seine Stimmlage war nun wieder beherrscht, trotz der nachdrücklichen Verurteilung.
»Kasidy?« Es war Theodore nie zuvor in den Sinn gekommen, dass die beiden auch nur im Entferntesten miteinander verwandt sein könnten. Das war absurd. »Kasidy ist deine Schwester?«
»Überraschung«, antwortete Greg giftig und mit beängstigender stoischer Selbstsicherheit.
Theodore konnte seine Verlegenheit nicht verbergen. Nicht, dass er sich für das Spannen schämte. Kasidy war eine unbeschreiblich attraktive Frau. Natürlich hegte er keine Gefühle für sie. Er hatte nur häufig ihren Anblick genossen, das war alles. Und sie wusste, dass er sie mit Freuden beobachtet hatte. Es war regelrecht eine Herausforderung von ihr gewesen, vielleicht sogar eine lüsterne Aufforderung.
Dass Greg ihr Bruder war, ließ einen gewaltigen Ekel in ihm aufsteigen. Es widerte ihn zutiefst an. Die beiden hatten sich nie wie Geschwister verhalten und auch niemals ein Sterbenswörtchen darüber verloren. Er hatte sogar angenommen, dass sie es miteinander trieben.
»Ich kann verstehen, warum du mit ihr geschlafen hast -«
»Aber ...« Theodore wollte ihn korrigieren. Er war nie mit ihr in die Kiste gestiegen – zumindest nicht physisch. Er hatte sie nie angerührt. Lediglich in seinem Kopf überschlugen sich andauernd bildhafte Vorstellungen von unanständigen, schmutzigen Spielen, zu denen sie durchaus bereit gewesen wäre, wenn er sich darauf eingelassen hätte. Er begrenzte das Ausleben jedoch ausschließlich auf seine Fantasie.
Immer, wenn die Tür zu ihrem Zimmer weit offen stand und sie ihn mit neuen, anstößigen, lasziven Dingen überraschte, hatte sie zweifelsfrei nur darauf gewartet, dass er ihr zur Hand ging. Angefangen bei einem professionellen Poledance zu My Humps von den Black Eyed Peas bis hin zu verdorbenen Soloeinlagen, die sie auf oder vor ihrem Bett mithilfe einer üppigen Auswahl an Spielzeugen geboten hatte. Nur einen Tag bevor er sich in diesem verdammten, abgedunkelten Verlies wiederfand, erwischte er sie in seinem Zimmer. Er war gerade von der Vorlesung Grundbau und Bodenmechanik für Ingenieurgeologen heimgekommen und sah, wie sie sich nackt in seinem Bett mit sich selbst vergnügte.
Als er nun den reinsten Hass in Gregs Augen sah, verflogen die Erinnerungen an Kasidy augenblicklich. Er versuchte, beherrscht zu wirken. Trotzdem musste er sich eingestehen, dass die Gedanken an Kasidys Showeinlagen in eben diesem Moment auch dazu beigetragen hatten, diese ausweglose Situation für einen Sekundenbruchteil zu vergessen. Aber anders als bei dem von Beatrice hervorgerufenen Gefühl des Schutzes und der Geborgenheit war es bei Kasidy vorwiegend ein spontaner Funke von Erregung, der bereits wieder verpufft war.
»Du hast sie nicht verdient. Keineswegs. Sie ist etwas Besonderes. Sie ist göttlich und du ... du bist nur ein mickriges Stück Abschaum, der den Wert meiner Schwester, und vor allem den meiner Familie, nicht im Geringsten zu schätzen weiß. Genauso, wie bei vielen anderen.«
»Und wie kommst du zu dieser glorreichen Erkenntnis, Greg?« Er sprach den Namen seines Gegenübers übertrieben abwertend aus und riskierte damit weitere Prügel. Er hatte nicht die Kraft und schon gar nicht die Absicht, mit ihm über das Geschehene zu diskutieren, zumal es keinesfalls etwas gebracht hätte. Vernunft war ein Fremdwort für ihn.
»Du scheinst dir über den Ernst der Lage nicht ganz im Klaren zu sein. Dabei solltest du inzwischen wissen, dass es hier um weit mehr geht als Kasidy. Die Vergangenheit holt dich ein. Deswegen solltest du um Gnade winseln. So, wie du dein Leben lang gewinselt hast, Theo. Ich weiß, dass du diesen Namen hasst. Früher haben dich deine Mitschüler mit dem Namen gehänselt. Sie haben dich damit in den Dreck gezogen und du hast es über dich ergehen lassen. Du bist ein feiger Schwächling. Deswegen bist du unserer Familie nicht würdig. Deine Mitschüler haben dich zu Recht verachtet.«
»Für diese Wohngemeinschaft war ich scheinbar gut genug.«
Mit einem unangekündigten kräftigen Hieb knallte Gregs Faust ansatzlos mitten auf Theodores Nase, die dabei hörbar an mindestens zwei Stellen brach. Doch sein Körper war wie gelähmt, er spürte keinen Schmerz mehr.
»Es war notwendig, dass du bei uns wohnst. Wir hatten von Anfang an einen Plan und wussten genau, was wir mit dir anstellen würden. Alles ist so gekommen, wie wir es uns vorgestellt haben. Du hast uns aus der Hand gefressen wie ein dummes Nagetier. Und ganz besonders hast du es geliebt, aus Kasidys Hand zu naschen.«
Theodore wusste nicht, was er darauf antworten sollte. Er hatte in keinem Moment das Gefühl gehabt, dass diese Leute ihm etwas Böses wollten. Es gab vielleicht das eine oder andere latente Anzeichen, wenn Greg direkte Konfrontationen heraufbeschworen hatte. Ständig hatte er ihn überstimmt. Als die WG Entscheidungen fallen musste, fiel Greg ihm ins Wort und hatte mit bösartig funkelnden Augen nur darauf gewartet, dass er ansprang. Er drängte sich andauernd in den Vordergrund – oder ihn in den Hintergrund –, beim Abendessen, bei der Filmauswahl der sporadischen DVDAbende; eigentlich bei so ziemlich jeder Gelegenheit zeigte er ihm, dass er der Stärkere war. Besonders im Beisein von Kasidy präsentierte er eifrig seine machohafte Männlichkeit. Aber alles war so unterschwellig, dass er sich nicht eine Sekunde lang bedroht gefühlt hatte. Er hatte nicht viel auf Gregs Machtspiele gegeben. Dabei hätte er es besser wissen müssen. »Was für einen Plan?«
»Du bist noch nicht bereit dafür. Du könntest es noch nicht verstehen. Ich muss dir erst weitere Lektionen erteilen, damit du begreifst, was das alles zu bedeuten hat. Ich habe lange überlegt. Heute wollte ich dir eigentlich die Wahl überlassen.«
»Welche Wahl?«, fragte Theodore mit ein wenig Hoffnung in der Stimme. Vielleicht gab es doch noch eine geringe Chance, die er ergreifen konnte. Für Beatrice würde er nach jedem noch so kleinen Strohhalm greifen, um hier wieder herauszukommen. Ihr zuliebe würde er alles machen, was Greg verlangte.
Greg deutete auf die Streichholzpackung und öffnete sie. »Ich wollte dich die Stelle aussuchen lassen, an der ich unser Zeichen in deinen Körper graviere. Aber weil du mich enttäuscht hast, habe ich mir etwas anderes überlegt.« Er holte ein Streichholz aus der Packung und musterte es fasziniert. »Stattdessen werde ich dir dein Augenlicht nehmen.«
In Theodores Gesicht offenbarte sich tiefstes Entsetzen. Er konnte sich nicht vorstellen, was für Schmerzen dies bedeutete. Er begann wieder, reflexartig auf dem Stuhl umher zu zappeln, und wollte so der Misshandlung entfliehen. Die kurz zuvor entfachte Hoffnung verschwand unverzüglich und wurde durch eine Heidenangst abgelöst. »Das kannst du nicht tun!«, winselte er. Er wusste, dass er dazu imstande war. Die Blutpfütze unter ihm sprach für sich. Es war ein verzweifelter Appell an Gregs nicht vorhandene Menschlichkeit. »Bitte.«
»Zu spät.« Bei diesen Worten strich er den Kopf des Hölzchens schnell an der Reibefläche der Packung entlang, worauf das Zündholz entfacht wurde. Die Flamme zuckte hastig umher, als Greg das Streichholz langsam an Theodores Augen heranführte.
»Nein!« Theodore wackelte stark hin und her, bis der Stuhl zu kippen begann. Er versuchte zurückzuweichen und schüttelte irrsinnig mit dem Kopf, damit seine Augen der lodernden Flamme nicht direkt ausgesetzt waren. Als er die Wärme des Feuers an seiner Wange spürte und Schwefelgeruch in seine blutige, kaputte Nase stieg, drückte er sich kräftig gegen die Lehne, woraufhin er den Schwerpunkt überschritt und nach hinten umstürzte.
»Shit!«, jammerte er, nachdem sein Hinterkopf auf den robusten Dielen aufgeschlagen war und der Stuhl dem Aufprall standgehalten hatte. Seine gefesselten Hände drückten heftig auf seine Wirbelsäule. Jetzt war er Greg hilflos ausgeliefert.
»Das bringt dir gar nichts, Theo. Du kannst nicht davor flüchten. Es wird ganz schnell vorbei sein, also sei nicht so feige! Werde endlich erwachsen und bring es hinter dich!«
»Nein!« Theodore schrie auf. Lauter als jemals zuvor. Er schrie sich die Seele aus dem Leib. Dabei war es ihm egal, ob sein Kreischen eine weitere mitleidlose Strafe zur Folge haben könnte. Das Ausbrennen seiner Augen würde er ohnehin nicht überstehen. Die Todesangst, die sich überall in und auf seinem Körper widerspiegelte, untersagte ihm jeden klaren Gedanken. Es war kein menschlicher Schrei mehr, den seine Lunge ausstieß, es war vielmehr ein animalisches Brüllen.
Nicht, dass Theodore noch daran glaubte, ihn könnte jemand hören – der triebhafte Jammerlaut besaß nur eine einzige Eigenschaft. Er sollte seinem Angreifer Furcht einflößen und ihn vertreiben.
Das Erste, was Theodore realisierte, war, dass er damit tatsächlich eine Wirkung erzielt hatte. Die Zimmertür wurde von außen geöffnet. Jemand hatte sein Geschrei vernommen.
Im Augenwinkel erkannte er Kasidy in der Tür stehen. Sofort holte er tief Luft, doch im selben Moment spürte er bereits Gregs fleischige Hand, die mit brutaler Entschlossenheit seine Kehle zuschnürte. Sein verzweifelter Hilferuf verlor sich in einem jämmerlichen Krächzen.
»Wir haben Besuch. Du musst nach oben kommen. Kannst du dich zusammenreißen?«, fragte sie ungeduldig. Dabei ignorierte sie Theodore gänzlich. Sie würdigte ihn keines Blickes, so bedeutungslos war er. Damit zeigte sie ihm, dass er nur ein wertloses Spielzeug für sie gewesen war; eine Einwegflasche, deren Inhalt aufgebraucht ist und die nun entsorgt werden konnte.
»Verdammt.« Greg blies das Streichholz aus und warf es samt Packung wieder auf den Schreibtisch. »Ich werde mich beherrschen.«
»Beeil dich«, forderte Kasidy und verschwand hinter der sich schließenden Tür.
»Es ist noch nicht vorbei, Theo.« Greg knebelte ihn mit einem neuen Stück Paketband, das er straff über die blutigen Lippen zog, während er hechelnd nach Luft rang. »Ich werde bald zurückkommen, und dann wirst du deine nächste Lektion lernen. Vielleicht wird aus dir doch noch ein Mann, wenn du dich deinem Schicksal stellst. Wimmern wird dir definitiv nicht helfen.« Hastig verließ Greg den Raum, schaltete den Deckenfluter aus und ließ Theodore mit dem heftigen Zuknallen der Tür auf dem Boden des Folterkellers zurück in der Dunkelheit.
Gewonnen hatte Theodore dadurch absolut nichts. Im Gegenteil – nun musste er sich noch länger mit Gregs grauenhaften Absichten auseinandersetzen. Das Unausweichliche wurde lediglich herausgezögert.
–II–
So einen Aufwand für eine Wohnungsbesichtigung hatte Jack Tanner noch nie erlebt. Nicht, dass er in seinem Alter schon viele solcher Termine wahrgenommen hätte, doch es war offensichtlich, dass diese Wohngemeinschaft es übertrieb.
Nervös wartete er vor der imposanten Tür des modernen Hauses darauf, dass einer der Bewohner ihn empfing. Er hatte seine Hand bereits erneut in Richtung der Klingel erhoben, bevor er den Knopf jedoch drücken konnte, hörte er, wie jemand von innen die Tür aufschloss.
»Hi ... Ich bin Jack Tanner. Ich komme wegen des freien Zimmers«, stellte er sich freundlich dem Augenpaar vor, das hinter dem Türspalt hervorblickte.
Eine geheimnisvolle Skepsis offenbarte sich in dem smaragdgrünen Funkeln. Dann wurde die Tür weiter geöffnet, und ein engelhaftes Gesicht einer atemberaubenden Schönheit wurde sichtbar.
»Ja ... ähm ... Jack ... Jack Tanner ... klar. Komm rein«, sagte sie stockend, aber sanftmütig und gewährte ihm Einlass.
Die Zärtlichkeit ihrer Stimme verriet ihre Jugendlichkeit. Sie ist zweifellos nicht älter als fünfundzwanzig, dachte Jack. Ihn überkam ein freudiges Lächeln. Wenn in diesem Haus ein solch wertvoller, exquisiter Schatz versteckt ist, erklärt das die übertriebene Sorgfalt bei der Auswahl der Mitbewohner selbstverständlich.
Er überquerte die Türschwelle und fand sich inmitten eines vortrefflich eingerichteten Foyers wieder. Die Eingangshalle war nicht übermäßig groß, aber sie war durchweg von einer noblen Einrichtung und geschmackvollen Dekoration geprägt. An den Wänden hingen Leinwandgemälde, es waren beachtliche Ölmalereien, und vier großgewachsene Drachenbäume zierten die Ecken des länglichen Raumes.
Jack hörte hinter sich die Tür ins Schloss fallen. Er wollte sich zu der jungen Frau wenden, doch sie stand bereits wieder vor ihm und musterte ihn. Ihre kirschroten Lippen waren zu einem offenherzigen Lächeln geformt und bildeten einen magischen Kontrast zu ihren perfekten Zähnen.
»Ich bring dich ins Esszimmer und hole die anderen Mitbewohner. Wir können gleich anfangen«, sprach sie und riss ihn aus dem Bann, in den er ihretwegen verfallen war. »Ich bin übrigens Kasidy.« Sie reichte ihm die Hand.
Jack erzitterte kurz am gesamten Leib, während er sich von der Bewunderung loslöste. Dann ergriff er ihre Hand und schüttelte sie vorsichtig. »Sehr erfreut.« Er wusste, dass sie sein Erschaudern bemerkt hatte, aber sie ließ es sich nicht anmerken.
»Hier entlang.« Sie machte auf dem Fuß kehrt und trat durch das Foyer in Richtung des rechten Türbogens.
Jack folgte ihr, nachdem sie bereits ein paar Schritte vorausgegangen war. Dabei begann er, den Rest ihres Körpers zu betrachten. Er war makellos. Ihre schmalen, langen Beine und ihr runder Po waren von einer hautengen GUCCI Blue Jeans verhüllt, die direkt an ihrer Hüfte endete. An ihrer Taille präsentierte sie einen kleinen Teil ihrer pfirsichgelben Haut, ihr Rücken wurde von einem dunkelblauen Top bedeckt. Vor ihm lief eine Frau mit perfekten Kurven, die ihn an eine lebensgroße Sanduhr erinnerten. Sie hatte eine betörende Figur, und ihr Gang brachte ihre Weiblichkeit noch stärker zur Geltung.
Jack musste sich beherrschen. Er benahm sich wie ein sabbernder Hund, der hechelnd einem Leckerli hinterher stolzierte.
Kasidy verschwand hinter dem Türbogen.
Und Jack beeilte sich, ihr zu folgen. Es geschah beinah intuitiv, als vermisste er bereits ihren Anblick. Komm schon, reiß dich zusammen! Sie ist nur ein Mädel...
... Und umwerfend, vollendete Jack seinen Gedanken, nachdem er das Esszimmer erreichte, und ihre Blicke sich erneut trafen.
Kasidy stand neben einem der sechs Stühle des ovalen Tisches in der Mitte des Raumes und deutete auf diesen.
Jack ging auf den Stuhl zu und nutzte die Gelegenheit, auch den vorderen Teil ihres Körpers genauer zu begutachten. Es verschlug ihm die Sprache, als er sie von oben bis unten musterte. Dabei überflogen seine Augen jede einzelne Stelle viel zu auffällig.
Kasidy schenkte ihm weiterhin ein Lächeln. »Ich bin gleich wieder da.« Sie setzte sich in Bewegung, lief zurück zum Foyer und stieß auf halbem Wege mit ihrem Arm an den von Jack. »Oh sorry, tut mir leid«, rief sie erschrocken und tastete einfühlsam seinem Oberarm entlang, als würde sie erwartungsvoll nach seinen angespannten Muskeln suchen.
Jack wich verschüchtert zurück. »Nichts passiert.«
Sie formte ihre Lippen erneut zu einem Lächeln. Diesmal war es anders. Berechnet. Frivol. Der Anrempler geschah mit voller Absicht. Ihr durchtriebener Blick verriet sie.
Dann wandte sie sich von ihm ab und setzte ihren Weg fort. Sie stolzierte graziös davon wie auf dem Catwalk auf der New Yorker Fashion Week.
Jack wusste genau, sie wollte seinen Blick spüren, und sie wollte seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Er gab ihr, wonach sie verlangte. Es war ihm absolut recht, denn Kasidy war heiß.
Er ließ sich auf dem schwarzen Schwingstuhl nieder, der ihm zugewiesen worden war und betrachtete das Zimmer. Es strotzte vor Pracht.
Ein eindrucksvolles Gemälde hing an der cremefarbenen Wandtapete. Es war gigantisch und vermutlich auch unbezahlbar. Wie bei allen Gemälden konnte Jack nicht deuten, was der Künstler mit dem Bild ausdrücken wollte. Es war für ihn eine übertrieben große Schmiererei.
Die Leinwand präsentierte auf der kompletten rechten Seite eine überdimensionierte Sonnenblume, deren Kerne gegen einen glatten Spiegel ersetzt worden waren. Ihre gelb-orangefarbenen Blüten waren verschnörkelt, sie wirbelten wild umher, und ihre Enden färbten sich in kräftige Rottöne, als stünden sie in Flammen. Die linke Seite des Bildes war durchweg schwarz. Aber irgendetwas schien sich dort zu verbergen. Die Schwärze wirkte unruhig und unharmonisch, als würde etwas darin lauern und das restliche Bild verschlingen wollen.
Jack verband eine eigenartige Assoziation mit dem Gemälde. Es hatte eine bedrohliche Wirkung auf ihn und verlieh dem großen, lichtdurchfluteten Raum ein Übermaß an Düsternis, wie er sie von der Wohnung seines alten Kumpels und selbsterkorenen Gothics Ethan kannte.
Ein eigenartiges Geräusch drang kaum hörbar in seine Ohren. Er hatte es nur bemerkt, weil es ringsum totenstill war. Nicht einmal der Zeiger einer Uhr tickte. Bevor er jedoch die Herkunft oder Art des Lauts ausmachen konnte, war er schon wieder verschwunden.
Jack ließ den Blick von dem seltsamen Bild ab und schaute sich weiter um. Ein hölzernes Sideboard mit Glasvitrine stand hinter seinem Stuhl. Darauf befanden sich zwei moderne Kerzenständer mit kleinen quadratischen Sockeln als Standfläche. Ohne Zweifel handelte es sich auch dabei um teure Designerstücke.
In der Vitrine lagerte ein edles Tellerservice, das am Rand mit blauen Akzenten verziert war. Daneben standen verschiedenste Gläser.
Dies alles hatte Jack definitiv nicht erwartet. Als er die Annonce in der Online-Zeitung gelesen hatte, hatte er sich eine hektische Wohngemeinschaft vorgestellt. Unaufgeräumt, verstaubte Ablageflächen, in der Küche stapelte sich massenhaft dreckiges Geschirr vom Vortag, regelmäßig war die Toilette verstopft und üble Gerüche überdeckten das Haus.
Stattdessen dominierte durchweg eine pedantische Sauberkeit. Entweder war er an eine Studentenverbindung geraten, bei der es tatsächlich Personal gab, das für die Reinigung und Instandhaltung des Verbindungshauses zuständig war, oder es war ein absoluter Glücksgriff.
Dieses rattenscharfe Juwel namens Kasidy deutete auf Letzteres hin. Doch jede Medaille hatte bekanntlich zwei Seiten.
In seinem Elternhaus war es nie annähernd so sauber gewesen. Wenn sein Vater von ihm verlangte, beim Hausputz mitzuhelfen, hatte er immer schleunigst die Flucht ergriffen. Hier würde er genauso reagieren, ehe ihm ein Staublappen in die Hand gedrückt wurde.
Noch während er über die Organisation der Wohngemeinschaft nachdachte, bemerkte er die Schritte mehrerer Personen, die sich dem Esszimmer näherten. Er atmete tief durch und schluckte den angesammelten Speichel herunter.
Hoffentlich sind es keine langhaarigen Freaks mit übermäßig Metall im Gesicht und Krallenhalsbändern, dachte er inständig, während er nochmals auf das Gemälde auf der gegenüberliegenden Wandseite schaute.
Dann richtete er seinen Blick erwartungsvoll in Richtung des Türbogens zum Foyer und sah, dass Kasidy zwei Männer im Schlepptau hatte.
»Das ist Jack Tanner«, sagte sie zu den Kerlen, die sie flankierten.
Unbeeindruckt betraten sie das Esszimmer und gingen voller Selbstbewusstsein auf den Tisch zu.
Der Höflichkeit halber wollte Jack sich erheben und den Jungs mit dem kräftigsten Händedruck begegnen, zu dem er fähig war.
»Sitzenbleiben!«, plärrte der Stämmigere von ihnen. »Ich bin Greg. Und das ist Anthony.«
Die Worte trafen wie ein Giftpfeil auf Jack. Sofort nahm er wieder Platz und setzte sich kerzengerade hin. Seine Hände legte er nebeneinander auf den Tisch. Dabei war Etikette keine seiner Stärken. Es fiel ihm prinzipiell schwer, ruhig zu bleiben und sich reserviert zu geben. Wenn dieser Macho ihn auf der Straße so angemacht hätte, wäre Jacks geballte Faust schon längst inmitten seines Gesichts gelandet. Aber er beherrschte sich.
Greg nahm direkt gegenüber Platz.
Auf der Stirnseite ließ sich Anthony nieder. Er wirkte unscheinbar, fast wie ein unbedeutender Schatten.
Jack konnte ihn schlecht einschätzen. Es war gut möglich, dass sich weit mehr Kraft in dem etwa Dreißigjährigen verbarg, als es den Anschein hatte. Seine schieferblauen Knopfaugen schenkten ihm zudem eine gewisse Unbedarftheit, die ihn harmlos wirken ließ.
»Du bist neunzehn?«, fragte Greg skeptisch. Seine dunklen, tief liegenden Augen verliehen ihm einen boshaften Blick, als ob er von einem Dämon besessen war.
»Korrekt.«
»Du siehst älter aus. Wie Jonathan Rhys Meyers.« Greg legte seinen Kopf quer wie ein neugieriger Hund. Starke Abneigung war in seinen Augen zu erkennen. Er bemühte sich nicht einmal, seine Verachtung zu verbergen.
»Das muss an meinem Bart und dem perfekten Gesicht liegen.« Jack strich sich stolz über den stoppeligen Bart.
»Was willst du studieren?«, fragte Anthony unvermittelt.
»Physik«, antwortete Jack, ohne seinen Blick von Greg abzulassen. »Was ist mit euch?«
»Wir stellen hier die Fragen!«, fauchte Greg.
Verwundert ließ Jack sich daraufhin in die Sitzlehne fallen und verschränkte die Arme vor seiner Brust. Er wollte mit dieser Abwehrhaltung eine gewisse Distanz aufbauen. Es wäre für ihn wirklich kein Problem gewesen, diesem aufgeblasenen Schwachkopf den Kopf umzudrehen und wie eine Glühlampe aus der Fassung zu schrauben. Noch gab es dafür keinen ausreichenden Grund, aber dieser Typ war auf dem besten Weg dorthin. Wenn sich Greg weiter so aufführte, konnte er für nichts mehr garantieren. Es wäre nicht das erste Mal, dass er jemanden, von dem er angepöbelt wurde, das Gesicht verunstaltete.
Bestimmt hat die heiße Braut ihn letzte Nacht nicht ran gelassen, dachte Jack. Irgendetwas geht ihm gewaltig gegen den Strich. Wahrscheinlich fühlt er sich durch meine Anwesenheit bedroht. So wie sich der Typ gibt, ist er hier der Hahn im Korb und hat Angst davor, dass ich ihm seinen Platz streitig mache und Kasidy sich mehr für mich interessiert als für ihn. Das war eine durchweg plausible Erklärung für diese ungehemmte Feindseligkeit.
Sollte sich der Gastgeber einer Party nicht benehmen, statt den Obermacker heraushängen zu lassen, wollte Jack eigentlich fragen, aber dies hätte die Situation nur eskalieren lassen. Dann hätte er nicht mehr für die Gesundheit des überheblichen Gregs garantieren können, und das erwartungsvolle Vorstellungsgespräch wäre schneller vorbei, als ihm lieb war. Wenn Kasidy nicht problemlos Kira Kazantsev, der amtierenden Miss America, den Rang ablaufen würde, hätte dieses Treffen aus Jacks Sicht schon längst sein Ende gefunden. Doch mit ihr unter einem Dach zu wohnen, war die Mühe für Anstand und Zurückhaltung allemal wert.
Deswegen nickte Jack nur und bestätigte Greg, von nun an nach seiner Pfeife zu tanzen. Immerhin hatte er schnell herausgefunden, wie die zweite Seite der Medaille aussah. Aber hinter seinem unterwürfigen Blick und dem freundlichen Lächeln verbarg sich ein unversöhnlicher Gedanke. Wenn ich erst einmal einen Fuß in deinem Haus habe...
– III –
Nachdem Kasidy mit einem letzten freundlichen Lächeln die Haustür verschloss und Jack Tanner endlich weg war, konnte Greg sich nicht länger zurückhalten.
»Dieser aufgeblasene Wichser wird hier nicht einziehen!«, entschied Greg wutentbrannt, weil ihr Gast ihn von seiner Arbeit abgehalten und seine Zeit vergeudet hatte. Anstelle der Vorstellungsrunde hätte er im Keller sitzen und voller Neugier die ausblutenden Augen Theodores betrachten können. Etwas, das ihm im Gegensatz zu dem Gespräch der letzten anderthalb Stunden echte Freude bereitet hätte.
»Komm runter!«
Anthony und Kasidy wussten genau, dass Gregs Frust nur indirekt mit Jack Tanner zusammenhing. Der Kerl war einfach zum ungünstigsten Zeitpunkt aufgetaucht, den es gab. Von daher war es erstaunlich, dass Greg ihn nicht im Laufe der lächerlichen Unterhaltung am Kragen gepackt und über den Tisch gezerrt hatte.
Unzufrieden schaute Anthony auf seine Markenarmbanduhr von Diesel, die Greg ihm einst geschenkt hatte. »Es ist erst kurz nach sieben.«
»Wow, du kannst die Uhr lesen«, motzte Greg genervt.
»Du weißt genau, was Tony meint«, warf Kasidy ein. »Du wolltest dich zusammenreißen.«
»Das war, bevor ich wusste, dass wir ein dämliches Machoarschloch eingeladen haben. Wollt ihr ernsthaft, dass dieser Typ hier wohnt?«
»Es geht nie darum, was wir wollen«, sagte Anthony.
»Zumindest nicht in erster Linie«, fügte Kasidy hinzu.
»Es gibt Grenzen. Und Tanner befindet sich außerhalb unserer Vorgaben. Wenn es unbedeutend wäre, wer hier einzieht, könnten wir auf diese bekackten Vorstellungsgespräche verzichten. Aber die Auswahl ist eben nicht egal.« Greg schlug unbeherrscht mit dem Faustballen gegen die Wand und untermalte damit sein Desinteresse an der Diskussion. Nicht schon wieder wollte er mit den beiden darüber streiten. Er hatte recht, das wusste er. Und sie wussten es ebenso.
»Unsere Kriterien beziehen sich nicht nur auf den ersten Eindruck. Es ist nun einmal erforderlich, dass sie zumindest eine Nacht hier verbringen. Und das hast du gehörig verbockt. Nicht zum ersten Mal ist das Vorstellungsgespräch aus dem Ruder gelaufen. Wenigstens hast du diesmal nicht auf den Besucher eingedroschen. Aber das eben hat erneut bewiesen, dass es die richtige Entscheidung war, dass wir diese Gespräche nur noch gemeinsam fuhren.«
»Anthony, ich trage die Verantwortung und bin mir der Konsequenzen meiner Entscheidung bewusst.« Gregs Wut wurde immer stärker. »Ich hätte keine fünf Minuten länger mit Jack Tanner ausgehalten, geschweige denn den restlichen Abend mit ihm verbringen können. Allein sein Name – klingt wie aus Zurück in die Zukunft.«
»Der hieß Biff Tannen.«
Greg rügte Anthony mit einem durchdringenden Blick. Auf diese Richtigstellung konnte er getrost verzichten. »Jack Tanner wird weder eine Nacht hier verbringen noch hier einziehen. Das ist mein letztes Wort.«
»Du stellst deine persönlichen Gefühle über unsere Regeln. Schon wieder!«
»Kas, zieh dir was an, bevor du dir eine Erkältung einfängst!«
Dieser Vorwurf ließ ihr Gesicht erstarren. »Im Gegensatz zu dir wirke ich in eng anliegenden Jeans und bauchfreien Tops betörend auf unsere Gäste. Ich mache das für uns. Ich bin keine billige Hafennutte. Wenn du denkst, du kannst das besser, zwäng dich in enge Klamotten und mach die Bewerber scharf. Ich bin gespannt, ob laszive Andeutungen und ein wenig Augenzwinkern von dir die Leute auch dazu veranlasst, die Nacht hier zu verbringen. Über meine Erfolgsquote brauchen wir wohl nicht zu sprechen.«
»Er hat dir andauernd auf die Brüste geschaut und du hast sie ihm mit einem dämlichen Grinsen im Gesicht immer weiter entgegengestreckt. Dein Ausschnitt war tiefer als der verdammte Grand Canyon. Ich bin fertig mit ihm.«
»Ich streiche ihn von der Liste«, sagte Anthony und machte sich mit einer abweisenden Geste auf den Weg ins Esszimmer.
»Warte!«, rief Kasidy ihm hinterher.
»Es ist sinnlos, weiter auf ihn einzureden. Er hört uns nicht mehr zu.«
Nachdem Anthony verschwunden war, schenkte Kasidy Greg einen garstigen Blick. »Echt klasse.«
Greg konnte diesem nicht sonderlich lange standhalten. Die bezeichnende Missbilligung in ihren grünen Diamantenaugen ging ihm bis unter die Haut. Er wandte sich rasch von ihr ab, ging zur Kellertreppe und riss die Tür auf. »Ich habe etwas zu erledigen!«, plärrte er und entrann schnellstmöglich der unangenehmen Situation.
Während er die Treppe herunter eilte, stieß Kasidy einen kurzen, intensiven Wutschrei aus und knallte die Kellertür hinter ihm zu.
Schäumend betrat Greg den dunklen Raum, in dem Theodore samt Stuhl noch immer auf dem Boden lag. Er war so in Rage, dass er nicht einmal das Zimmerlicht anschaltete. Nur das spärliche Kellertreppenlicht warf einen trüben Schein in den Raum.
Greg ging an Theo vorbei zur hinteren Wand. Ein metallisches Kratzen erklang, als er die Klinge des Katanas aus der hölzernen Scheide an der Wand zog.
Dann drehte Greg sich zu Theo um, der irgendetwas Unverständliches unter dem Klebeband nuschelte. Er schritt auf ihn zu. Und er tat, was er tun musste.
–IV–
Libby hatte es sich auf dem gigantischen King Size Bett von Beatrice gemütlich gemacht. Sie saß mit dem Rücken an die Wand gelehnt und betrachtete ihre langen, kirschroten künstlichen Fingernägel.
Bei ihren Füßen lagen Unmengen aufgerissener Chipstüten sowie deren Inhalt, Fruchtgummi und Schokolade auf dem Bett verteilt. »Ich starte jetzt den Film«, rief sie ungeduldig ins anliegende Badezimmer.
»Warte!«, kam die prompte Antwort.
»Beeil’ dich, Süße, vor Sorge habe ich schon eine Vermisstenanzeige aufgegeben«, sagte Libby und feixte dabei. »Wenn du den Anfang verpasst, wirst du den ganzen Film über nicht verstehen, worum es geht.«
»Deswegen sollst du dich auch noch kurz gedulden.«
»Ich warte schon zwei Ewigkeiten.«
Libby hörte ein genervtes Seufzen aus dem Badezimmer, woraufhin sie laut Auflachen musste.
»Ich habe PLAY gedrückt«, verkündete sie und klatschte amüsiert mit der Rückseite der Fernbedienung mehrfach gegen ihre Hand.
Beatrice steckte ihren Kopf durch die Tür, während sie sich mit einem Handtuch die nassen Haare trocknete. »Das ist deine Schuld. Wenn du nicht die Sektflasche über mir ausgeschüttet hättest, könnten wir schon längst den Film schauen.«
Unschuldig wies Libby die Hände von sich. »Keine Ahnung, wovon du sprichst.«
»Du hast keine Ahnung, wie widerlich dieses Zeug in den Haaren klebt«, fluchte Beatrice und verschwand wieder im Bad.
»Nicht nur Sekt kann verdammt widerspenstig in den Haaren sein, glaub mir.«
»Ich will’s gar nicht wissen.«
Dabei hätte Libby ihr so gern von dem Erlebnis der vergangenen Woche berichtet. Bestimmt würde ihre Freundin schnell das Thema wechseln, damit sie nicht dazu kam. Beatrice war so durchschaubar, was das anging, aber sie akzeptierte und respektierte es.
Libby dachte daran, wie wundervoll die letzten Tage doch gewesen waren. Sie hätte stundenlang darüber erzählen können, aber Beatrice würde ihre Begeisterung wohl kaum nachempfinden können. Sie war viel zu anständig und führte ein zu organisiertes Leben, in dem draufgängerische Abende keinen Platz fanden. In der vergangenen Woche gab es keine Nacht, in der sie nicht unterwegs war. Immer ein anderer Club und immer ein anderes Bett. Es war legendär.
»Ich ziehe mir nur noch schnell eine trockene Schlabberhose an, dann bin ich bei dir.«
Libby rollte sich zum Bettrand und kramte in den Taschen ihrer auf dem Fußboden liegenden Jeanshose herum – bis sie endlich fand, wonach sie suchte. Sie zog ein Plastiktütchen hervor. Eisklare Kristalle türmten sich darin. Schnell rupfte sie den Verschluss auf und fischte sich zwei davon. Sie legte sie auf die offene Handfläche und schnupfte sie mit einem tiefen Zug durch die Nase. Dabei verdrehte sie die Augen und packte das Tütchen daraufhin wieder zurück in die Hosentasche. »Geiles Ice.«
»Was hast du gesagt?«, fragte Beatrice, nachdem sie das Licht im Bad ausgeschaltet hatte und das Chaos begutachtete, das sie in den vergangenen Stunden in ihrem Zimmer – insbesondere aber auf dem Bett – angerichtet hatten.
»Assikluft«, sagte Libby und lachte Tränen, während sie Beatrices neues Outfit betrachtete. »Wieder trocken ...«
»Zum Glück. Das war echt eklig.«
»Nein, nein. Ich sitz auf dem Trockenen, das wollte ich damit sagen. Bringst du eine neue Flasche Sekt mit, die alte ist schon wieder leer.«
Beatrice blickte auf den Couchtisch zwischen Bett und Fernseher. Darauf standen unzählige Flaschen. Das Sortiment war beinah so ergiebig wie das des lokalen Getränkehandels. Sie schüttelte den Kopf und Libby formte ihre schmalen Lippen zu einem übertriebenen Schmollmund.
»Eigentlich dürfte ich dir keinen Alkohol mehr geben.«
»Ach nein?«, fragte Libby skeptisch und in der Überzeugung, dass es nicht richtig wäre, jetzt mit dem Trinken aufzuhören. »Was ich mich schon immer gefragt habe, Süße: du und Theodore.« Sie deutete mit beiden Zeigefingern herab auf das Bett, auf dem sie saß, und biss sich theatralisch lüstern auf die Unterlippe. »Wie oft habt ihr schon?«
Beatrice schnaubte die angestaute Luft heraus. Dennoch formte sich ihr Mund zu einem freudigen Lächeln, als sie den Namen ihres Schatzes hörte. »Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Hier, nimm!« Sie reichte Libby die ungeöffnete Sektflasche.
Kurz bevor Libby zupacken konnte, zog Beatrice die Flasche wieder zu sich heran. »Du wirst sie trinken, nicht ausschütten, verstanden?«
Grimmig schaute Libby auf die Flasche, die soeben wieder außer Reichweite gebracht worden war. »Versprochen!« Sie ließ die Fernbedienung fallen und grapschte eifrig mit den Händen nach der Flasche. »Danke, Süße. Aber jetzt setz dich hin, sonst bekommen wir beide nichts vom Film mit!«
Beatrice nahm am Ende des Bettes Platz. Sie fuhr sich mit der Hand durch die Haare und rümpfte unzufrieden die Nase, als wäre da noch eine klebrige Stelle. Nebenbei schaute sie auf den Fernseher und ihre Stirn legte sich in Falten.
»Kommt dir der Anfang auch irgendwie bekannt vor?«, fragte Libby und strich sich über die juckende Nase.
»Hast du die DVD gewechselt?«
Ein kreischendes Lachen verhinderte eine Antwort. Libby prustete amüsiert, und es dauerte einen Moment, bis sie die Beherrschung zurückerlangte. »Ups.«
»Ich kümmere mich darum. Du bist unglaublich. Der Abend ist noch so jung und die größte Menge Alkohol ist bisher auf mir gelandet. Wie kannst du jetzt schon so verbimmelt sein?«, meckerte Beatrice und wechselte die DVD.
»Ich finde es übrigens cool, dass deine Eltern das Wochenende weggefahren sind. So haben wir das ganze Haus für uns.«
»Willst du meinen Ruf als die Meisterin des Themenwechsels streitig machen?«
»Ich dachte mir, dass wir vielleicht noch Adrian einladen könnten. Und Kyle«, sagte Libby.
»Dass du wegen Adrian fragen würdest, war mir klar. Aber Kyle?«
»Nun, soweit ich weiß, steht er auf dich.«
Beatrice schob die DVD in den Player und rappelte sich wieder auf. Sie ging zurück zum Bett und schaute ihre Freundin fragend an. »Und?«
»Wir beide mit zwei Jungs. Sturmfrei. Das wird bestimmt witzig.«
»Du hast den Alkohol in deiner Gleichung vergessen.«
Libby schnalzte mit der Zunge und gönnte sich einen großen Schluck aus der Sektflasche. »Stimmt. Jetzt, da du es sagst.«
»Ich weiß, dass du für alle verrückten Dinge offen bist, aber vergiss es. Ich werde den Wochenendtrip meiner Eltern nicht ausnutzen, um daheim eine Sex House Party zu schmeißen.«
»Nein, nein, nein«, korrigierte Libby ihre Freundin. »Wir sind doch nur zu viert. Zwei Pärchen, weißt du?«
»Theodore!«, ergänzte Beatrice.
»Der ist nicht da.«
»Ich werde ihn nicht betrügen, und das weißt du. Wir wollen bald heiraten, schon vergessen?«
Libby schnappte tief nach Luft und zeigte einmal mehr, dass sie nicht sonderlich begeistert war, dass Beatrice sich so früh festlegte. Sie war von Anfang an dagegen gewesen, doch bisher konnte sie Beatrices Meinung nicht ändern. »Komm schon. Du bist zwanzig. Du musst noch nicht heiraten. Es gibt noch so viel zu erleben.«
»Es gibt noch vieles, was ich mit Theodore erleben werde.«
»Aber Kyle ist ein super Typ, er –«
»Nein, Libby.«
Libby war von der Reaktion enttäuscht. Ihr Gesicht offenbarte extreme Traurigkeit.
Das überraschte Beatrice offensichtlich. »Was ist los, Kleine? Du wusstest bereits vorher, dass ich mich darauf nicht einlasse.«
»Schon.«
»Aber?«
»Kyle hat mich gebeten, dich zu fragen.«
Beatrice setzte ein gespieltes Grinsen auf. »Und das hast du auch getan. Also musst du dich nicht schlecht fühlen. Es gibt bestimmt eine andere Frau, die Kyle glücklich machen wird.«
»Er hat gesagt, er sei für dich da, wenn du mal Hilfe brauchst.«
»Kyle kennt mich überhaupt nicht. Wir haben zweimal geplaudert. Sonst beschränken sich unsere flüchtigen Begegnungen auf der Straße darauf, dass er mich mit seinem Blick auszieht. Ich bin mir sicher, wir passen nicht zusammen.«
»Trotzdem finde ich es schade. Nur wenn du es ausprobierst, wirst du es herausfinden. Ich weiß echt nicht, ob Theo der Richtige für dich ist. Bei Kyle habe ich ein weitaus besseres Gefühl.«
»Theodore!«, verbesserte sie den unliebsamen Kosenamen ihres Verlobten. Obwohl diese Behauptung wie ein Schlag ins Gesicht war, beherrschte sich Beatrice.
Wenn Beatrice es ihr krummnehmen sollte, konnte sie es immerhin auf den Alkohol schieben.
»Und das begründest du wie?«
»Anhand der Größe seines –«
»Seiner Oberarme, schon verstanden. Aber nein danke, ich bin absolut nicht interessiert. Wenn er dich fragt, wie ich reagiert habe, dann sag ihm bitte, dass ich mich geschmeichelt fühle, aber ich momentan nichts an meinem hervorragenden Leben verändern werde.«
»Aber –«, versuchte Libby einzulenken, wurde von Beatrice jedoch gleich wieder davon abgehalten.
»Jetzt hör auf damit, mich verkuppeln zu wollen«, zischte sie und warf eines der flauschigen Kissen in Libbys Gesicht. »Der Film fängt nun wirklich an.«
»Gruseln«, sagte Libby und war sofort auf den Fernseher fixiert wie ein Kleinkind auf seine Rassel.
Wahrscheinlich war es besser, wenn sie ihre Bedenken für sich behielt. Sie hatte einige Gerüchte über Theodore gehört, die ihr einen kalten Schauer über den Rücken jagten, und sie war sich sicher, dass Beatrice sie nicht kannte.
Beatrice dimmte die Zimmerbeleuchtung mit der Universalfernbedienung auf ein Minimum und manövrierte sich an den vielen Chipstüten, Haarbürsten, Spangen und anderen Utensilien auf dem Bett vorbei, bis sie eine bequeme Sitzposition neben Libby fand.
Kurz darauf legte Libby eine Hand auf Beatrices dünnen Oberschenkel und streichelte ihn sanft.
»Hände weg, Libby!«, sagte sie forsch und schob sie weg.
»Wenn Adrian hier wäre, dann –«
»Chance vertan, Kleine«, schnitt Beatrice ihr das Wort ab. »Schau hin und genieße die Schwertkunst von Beatrix Kiddo«, forderte ihre beste Freundin sie auf.
Noch während ein altes klingonisches Sprichwort auf dem Fernseher zitiert wurde, bemerkte Libby im Augenwinkel, dass Beatrice enttäuscht auf ihr Handy starrte. Er hat sich noch immer nicht gemeldet. Von wegen hervorragendes Leben, dachte sie, schaute wieder auf den riesigen Flachbildfernseher und wartete darauf, dass das Crystal den Film noch besser und blutiger machte, als er ohnehin schon war.
– V –
Zoe Caplan wusste nicht, wo sie war oder wie sie dorthin gelangte. Aber dieser Ort besaß eine beängstigende Vertrautheit. Sie kannte ihn. Er war unheimlich, und er war gefährlich.
Sie stand inmitten eines riesigen Sonnenblumenfeldes. Es war finsterste Nacht und sie erkannte kaum die eigene Hand vor ihrem Gesicht. Selbst der sanfte, fruchtige Duft der Blumen um sie herum konnte ihre Angst nicht vertreiben.
Ihr lief ein bitterkalter Schauer über den Rücken, als sie die großen rauhaarigen Stängel vor sich vorsichtig beiseiteschob. Zoe ahnte, dass dahinter etwas Grässliches auf sie lauerte. Sie war nicht allein. Irgendetwas war zugegen. Ein Wesen. Ganz in ihrer Nähe. Und auf der Suche nach ihr.
Ihr Herz raste und hallte durch die Dunkelheit. Das Einzige, was sich von der Schwärze abhob, waren die gelben Blüten um sie herum. Sie strahlten ein minimales Licht ab, das beinah magisch war.
Das Letzte, woran Zoe sich erinnern konnte, war, dass sie sich, nach einem harten Tag in der Praxis, daheim in die Badewanne gelegt hatte und ein wohltuendes Schaumbad nahm. Alle darauffolgenden Erinnerungen waren wie ausgelöscht.
Es muss ein Traum sein. Zumindest suggerierte sie sich das immer, nachdem sie den finsteren Ort wiedererkannte. Sie war definitiv schon häufig dort gewesen. Aber es war jedes Mal anders; noch intensiver und noch lebendiger als vorher. Außerdem war es nicht die gleiche Stelle in diesem unheimlichen Feld. Obwohl sie das nicht mit bloßem Auge erkennen konnte, so spürte sie doch einen gravierenden Unterschied, den sie sich auf keine rationale Weise erklären konnte. Sie wusste es einfach, genau, wie sie über die Existenz dieses bedrohlichen Geschöpfs Bescheid wusste, das sie jagte.
Es hieß, dass man aufwachte, wenn man einen Traum als solchen entlarvte. Hätte das nicht in diesem Moment eintreten müssen? Hätte Zoe nicht aufwachen sollen, als sie selbst davon überzeugt war, dass sie träumte? Da dies offenbar doch nicht genügte, zwinkerte sie heftig. Sie hatte gelesen, dass Blinzeln dazu beitragen konnte, die Augen auch real zu öffnen und damit den Traum zu beenden. Als das ebenso nutzlos war, zwickte sie sich, und ein Schmerzpfeil jagte durch ihren Unterarm. Noch immer war sie von Sonnenblumen umringt. Sich selbst wachrütteln oder um Hilfe schreien waren ebenfalls Optionen, aber sollten auch diese nicht funktionieren, würde sie die bösartige Identität damit direkt zu sich führen. Sie musste einen anderen Weg finden; einen sicheren. Vielleicht wachte sie auf, sobald sie den Rand des Feldes erreichte.
Sie machte einen kleinen Schritt vor den nächsten. Vorsichtig bahnte sie sich ihren Weg durch den dichten Wald von leuchtenden Sonnenblumen, so leise sie nur konnte. Ihre nackten Füße versickerten im nassen Erdboden. Es fühlte sich eklig an, doch Zoe war zu angespannt, um sich mit dieser Unannehmlichkeit auseinanderzusetzen.
Plötzlich vernahm sie ein bösartiges Schnauben rundum. Egal, in welche Richtung sie blickte, es zeigte sich fortwährend das gleiche Bild: einige Reihen Sonnenblumen, gefolgt von tiefschwarzer Finsternis.
Was auch immer dieses schwere Atmen verursachte, es ließ die Angst in ihr explosionsartig ansteigen. Zoes Bewegungen wurden hektischer und unkontrolliert. Ihr Überlebensinstinkt wollte die Kontrolle übernehmen. Ihre Vernunft stand ihr selber im Weg, also mussten ihre Triebe hervortreten und sie aus dieser Lage retten. Sie verlor sich selbst.
Das Schnauben wurde lauter.
Es kommt näher.
Zoe war noch immer orientierungslos. Doch jetzt war es zu spät, um sich irgendwelche nüchternen Gedanken über die Flucht zu machen. Die Lösung war verdammt einfach: Ich muss davonrennen, so schnell ich nur kann.
Dann hastete Zoe los. Angetrieben von unermesslicher Todesangst. Sie fuchtelte wild mit ihren Armen umher und schlug Stängel und Blüten auf ihrem Weg beiseite. Ein Heer von Sonnenblumen stellte sich zwischen sie und die ersehnte Freiheit, als existierte es nur aus einem Grund: Es war eine Barriere, die sie aufhalten sollte.





























