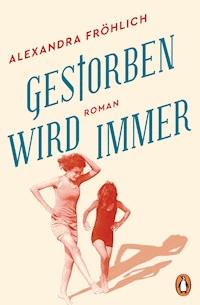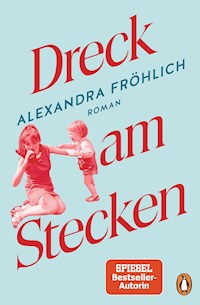
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Familie, die sich fremd geworden ist. Ein unerwartetes Erbe, das sie wieder zusammenführt. Und jede Menge Dreck am Stecken ...
Opa Heinrich ist tot. Sein Vermächtnis: ein vergilbtes Tagebuch. Johannes und seine Brüder beschließen erst mal, seine Vergangenheit ruhen zu lassen. Doch zur Beerdigung erscheinen lauter Menschen, die sie noch nie gesehen haben, eine alte Dame ist sogar aus Argentinien angereist. Was hatte der Großvater mit diesen Leuten zu schaffen? Aus Neugierde beginnt Johannes, das Tagebuch zu lesen. Danach ist klar: Die vier Brüder müssen ihrer Familiengeschichte auf den Grund gehen. Denn Opa hatte Dreck am Stecken. Und zwar nicht zu knapp ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Alexandra Fröhlich lebt als Autorin in Hamburg und arbeitet als freie Textchefin für verschiedene Frauenmagazine. Mit ihren Romanen »Meine russische Schwiegermutter und andere Katastrophen« und »Gestorben wird immer« stand sie monatelang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. In ihrem neuen Roman »Dreck am Stecken« erzählt Alexandra Fröhlich die faszinierende Geschichte einer Familie, die sich ihrer dunklen Vergangenheit stellen muss.
»Alexandra Fröhlich kann viel mehr als grandiose Komödien.« Für Sie
»Mehr-Generationen-Roman mit schrulligem Humor.« Bella über »Gestorben wird immer«
»Ein wunderbarer Familienroman, der die Zeitgeschichte spannend und authentisch einfängt. Unterhaltsam geschrieben und zum Nachdenken anregend.« Preußische Allgemeine Zeitung über »Gestorben wird immer«
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Alexandra Fröhlich
DRECK AM STECKEN
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,
da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich
auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Penguin Verlag dankt dem Rowohlt Verlag für die Genehmigung, im Buch aus folgendem Werk zu zitieren:
Jean-Paul Sartre: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie, Deutsch von Hans Schöneberg und Traugott König, Rowohlt 1993.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2019 Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Lektorat: Marion Kohler
Umschlaggestaltung: Favoritbüro
Umschlagabbildung: © imageBROKER / Alamy Stock Foto
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-21717-4V003
www.penguin-verlag.de
Für Edvard, Lasse und Lennart
»Heinrich! Mir graut’s vor dir.« Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Der Tragödie Erster Teil
DAMALS
Unsere Mutter rauchte und trank. Beides nicht zu knapp. Und sie war ein lustiger Vogel, wenn sie nicht gerade einen ihrer Schübe hatte. Dann rauchte und trank sie noch mehr und sprach kein Wort, sondern starrte tagelang lieber stumpfsinnig aus dem Fenster. Alles in allem aber war sie ziemlich in Ordnung. Sie war nur anders als andere Mütter.
Sie selbst sagte immer, sie sei eine Schlampe, was sie weniger auf ihre wechselnden Männerbekanntschaften bezog als vielmehr auf ihren fehlenden Ordnungssinn. Wie sollte sie dem Chaos auch Herr werden, so ganz allein mit vier Kindern und einem kränkelnden Vater?
Vier Sommer vor der großen Katastrophe stand Opa auf einmal vor der Tür, mit einem alten Köfferchen in der ledrigen Hand, und zog einfach bei uns ein. Wir Jungs kannten ihn nur von einem eingestaubten Bild, das in Mutters Nachttisch lag. Aufmüpfig blickte er dort in die Kamera, spitzes Kinn, blitzende Augen, ein junger Bursche in Uniform. Mutter hatte nie von ihren Eltern erzählt, wir wussten einzig, dass sie irgendwo in der Ferne weilten, um dort ihr Glück zu suchen. Hakten wir nach, unterband sie unser Begehren stets mit einem knappen: »Die Vergangenheit soll man ruhen lassen.«
Der ältere Herr, der nun in unser Leben trat, hatte mit dem schneidigen Soldaten auf der Fotografie nicht mehr viel gemein. Insgesamt betrachtet, war er in keinem guten Zustand. Humpelnd räumte er seine wenigen Sachen in unsere Schränke, verlangte sofort nach einem Gehstock, besser noch einem Rollstuhl, und nässte nachts ein.
»Heinrich«, brüllte Mutter fortan jeden Morgen, wenn sie die Sauerei entdeckte, »Heinrich, was soll das? Zu faul, um aufs Klo zu gehen? Als ob ich nicht genug Probleme hätte!«
»Opa hat ins Bett gepiescht, Opa hat ins Bett gepiescht«, sangen wir im Chor, und dann flitzten wir, um ihren Schlägen zu entgehen.
»Macht euch nicht über euren Großvater lustig«, ermahnte sie uns, wenn ihr Zorn verraucht war, »der kann nichts dafür. Der hat einiges hinter sich.«
Damit gaben wir uns nicht zufrieden. Was genau er denn hinter sich habe, wollten wir wissen, woher und warum überhaupt er so plötzlich gekommen sei und ob er jetzt etwa ewig bei uns bliebe.
»Das hat euch nicht zu interessieren«, war Mutters Antwort, »es ist eben, wie es ist. Ich erklär’s euch, wenn ihr älter seid.«
Doch für eine Erklärung wurden wir nie alt genug.
Bald gewöhnten wir uns an das neue Familienmitglied, bald war es so, als wäre er immer bei uns gewesen. Opa störte nicht weiter, außer dass er Platz wegnahm. Stundenlang konnte er vor Radio oder Fernseher sitzen und auf die modernen Zeiten schimpfen. Bald wurde er auch ein gern gesehener Gast unten in der Eckkneipe, wo er die anderen Nachbarn mit Tagesfreizeit unterhielt.
Wir hatten im Handumdrehen raus, wie wir ihn auf Hundertachtzig bringen konnten. Wir mussten uns nur scheinheilig erkundigen, was eigentlich mit Oma sei, und er drehte durch. »Dieses verfluchte Luder!«, brüllte er. »Ein Segen, dass ich sie los bin.«
Torpedierten wir ihn weiter mit Fragen, grummelte er böse vor sich hin. Wurde es ihm zu viel, beschwerte er sich bei Mutter über ihre missratene Brut, woraufhin die beiden stets in Streit gerieten, den Opa mit seinem Totschlagargument beendete: »Vier Kinder von vier verschiedenen Vätern. Sodom und Gomorrha! Das wird alles böse enden.«
Die Sache mit den vier Vätern ließ uns Jungs kalt, für uns war Mutter die Sonne, um die wir kreisten. Wie Meteoriten, die vom Himmel fielen und weiter keinen Schaden anrichteten, schlugen unsere Erzeuger ab und an bei uns ein. Sie gingen mit uns in den Zoo, ins Kino oder sonst wohin, je nachdem, was ihren eigenen Vorlieben und ihren eher vagen Vorstellungen davon, was Kinder lieben, am ehesten entsprach.
Philipps Vater nervte, ein vergeistigter Oberstudienrat, der in einer schwachen Stunde Mutters nicht unerheblichem Charme erlegen war. Beseelt von einem diffusen Bildungsauftrag, schleppte er uns vier – artig Mutters Vorgabe »Alle oder keiner« folgend – ungezählte Male ins Museum für Hamburgische Geschichte. Da standen wir dann vor Störtebekers Schädel und ertrugen nasebohrend seine einfallslosen Piratengeschichten.
Mein Vater war nicht viel besser. Ein einsilbiger Trucker, den Mutter in den sechziger Jahren kennengelernt hatte, als sie zu einem Hippie-Festival nach Frankreich trampte. Er war grobschlächtig, ungehobelt und roch nicht besonders gut. Bis heute habe ich keine Ahnung, was Mutter, die so hübsch und so klug war, damals in ihm sah. Bei seinen sporadischen Stippvisiten brachte er mir amerikanische Country-Platten mit, eine Musik, die ich schon als Kleinkind ablehnte. Außerdem stand er Mutters Bestreben, dass aus uns Jungs etwas Besseres werden sollte, skeptisch gegenüber. Als ich von der Grundschule aufs Gymnasium wechselte, verschwand er für ein gutes halbes Jahr, so sauer war er.
Jakobs Vater ließ uns in Ruhe. Er saß im Vorstand eines Hamburger Pharmakonzerns, wohnte mit Frau und Töchtern in Wellingsbüttel und hielt sich Mutter eine Zeit lang als Geliebte. Als sie schwanger wurde, tauchte er panisch ab. Doch er war der Einzige, der regelmäßig und reichlich für seinen Sohn zahlte.
Am Amüsantesten war Simons Papa, ein kohlschwarzer Brite, den es als mittellosen Musiker in den Siebzigern nach Deutschland verschlagen hatte, außer den wilden schwarzen Locken hatte er seinem einzigen Nachkommen nichts zu vererben. Er zog mit uns durch verräucherte Jazz-Kneipen, in denen der Tag zur Nacht wurde. Stundenlang umfing uns sein trauriges Saxofon-Gejaule, und wir nuckelten zufrieden an unserer Cola, die zu Hause verboten war.
Mutter war um Strenge bemüht, ihre Erziehungsmethoden konnte man durchaus robust nennen. Wenn wir nicht spurten, verteilte sie Hiebe auf den Hinterkopf. Dabei war es ihr egal, ob sie den Richtigen traf. Meistens steckten wir alle ein, wenn sie in Rage war.
Wir waren berüchtigt im ganzen Viertel. Und das wollte in der Hochhaussiedlung am Osdorfer Born, deren Bewohner Kummer gewohnt waren, etwas heißen. Wir waren eine Gang, lange bevor man dieses Wort überhaupt kannte. Schlenderten wir zu viert, möglichst breitbeinig, über den Bürgersteig, wechselten unsere Nachbarn die Straßenseite. Wir trugen die Haare lang und verfilzt, unsere Jeans waren trotz Mutters ständiger Flickversuche löchrig, über unseren schmalen Schultern hingen schwere schwarze Lederjacken, die uns mit der Aura der Unbesiegbaren umgaben. Letztere waren eines der seltenen Geschenke von Simons Vater. Als er sie stolz überreichte, raunte er verschwörerisch, sie seien »vom Laster gefallen«. Eine Tatsache, die ihren Besitz für uns umso wertvoller machte.
Mit wiegenden Schritten durchmaßen wir nach der Schule den Born, auf der Suche nach ein wenig Ärger, der uns stets fand. Simon, der Kleinste, immer vorneweg, großspurig zog er alle paar Minuten seine Nase hoch und spie den Schnodder auf den Gehweg, er litt zu seinem Glück an einer chronischen Sinusitis, sodass ihm immer genügend Munition zur Verfügung stand. Philipp, der Zweitjüngste, dann Jakob und ich, der Älteste, dicht hinter ihm, geschickt den Rotzfladen ausweichend. Es gelang uns nicht immer.
Aus der Ferne muteten wir wahrscheinlich an wie die sprichwörtlichen Orgelpfeifen. Mutter hatte es irgendwie geschafft, uns in ziemlich exakten Zweijahresabständen auf diese Welt zu werfen. Und dann hatte sie uns diese merkwürdigen Namen gegeben. Zu unserer Zeit hießen Jungs Thomas, Bernd, Andreas oder Jürgen. Aber Johannes, Jakob, Philipp und Simon?
Wir wussten, dass sie uns nach den Aposteln benannt hatte. Das machte uns eine Zeit lang Angst. Mutter war zwar belesen, aber bei Gott nicht das, was man fromm nannte. Eine Kirche hatte keiner von uns je von innen gesehen. Was sollte dieser Apostel-Scheiß? Wir waren nur vier. Sollten etwa noch acht weitere folgen?
Mutter war alles zuzutrauen. Zumal wir in regelmäßigen Abständen ihre neuen »Bekannten« kennenlernten. Männer, die sie abends abholten und kurz den Kopf ins Wohnzimmer schoben, um verkrampft ein »Schönen guten Abend allerseits« oder ein »Na, Jungs, alles okey dokey?« loszuwerden. Wir schwiegen sie an und starrten in fragende Gesichter, die wir uns gar nicht erst einprägten.
Opa, als er schließlich bei uns wohnte, versuchte dagegen, die wechselnden Herren in ein Gespräch zu verwickeln, das jedes Mal mit der Frage »Was machen Sie denn beruflich?« begann und mit »Haben Sie eigentlich gedient?« endete. Die Typen verschwanden schneller als gewöhnlich aus unserem Leben. So gesehen war Großvater ein echter Zugewinn für uns.
Mir als Ältestem fiel die lästige Aufgabe zu, mich nach seinem überraschenden Einzug um ihn zu kümmern. Kümmern bedeutete, dass ich jeden Tag großkotzig zum Kiosk schlawinerte und fünf Halbe und zwei HB orderte. Ohne seine Zigaretten war Opa ungenießbar, ohne sein Bier wollte er nicht einschlafen. Die allabendlich genossenen zweieinhalb Liter Flüssigkeit machten die Sache mit der Inkontinenz nicht besser. Also zwang mich Mutter, Windeln zu besorgen. Die Apotheken im Viertel mied ich, lieber setzte ich mich einmal in der Woche in den Bus und fuhr ganz raus bis nach Wedel. Mir war es gleich, dass die Leute über uns redeten. Nicht egal war, was sie sagten. Ich wollte nicht, dass wir als eine Familie der Bettnässer in die Annalen des Born eingingen.
Meine Ausflüge, die anfangs einzig dem Zweck dienten, den Ruf der Meinen zu wahren, verselbstständigten sich, als ich Sabine kennenlernte. Sie arbeitete als Verkäuferin in dem Lebensmittelgeschäft neben der Wedeler Apotheke, trug ihr blondes Haar wie Farah Fawcett in Drei Engel für Charlie, tief ausgeschnittene Oberteile und Jeans, die oben atemraubend eng und unten mit einem gewaltigen Schlag versehen waren.
Mit fadenscheinigen Fragen versuchte ich, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, und lungerte im Kassenbereich herum, bis mich der Ladenbesitzer aus seinem Markt schmiss, weil er argwöhnte, dass ich doch nur etwas klauen wollte. Sabine nahm weiter keine Notiz von mir. In ihren Augen lagen wahrscheinlich Welten zwischen uns – sie eine berufstätige Frau mit besten Aussichten und ich nur ein pubertierender Rotzlöffel.
Eines Nachmittags versuchte ich, sie nach Ladenschluss abzupassen, und beobachtete im Schutz einer Litfaßsäule den Eingang des Supermarkts. Im Geiste malte ich mir aus, wie ich lässig auf sie zuschlendern und überrascht tun würde, sie zu treffen. Souverän und männlich würde ich sie in ein Gespräch verwickeln, sie sich verlegen eine lange Strähne hinter das Ohr streichen und mit einer leichten Röte auf den Wangen meine Einladung in die lokale Eisdiele annehmen.
Während ich noch überlegte, ob es wohl zu aufdringlich von mir wäre, gleich bei der ersten Verabredung den großen Malaga-Becher mit ihr zu teilen, trat Sabine aus dem Geschäft und blickte suchend umher. Mit schwitzigen Händen stolperte ich auf sie zu und öffnete den Mund. Heraus kam lediglich ein verzweifelt gekrächztes »K-k-kann …«. Sabine musterte mich verächtlich von oben bis unten, warf ihre Haare nach hinten und ging einfach weiter, bevor ich mich fassen konnte.
Sie strebte um die nächste Ecke, ich spurtete hinterher und sah gerade noch, wie sie einem Typen mit Löwenmähne und pompösem Schnauzer um den Hals fiel, bevor sie zu ihm auf sein frisiertes Moped stieg und die beiden davonknatterten. Aus, schoss es mir durch den Kopf, mit Sabine ist es aus. Endgültig. Ich beschloss, die Finger von den Weibern zu lassen, mich höheren Aufgaben zu widmen, und arbeitete meine feuchten Fantasien an den Foto-Lovestorys der Bravo ab. Geschichten wie Petra spielt mit dem Feuer nährten allerdings meine vage Hoffnung, eines fernen Tages doch noch zum Schuss zu kommen.
Jakob, jünger als ich, hatte mehr Glück bei den Frauen. Schon als er klein war, umgab ihn eine aristokratische Aura, seine Augen waren blauer als blau, seine Haare blonder als blond. Auch wenn er sich wie ein zufriedenes Schwein im Dreck suhlte, blieb er stets sauberer als wir anderen und war das bevorzugte Opfer älterer Damen, die ihm auf der Straße begeistert in die Wange kniffen und Bonbons zusteckten.
Ich schoss in der Pubertät lediglich in die Höhe, verpickelte großflächig und kämpfte mit langen, dürren Gliedmaßen. Mein Stimmbruch setzte spät ein und dauerte quälende zwei Jahre, in denen sich meine Zunge immer öfter um die Konsonanten schlang und ich ein schönes Stottern entwickelte.
Jakob wuchs langsam, aber stetig und proportional ausgewogen, bekam breite Schultern und quasi über Nacht einen dunklen, sonoren Bass. Alle Mädchen in der Nachbarschaft verzehrten sich nach ihm. Schon mit zehn besaß er eine beachtliche Sammlung an Liebesbriefen und zerknüllten Zetteln: »Willst du mit mir gehen? Kreuze an!« Mit zwölf hatte er eine derart herausgehobene Position, dass er einen Groschen pro Zungenkuss fordern konnte und seine Klassenkameradinnen Schlange standen. Mit vierzehn schleppte er Woche für Woche eine neue Auserwählte an, er brach die Herzen reihenweise, eine Angewohnheit, die er für immer beibehalten sollte.
Zwar trug ich als Erstgeborener offiziell die Verantwortung für meine Brüder und wurde deshalb im Zuge der Sippenhaft auch immer vor allen anderen zur Rechenschaft gezogen, wenn wir gemeinschaftlich etwas angestellt hatten. Jakob jedoch war unser heimlicher Herrscher, er dirigierte, und wir tanzten nach seinem Takt wie Marionetten an unsichtbaren Fäden. Er heckte die tollkühnsten Pläne aus, Philipp und Simon folgten blind, und ich redete mir ein, dass ich nur mitzog, um meine Brüder vor größerem Schaden zu bewahren.
Gerade Simon musste beschützt werden, vor den anderen Jungs des Viertels, aber besonders vor sich selbst. Er war nicht nur der Jüngste, er war auch der Zarteste, sein unbändiges Gestrüpp dunkler Haare und der dunkle Teint beliebtes Ziel diverser Spötteleien. »Negerblag, Negerblag«, schallte es hinter ihm her, wagte er sich allein auf die Straße. Dann wurde sein Gesicht blass, mit dem Mut des Irrsinns stürzte er sich auf die Rufenden und drosch auf sie ein, bis mindestens einer blutete.
Meist blutete Simon, denn ihm war es gleich, dass seine Feinde größer, stärker und älter waren. Er geriet bei diesen Schlägereien völlig außer sich, stieß hohe, spitze Schreie aus wie ein gequältes Tier und zitterte noch Stunden später am ganzen Körper. Uns Großen machten diese Anfälle Angst, insgeheim mutmaßten wir, Simon habe Mutters Makel geerbt. Keiner sprach diese Sorge jemals offen aus, aber jeder las sie in den Blicken der anderen.
Da nicht sein konnte, was nicht sein durfte, erzählten wir Mutter nichts von Simons merkwürdigem Verhalten. Immer und immer wieder dachte ich mir neue Ausreden für seine Verletzungen aus: von der Schaukel gefallen, gestolpert, beim Fußball gefoult. Sie nickte dann nur, verband seine Wunden, drückte ihm einen Kuss auf die Stirn und trank – »Der ist gut für meine Nerven und den Blutdruck, Kinder!« – vorsichtshalber einen Asbach-Cola.
Philipp war derjenige, der Mutters medizinische Weisheit früh verinnerlichte. Dabei war mit seinen Nerven eigentlich alles in Ordnung. Er war der Ruhigste und Unauffälligste von uns, außerdem ab der ersten Klasse ein Einserschüler, ein wissbegieriges Kind. Mit acht Jahren nippte er zum ersten Mal heimlich an Mutters Branntwein, um herauszufinden, welche Wirkung dieses stinkende Gesöff auf den menschlichen Körper hatte. Nach zahlreichen Selbstversuchen hatte er mit zehn seinen ersten Vollrausch. Stundenlang suchte ich nach ihm und fand ihn schließlich, in seinem Erbrochenen liegend, neben einem Gebüsch auf dem Spielplatz. Danach lernte er schnell, seine Arznei richtig zu dosieren.
Vielleicht war Philipp gerade wegen des Alkohols ein so stillvergnügter und ausgeglichener Junge. Uns Brüdern war das egal, wir schätzten ihn, weil er uns mit seinen subtilen Scherzen zum Lachen brachte, und bewunderten ihn für seine Klugheit. So mancher Raubzug wurde zwar von Jakob erdacht und vorgeschlagen, die clevere Umsetzung der Pläne entsprang aber oft Philipps kühnem Hirn.
Natürlich wurden wir auch erwischt, wenn wir etwa die Geldkassetten der Zeitungsständer knackten oder Fahrräder aus den Kellerverschlägen stahlen. Aber unsere Erfolgsquote lag bei sagenhaften siebzig Prozent, Philipp rechnete es uns vor. Und das war weit mehr, als alle anderen am Born vorweisen konnten.
Wegen der anderen dreißig Prozent kam in unregelmäßigen Abständen Frau Beinlich vorbei, eine ältere Dame von der Fürsorge. Da sie ihren Besuch stets Tage vorher anmeldete, fand sie niemals etwas, das sie tatsächlich beanstanden konnte. Wir hatten genügend Zeit, die Wohnung aufzuräumen, wir bürsteten uns sogar und zwangen Großvater in seinen einzigen Anzug, wir hängten Mutter eine Schürze um und versorgten sie reichlich mit Pfefferminzbonbons.
Frau Beinlich saß in der Küche, auf dem Resopaltisch standen Kaffee und Kuchen bereit, milde lächelnd sah sie auf uns herab und strich bevorzugt Jakob über sein glänzendes Haar. »Sie haben es aber auch nicht leicht, so ganz allein mit vier Jungs«, seufzte sie dann.
Mutter schlug die Augen nieder und nickte bekümmert, Großvater räusperte sich und sagte: »Ich helfe, wo ich kann. Aber ich bin nicht mehr der Jüngste, Sie verstehen …«
Was uns wirklich rausriss, waren unsere Noten. Philipp war zwar der Überflieger, aber auch wir anderen drei beeindruckten mit guten Zeugnissen, alle gingen wir irgendwann aufs Gymnasium und sollten Abitur machen. Alle versprachen wir Frau Beinlich, uns zu bessern und unserer Mutter keine Schande mehr zu bereiten. Frau Beinlich war jedes Mal zufrieden und stellte eine günstige Sozialprognose. Bis zu ihrem nächsten Besuch.
So lebten wir am Born, mit unseren Schatten-Vätern, unserem bettnässenden Großvater und unserer im Leben schwankenden Mutter. Wir lebten nicht schlecht. Wir Jungs fanden, es hätte kein besseres Leben für uns geben können, kannten wir doch kein anderes.
Bis ich achtzehn wurde. Einen Tag nach der Vollendung meiner Volljährigkeit legte sich Mutter mit einem Gläschen ihres geliebten Asbach-Colas in die Badewanne und schnitt sich die Pulsadern auf. Als hätte sie beschlossen, dass es nun gut war. Dass sie alles getan hatte, um uns auf den richtigen Weg zu bringen. Und dass nun jemand anderes dran war, für das Weitere zu sorgen.
2008
»K-k-kann, k-k-kann …«
»Johannes?« Jakobs Stimme am Telefon klingt ungeduldig. »Um Himmels willen, hör auf zu stottern! Ist was mit Simon?«
»Nnn-nn …, nn-nnein«, antworte ich. »K-k-kann …«
»Okay, atme tief durch und dann spuck’s aus. Ich hab nicht ewig Zeit, ich muss ins Meeting.«
So ist er, mein Bruder, empathisch wie immer. Nein, niemand kann Jakob nachsagen, dass er zur Gefühlsduselei neigt.
Ich atme durch und nehme einen neuen Anlauf. »K-kannst du nach Hause kommen? G-g-großvater ist g-gestorben.«
Jakobs Antwort ist Schweigen.
»Scheiße«, sagt er schließlich, »das passt jetzt gar nicht.«
»Sorry für das schlechte T-t-timing. K-k-kommt nicht wieder vor.«
»Deinen Sarkasmus kannst du dir sparen. Du hast keine Ahnung, was hier gerade los ist. Ich steh kurz vor der Übernahme, das ist wirklich der beschissenste Zeitpunkt, den der Alte sich aussuchen konnte!«
»K-k-kommst du?«
»Natürlich komme ich. Was ist mit Philipp?«
»Schon unterwegs.«
»Und Simon?«
»Weiß es n-n-noch nicht.«
»Sieh zu, dass du’s ihm schonend beibringst. Ruf ihn nicht an, fahr hin.«
»Ja.«
»Ich buch den nächsten Flieger. Morgen bin ich da. Und Johannes, krieg das mit deinem Stottern wieder in den Griff. Das ist ja fürchterlich«, sagt er noch und legt auf.
Ich habe die Sache mit meinem Stottern im Griff. Diverse Logopäden habe ich in drei Jahrzehnten verschlissen, um meiner Zunge meinen Willen aufzuzwingen. Mittlerweile gehorcht sie mir. Es sei denn, es passiert etwas Unvorhergesehenes. Dann führt sie ihr Eigenleben. Zum Glück kommt das selten vor.
Ich achte peinlich darauf, dass mein Leben möglichst gleichförmig verläuft, ohne besondere Höhen und Tiefen. Alle, die mich oberflächlich kennen, halten mich für einen schweigsamen, hartgesottenen Burschen, der allein, aber zufrieden seine Kreise zieht. Typ einsamer Wolf. Bei Frauen kommt dieses Klischee erstaunlicherweise gut an. Und kaum eine habe ich jemals so weit an mich herangelassen, dass sie den armseligen Stotterer hinter der coolen Fassade entdecken konnte.
Gestern geschah das Unvorhergesehene. Am Morgen rief mich die Leiterin des Pflegeheims an. Friedlich eingeschlafen sei unser Großvater, so sagte sie, was für ein Segen.
Ich glaubte ihr kein Wort. Friedlich war für unseren Großvater ein Fremdwort, schon bevor sich der Nebel in seinem Kopf verdichtet hatte. Seine Neigung zur Renitenz verschlimmerte sich, als er an Alzheimer erkrankte. Andere Demente vergaßen erst Namen und dann Menschen und kehrten in ihre Vergangenheit zurück, in der sie still vor sich hin vegetierten. Auch Opa wurde mehr und mehr von Flashbacks heimgesucht. Anders als die anderen Patienten in seinem Heim erzählte er aber keine wirren Geschichten, aus denen wir uns einen Reim hätten machen können auf das, was er durchlebte. Zum Schluss saß er tagsüber nur noch da, gab gutturale Laute von sich, sein Körper bretthart in einem einzigen Krampf, die Augen geweitet. Nachts hatte er Albträume. Meist wurde er dann sediert und an seinem Bett fixiert. Zu seiner eigenen Sicherheit, wie das Personal auf der Station betonte. Ich nahm aber an, dass die Pfleger einfach mal ihre Ruhe haben wollten.
Gegen Mittag erreichte mich der zweite denkwürdige Anruf des Tages. Eine hohe, brüchige und alte Stimme fragte: »Johannes?«
»Ja, bitte?«, antwortete ich irritiert, da mir diese Stimme nicht vertraut war, der dazugehörige Mensch mich aber offensichtlich so gut kannte, dass er als Anrede meinen Vornamen wählte.
»Johannes, mein Name ist Friedrich Löwe, ich bin der Anwalt Ihres Großvaters. Zunächst möchte ich Ihnen mein tief empfundenes Beileid aussprechen.«
»D-d-danke«, stammelte ich. Opa hatte niemals einen Anwalt gebraucht. Wofür denn auch? »Entschuldigung, wer sind Sie g-g-genau?«
»Friedrich Löwe, der Anwalt Ihres verstorbenen Großvaters«, wiederholte die Stimme geduldig. »Ich möchte Sie bitten, in meine Kanzlei zu kommen. Zur Testamentseröffnung.«
»T-t-testament?« Opa hatte nichts zu vererben. Das wenige Ersparte war neben der mageren Rente in den letzten Jahren für seine Pflege draufgegangen, und es hatte bei Weitem nicht gereicht, um die Kosten zu decken.
»In der Tat, der gute Heinrich hat bei mir sein Testament hinterlegt. Ist Ihnen kommenden Montag recht? Um sechzehn Uhr? Bis dahin sollte es auch Jakob aus London nach Hamburg schaffen. Was meinen Sie?«
»Ja.«
»Gut. Und Johannes, es ist von großer Wichtigkeit, dass Sie alle vier erscheinen. Auch Simon. Hören Sie?«
»Ja.«
»Gut. Dann bis Montag. Auch wenn der Anlass traurig ist, freue ich mich doch, Sie alle kennenzulernen. Heinrich hat früher immer viel von Ihnen erzählt.« Und mit diesen Worten beendete er das Gespräch.
Zunächst glaubte ich, irgendein dummes Arschloch hätte sich einen noch dümmeren Scherz erlaubt. Aber welches Arschloch kannte uns alle und wusste zudem, dass Jakob gerade in London war? Mir fiel niemand ein. Woher hatte dieser Mensch meine Büronummer, und wie hatte er überhaupt so schnell von Opas Tod erfahren?
Ich ging zu meinem Chef, erklärte, dass ich einen Todesfall in der Familie hätte, verabschiedete mich aus der Redaktion und fuhr nach Hause.
Seitdem hocke ich in meinem Arbeitszimmer und versuche, etwas über Friedrich Löwe herauszufinden. Ich gab die spärlichen Informationen bei Google ein und landete einen Treffer – Kanzlei Löwe und Hahn in der Heimhuder Straße. Ich klickte auf die Homepage und betrachtete die Seite, die mehr als übersichtlich gestaltet war. Der Name der Kanzlei, ihrer Inhaber – Friedrich Löwe und Hubertus Hahn –, die Anschrift, eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, mehr stand dort nicht. Keine Angaben über die Rechtsgebiete, auf die man sich spezialisiert hatte, keine Vita, keine Fotos, keine weiterführenden Links.
Ich rief in der Kanzlei an, mehrmals. Dort lief nur ein Band mit der Ansage, dass man bitte deutlich Namen und Nummer hinterlassen solle, man werde sich umgehend melden. Das habe ich getan. Danach wählte ich die Nummer der Hamburger Anwaltskammer und die eines mir gut bekannten Richters. Nirgendwo bin ich auf etwas Erhellendes gestoßen, niemand konnte mir helfen, die Kanzlei hat nicht zurückgerufen. Friedrich Löwe bleibt ein unbeschriebenes Blatt.
Gedankenverloren starre ich aus dem Fenster auf die Rote Flora gegenüber, als mich die Klingel zusammenzucken lässt. Es muss Philipp sein. Ich drücke den Summer. Es dauert ein wenig, bis er die vier Stockwerke des Altbaus überwunden hat. Keuchend steht er vor mir im Flur, lässt seine Reisetasche fallen und nimmt mich kurz in den Arm.
»Johannes, wie geht es dir?«
»G-g-gut so weit. Und d-d-dir?«
»Alles okay«, antwortet er zerstreut, und nur die Andeutung eines Stirnrunzelns zeigt mir, dass ihm mein Stottern nicht entgangen ist. »Ein bisschen abgespannt vielleicht. Ich hatte heute Morgen noch eine OP, sechs Stunden. Hast du was zu trinken für mich?«
»K-k-kaffee?«
»Kaffee? Wenn’s sein muss …« Er grinst schief und geht voran in die Küche.
Ich folge ihm und sehe, dass sein kurzes graues Haar am Hinterkopf schon ziemlich ausgedünnt ist. Während ich die Espressomaschine in Gang setze, erzähle ich ihm, dass Jakob erst morgen kommt und dass ein Anwalt angerufen hat, den wir am Montag treffen sollen.
»Komische Geschichte«, murmelt er. »Und was ist mit Simon? Warst du schon bei ihm?«
»Nein. Ich d-d-dachte, wir machen d-d-das zusammen.«
»Oh.« Philipp zieht die Luft ein und betrachtet ausgiebig seine feingliedrigen Chirurgenhände. Er hat einen leichten Tatterich. »Okay, ist wahrscheinlich besser. Wer weiß, wie er reagiert. Hast du Opa noch einmal gesehen, bevor er …«
»Vor zwei Wochen. Er hat mich n-n-nicht erkannt. Wie immer.«
»Okay.« Philipp verstummt. Ich gieße ihm Kaffee ein, er steht wortlos auf und nimmt die Flasche Osbourne aus dem Regal, aus der er sich großzügig einschenkt. Nach dem zweiten Kaffee werden seine Hände langsam ruhiger.
Wir reden über Belanglosigkeiten: die Arbeit, das Wetter, Politik, alte, gemeinsame Bekannte. Später am Abend schlendern wir zum Portugiesen um die Ecke, essen Tapas und trinken drei Flaschen Wein. Der Alkohol lockert meine Zunge, auf einmal kann ich mich wieder verständlich artikulieren, und wir reißen dämliche Witze über Stotterer.
Gegen Mitternacht gehe ich mit ziemlicher Schlagseite ins Bett. Philipp verschwindet mit der Flasche Osbourne im Gästezimmer.
»Ankunft 9.35, Terminal 2. Hol mich ab!«
Die Buchstaben der SMS verschwimmen vor meinen Augen, mein Blick wandert zur Uhr. Es ist acht. Ächzend wuchte ich mich aus dem Bett und schlurfe in die Küche. Philipp ist längst wach und frisch geduscht. Er hat Brötchen geholt und den Frühstückstisch gedeckt.
»Jakob landet b-b-bald. Wir sollen ihn vom Flughafen abholen.«
Philipp verdreht die Augen. »Warum kann der sich kein Taxi nehmen?«
»Der Herr verlangt ein Begrüßungskomitee, du k-k-kennst ihn doch.«
»Schläft er auch hier?«
»K-k-keine Ahnung, glaube ich aber nicht. Er hat bestimmt irgendwo irgendeine Suite gebucht.«
Nach dem Frühstück fahren wir in meinem alten Mercedes-Coupé zum Flughafen. Der Flieger aus Heathrow ist pünktlich, Jakob eilt als einer der Ersten aus dem Sicherheitsbereich heraus. Er hat wie üblich nur Handgepäck, fehlt ihm etwas, wird er es einfach kaufen. In seiner Bugwelle schwimmt ein ätherisches Wesen im knapp sitzenden Kleid, auf hohen Hacken versucht die junge Dame, mit ihm Schritt zu halten.
»Das kann doch nicht wahr sein«, stöhnt Philipp neben mir leise. »Da schleppt er eine seiner Bettgeschichten mit! Guck dir die mal an! Könnte glatt seine Tochter sein …«
»Neidisch?«
»Pfff …«
Eine Hand in der Hosentasche, die andere am Rollkoffer, kommt Jakob grinsend auf uns zu. Er baut sich vor uns auf, mustert uns kurz und nickt. »Phil. Joe«, sagt er knapp zur Begrüßung, das muss reichen und soll wohl gleichzeitig die Aufforderung sein, uns in Gang zu setzen, denn er wendet sich schon dem Ausgang zu.
»Willst du uns nicht vorstellen?«, fragt Philipp mit einem Blick auf Jakobs Begleitung.
»Natürlich, sorry. Meine Herren, das ist Amy, meine neue Assistentin. Und nein, ihr braucht euch den Namen nicht zu merken. Nächste Woche schmeiß ich sie wieder raus. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Spaß zusammen.« Er tätschelt Amys Hintern. »Sie bläst wie der Teufel …«
Als er unsere versteinerten Mienen sieht, fügt er hinzu: »Keine Sorge, Amy versteht kein Wort Deutsch. So, und jetzt raus hier. Wo hast du deine Schrottkarre geparkt?«
»D-d-das ist ein Oldtimer, ein echtes Ll-ll-ll …«
»… Liebhaberobjekt, ja, ich weiß. Verdammt Johannes, was ist los mit dir? Warum stotterst du wieder? Und wo steckt eigentlich Simon?«
»N-nn-n, n-n-nn …« Das sind zu viele Fragen auf einmal für den Knoten in meiner Zunge, Philipp springt ein. »Herrgott, Jakob, lass ihn in Ruhe. Großvater ist tot. Das müsste doch als Erklärung reichen. Kann ja nicht jeder so ein dickes Fell haben wie du.«
»Wo steckt Simon?«, wiederholt Jakob ungerührt.
»Simon weiß noch nichts.«
Für eine Sekunde verhärten sich Jakobs Sunnyboy-Züge. »Ich dachte, du hast das schon erledigt.«
»Nn-nn-n …«
»Schon gut. Dann fahren wir eben alle zusammen zu ihm. Und zwar jetzt sofort.«
Ich verstaue das Gepäck im Kofferraum und frage Jakob: »Welches Hotel?«
»Atlantic. Aber wir checken später ein. Erst zu Simon.«
»Du willst Amy doch nicht mit zu Simon nehmen?«, interveniert Philipp.
»Die stört nicht weiter«, bestimmt Jakob.
Ich steuere den Wagen aus der Stadt auf die A1 Richtung Lübeck. Philipp sitzt neben mir und starrt aus dem Fenster. Auf der Rückbank turteln Amy und Jakob. Die Ausfahrt Bad Oldesloe kommt schneller, als mir lieb ist. Nur noch zwanzig Kilometer bis zu Simon. Er lebt auf dem Land, umgeben von Wald und Weiden, vielen Kühen und wenig Menschen.
Offiziell ist Simon Künstler, er fertigt Skulpturen aus Stein und Metall, manchmal malt er auch. Seine Arbeiten kann man durchweg als abstrakt bezeichnen, jedenfalls fällt es schwer, irgendetwas darin zu erkennen, Formen schon gar nicht, auch der Sinn bleibt verborgen. Trotzdem hat er eine Galeristin in Hamburg, der es gelingt, ab und an eines seiner Ungetüme an den Mann zu bringen.
Ich biege von der Landstraße ab auf einen kleinen Feldweg, der direkt zu Simons Gehöft führt. Mein Mercedes rumpelt über das Kopfsteinpflaster der Einfahrt, ich parke vor der Scheune. Einen Augenblick rührt sich keiner von uns, selbst Amy sitzt ganz still, die gespannte Stimmung ist ansteckend.
»Auf geht’s«, sagt Jakob schließlich. »Bringen wir’s hinter uns.«
In diesem Moment öffnet sich die Tür der Scheune, die als Atelier dient. Ania kommt heraus und schaut uns erstaunt an. Sie ist Simons polnische Haushälterin, sie kocht, sie putzt, sie kauft ein und kümmert sich um alles, zu dem er keine Lust und Nerven hat. Außerdem ist sie examinierte Krankenschwester. Sie weiß, was zu tun ist, wenn es Simon nicht gut geht.
Ania lebt auch auf dem Hof, sie ist vierundzwanzig Stunden am Tag in Bereitschaft. Nur zwei Mal im Jahr fährt sie für ein paar Wochen zu ihrer Familie nach Stettin. Dann kommt ihre Freundin Agnietzka als Urlaubsvertretung.
Wir lassen uns Simons Rundumversorgung etwas kosten, Ania bekommt ein fürstliches Gehalt für ihren Einsatz. Sie ist allerdings auch die Einzige, die es bisher länger mit Simon ausgehalten hat. Wahrscheinlich liegt das an ihrem stoischen Naturell.
Sie stellt keine überflüssigen Fragen, sondern deutet schlicht auf das Haupthaus. »Euer Bruder ist in Küche.« Dann geht sie voran und ruft: »Simon, Besuch!«
Unser Bruder ist hocherfreut, uns zu sehen. Er sitzt am Tisch und liest in einem Buch, als wir eintreten. Jetzt springt er auf und fällt uns allen nacheinander um den Hals, auch Amy. »Alter Schwede, was macht ihr denn hier? Warum habt ihr nicht angerufen, dass ihr kommt? Ania hätte was zu essen gemacht!«, sagt er und lacht. Er sieht gut aus, seine langen Locken trägt er zu einem Zopf tief im Nacken gebunden, dank der frischen Landluft hat sein Gesicht noch mehr Farbe als üblich.
Als er mich in seine Arme schließt, erdrückt er mich fast. Simon hat Kraft, die bekommt man wohl, wenn man täglich stundenlang wie besinnungslos auf Steine einhämmert und Metall schmiedet. Und er hat einen guten Tag, das sehe ich sofort, seine braunen Augen sind klar.
Ania fängt an, Kaffee zu machen und Brote zu schmieren. Jakob, Amy und ich setzen uns zu Simon an den Tisch, Philipp nestelt am Kühlschrank herum. Ich muss gar nicht hinschauen, ich weiß, was er macht. Er sucht die Ampullen mit dem Lorazepam und wird vorsichtshalber eine Spritze aufziehen. Ich nehme Simons Hand und sage: »G-g-großvater, w-ww-w …« Dann breche ich ab.
»Opa ist tot«, erklärt Jakob kurz und bündig.
Unwillkürlich halten wir die Luft an.
Einen Augenblick lang schweigt Simon. »Aha«, meint er schließlich und zuckt die Schultern, »und deshalb seid ihr extra hergekommen? War doch klar, dass der Alte es nicht mehr lange macht.« Dann beißt er ungerührt in eine Wurststulle. Sein Blick ist immer noch klar.
Jakob und Philipp atmen hörbar und erleichtert aus. Ich dagegen bleibe weiter auf der Hut. Das war zu einfach, viel zu einfach.
Auf der Rückfahrt nach Hamburg hat sich Simon zwischen Jakob und Amy gequetscht, vertrauensvoll nimmt er ihre Hand und hält sie fest. Manchmal spielt er gern den Irren und macht einen auf ganz zutraulich wie ein kleines, verschmustes Tierchen. Er kann aber auch mal zuschnappen. Wie Amy dieses Tierchen, das jetzt auch noch an ihrem Hals schnuppert, findet, lässt sie sich nicht anmerken. Jedenfalls versucht sie nicht, sich aus Simons Klammergriff zu befreien. Vielleicht hat Jakob ihr auch erzählt, dass sein jüngster Bruder manchmal etwas merkwürdig ist und man ihm dann besser nicht blöd kommt.
Wir haben Ania eröffnet, dass Simon wegen Großvaters Tod mit nach Hamburg muss und dass wir ihn gegen Ende der Woche wohlbehalten wieder bei ihr abliefern werden. Simon ist von der Idee begeistert, das ist ihm anzusehen. Vergnügt wippt er mit den Füßen und summt ein Lied. Ania allerdings hält diesen Ausflug für eine Schnapsidee.
»Ist nicht gut für Bruder«, erklärte sie uns, als Simon aus der Küche gegangen war, um seine Sachen zu packen. »Zu viel Aufregung.«
»Wir passen schon auf ihn auf«, sagte Jakob. »Mach dir mal keine Sorgen.«
»Bist du ruhig!«, fuhr Ania ihn an. »Bist du nie da. Weißt du nicht, wie geht es Bruder.«
Jakob sagte tatsächlich kein Wort mehr, Ania hat etwas sehr Resolutes – und sie hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie diesen Londoner Banker für einen überheblichen, oberflächlichen Schnösel hält.
»Ich war lange nicht mehr in der Stadt«, sagt Simon nun aus dem Fond heraus. »Ziehen wir heute ein bisschen um die Häuser? So wie früher, alle zusammen?«
Philipp und ich wechseln einen schnellen Blick.
»Klar, warum nicht?«, antwortet Jakob leichthin, bevor einer von uns beiden reagieren kann. »Wir liefern Amy im Hotel ab und machen uns einen flotten Abend. So wie früher.«
Ich merke, wie ein Kribbeln in mir aufsteigt, ein Gefühl der Vorfreude. So wie früher. Warum nicht? Was soll schon groß passieren?
Ich beschleunige den Mercedes auf hundertachtzig Sachen und grinse Philipp an. Er grinst zurück. Seine Augen funkeln. So wie früher. Abgemacht.
Es kommt nicht mehr oft vor, dass wir vier zusammen sind. Wir telefonieren zwar regelmäßig miteinander, um uns gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Aber gemeinsame Treffen sind selten geworden. Wir geben vor, dass wir einfach zu viel um die Ohren haben.
Jakob jettet ständig um die Welt wie auf der Flucht und immer auf der Suche nach Unternehmen, die er aufkaufen und dann gewinnbringend zerschlagen kann.
Philipp lebt zwar nicht weit weg, in Hannover, ist aber entweder im OP oder in seiner glücklosen Ehe gefangen. Hinzu kommt, dass keiner von uns seine Frau mag – eine magersüchtige, missgünstige Ziege aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, deren Lebensaufgabe darin besteht, ihren Status in der Hannoveraner High Society zu festigen, die gemeinsamen missratenen Töchter zum Reitunterricht zu kutschieren und ihren Gatten zu schikanieren. Zu Familienfesten lädt Philipp daher eher selten ein.
Ähnlich wie Jakob und Philipp verschanze ich mich hinter meiner Arbeit. Ich bin Redakteur bei einem Nachrichtenmagazin, man schickt mich oft auf Reportagereisen. Zum Glück bin ich ungebunden, ich habe weder Frau noch Kinder, zu Hause vermisst mich niemand. So tauche ich ein in das Leben fremder Menschen und bin davon befreit, mich mit meinem eigenen und dem meiner Familie auseinandersetzen zu müssen.
Simon hockt auf seinem Hof und bearbeitet seine Steine. Wahrscheinlich ist er froh, wenn er von der Welt und seinen Brüdern so wenig wie möglich mitbekommt. In seinen klaren Momenten, und davon gibt es nicht wenige, wird er sich fragen, warum er eigentlich die Arschkarte gezogen hat. Unternehmensberater, Herzchirurg, Journalist – aus uns ist durchaus etwas geworden. Und er? Er ist der Bekloppte in der Familie. Das weiß er. Aber er will nicht ständig daran erinnert werden.
An diesem Abend sind wir uns wieder nah. So wie früher. Und so wie früher dauert es nicht lange, bis wir anfangen, uns zu streiten. Als Jakob in epischer Breite über seine letzten Abenteuer aufklärt, fahre ich ihm durch seine sorgfältig gestylte blonde Tolle. »Du wirst nie erwachsen«, bringe ich dank vier Halber einwandfrei heraus.