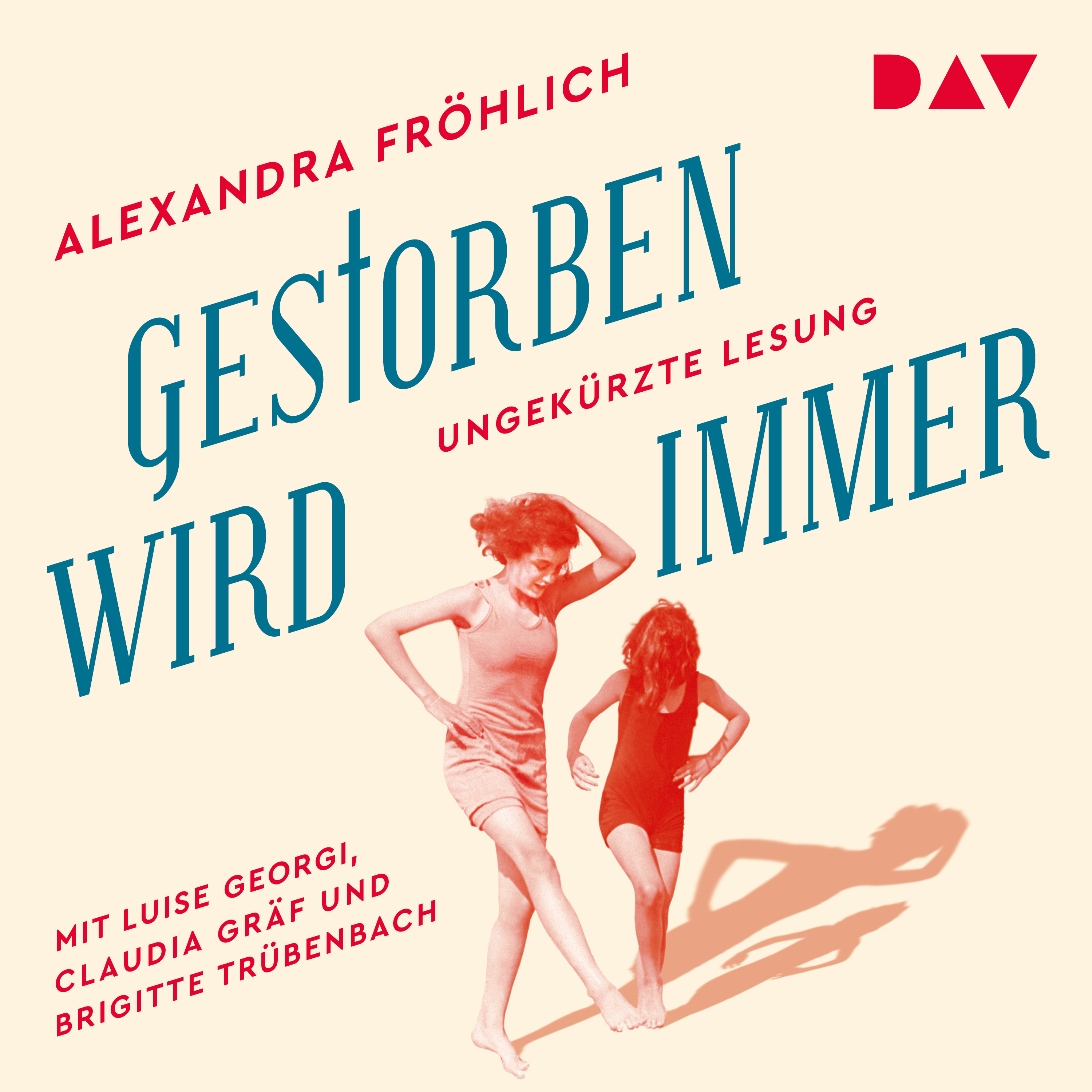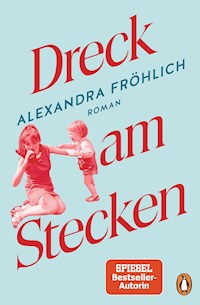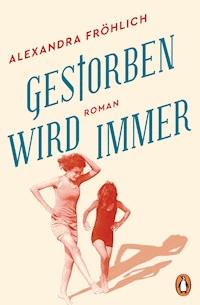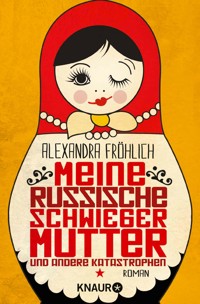
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihrem SPIEGEL-Bestseller "Meine russische Schwiegermutter und andere Katastrophen" schildert die Journalistin Alexandra Fröhlich mit staubtrockenem Humor eine zum Brüllen komische Liebes- und Familiengeschichte zwischen Deutschen und Russen. Basierend auf eigenen Erfahrungen der Autorin entsteht ein liebevoll beobachteter und charmant überspitzter Roman über das Aufeinanderprallen zweier Kulturen. Kann man einen Tsunami aufhalten? Eine Lawine? Einen Hurrikan? Ebenso hoffnungslos ist es, Paulas russische Schwiegermutter vom Gegenteil zu überzeugen, wenn diese beschließt, heimlich einen zwei Zentner schweren Neufundländer auf einem Hamburger Friedhof zu begraben. Denn Darya ist stur wie ein russischer Panzer und verrückt wie ein tollwütiges Frettchen. Mit Logik ist da nichts zu machen, nur Betteln hilft – manchmal. Wäre da nicht Daryas Sohn Artjom, Paula hätte längst die Flucht ergriffen. Zugegeben, Artjom liebt Wodka, Nachtklubs und Chopin, aber er hat eine Stimme, die Paulas Kniescheiben zum Vibrieren bringt … "Der Journalistin und Autorin Alexandra Fröhlich ist mit ihrem Roman «Meine russische Schwiegermutter und andere Katastrophen» eine West-Ost-Satire buchstäblich zum Brüllen gelungen. Der Roman ist eine vergnügliche Lektüre nicht nur für Russland-«Insider», die an tristen Wintertagen die Lachmuskeln stärkt." dpa
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Alexandra Fröhlich
Meine russische Schwiegermutter und andere Katastrophen
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kann man einen Tsunami aufhalten? Eine Lawine? Einen Hurrikan? Ebenso hoffnungslos ist es, Paulas russische Schwiegermutter vom Gegenteil zu überzeugen, wenn diese beschließt, einen zwei Zentner schweren Neufundländer nachts auf einem Hamburger Friedhof zu begraben. Denn Darya ist stur wie ein russischer Panzer und verrückt wie ein tollwütiges Frettchen. Mit Logik ist da nichts zu machen, nur Betteln hilft – manchmal. Wäre da nicht Daryas Sohn Artjom, Paula hätte längst die Flucht ergriffen. Zugegeben, Artjom liebt Wodka, Nachtklubs und Chopin, aber er hat eine Stimme, die Paulas Kniescheiben zum Vibrieren bringt …
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Epilog
Dank
Kleines Russisch-Wörterbuch für Anfänger
Zum Lesen
Zum Lernen
Zum Gucken
»Was für einen Deutschen den Tod bedeutet, ist für einen Russen gesund.«
Russisches Sprichwort
»Ich kenne das russische Volk und bin nicht geneigt, dessen Vorzüge zu übertreiben, aber ich bin davon überzeugt, und ich glaube daran, dass dieses Volk das geistige Leben der Welt um etwas Eigenartiges und Tiefes, etwas für alle Bedeutendes bereichern kann.«
Maxim Gorki (1868–1936)
»Wodka macht aus allen Menschen Russen.«
Ivan Rebroff (1931–2008)
Prolog
Unauffällig mustere ich meine Schwiegermutter von der Seite. Da sitzt diese Irre, mit zusammengekniffenen Lippen, der Lidstrich noch verschmierter als üblich, ihr falsches Haarteil hat sich von den Klemmen am Hinterkopf befreit, wirr schlängeln sich die blonden Strähnen um ihr kantiges Gesicht. Sie sieht aus wie eine Comicfigur, die einen Stromschlag bekommen hat. Hat sie nicht. Sie ist einfach, wie sie immer ist. So verrückt wie ein tollwütiges Frettchen.
»Darya, meine Liebe«, flüstere ich und versuche, einen Hauch Sanftmut in meine Stimme zu legen, »Darya, ich bitte dich, wenn die Polizeibeamten gleich zurückkommen, lass mich reden. Ich regle das schon, ja? Lass mich einfach machen, okay?«
Sie kneift die Lippen noch fester zusammen.
»Herrgott, ich bitte dich doch nur, ein einziges Mal die Klappe zu halten. Das kann doch nicht so schwer sein!«
Ohne mich eines Blickes zu würdigen, öffnet sie ihre Handtasche, entnimmt ein goldenes Döschen und beginnt, ihre Nase zu pudern. Das ist kein gutes Zeichen.
»Darya, Dascha«, flehe ich zuckersüß, »bitte, ich mach das schon. Ich hole uns hier raus. Dascha, bitte!« Betteln hilft manchmal, Erniedrigen hilft immer.
Sie nickt würdevoll. »Charascho.«
Ich habe keine Ahnung, ob sie mich verstanden hat. Meine Schwiegermutter spricht kein Deutsch. Sie lebt seit achtzehn Jahren in meinem Land. Aber sie spricht kein Deutsch. Manchmal sagt sie zum Abschied »Tschüssi« oder »Bis gleich«, wenn wir uns erst in zehn Tagen wiedersehen. Sie kennt ein paar Phrasen, Redewendungen, Satzfetzen, ansonsten verweigert sie sich meiner Sprache. Doch wenn ich mich mit ihrem Sohn unterhalte, sehe ich am Blitzen ihrer Augen, dass sie mehr versteht, als sie zugibt.
Auch ihren Wortschatz muss sie heimlich um wesentliche Vokabeln erweitert haben. »Dreckschwein, Nazi«, brüllte sie noch vor zwei Stunden völlig akzentfrei, als sie mit ihrem Gucci-Täschchen auf die Polizisten eindrosch, die uns in der Nacht auf dem Ohlsdorfer Friedhof stellten.
»Entschuldigung, die Dame weiß nicht, was Sie von ihr wollen, sie ist nicht von hier«, wandte ich zaghaft ein, während ich dezent versuchte, die Leiche des achtzig Kilogramm schweren Neufundländers zu meinen Füßen beiseitezuschieben.
Im Gegensatz zu Darya bin ich von eher mickriger Statur, geschönte einhundertdreiundsechzig Zentimeter groß, dreiundfünfzig Kilo leicht. Weiß Gott, wie wir es überhaupt geschafft haben, diesen stinkenden Köter bis hierherzuschleifen. Er roch schon nicht gut, als er noch lebte. In jenem Zustand allerdings war er unerträglich.
Ich war sofort dafür gewesen, Wassilij, auch liebevoll Wassja genannt, nach dem Einschläfern beim Tierarzt zu lassen. Und ich wusste sofort, dass mein Vorschlag inakzeptabel war. Also wanderte das tote Trumm in die Billstedter Datscha, lagerte unter einer schwarzen Plane im aprilfeuchten Schrebergarten meiner Schwiegereltern und weste vor sich hin, während wir uns in endlose Diskussionen verstrickten.
Im Garten begraben? Nein, dann sind die Johannisbeeren, die Gurken, die Tomaten ungenießbar, weil das Erdreich verseucht wird. Eine durchaus interessante Theorie, der ich nicht zu widersprechen wagte.
Auf freiem Feld verscharren? Zu würdelos.
Pietätvoll auf einem Tierfriedhof beisetzen? Eine kurze Recherche ergab, dass diese Zeremonie mit weit über tausend Euro zu Buche schlagen würde – inklusive Sarg aus Kirschbaum und individuell gestaltetem Marmorgrabstein, exklusive einer jährlichen Pacht der Grabstätte in Höhe von circa zweihundertfünfzig Euro. Von den Kosten der Grabpflege ganz zu schweigen, denn wer hat schon die Zeit, jeden Tag von Billstedt ins Hamburger Umland zu fahren, um Laub zu harken oder vertrocknete Blüten abzuknipsen? Aber was sollte Wassja auch auf einem Tierfriedhof? Er war schließlich ein vollwertiges Mitglied der Familie.
Rostislav, mein Schwiegervater, enthielt sich elegant einer Entscheidung, indem er den Kopf hin- und herwiegte, unverständlich vor sich hin brummelte und von Zeit zu Zeit spontan in Tränen ausbrach. Immerhin war ein naher Verwandter gestorben.
Artjom, mein Mann, war, wo er immer war, wenn man ihn brauchte: nicht da. Unabkömmlich, beruflich unterwegs, weit weg, in einer anderen Stadt. Schatz, das verstehst du doch, du machst das schon, ich verlass mich auf dich.
Darya kam das nicht ungelegen. So konnte sie ungestört überlegen, was mit Wassja werden sollte. Sie kommt aus Moskau, eigentlich aus Jakutsk, Sibirien, aber das erwähnt sie ungern, jedenfalls hat sie jahrelang in Moskau gelebt, und dort gibt es nur eine letzte Ruhestätte für herausragende Persönlichkeiten. Das ist der Nowodewitschi-Friedhof. Chruschtschow liegt dort, Puschkin, Gogol, Molotow, Prokofjew – einfach jeder, der einmal etwas auf sich gehalten hat.
Nun ist sie zwar irre, aber nicht irre genug, den Leichnam eines Hundes nach Russland überführen zu wollen. Ein Pendant zum Nowodewitschi musste also her. Es war schnell gefunden. Da sie in Hamburg gestrandet war, durfte es nichts Geringeres als der Friedhof Ohlsdorf sein. Natürlich ist Ohlsdorf höchstens ein müder Abklatsch vom Nowodewitschi, kein Prokofjew, kein Puschkin, aber immerhin Hans Albers und Heinz Erhardt, mehr kann man in diesem Land nicht verlangen.
Mein Einwand, dass es in Deutschland unmöglich sei, einen Hund auf einem regulären Friedhof zu beerdigen, wurde mit einem hoheitsvollen Lächeln abgetan. Natürlich müsse man den inoffiziellen Weg wählen, es gebe da doch sicherlich einen Friedhofswärter mit finanziellen Problemen und einem großen Herzen, der ein Gebüsch, ein Stück Wiese, ein Beet kenne, das für Wassja geeignet sei.
»Dascha«, sagte ich, »Dascha, vergiss es. Wir sind hier nicht in Russland.«
Nur einen Tag später fand ich mich auf einem Spaziergang über das weitläufige Ohlsdorfer Gelände wieder, fest untergehakt von Darya, die auf ihren Louboutins in schwindelerregender Höhe neben mir herstöckelte. Den Plan mit dem Friedhofswärter hatte sie verworfen, jeder irrt einmal im Leben, stattdessen favorisierte sie nun eine noch inoffiziellere Variante.
Wir brauchten nur drei Stunden, um ein angemessenes Gebüsch für Wassja zu finden. Ein an diesem Tage besonders gütiger Gott führte uns zu einem Platz unweit der letzten Ruhestätte von Carl Hagenbeck, Gründer des berühmten Zoos. Darya betrachtete die Bronzeplastik eines Löwen auf dem Grabmal und schaute selig.
Nach sechs weiteren Tagen legte sich endlich ein feiner Dauerregen über die Stadt, Wassja wurde in den Kofferraum des alten Kombis gewuchtet und nach Ohlsdorf überführt. Wie gewünscht war das Areal wegen des Wetters nahezu menschenleer, unbeobachtet zerrten wir den Kadaver so weit unter einen blühenden Rhododendron, bis er vom Weg aus nicht mehr zu sehen war, fuhren zurück nach Billstedt und warteten darauf, dass es Nacht wurde.
Gegen ein Uhr war es Darya dunkel genug. Und mir alles egal. Wahrscheinlich lag das am Cognac, den ich in den letzten Stunden wie Wasser konsumiert hatte. Nein, ich trinke nicht, ich bin keine Säuferin. Alkohol ist für mich vielmehr ein Medikament, ein Balsam, der sich über meine Nerven legt und ihnen Normalität vorgaukelt. Schwankend erhob ich mich und nahm Darya die Autoschlüssel ab.
»Nimm du die Schaufel. Ich fahre.«
Insgeheim hoffte ich, dass wir auf der Fahrt nach Ohlsdorf in eine Verkehrskontrolle gerieten und meine Fahne auffiele. Ich würde meinen Führerschein verlieren. Aber das war mir das Scheitern unserer Unternehmung wert. Ich fuhr Schlangenlinien, ich missachtete rote Ampeln und die Geschwindigkeitsbegrenzung – es störte niemanden. Neben mir saß Darya, ungerührt, und hielt die Schaufel umklammert.
Wir parkten an der Fuhlsbütteler Straße, schlugen uns durch stille Kleingärten, bis wir vor dem Zaun des Friedhofs standen. Weit über zwei Meter hoch, mit einem engmaschigen Drahtgeflecht, ragte er vor uns in den Nachthimmel. Ich grinste triumphierend.
»Darya, meine Liebe, nach dir«, sagte ich höflich und dachte: Da kommt die nie rüber. Schon gar nicht in diesem Outfit.
Ich hatte erwartet, dass sie dem Anlass und unserem Unterfangen entsprechend in Schwarz und praktisch gekleidet sein würde. Stattdessen trug Darya einen Catsuit im Leoprint, darüber ein dunkles, bodenlanges Samtcape, High Heels und eine passende Clutch. Sie sah aus wie eine Mischung aus Graf Dracula und Barbarella.
Ihre falsche Löwenmähne wippte dramatisch im Mondlicht, dann flogen Schaufel, Schuhe und Handtasche über den Zaun. Behende wie ein Affe erklomm sie das Hindernis, ließ sich ächzend auf die andere Seite fallen und zischte: »Dawai!«
Für den Bruchteil einer Sekunde war ich versucht, einfach wegzugehen, mich ins Auto zu setzen, nach Hause zu fahren, mir die Bettdecke über den Kopf zu ziehen und die Wahnsinnige ihrem Schicksal zu überlassen. Aber ich wusste sofort: Das ist zu kurz gedacht. Sie wird dich finden, sie wird dich stellen, und dann wird sie dich mit der Schaufel erschlagen.
Nach mehreren Anläufen überwand ich den Zaun. Geduckt schlichen wir durch stachelige Sträucher, nach einer halben Stunde hatten wir das Ziergehölz, unter dem Wassja auf uns wartete, erreicht. In einem verbissenen gemeinschaftlichen Kraftakt zogen wir den Koloss einen halben Kilometer bis zur auserkorenen Grabstätte und schaufelten abwechselnd das Loch. Mit Genugtuung bemerkte ich, dass diese Arbeit weder Samtcape noch High Heels gut bekam.
Schweigend, verschwitzt und in seltener Eintracht hatten wir schon eine ungefähr zwei mal zwei Meter große und etwa dreißig Zentimeter tiefe Grube ausgehoben, als uns Taschenlampenstrahlen ins Gesicht trafen. Meine Schwiegermutter schrie auf und schwang die Schaufel über den Kopf. Ich stand in der Grube und widerstand nur schwer dem Impuls, mein Haupt in die lose Erde zu stecken.
Zwei Polizeibeamte gaben sich als solche zu erkennen und fragten irritiert, aber nicht unfreundlich, was wir da täten und ob wir so nett wären, uns auszuweisen. Ich krabbelte beflissen aus dem Loch und suchte nach einer nicht allzu unglaubwürdigen Ausrede, als Darya losbrüllte und mich mit ihren Deutschkenntnissen verblüffte.
Selbst der gutmütigste und phlegmatischste deutsche Polizist reagiert ungehalten, wenn er als »Dreckschwein« und »Nazi« tituliert wird. Wer wollte es ihm verdenken? Ich jedenfalls war voller Verständnis, als sich die Beamten auf Darya stürzten und versuchten, ihr die Schaufel zu entwinden.
Im sich anschließenden Handgemenge stolperte einer der beiden über den bis dahin unbemerkt gebliebenen Wassja und ging mit einem Schmerzensschrei zu Boden. Meine helfend ausgestreckte Hand missverstand er als tätlichen Angriff – auch das konnte ich ihm nicht übelnehmen – und briet mir mit seiner Taschenlampe beherzt eins über.
Die Polizisten verzichteten nun darauf, unsere Personalien vor Ort aufzunehmen, wir wurden wie Verbrecher abgeführt und landeten auf der Rückbank eines Streifenwagens. Auf der Fahrt zum Revier schimpfte Darya ununterbrochen vor sich hin. Glücklicherweise auf Russisch. Ich starrte aus dem Fenster, während mir Sprichwörter durch den Kopf schossen. Mitgefangen, mitgehangen. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.
Das wird teuer, denke ich und hypnotisiere die Tür der Arrestzelle. Hausfriedensbruch, Störung der Totenruhe, ordnungswidrige Beseitigung eines Tierkörpers, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, in Tateinheit mit Körperverletzung. Erneut fixiere ich Darya. In ihren Augen sammeln sich Tränen, an ihrer Nase hängt ein Tropfen.
Meine Schwiegermutter hat nah am Wasser gebaut, wie der Rest meiner angeheirateten Familie. Warum sie gerade jetzt heult, erschließt sich mir nicht. Bereut sie die Schwierigkeiten, in die sie uns gebracht hat? Hat sie Angst vor den Konsequenzen? Trauert sie um Wassja und fragt sich, was nun aus ihm wird? Oder ist es ein allgemeines, diffuses Bedauern über die Ungerechtigkeit der Welt? Ich frage nicht nach, ich bin zu müde, mir ist übel, und mein Kopf schmerzt vom Hieb der Taschenlampe.
Ich tätschele Daryas Knie, als die Zellentür aufgeschlossen wird und ein Beamter den kleinen Raum betritt.
»Der Dolmetscher für Frau Polyakowa ist da. Wir können jetzt das Protokoll aufnehmen. Wenn Sie mir bitte folgen.« Darya schaut mich fragend an, ich nicke aufmunternd und bedeute ihr, mit dem Polizisten zu gehen. Entschlossen zieht sie die Nase hoch und wankt auf erdverkrusteten Absätzen ihrem Schicksal entgegen.
Fünf Minuten später werde auch ich von einer Beamtin in ein Büro geführt, sie gibt mir meinen Personalausweis zurück.
»Frau Matthes, Sie wohnen noch unter der angegebenen Adresse?«
»Ja.«
»Was machen Sie beruflich?«
»Ich bin Anwältin«, sage ich. Die Frau bekommt große Augen und schüttelt den Kopf.
»Das heißt, Ihnen war die Tragweite Ihrer Handlung bewusst? Dass Sie sich strafbar machen?«
Ich zucke die Schultern. Was heißt schon bewusst – nach all dem Cognac?
»Ist Frau Polyakowa Ihre Mandantin?«
»Nein.«
»Sie sind befreundet?«
»Nein.«
»Woher kennen Sie die Dame denn?«
Durch eine gläserne Trennwand kann ich die »Dame« im Nebenraum beobachten. Gerade schreit sie und fuchtelt mit den Händen. Der Dolmetscher schreit und fuchtelt zurück. Später erfahre ich, dass er aus Kasachstan kommt. Darya Polyakowa aus Moskau wird von einem Kasachen übersetzt. Eine Zumutung.
Ich seufze. »Frau Polyakowa ist meine Schwiegermutter.«
»Oh.« Pause. »Sie haben also nach der Heirat Ihren Mädchennamen behalten?«
»Ja. Ich fand, Paula Polyakowa klingt lustig, aber nicht seriös.«
»Ganz ehrlich, Frau Matthes, letzte Nacht haben Sie keinen besonders seriösen Eindruck auf meine Kollegen gemacht.« Im Blick der Polizistin liegt Häme.
Ich räuspere mich. »Es wäre mir recht, wenn wir uns auf die Sachlage konzentrieren könnten.«
»Na klar«, mein Gegenüber grinst, »dann erklären Sie mir mal ganz sachlich, was Sie nachts auf dem Friedhof wollten und warum Sie die Beamten angegriffen haben.« Hier habe ich kein Mitleid zu erwarten.
In knappen Worten schildere ich die Fakten, mehr oder minder erfolgreich bemüht, keinen Vorsatz zuzugeben. Anschließend liest mir die Polizistin meine Aussage vor, ich unterschreibe das Protokoll.
»So, Frau Matthes, natürlich stellen wir Strafanzeige. Aber da sonst nichts weiter gegen Sie vorliegt, können Sie nun gehen. Wahrscheinlich möchten Sie auf Ihre Schwiegermutter warten? Das wird wohl noch ein bisschen dauern.« Sie grinst schon wieder.
Nebenan hockt Darya zusammengekauert auf ihrem Stuhl und wird von nicht hörbaren Schluchzern geschüttelt. Auch der Dolmetscher scheint den Tränen nahe. Der zuständige Beamte dagegen scheint zu überlegen, wen von beiden er zuerst schlagen soll.
Im Vorraum des Reviers setze ich mich unter den scheelen Blicken der Polizisten auf eine Holzbank. Mir fallen sofort die Augen zu. Zwei Stunden später weckt mich Darya.
»Färrtik! Gähen!« Als ob sie ahnt, dass ihr Befehlston in dieser Situation unangebracht ist, fügt sie leise hinzu: »Dawai, Poletschka.«
Ich hasse es, wenn sie mich so nennt. Ich hasse diese Frau. Und in diesem Moment hasse ich mein ganzes verfluchtes Leben. Im Windschatten meiner Schwiegermutter stolpere ich in den grellen Tag.
1
Begonnen hatte alles mit einem scheinbar lukrativen Mandat. An einem Maitag vor etwa einem Jahr trat diese russische Familie durch die Tür meiner kleinen Kanzlei in mein Leben und hat es seitdem nicht mehr verlassen. Mein externer Sekretariatsservice hatte den Termin vereinbart. Als ich wissen wollte, worum es dabei ginge, bekam ich die lakonische Antwort, so richtig habe man das nicht verstanden, aber es seien wohl irgendwelche Streitigkeiten mit dem Vermieter des Ehepaares Polyakow.
Genau genommen dem Ex-Vermieter, wie mir Herr Polyakow, ein gemütlich wirkender, untersetzter Mann mit spärlichem mausgrauem Haar, gestenreich erklärte. Sein Deutsch war zu diesem Zeitpunkt nur unzureichend, dafür sprach er fließend Italienisch. Das half bei unserem Erstgespräch nicht wirklich, da sich meine Kenntnisse dieser Sprache auf »O sole mio« und »Ciao« beschränkten. Zumindest verstand ich, dass ihr ehemaliger Vermieter sie bestohlen habe, ein Instrument sei verschwunden.
Viel mehr begriff ich leider nicht, da Herr Polyakow während seiner holprigen Ausführungen unentwegt von seiner imposanten Frau, die mindestens einen Kopf größer war als er, unterbrochen wurde. Offensichtlich war sie mit seiner Version der Geschichte nicht einverstanden und sah sich gezwungen, ihn in ihrer Muttersprache zu korrigieren.
Auf meine Frage, ob sie denn schon Anzeige erstattet hätten, starrten sie mich ratlos an.
»Po-li-zei«, sagte ich, »waren Sie bei der Polizei?«
Beide zuckten erschrocken zurück und schüttelten die Köpfe. »Kaine Polizei, kaine Polizei.«
Wir kamen nicht recht weiter. Kurz war ich versucht, die beiden an einen Kollegen zu verweisen, der Russisch oder wenigstens Italienisch sprach. Angesichts meiner finanziellen Lage verwarf ich den Gedanken wieder.
Ich hatte mich damals erst vor ein paar Monaten von meinem langjährigen Lebensgefährten getrennt und darüber hinaus die Partnerschaft in unserer Gemeinschaftskanzlei gekündigt. Als Einzelkämpferin wollte ich nun wieder ran an die echten Menschen. Paula Matthes, die Rächerin der Enterbten, Kämpferin für Recht und Ordnung, für eine bessere Gesellschaft, in der jeder das bekommt, was ihm zusteht.
So sah ich mich. Allerdings stand ich mit dieser Sichtweise alleine da, meine Auftragsbücher waren leer, und ich wähnte mich, gerade Ende dreißig, bereits am Tiefpunkt meiner juristischen Karriere.
Jetzt saßen endlich zwei Menschen vor mir, teuer gekleidet und mit reichlich Gold behangen – mindestens 750er, das erkannte mein geschulter Höhere-Tochter-Blick sofort –, und deshalb versuchte ich, dem Ehepaar Polyakow zu erklären, dass wir wohl einen Dolmetscher bräuchten. Nach längerem Hin und Her standen sie abrupt auf, Herr Polyakow sagte: »Wiedärkommen. Wiedärsähen.«
Weg waren sie. Ich rechnete nicht ernsthaft mit einem Wiedärsähen. Ich irrte.
Keine vierundzwanzig Stunden später kehrten sie zurück, unangemeldet. Ich versuchte noch, die Form zu wahren, und blätterte hektisch im unbefleckten Terminkalender. »Ich muss mal schauen, ob ich Sie so spontan dazwischenschieben kann …« Ich konnte.
Das Ehepaar setzte sich vor meinen Schreibtisch, Herr Polyakow wippte vergnügt mit den Beinen, Frau Polyakowa nickte mir kurz zu, um dann etwas missmutig meine kahlen Wände zu betrachten.
Ich räusperte mich. »Nun, wir hatten ja wegen der leichten Sprachbarriere schon bei Ihrem letzten Besuch über einen Dolmetscher gesprochen …«
»Warten. Artjom kommt«, sagte Herr Polyakow freundlich und wippte weiter.
Fünfundvierzig Minuten voller Schweigen zogen sich. Fünfundvierzig Minuten, in denen ich so tat, als studierte ich Akten, während ich überlegte, ob ich diese Zeit schon als Arbeitsleistung auf der Rechnung geltend machen könnte, ohne als geldgierige deutsche Schlampe dazustehen, die ausländische Mitbürger übers Ohr haut.
Herr Polyakow wippte. Seine Gattin guckte weiter ins Nichts, durch das frisch gestrichene Weiß in eine Art Trance versetzt. So ruhig habe ich sie selten wieder erlebt.
Dann öffnete sich die Tür, und herein trat ein Mann unbestimmbaren, aber eher mittleren Alters, von dem ich erst annahm, er müsse sich verlaufen haben. Cremefarbener Leinenanzug, ein goldenes, weit geöffnetes Hemd darunter, eine funkelnde Panzerkette auf der unbehaarten Brust, Panamahut, cremefarbene Lederhandschuhe, helle Schlangenlederboots. Ein südamerikanischer Großgrundbesitzer auf dem Weg zu einer Rinderauktion, dachte ich.
Doch beim zweiten Blick stellte ich die Ähnlichkeit mit Frau Polyakowa fest: groß, mit der Körperspannung eines Athleten, schwarze Locken, die ihm mit scheinbar unbeabsichtigter Lässigkeit ins Gesicht fielen, eine gebogene Nase im markanten Gesicht, dunkle, melancholisch blickende Augen. Attraktiv, aber insgesamt eine leicht übertriebene Erscheinung.
Die Erscheinung durchmaß mit zwei Schritten den Raum, und bevor ich aufstehen konnte, war sie schon hinter meinem Schreibtisch an mich herangetreten, entledigte sich ihrer Handschuhe, ergriff meine Rechte und deutete einen Handkuss an.
Es mag sein, dass ich ein Nähe-Distanz-Problem habe, aber meines Erachtens gibt es zwischen zivilisierten Menschen unsichtbare, von allen akzeptierte Grenzen.
In der Schlange vor dem Postschalter legt man nicht sein Kinn auf die Schulter des Vordermannes.
An der Kasse im Supermarkt schiebt man seinen Einkaufswagen nicht in die Hacken anderer Kunden.
Und niemals, wirklich niemals, verlässt man als Besucher unaufgefordert die Besucherseite eines Schreibtisches und entweiht die Privatsphäre des Besitzers, indem man ungeniert auf seinen Monitor starrt.
Ich war konsterniert. Einerseits.
Andererseits war die ganze Szene inklusive ihrer skurrilen Darsteller derart absurd, dass ich, von einem unterkühlten Lächeln abgesehen, zu keiner Abwehrreaktion imstande war.
»Artjom. Unsärr Sonn«, sagte Herr Polyakow erklärend und stellte schlagartig sein Wippen ein.
»Frau Matthes«, sagte Artjom und strahlte mich an, »entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Der Verkehr …«
Welche Verspätung?, dachte ich. Wir hatten doch gar keinen Termin. Und welcher Verkehr? Es ist elf Uhr dreiundzwanzig an einem Mittwoch, da sind Staus in Eimsbüttel eher selten.
Artjom rückte von mir ab und setzte sich zu seinen Eltern.
»Frau Matthes«, sagte er wieder, »ich finde es großartig, dass Sie uns helfen wollen. Ich möchte Ihnen jetzt schon für Ihr Engagement danken. Wenn Sie nicht wären, wüssten wir nicht weiter.«
Sein fließendes Deutsch hatte einen schweren, unverkennbar osteuropäischen Akzent, seine Stimme war voll und tief, versehen mit diesem Timbre, das insbesondere bei weiblichen Zuhörern durch die Ohren über den Unterleib abwärtsschießt und die Kniescheiben zum Summen bringt.
Ich bemühte mich, das Zittern meiner Beine zu ignorieren.
»Herr Polyakow«, erwiderte ich, »ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, aber bis dato weiß ich noch gar nicht genau, worum es eigentlich geht und ob ich Ihnen tatsächlich helfen kann.«
»Deshalb bin ich ja heute gekommen.« Artjom strahlte erneut. »Bitte verzeihen Sie das schlechte Deutsch meiner Eltern. Rostislav, mein Vater, ist als Geschäftsmann hauptsächlich in Italien und der Schweiz aktiv, bisher fehlte ihm einfach die Zeit, die Sprache seines Gastlandes zu lernen. Und Darya, meine Mutter, nun ja …«, er hüstelte, »Mam ist Cellistin, ihre Sprache ist die Musik.«
Bei der Erwähnung ihres Namens setzte sich Darya kerzengerade auf und nickte heftig, bis sich ihre Kreolen in den Haaren verfingen.
Dann erzählte Artjom eine Geschichte, die so unglaublich war, dass ich sie sofort glaubte. Vor einem Jahr hatten seine Eltern eine geräumige Dreizimmerwohnung in Winterhude gemietet. Dass ihr neues Zuhause nicht wirklich im noblen Winterhude lag, sondern im angrenzenden früheren Arbeiterviertel Barmbek, wurde ihnen erst nach dem Einzug bewusst. Schon zu diesem Zeitpunkt fühlten sie sich von ihrem Vermieter arglistig getäuscht, aber da die Wohnung einen kleinen Garten hatte, der perfekt schien für die vier Hunde, fügten sie sich als friedliebende Mitmenschen in ihr Schicksal.
Dass die Heizung im Winter nicht funktionierte, auch darüber hätte man reden können.
Dass die Spülung versagte und die Toiletten ständig verstopften – geschenkt.
Aber dass die Wände anfingen, Zeichen von Schimmel zu zeigen, das war letztendlich zu viel. Schimmel überträgt Krankheiten, und insbesondere der französische Pudel war ein sensibles, anfälliges Tier.
Das Ehepaar Polyakow suchte sich eine andere Bleibe und kündigte. Die Schlüsselübergabe fand während des noch laufenden Auszugs statt, man hatte sich ein wenig mit der Zeit vertan, das kann passieren, und nachdem man im neuen Domizil Kartons und Mobiliar sichtete, stellte man fest: Etwas fehlte. Etwas Entscheidendes. Daryas Violoncello war unauffindbar.
Nun handelt es sich bei einem Cello nicht um einen Eierbecher, der in der Aufregung eines solchen Tages leicht verlorengehen kann. Ein Versehen war ausgeschlossen. Man rief sofort Herrn Reimers an, den Vermieter, der das Gespräch nach zwei Sekunden gruß- und erklärungslos beendete. Alle nachfolgenden Kontaktaufnahmen endeten ähnlich.
»Sie glauben also, dass Herr Reimers das Cello Ihrer Mutter gestohlen hat? Haben Sie das denn auch gesehen?«, hakte ich nach.
»Gesehen nicht direkt. Aber es gibt keine andere Erklärung. Herr Reimers war der einzige Besucher an diesem Tag. Und während wir Kartons nach draußen trugen, war er mindestens zehn Minuten allein in der Wohnung«, sagte Artjom ernst.
»Aber warum sollte Herr Reimers das Cello Ihrer Mutter stehlen?«
»Dem Zustand seiner Wohnungen nach zu urteilen, hat er wohl Geldsorgen«, erklärte Artjom noch ernster.
»Wie teuer ist denn das Instrument?«
»Es ist sehr wertvoll. Unschätzbar wertvoll«, flüsterte Artjom und begann mit dem zweiten Kapitel seiner Geschichte.
Daryas Violoncello war kein gewöhnliches Violoncello. Es war ein original Testore aus Mailand. Carlo Giuseppe Testore war nicht ganz so berühmt wie sein Kollege Stradivari, wurde aber in Fachkreisen mindestens ebenso verehrt. Das Instrument datierte auf 1691, sein Boden war aus Pappelholz, die Schnecke aus Ahorn, die Zargen aus Buche – ein Meisterstück der Geigenbaukunst.
Was das Violoncello aber so unbezahlbar machte, war nicht allein seine Herkunft, sondern auch seine Historie. Nachdem über die Jahrhunderte zahlreiche bekannte Musiker auf dem Instrument gespielt hatten, gelangte es schließlich in den Besitz von Mstislaw Rostropowitsch, dem bedeutendsten Cellisten aller Zeiten.
Dieser Rostropowitsch verfiel mit Mitte zwanzig dem Charme Ljudmiljas, einer blutjungen, nicht untalentierten Balletttänzerin am Bolschoi-Theater. Die Affäre war ebenso leidenschaftlich wie kurz. Und auch wenn Rostropowitsch drei Jahre später die Sopranistin Galina Wischnewskaja heiratete – vergessen konnte er Ljudmilja nicht.
Als er 1974 die Sowjetunion verlassen musste – »Stellen Sie sich vor«, Artjom lachte süffisant, »er hatte sich mit so unvernünftigen Dingen wie Demokratie und Menschenrechten beschäftigt. Weiß Gott, warum. Er hat seiner Familie damit viel Kummer bereitet. Aber da sieht man mal wieder, dass eine unerfüllte Liebe einen Mann wirklich verrückt machen kann …« Jedenfalls schickte er Ljudmilja zum Abschied sein Testore.
Ljudmilja hütete und pflegte das Instrument im Verborgenen und erzählte niemandem von ihrem Geschenk. Erst auf dem Sterbebett offenbarte sie sich und vermachte das Violoncello ihrer Tochter, Darya Polyakowa.
Seitdem hatte das Instrument die Familie auf ihrem Weg begleitet, es wurde bewahrt wie eine Reliquie, kaum dass sich Darya traute, darauf zu spielen – und wenn, dann nur im stillen Gedenken an das unsichtbare Band zwischen Mstislaw und Ljudmilja.
Artjom standen Tränen in den Augen, als er endete, Rostislav wischte sich den Schweiß von der Stirn, Darya schneuzte in ein Taschentuch. Natürlich hatte die Story auch mich nicht kaltgelassen, aber große, coram publico dargebotene Gefühle sind nicht meins, und schließlich war ich als knallharte Anwältin gefordert. Deshalb fragte ich sachlich: »Haben Sie denn das Cello einmal schätzen lassen?«
»Sein Wert geht in die Hunderttausende, er liegt im knapp siebenstelligen Bereich«, sagte Artjom.
»Hunderttausende …«, jetzt flüsterte ich, »… knapp siebenstellig.« Ich schlug die Augen nieder, aus Angst, dass die reine Gier darin stand. Immerhin berechnet sich das Salär eines Rechtsanwalts auch nach dem Streitwert des jeweiligen Verfahrens. Die Lösung all meiner Probleme schien greifbar nahe.
»Und den Wert können Sie auch belegen?«
Artjom nickte. »Wir haben die Expertise eines renommierten russischen Musikwissenschaftlers.«
»Sehr gut. Können Sie mir dieses Dokument vorbeibringen? Für ein mögliches Verfahren muss ich es übersetzen und beglaubigen lassen.«
»Kein Problem, Frau Matthes«, sagte Artjom.
Ich griff in meine Schreibtischschublade und zückte ein Formular. »Wenn Ihre Eltern mir das bitte unterschreiben. Damit erklären Sie, dass ich Sie anwaltlich vertrete und befugt bin, Ihre Interessen Dritten gegenüber wahrzunehmen.« »Das heißt, Sie helfen uns?«
»Herr Polyakow, es ist mir ein Vergnügen.«
»Nennen Sie mich doch bitte Artjom.«
Sehr gern, dachte ich und spürte dem Klang seiner Stimme nach, die durch meinen Körper rauschte.
2
Nachdem Familie Polyakow sich überschwenglich von mir verabschiedet hatte, stürzte ich mich in die Arbeit. Fairerweise, dachte ich, sollte ich zunächst Kontakt zu dem Vermieter aufnehmen. Eventuell zeigte er sich einsichtig und gab das Cello ohne weiteres Aufheben zurück. Oft kommen Menschen schon zur Vernunft, wenn sie einen Anwalt nur an der Strippe haben.
Ich wählte die Nummer von Herrn Reimers.
»Reimers?«
»Guten Tag, Herr Reimers, Rechtsanwältin Matthes hier. Ich vertrete Ihre ehemalige Mieterin Frau Polyakowa und …«
Schallendes Gelächter, dann machte es klick. Vielleicht eine Störung in der Leitung? Ich rief erneut an.
»Reimers?«
»Herr Reimers, wir sind gerade unterbrochen worden. Matthes mein Name, ich bin die Anwältin von Darya …«
»Blöde Kuh!« Klick. Nein, keine Störung in der Leitung.
Ich war mir nicht sicher, ob er mit der blöden Kuh nun mich oder meine Mandantin gemeint hatte. Ich beschloss, persönlich beleidigt zu sein, und schrieb einen unfreundlichen Brief, in dem ich die Herausgabe des Cellos innerhalb von vierzehn Tagen forderte und mit weiteren rechtlichen Schritten drohte.
Zwei Wochen lang passierte nichts – außer, dass mich mehrmals täglich abwechselnd Artjom und sein Vater anriefen, um zu erfragen, wie weit ihr Fall gediehen war. Meine Erklärung, dass diese Sache etwas Zeit in Anspruch nehme, da man in Deutschland bestimmte Fristen einzuhalten habe, und mein Versprechen, mich sofort zu melden, wenn es etwas Meldenswertes gebe, ignorierten sie eisern. Nichtsdestotrotz zog ich die Gespräche mit Artjom künstlich in die Länge, nur um in den Genuss seines satten Basses zu kommen.
Kurz vor Ablauf meines Ultimatums erläuterte ich ihm, dass ich nun Klage beim Landgericht einreichen wolle. Der entsprechende Schriftsatz sei in Vorbereitung – dass ich diesen mindestens achtmal überarbeitet hatte, behielt ich für mich. Ich wies Artjom darauf hin, dass an deutschen Gerichten das Prinzip der Vorkasse gilt. Klage gegen Cash. Und die Verfahrenskosten bemaßen sich an der Höhe des Streitwerts.
»Oh«, erwiderte Artjom, »wie viel ist das denn ungefähr?«
»Sie müssen schon mit fünf- bis sechstausend Euro rechnen.«
»Oh«, sagte Artjom wieder, »ich melde mich gleich noch mal.«
Bei seinem nächsten Anruf schlug er vor, die Angelegenheit doch besser in aller Ausführlichkeit zu besprechen, und fragte, ob ich am Samstagabend schon etwas vorhabe.
»Samstagabend?«
»Ja, meine Eltern möchten Sie gern zu einem kleinen Picknick einladen. Im Garten ihres Wochenendhauses. Bitte machen Sie uns die Freude. Wäre Ihnen zwanzig Uhr recht?«
Eigentlich nicht. Normalerweise treffe ich privat keine Mandanten. Nun waren die Polyakows meine einzigen, und ich redete mir ein, sie nicht vor den Kopf stoßen zu wollen. Dass der Umstand, Artjom wiedersehen zu können, ausschlaggebend für meine Zusage war, verdrängte ich geschickt.
Außerdem hatte ich tatsächlich nichts vor. Mein soziales Leben bewegte sich in einem eher bescheidenen Rahmen, nachdem die über zehnjährige Beziehung zu Bernhard gescheitert war. Wir wussten uns schon länger nichts mehr zu sagen, als der Herr eine Mitarbeiterin unserer Kanzlei recht körperintensiv einarbeitete. Daraufhin suchte ich das Weite. Der gemeinsame Freundeskreis, alles Pärchen, hatte sich von mir ab- und ihm und seiner neuen Flamme zugewandt.
Ab und an traf ich mich mit Freundinnen aus Studentenzeiten, ab und an besuchte ich meine Eltern in Nienstedten, um bei der ersten Gelegenheit zu flüchten, da meine Mutter spätestens nach einer halben Stunde ihrem Wunsch nach einem Enkel Ausdruck gab. Immer verbunden mit der abschließenden Bemerkung: »Kind, du wirst schließlich nicht jünger.«
Zu behaupten, dass ich einsam war, traf es nicht. Ich war einsam und verzweifelt und hungrig nach Aufmerksamkeiten jeder Art. Deshalb freute ich mich auf den Abend mit dieser merkwürdigen Familie.
Picknick, Garten, Wochenendhaus, das klang entspannt und leger, und ich fühlte mich bei meinem Aufbruch in Jeans und T-Shirt passend gekleidet.
Natürlich hatte ich mir im Vorfeld über russische Tischgepflogenheiten, insbesondere das Trinkverhalten, Gedanken gemacht. Gleich einem Pawlowschen Reflex schob sich vor mein geistiges Auge das Bild von lauten, ungehobelten Menschen, die Unmengen von Wodka konsumieren und ihre Gläser an die Wand schmeißen. Man hat seine Klischees im Kopf.
So schlimm wird es nicht werden, dachte ich. Die Polyakows waren zwar anders als die meisten Menschen, die ich kannte, aber sie schienen gebildet und keine Säufer zu sein. Vorsichtshalber und als kleines Gastgeschenk nahm ich eine Flasche staubtrockenen Chardonnay mit.
Ich hatte nicht gefragt, wo genau das Wochenendhaus lag, tippte den Straßennamen, den Artjom mir genannt hatte, in mein Navi ein und wähnte mich auf dem Weg zu einem idyllischen Wäldchen in einem Hamburger Randgebiet. Das Gerät lotste mich in eine Kleingartenkolonie in Billstedt.
Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. In meiner Fantasie war aus dem Wochenendhaus so etwas wie ein Schweizer Chalet in den Harburger Bergen geworden. Nun stand ich vor einer windschiefen Gartenlaube mitten in einem Stadtteil, der mir als gebürtiger Hanseatin bislang nur vom Hörensagen als sozialer Brennpunkt und architektonische Hochhausödnis bekannt war.
Unvorsichtigerweise öffnete ich die Pforte des rostigen Zauns, betrat den verwilderten Garten und rief dann fragend: »Hallo?«
Aus einem Gestrüpp rechts von mir stürzte etwas hervor, das ich zunächst für ein Pony hielt. Das Etwas begrub mich unter sich und hechelte mir mit fauligem Atem ins Gesicht, dann bellte es.
»Wassja! Fu! Dawai!«, schrie jemand von irgendwoher.
Ich nahm an, dass dieser Befehl dem Riesen auf mir galt, der sich allerdings nicht rührte.
»Wassja! Fu, fu!«
Das Vieh gähnte mich an, erlaubte mir einen Blick auf seine verrotteten Zahnreihen und wuchtete sich von mir herunter.
Artjom schob sich in mein Blickfeld.
»Frau Matthes, geht es Ihnen gut?«
»Danke, nix passiert«, versicherte ich und ließ mir aufhelfen.
»Da sind Sie ja schon. So früh … Wir haben noch gar nicht mit Ihnen gerechnet!«
Ich schaute auf meine Uhr. Punkt acht. Hatte ich ihn am Telefon falsch verstanden?
»Sagten wir nicht zwanzig Uhr?«, fragte ich irritiert.
»Egal, egal. Wie schön, dass Sie da sind. Kommen Sie …« Artjom ging voran in den hinteren Teil des Gartens. Jetzt erst wurde mir bewusst, dass er nur eine Jogginghose trug. Das war wirklich sehr leger.
Hinter dem verwitterten Holzhäuschen, dessen grüner Anstrich nur noch in Rudimenten zu erkennen war, erstreckte sich eine überraschend große Wiese mit Obstbäumen, an den Rändern lagen Gemüsebeete. Rostislav eilte mir in Unterhemd und Unterhose mit ausgestreckten Armen entgegen, aus den Augenwinkeln sah ich, wie Darya in einem durchsichtigen Negligé über eine Holzterrasse ins Haus huschte. Ich musste mich völlig in der Zeit geirrt haben, wie unangenehm.
Meine Gastgeber schien dieser Fauxpas nicht weiter zu stören, man drückte mir mit der Bemerkung: »Champagner!« ein Glas Sekt in die Hand, bugsierte mich in einen Campingstuhl an einem riesigen Tisch, der anschließend von Artjom und seinem Vater mit Bergen von unbekannten Nahrungsmitteln beladen wurde.
Während die Männer über den Rasen flitzten, beschränkte Darya sich darauf, aus dem Inneren der Laube Kommandos zu bellen. Nach verrichteter Arbeit entschuldigten sich die Herren, man wollte sich noch kurz frisch machen.
Ich blinzelte in die Abendsonne, hinter mir knisterten die Kohlen in einem Schwenkgrill, auf dem einen Meter lange Fleischspieße lagen, über mir im Apfelbaum zwitscherte eine Amsel, unter einem Busch schnarchte der Neufundländer. Eigentlich ganz schön hier, dachte ich.
Dann trat Darya auf die Veranda, und ich hielt den Atem an. Sie trug ein langes, eng geschnittenes Abendkleid, silberfarben, mit einem schwarzen, psychedelischen Muster und so tief dekolletiert, dass ich Angst hatte, ihre gewaltigen Brüste könnten jederzeit den Weg in die Freiheit finden. An ihren Füßen klebten kleine, silberne Schläppchen mit winzigen Absätzen, vorne verziert von grauen Federpuscheln. Solche Schuhe hatte ich zuletzt in einem Doris-Day-Film aus den Sechzigern gesehen. Ich war tief beeindruckt.
Sie schwebte auf mich zu, umarmte mich, sank auf den Stuhl neben mir und tätschelte mit ihrer üppig beringten Hand meinen Arm.
»Gutt, gutt«, sagte sie, »gutt, gutt.«
Rostislav und Artjom gesellten sich zu uns, beide nun in tadellos sitzenden Anzügen, einzig die Farbwahl wirkte ein wenig exzentrisch – der Vater in Lindgrün, der Sohn in changierendem Blau-Mauve.
Ich war eindeutig underdressed.
Familie Polyakow schaute mich erwartungsvoll an. Etwas unsicher, was nun zu tun sei, hob ich mein Glas und sagte: »Liebe Polyakows, ich möchte mich ganz herzlich für die nette Einladung bedanken. Da das nun eine Art Arbeitsessen ist, habe ich auch etwas mitgebracht …« Ich griff in meine Handtasche und holte den Schriftsatz nebst Chardonnay hervor.
»Njet! Kain Bisness. Ärrst essen«, rief Rostislav, griff nach dem Wein und deutete auf den Tisch. »Sakusski!«
»Vorspeisen«, übersetzte Artjom.
Ach, das sind erst die Vorspeisen, dachte ich, na dann, und steckte die Papiere wieder weg.
Das Gelage begann. Tapfer arbeitete ich mich durch Unmengen von Speisen, die auf meinen Teller geschaufelt wurden, begleitet von den charmanten Erklärungen Artjoms, was ich da jeweils zu mir nahm. Mein Teller leerte sich nie. Kaum hatte ich einen Happen der fremden Köstlichkeiten vertilgt, wurde mir mit wohlwollenden Blicken nachgelegt.
Es gab eingelegte Salzgurken, eingelegte Tomaten, eingelegte Pilze. Diverse Salate – mit Hering und roter Bete, mit Hühnchen, Kartoffeln und Erbsen, mit Kohl und Nüssen, alle mit Mayonnaise. Gekochte Zunge, geräucherten Fisch, Minipfannkuchen mit Schmand und Kaviar.
Und dazu schließlich doch Wodka, der in große Wassergläser geschenkt und mit Todesverachtung heruntergestürzt wurde. Vor jeder Runde stand Rostislav auf, brachte brüllend einen Toast aus – zumindest nahm ich an, dass es einer war –, und die anderen antworteten ebenso brüllend »Wasche sdarowje!« Nach dem dritten Toast brüllte ich mit und warf mein Glas an den Stamm des Apfelbaums, was von meinen Gastgebern erstaunt, aber kommentarlos registriert wurde.
Nach den Sakusski gab es eine Brühe, in der kleine, mit Fleisch gefüllte Teigtaschen schwammen.
»Tortellini!«, rief ich.
»Pelmeni«, verbesserte mich Darya.
Dann kamen die Fleischspieße.
Danach gab es Buttercremetorte, dann Gebäck, Pralinen und starken schwarzen Tee.
Mir war ein wenig übel.
»Könnte ich wohl noch einen klitzekleinen Wodka haben? Zur Verdauung?«, fragte ich schüchtern. Rostislav schenkte mein Glas randvoll und betrachtete mich mit einem milden Lächeln.
»Jetzt müssen Sie etwas sagen«, flüsterte Artjom mir zu, »in Russland heißt es: Trinken ohne Trinkspruch ist Trunksucht.«
Mit kleinen Gleichgewichtsstörungen erhob ich mich und lallte feierlich: »Ich trinke auf das Wohl meiner wunderbaren Gastgeber. Und auf unseren gemeinsamen Erfolg. Eines sage ich Ihnen: Reimers mache ich platt. Platt mach ich den!« Ich leerte mein Glas in einem Zug, Artjom übersetzte, das Ehepaar Polyakow klatschte begeistert.
Während des Essens hatte ich immer wieder versucht, das Gespräch auf den eigentlichen Grund meines Kommens zu lenken. Ohne Erfolg.
»Ärrst essen!« oder »Ärrst trinken!«, sagte Rostislav jedes Mal und füllte auf.
Nach dem Genuss des wunderbaren, aber schweren Mahls und diverser alkoholischer Getränke – neben Wodka wurden auch Wein und Sekt gereicht – stand mir der Sinn überhaupt nicht mehr nach Dingen wie Streitwert, Schriftsätzen oder Gerichtskosten.
Was soll’s, dachte ich, morgen ist auch noch ein Tag. Seit langer Zeit fühlte ich mich erstmals wieder wohl. Das schrieb ich zum Teil dem Hochprozentigen zu, aber auch den Polyakows, die ich mittlerweile so originell wie reizend fand.
Ihre Aufmerksamkeiten während des Essens, ihr offensichtliches Bestreben, mir alles recht zu machen und mich zu umsorgen, versetzten mich in einen Zustand tiefer Behaglichkeit. Ich kam mir vor wie ein satter Säugling. Gern hätte ich ein Bäuerchen gemacht.
Da die Nacht kühl war, brachte Darya mir zwischen den Gängen eine Decke, Rostislav hatte Holzscheite entfacht. Ich kuschelte mich in das kratzige Ding, das nach Hund roch, und starrte in die Flammen.
Artjoms Mutter war am Tisch beim Armetätscheln eingeschlafen, schwer ruhte ihre Hand auf meiner, sie schnarchte mit Wassja im Duett. Rostislav hatte sich mit einem Akkordeon abseits ans Feuer gesetzt und sang leise traurige Lieder, stimmlich nicht ganz sicher, aber voller Gefühl. So muss es in der Taiga sein, bildete ich mir ein, genau so.
Der Sohn des Hauses war dichter an mich herangerückt und schenkte mir Wein ein. Attacke, Paula, dachte ich, die Gelegenheit ist günstig!
»Herr Polyakow«, begann ich mit gelockerter Zunge, »was machen Sie eigentlich beruflich?«
»Ich richte Bankette aus, Feiern, Kongresse – in ganz Deutschland. Hauptsächlich für Landsleute, die in Deutschland leben oder hier geschäftlich zu tun haben.«
»Also ein Partyhengst?«, kicherte ich debil.
»Nein, nein. Ich würde mich eher als Event-Manager bezeichnen, auf gehobenem Niveau.«
Event-Manager, aha, ein durchaus ehrbarer Beruf.
»Und Ihr Vater? Sie erzählten, dass er oft in Italien und der Schweiz ist.«
»Hauptsächlich in Italien, ja. Er handelt mit Stoffen.«
»Mit Stoffen?«
»Genau. Er fährt zum Beispiel nach Mailand, kauft dort feines Tuch, lagert die Ware in Deutschland zwischen und verkauft sie dann an Textilfabrikanten in Russland, die auf der Suche nach guter Qualität sind.«
Modebranche. Feines Tuch. Stoffe, die von Italien über Deutschland bis nach Russland exportiert werden. In jener lauschigen Nacht klang das mehr als plausibel und erklärte zugleich den ausgefallenen Kleidungsstil der Polyakows.
»Und wie lange leben Sie schon in Deutschland?«
»Seit über sechzehn Jahren.«
»Ach, und Ihre Mutter spricht immer noch kein Deutsch?«, platzte es aus mir heraus.
»Nun ja«, Artjom zögerte, »Mam ist so sensibel. Unsere Flucht aus Moskau hat sie damals sehr verstört, sie ist irgendwie in die innere Immigration gegangen und hat sich lange völlig aus dem Leben zurückgezogen. Noch nicht einmal Cello hat sie mehr gespielt. In letzter Zeit allerdings hatte ich das Gefühl, dass sie sich wieder ein wenig öffnet. Und dann kommt dieses Schwein und nimmt ihr das Wertvollste! Ich weiß nicht, ob sie sich davon noch einmal erholt, mit Ende fünfzig …« Artjoms Stimme schwankte.
Merkwürdig, dachte ich, Darya kommt mir so handfest vor, gar nicht zart besaitet, aber ich kenne sie ja nicht. Neben mir unterdrückte Artjom trockene Schluchzer. Um ihn zu beruhigen und weil der Wein mich mutig und neugierig gemacht hatte, versuchte ich es mit einem Themenwechsel. Ich legte meine Hand auf seinen Arm – das schien mir eine landestypische Geste zu sein – und fragte: »Sie sagten gerade, Sie seien aus Moskau geflohen. Mögen Sie mir mehr davon erzählen?« Er mochte.
Wie ich schon wusste, war seine Mutter eine in der Sowjetunion nicht unbekannte Solocellistin, ihre ganze Familie hatte sich seit Generationen der Musik verschrieben. Sein Vater Rostislav hatte als Professor für Geophysik an der Lomonossov-Universität gearbeitet, er entstammte einer Sippe berühmter Naturwissenschaftler und Mediziner. Dann kamen Gorbatschow und Glasnost und Perestroika, und das ganze marode System brach zusammen. Viele Betriebe und Institutionen konnten keine Gehälter mehr zahlen. Auch Rostislav an der Lomonossov war davon betroffen. Um seine Familie zu ernähren, stieg er nebenbei in die Modeboutique seines entfernten Cousins Maxim Moissejewitsch Komarow ein.