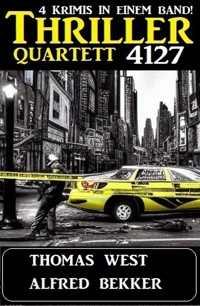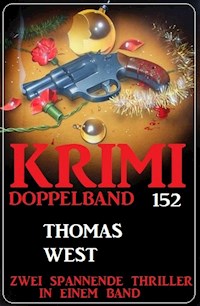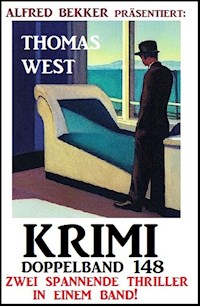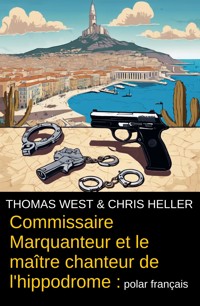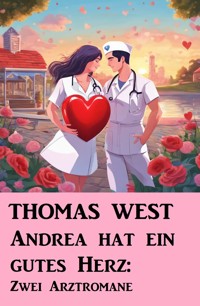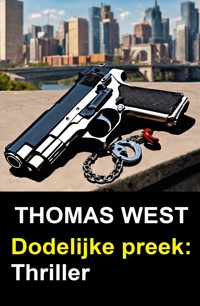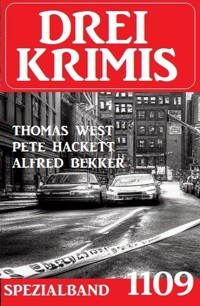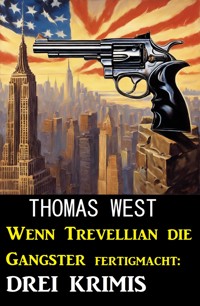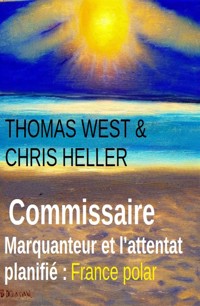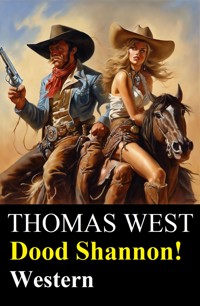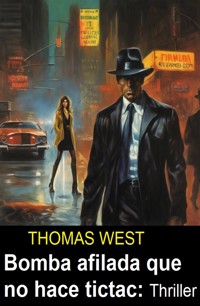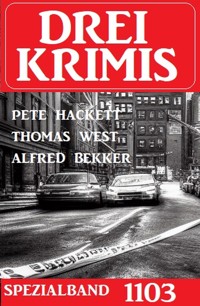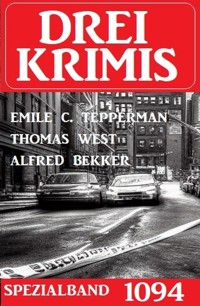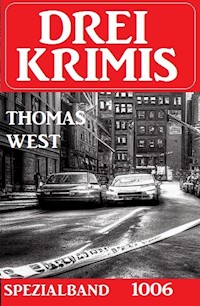
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis von Thomas West: Wenn du erbst, bist du tot Tödliche Nebenrolle Verhängnisvolle Erpressung Es scheint ein genialer Plan zu sein, um einen Schwerverbrecher aus dem gut bewachten Rikers Island herauszuholen: Gleich mehrere Wächter unter Druck zu setzen und zur Mitarbeit zu erpressen, das gilt besonders für den Gefängnisdirektor, dessen Frau entführt wurde. Als das FBI eingeschaltet wird, scheint es bereits zu spät zu sein. Doch geht es wirklich um Rabian und seinen Kumpan? Als Trevellian und Tucker eingreifen, scheint plötzlich alles verkehrt zu laufen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas West
Inhaltsverzeichnis
Drei Krimis Spezialband 1006
Copyright
Wenn du erbst, bist du tot
Tödliche Nebenrolle
Verhängnisvolle Erpressung
Drei Krimis Spezialband 1006
Thomas West
Dieser Band enthält folgende Krimis
von Thomas West:
Wenn du erbst, bist du tot
Tödliche Nebenrolle
Verhängnisvolle Erpressung
Es scheint ein genialer Plan zu sein, um einen Schwerverbrecher aus dem gut bewachten Rikers Island herauszuholen: Gleich mehrere Wächter unter Druck zu setzen und zur Mitarbeit zu erpressen, das gilt besonders für den Gefängnisdirektor, dessen Frau entführt wurde. Als das FBI eingeschaltet wird, scheint es bereits zu spät zu sein. Doch geht es wirklich um Rabian und seinen Kumpan? Als Trevellian und Tucker eingreifen, scheint plötzlich alles verkehrt zu laufen.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER A. PANADERO
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Wenn du erbst, bist du tot
Krimi von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 121 Taschenbuchseiten.
Der Tod von June Berkeley war unvermeidbar, denn ihre Partnerin Donna Richardson ist daran interessiert, die plötzlich aufgetauchte Erbschaft selbst in die Finger zu bekommen. Jesse Trevellian und seine Kollegen werden bei einer Kanu-Tour von einem seltsamen Kauz aus einem reißenden Fluss gerettet. Niemand hätte daran gedacht, dass ausgerechnet Brian Silverwood der einzige noch lebende Verwandte der Toten ist. Als Donna davon erfährt, reift in ihr ein skrupelloser Plan, den die FBI-Agenten zunächst nicht durchschauen.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker.
© by Author
© dieser Ausgabe 2017 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
1
Freitagvormittag. Gegen elf wachte Donna auf und tat, was sie in letzter Zeit oft zu tun pflegte. Beunruhigend oft zu tun pflegte. Sie griff nach der Ginflasche auf dem Nachttisch, schenkte sich das gebrauchte Glas daneben halbvoll ein und steckte sich eine Zigarette an. Und begann zu grübeln.
Grübelte wie jeden Morgen in letzter Zeit darüber nach, wie sie aus der verdammten Tretmühle ihres Lebens ausbrechen könnte. Aus ihrer chronischen Finanzkrise. Aus ihrem öden Job als Maskenbildnerin am Roundabout-Off-Theater am Broadway, wo sie einen Spitzenjob als everybody′s Arschloch hatte. Und aus ihrer festgefahrenen Beziehung mit der todlangweiligen und zwanzig Jahre älteren Jane Berkeley.
Dann klingelte es. Donna ignorierte es zunächst. Doch wer immer da vor der Haustür stand und klingelte – er schien sich für wahnsinnig wichtig zu halten. Denn er klingelte ein zweites Mal. Und ein drittes Mal. Donna stieß einen Fluch aus und stieg aus dem Bett.
Damit tat sie den ersten Schritt aus der Tretmühle ihres Lebens. Den ersten Schritt zu einer tödlichen Veränderung.
Davon hatte sie natürlich nicht die Spur eines Schimmers, als sie in Janes schwarzen Morgenmantel schlüpfte und zur Wohnungstür schlurfte. Sie drückte den Türöffner. Im Erdgeschoss hörte sie die Haustür aufgehen. Rasche Schritte eilten die vier Treppen ins zweite Obergeschoss hinauf.
Der Briefträger. Ein Neuer. Ein junger Afro, dessen Gesicht glänzte, wie die Haut einer gewienerten Avocado. „Mrs. Jane Berkeley?‟, strahlte er.
„So ist es.‟ Donna stemmte die Hände in die Hüften und streckte die Brust heraus, so dass die Kragenaufschläge des Morgenmantels etwas auseinanderfielen, und die Ansätze ihres nicht eben spärlichen Busens sichtbar wurden. Und sie sagte Ja. Einfach so.
„Ein Einschreiben.‟ Der junge Schwarze reichte ihr einen Brief und dann eine Schreibkladde, auf die eine Liste geklemmt war. „Eine Unterschrift bitte, Mrs. Berkeley.‟
„ber ja doch, junger Mann.‟ Donna zwinkerte ihm zu. Anders als Jane stand sie auch auf Männer. Sie suchte Janes Namen in der linken Spalte und setzte ihre unleserliche Unterschrift in die rechte. Nur den Nachnamen – Richardson. Ein undeutliches Gekritzel. Es hätte genauso gut Miller, Brown oder Washington heißen können.
Der junge Afroamerikaner verschlang die zierliche Frau mit dem wasserstoffgebleichten Kurzhaarschnitt mit sehnsüchtigen Augen. Dann nahm er die Kladde wieder entgegen, tippte mit dem Zeigefinger seiner Rechten an seine Schirmmütze und lief die Treppe hinunter. Donna schloss die Wohnungstür und ging mit dem Brief zurück in ihr Bett. Oder genauer gesagt: In Jane Berkeleys Bett.
Sie hätte den Brief in Janes Arbeitszimmer auf den Schreibtisch neben Janes PC legen können. Oder in die Küche auf die Anrichte, wo sich die Tageszeitungen und die Post der letzten drei Tage stapelten. Seit Jane auf Dienstreisen war. Oder wenigstens auf den Telefontisch neben der Wohnungstür.
Aber Donna nahm ihn mit ins Bett und öffnete ihn. Indem sie das tat, entschied sich das Schicksal von einem halben Dutzend Menschen. Donnas Schicksal mit eingeschlossen.
Der Brief war von einem Züricher Rechtsanwalt. Ein Rechtsanwalt, der eine Schweizer Bank vertrat. Er sei bevollmächtigt, so entnahm Donna dem Brief, Mrs. Jane Berkeley davon in Kenntnis zu setzen, dass sie und ihr Onkel nach langen Bemühungen der Bank als Rechtsnachfolger eines Kontoinhabers bei der betreffenden Bank ausfindig gemacht worden seien. Eines Kontos, auf dem eine beträchtliche Summe Geld ruhte.
Eine beträchtliche Summe Geld, so hieß es in dem Brief. Donna drückte ihre Zigarette aus. Sie schwang ihre Beine aus dem Bett und las ein zweites Mal.
Es ging um ein Konto aus den vierziger Jahren. Ein Konto, auf dem ein jüdischer Industrieller sein Vermögen vor den Nazis in Sicherheit gebracht hatte. Ein Großvater mütterlicherseits von Jane Berkeley. Und ein Onkel, ebenfalls mütterlicherseits, von Jane Berkeley. Also ein Bruder ihrer Mutter, oder wie ...?
Donna schwirrte der Kopf. Zusammen mit Jane hatte sie den jüngeren Bruder von Janes Mutter einmal besucht. Als er nach einem Bergunfall mit gebrochenen Rippen und gequetschten Nieren halbtot auf der Intensivstation des North General Hospitals lag. Und danach noch zweimal, während er sich zuhause von seinem Unfall erholte. Ein merkwürdiger Kauz. Mit einem merkwürdigen Gesicht, das Donna nie vergessen hatte.
Sie leerte ihr Glas, griff nach der Flasche und füllte es bis zum Rand. Dann zündete sie sich eine Marlboro Light an und las zum dritten Mal.
Die Adresse Ihres Onkels, so hieß es in dem Brief, konnten wir leider nicht ausfindig machen. Den US-Behörden ist ein Bürger obengenannten Namens nicht bekannt. Bitte setzen sie sich mit uns in Verbindung, und teilen Sie uns die von Ihnen gewünschten Modalitäten der Geldtransaktion und die Adresse und gegebenenfalls den neuen Namen Ihres Onkels mit. Selbstverständlich ist mein Mandant, hier folgte der Name der Schweizer Bank, daran interessiert, mit Ihnen als Rechtsnachfolger des obengenannten Kontoinhabers auch in Zukunft in beiderseitigem Interesse ..., und so weiter, und so weiter.
Donna legte den Brief auf den Nachttisch. Eine beträchtliche Summe Geld ... Sie starrte auf ihre grau lackierten Zehennägel. In ihrem Hirn jagte ein Gedanke den nächsten. Eine beträchtliche Summe Geld …
Ein Gesicht schälte sich aus den vielen Bildern in ihrem Kopf. Das Gesicht eines Mannes, den sie einmal für eine Casting Agentur fotografiert, und der ihr hinterher den einen oder anderen Gefallen getan hatte.
Sie betrachtete das Gesicht auf ihrer inneren Bühne mit den Augen einer Maskenbildnerin. Das Gesicht gefiel ihr. Als sie aufstand und zum Telefontisch ging, hatte sie längst eine Entscheidung gefällt, die man nicht jeden Tag fällt. Eine Entscheidung, die nur wenige Menschen in ihrem Leben fällen. Die Entscheidung zu töten.
Donna wählte die Nummer der Auskunft der New York Telephone Company.
„Bitte geben Sie mir die Nummer von Mr. Louis Mood‟, sagte sie. „Louis Mood, genau ... nein, ich kenne seine genaue Adresse nicht, er wohnt nördlich der East Hundertfünfundzwanzigsten ... in der Bronx, genau ...‟
2
Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Der Sonntag, an dem ich Brian Silverwood kennenlernte, war so einer, schätze ich. Man läuft nicht allzu oft einem verrückten Freak wie Brian über den Weg. Und auch dem Tod läuft man nicht allzu oft über den Weg. Selbst in unserer Branche nicht.
An jenem Tag liefen wir beiden über den Weg. Erst dem Tod, und dann Brian.
Wir hatten uns für ein langes Wochenende in die Adirondack Mountains verzogen. Milo, Orry und ich. Und ein paar Wildwasserkanuten des Kanu-Clubs der Columbia University.
Ein Professor für Kunstgeschichte war mit von der Partie. Drei seiner Studenten und zwei Medizinstudentinnen. Ein munteres Völkchen. Ein bisschen sportversessen vielleicht, aber sehr gesellig. Wir hatten eine Menge Spaß miteinander. Jedenfalls während der ersten zwei Tage.
Vor allem die beiden Frauen sorgten für Stimmung. Nancy und Liz. Dicke Freundinnen. Sie konnten 'herumalbern und Witze reißen, bis die ganze Gruppe vor Lachen wieherte. Es steckte einfach an. Liz hatte eine Art, frivole Witze zum Besten zu geben, die selbst dem abgebrühten, über sechzigjährigen Professor die Schamröte ins Gesicht trieb – bevor er in Tränen ausbrach vor Lachen.
Natürlich wurde um die Wette geflirtet. Die zwei Frauen waren nicht nur sympathisch, sondern ausgesprochen attraktiv – und Nancy war noch zu haben. Alle wetteiferten um ihre Gunst. Alle – außer Orry.
Liz war nämlich Orrys Freundin zu der Zeit. Und die größte Supermacht der Welt hatte sie gerade erst in ihren süßen Würgegriff genommen. Deswegen hielt er sich mit dem Flirten ziemlich zurück, deswegen seine plötzliche Begeisterung für Kanu-Ausflüge in wilden Gewässern, und deswegen unsere Connection zu den Sportleuten. Milo und ich, immer offen für etwas Neues, hatten uns ein paar Wochen zuvor von Orry in den Kanuten-Verein mitnehmen lassen. Und wie es so geht: Wir fanden Spaß daran, in Gebirgsflüssen durchs Grüne zu paddeln, und hatten uns nach ein paar Lehrgängen auf eine Kanu-Exkursion im Quellgebiet des Hudsons eingelassen.
So weit, so gut – jedenfalls kam dann dieser unvergessliche Sonntag. Wir verbrachten die Nacht in einer Blockhütte in der Gegend der Blue Mountains. Die Kanutenfanatiker von der Universität wollten einen kleinen Gebirgsfluss zum Indian Lake hinunterfahren. Und natürlich hatten Milo, Orry und ich nichts dagegen einzuwenden.
Wir standen also sehr früh auf, packten unsere Sachen, und ließen die Kanus zu Wasser. Das Flüsschen strömte nicht gerade behäbig vor sich hin, machte aber auch keinen besonders gefährlichen Eindruck. Während der ersten sechs, sieben Meilen jedenfalls nicht. Am späten Vormittag zog sich der Himmel zu, und zwar innerhalb weniger Minuten.
„Hast du den Wetterbericht gehört?‟, rief ich Milo zu, der hinter mir paddelte. Er schüttelte den Kopf. Auch Orry hatte keinen Wetterbericht gehört. Der Professor hatte ihn sicher gehört, aber der paddelte an der Spitze der Gruppe.
Es fing an zu regnen. Was heißt: Es fing an zu regnen! - Wie aus tausend gebrochenen Hauptleitungsrohren klatschte das Wasser auf einmal aus den schwarzen Wolken. So dicht war der Regen plötzlich, dass ich Orry vor mir zeitweise aus den Augen verlor.
Praktisch von einer Sekunde auf die andere schossen rechts und links von uns Wasserfontänen aus dem zerklüfteten Felsufer in den Fluss, und die wilden Fluten warfen unsere Kanus hin und her wie Papierschiffchen.
„Ans Ufer!‟, hörte ich Milo hinter mir brüllen, und Orry vor mir machte ein Handzeichen, das genau dasselbe sagen wollte. Offenbar hatten auch unsere Profikanuten an der Spitze gerafft, dass die Sintflut ausgebrochen war. Aber paddel mal ans Ufer, wenn die Wasser unter dir mit der Kraft und der Geschwindigkeit einer panischen Wildpferdeherde vorwärts schießen!
Ich tat mein Bestes. Stieß das Paddel rechts und links ins Wasser, verlagerte blitzschnell mein Körpergewicht, schrammte an Steinen vorbei und balancierte das Kunststoffboot über peitschende Wogen und durch schäumende Wirbel.
Und dann war es zu spät, ans Ufer zu steuern. Das Unwetter hatte uns uns kurz vor einem Steiluferabschnitt des Flusses erwischt. Rechts und links von uns ragten plötzlich zerklüftete Felswände auf. Das wild gewordene Wasser warf sich gegen sie, verspritzte in ihren schroffen Aushöhlungen und tobte an ihnen hoch, als wollte es aus dem Flussbett ausbrechen.
Wir hatten null Chance, unsere Boote irgendwo ans Ufer zu setzen.
Rasend schnell schossen Steilwände und Felsbrocken an uns vorbei. Wir waren nur noch damit beschäftigt, das Kentern unserer Boote zu verhindern. An Steuern war längst nicht mehr zu denken – die entfesselte Kraft des Wassers riss uns einfach mit sich.
Durch den Schleier des Platzregens hindurch sah ich die Verengung. Die Felswände schienen fast zusammenzustoßen, und die Wasser drängten sich mit atemberaubender Geschwindigkeit auf das Nadelöhr zu. Es war noch etwa dreihundert Meter von uns entfernt.
Es gab kein Entkommen – jeder von uns würde unweigerlich in die Stromschnelle hineingerissen werden. Schon sah ich die ersten Boote kentern. Farbtupfer wirbelten durch den Regenschleier – Schwimmwesten der Kanuten vorne an der Spitze. Sie tauchten auf und unter, versuchten, sich an ihren umgekippten Booten festzuhalten, und wurden in das Nadelöhr hineingedrückt, wo das Wasser zu einer mächtigen Springflut anschwoll.
Wie Pfeile schossen zwei Kanus über die Stromschnelle, wurden von ihr in die Luft katapultiert, und verschwanden dann aus meinem Blickfeld. Leere Kanus …
„Das überlebt keiner!‟, brüllte Orry über die Schulter zurück. „Wir kentern lieber und versuchen, uns an irgendeinem Stein festzuhalten!‟ Er schrie heraus, was mir auch durch den Kopf geschossen war. Plötzlich sah ich einen grünlichen Schatten im Felsen fünfzig Meter vor und knapp zwei Meter über uns. Ein Mensch – er winkte! Dann wirbelte etwas durch den Regenschleier auf die andere Uferseite – ein Seil! In der Felswand der anderen Uferseite entdeckte ich einen zweiten Schatten. Sekunden später straffte sich ein Seil über die tosenden Wildwasserfluten.
„Das Seil!‟, brüllte ich. Orry gab meinen Schrei weiter. Schon klammerten sich die ersten Kanuten an der rettenden Leine fest. Ich sah, wie Orry sein Paddel wegwarf, die Arme ausstreckte, und nach dem Seil griff. Die Spitze seines Kanus bäumte sich auf, Orrys Körper glitt aus der Spritzdecke, das Boot versank in den Fluten, tauchte auf, tanzte fast senkrecht auf den Wogen und schoss dann der Todesfalle entgegen.
Das Gewicht von vier oder fünf Kanuten zog das Seil tief auf die Wasseroberfläche hinunter. Ich ließ das Paddel los und griff zu. Sekunden später sprang Milo neben mir in die Rettungsleine.
Langsam arbeiteten wir uns durch das Wasser und über die Steine. Immer noch klatschte der Regen aus dem schwarzen Himmel. Nacheinander erreichten wir das Steilufer. Eine Strickleiter hing aus der Felswand in den Fluss herab. Ich wartete, bis Orrys Beine aus meinem Blickfeld verschwanden. Dann fasste ich nach den Sprossen und zog mich hoch.
Eine Hand streckte sich mir entgegen. Sie griff kurz und hart zu und riss mich auf den Felsvorsprung. Für Augenblicke sah ich in ein stoppelbärtiges, zerfurchtes Gesicht. Schmale, graue Augen blitzen mich an.
Zwei Stunden später saßen wir in warme Decken gehüllt in einer Kote. Ein Feuer brannte in der Mitte des Zeltes. Der Rauch zog durch die Öffnung in der Zeltspitze ab.
Der Professor und Nancy fehlten.
Wir schlürften heißen Tee und schwiegen. Mir gegenüber hockte der Mann mit dem Stoppelbart und dem Furchengesicht. Über sein Handy telefonierte er mit der Rangerstation in Atwell. Gleich vom Fluss aus hatte er die Parkaufsichtsbehörden alarmiert. Längst waren Rettungsspezialisten in Hubschraubern unterwegs, um nach Nancy und dem Professor zu suchen.
„Nichts Neues‟, knurrte der Mann und steckte sein Handy weg. „Jeder Idiot, der heute morgen den Wetterbericht gehört hat, hat gewusst, dass ein Unwetter aufzieht!‟ Vorwurfsvoll blitzte er uns an. Weißgraues Stoppelhaar überzog seinen schmalen Schädel. Im linken Ohr glänzte ein kleiner Goldreif.
„Wir dachten, wir würden den Indian Lake noch vor dem Unwetter erreichen‟, verteidigte einer der Studenten uns kleinlaut. Zum ersten Mal erfuhr ich, dass einige unserer Gruppe über die Wetterlage informiert waren.
„Das Denken ist nicht jedermanns Sache‟, knurrte der Mann.
„Danke, Mister‟, sagte ich, „Ich glaube, Sie haben uns das Leben gerettet.‟
„Glaub′ ich auch ...‟
Wir stellten uns vor. Der Graukopf musterte jeden von uns mit einer Mischung aus Wachsamkeit und Misstrauen. „Freut mich‟, brummte er, als wir alle unsere Namen genannt hatten. „Ich bin Brian Silverwood. Sagt Brian zu mir.‟
Wir erfuhren nicht viel von ihm. Nur soviel, dass er als eine Art Privatscout Überlebenstraining in der Wildnis durchführte.
Die Sorge um Nancy und den Professor wollte keine erleichterte Stimmung über unsere eigene Rettung aufkommen lassen. Ständig sah ich die verdammte Stromschnelle vor mir, und sah die leeren Kanus durch die Luft schießen.
Am späten Nachmittag dann die niederschmetternde Nachricht: Man hatte Nancy und den Professor aus dem Wasser gefischt. Mit Schädelfrakturen und gebrochenen Rippen und Beinen. Beide lagen im Koma und schwebten in akuter Lebensgefahr. Keiner von uns sprach ein Wort. Schweigend drückten wir Brian und seinen Leuten die Hände und stiegen in zwei Helikopter, die uns in unser Basislager brachten.
Ein paar Wochen noch, und wir würden uns intensiver mit Brian beschäftigen, als uns lieb sein konnte …
3
Auf dem Schreibtisch stapelten sich die Akten. Stickige Luft stand im Raum. Jane Berkeley riss das Fenster ihres Büros auf. Zwölf Stockwerke unter ihr hasteten Menschen durch frühsommerlichen City Hall Park. Frauen und Männer mit Aktenkoffern unterwegs in die City Hall, zur Wallstreet oder einem der benachbarten Bürotürme.
Jane war ziemlich groß für eine Frau – hundertsechsundsiebzig Zentimeter, um genau zu sein – sie trug streichholzkurzes, schwarzgefärbtes Haar. Ein anthrazitfarbener Hosenanzug in klassischer Linie verhüllte den dürren Körper der 46jährigen.
Sie atmete tief durch. Dann drehte sie sich um und betrachtete das Chaos auf ihrem Schreibtisch. So sehr sie die Abwechslung einer Dienstreise schätzte – die Rückkehr in ihr Chefbüro der Manhattaner Verkehrsbehörde war jedes Mal ein Albtraum. Natürlich hatte sie einen Stellvertreter – aber die meisten Chefsachen landeten dennoch auf ihrem Schreibtisch.
Die Woche in Washington hatte ihr gut getan. Andere Gesichter, andere Kneipen. Sie hatte an einer Konferenz von Verkehrsspezialisten aller Ostküstenstaaten teilgenommen. Die Infrastruktur des Straßennetzes für das neue Jahrtausend musste angedacht werden.
Jane seufzte. Das Gesicht der kleinen Sekretärin des Senators für Verkehrswesen blitzte auf ihrer inneren Bühne auf. Die letzten beiden Nächte hatte sie ihr Einzelzimmer mit der jungen Frau geteilt …
Jane ließ sich in ihren hochlehnigen Ledersessel fallen, rollte an den Schreibtisch heran, und schaltete ihren Computer ein. Dann begann sie, sich durch den Aktendschungel zu arbeiten.
Konzentriert arbeitete sie sich bis zur Mittagszeit durch. Sie hatte ihre Chefsekretärin angewiesen, alle Termine, Telefonate und so weiter auf den frühen Nachmittag zu verlegen. Natürlich wollte sie ihre leitenden Mitarbeiter über das Ergebnis der Tagung informieren. Und eine Menge Leute, die sie die Woche über nicht erreicht hatten, würden am Nachmittag anrufen.
In der Kantine des Municipal Buildings aß sie einen gemischten Salat und trank eine Flasche Wasser. Danach ging es sofort wieder ins Büro. Ein Blick auf die Uhr – noch genau eine halbe Stunde Zeit bis zum Meeting mit ihren Abteilungsleitern.
Ihr Handy orgelte los. „Shit ...‟ Jane liebte keine Privatgespräche während der Arbeitszeit. Trotzdem griff sie nach dem Handy. „Jane Berkeley?‟
„Hi, Darling – was wünscht du dir heute Abend zum Essen.‟ Donnas aufgekratzte Stimme.
Jane verdrehte die Augen. „Gott, Donna! Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du mich nicht in der Behörde anrufen sollst!‟ Jane Berkeley war eine furchtlose Frau. Sonst hätte sie es nicht bis ins Chefzimmer der Manhattaner Verkehrsbehörde gebracht. Was sie aber fürchtete, war die ständig wie ein Damoklesschwert über ihr hängende Möglichkeit, einer ihrer Mitarbeiter könnte ihre sexuelle Vorliebe für Frauen herausfinden.
In den Manhattaner Chefetagen war man in letzter Zeit ziemlich rigide, was den Umgang mit Homos und Lesben betraf. Da machte auch die Stadtverwaltung von Manhattan keine Ausnahme.
„Stell dich nicht so an, Darling‟, kicherte Donna. „Ich hab′ extra die Handynummer benutzt. Also – was willst du essen? Ich koch′ dir was Schönes.‟
Jane runzelte die Stirn. Schon gestern Abend, nach ihrer Rückkehr aus Washington, war Donna ungewöhnlich nett gewesen. Als würde sie ahnen, was die Stunde geschlagen hatte.
„Du hast schon seit Wochen nicht mehr für mich gekocht‟, sagte sie.
„Sei nicht nachtragend, Darling‟, flötete Donna. „Ich hatte eine Krise. Vergessen und vorbei. Jetzt wird alles wieder wie früher. Also, raus mit der Sprache – was willst du essen?‟
Alles wieder wie früher ... Jane dachte an die kleine Sekretärin des Senators. „Hör zu, Donna – vergiss die Küche und bestell uns einen Tisch in der Oyster Bar, sagen wir für neun Uhr. Bis um acht brauch′ ich heute sicher, bis ich das Chaos vom Schreibtisch hab′. Ich lad′ dich zum Fischessen ein.‟
„Hey! Wir waren schon wochenlang nicht mehr essen!‟, jubelte Donna. „Ich freu′ mich, Darling.‟
Jane legte das Handy neben ihre Telefone und starrte es an. „Es wird unser letztes gemeinsames Essen sein, Donna ...‟, murmelte sie.
Eine Woche Abstand von ihrer Freundin hatten ihr genügt, um die lange fällige Entscheidung zu treffen. Und natürlich die kleine Sekretärin ... Heute Abend würde sie Donna den Laufpass geben.
Seit zwei Jahren hielt sie die Fünfundzwanzigjährige aus. Seit Donna wieder zu schnupfen und zu trinken angefangen hatte, gab es keinen Tag ohne Streit mehr. Außerdem hielt Jane sie inzwischen für eine egozentrische Schlampe. Tagsüber faulenzte sie im Bett herum, und nachts – nach zwei, drei Stunden sogenannter Arbeit – tobte sie in irgendwelchen Theaterkneipen herum. Alles auf Janes Kosten.
„Schluss damit‟, zischte Jane. Allein die einmal getroffene Entscheidung erfüllte sie mit ungeahnter Erleichterung. Aber sie machte sich nichts vor: Sie würde mit harten Bandagen kämpfen müssen, bis Donna endlich ihre Siebensachen packen und verschwinden würde.
Jane konzentrierte sich wieder auf ihre Arbeit. Akten, Akten, Akten. Dann das Meeting mit den Abteilungsleitern. Dann Telefonate ohne Ende fast bis zum Schluss der üblichen Bürozeit. Für Jane Berkeley gab es keine übliche Bürozeit. Ab fünf also wieder Akten, Akten, Akten. Bis gegen halb neun.
Ein Blick auf die Uhr. Bis um neun in der Fischbar am Grand Central Terminal – unmöglich. Sie tippte Donnas Nummer in ihr Handy. „Tut mir leid, Donna – ich komm′ zwanzig Minuten später.‟
„Kein Problem‟, flötete Donna, „überhaupt kein Problem. Ich warte auf dich. Fahr bloß vorsichtig ...‟
Jane wunderte sich über die Toleranz ihrer Freundin. Normalerweise ordnete Donna jede Unpünktlichkeit als Beziehungskrise ein.
Jane hastete zum Aufzug und fuhr in die Tiefgarage des Municipal Buildings hinunter. Die Absätze ihrer Pumps knallten auf den Betonboden. Janes Schritte hallten aus der weiten Garage wieder.
Sie schloss ihren schwarzen Golf auf und ließ sich hinter das Steuer fallen. Ein fremdartiger Geruch machte sie stutzig. Als hätte jemand in ihrem Wagen geraucht. Jane, eine fanatische Nichtraucherin, schnupperte kalten Zigarettenrauch sofort. Sollte Donna während ihrer Abwesenheit den Wagen benutzt haben? „Schlampe‟, zischte Jane und startete den Motor.
An der Garagenausfahrt setzte sie den Blinker nach rechts. Etwas Kaltes, Hartes drückte sich von links gegen ihren Hals. Eiskalter Schauer jagte von Janes Herz aus in ihre Zehenspitzen hinunter und bis in ihre Haarspitzen hinauf. Sie schnappte nach Luft, wollte schreien, aber der Schrei blieb ihr im Hals stecken.
„Du fährst die Park Row hinunter nach Süden‟, schnarrte eine Männerstimme. Sie klang rau und gleichgültig. Eine Faust legte sich von rechts auf ihre Brust. „Kapiert?!‟
Warmer Atem strich an ihrem rechten Ohr vorbei. Atem, der nach Rauch stank. Jane sah auf ihre Brust hinunter. Und sah sehnige Fingerknöchel, die sich unter einem Lederhandschuh wölbten. Sie sah eine Faust sich um den Griff einer Pistole spannen. Und sie sah in das Loch eines Pistolenlaufs.
Der Druck der Messerklinge an ihrem Hals verstärkte sich. „Mach schon!‟ Jane setzte den Blinker nach links und bog in die Park Row ein.
Die raue Stimme hinter ihr dirigierte sie in zum Broadway, dann nach links in die Rector Street, und dann nach rechts über den Trinity Place in den Brooklyn Batterie Tunnel hinein.
„Was wollen Sie von mir?‟, krächzte Jane, als sie ihre Sprache wieder gefunden hatte.
„Lass dich überraschen ...‟ Die Stimme klang nicht mehr ganz jung. Im Rückspiegel sah Jane einen schmalen Schädel. Ein grauer Bürstenschnitt, kürzer als ihrer, überzog ihn. Um schmale Lippen und ein kantiges Kinn herum wucherte ein Dreitagebart. „Konzentriere dich auf den Verkehr!‟ Die Faust mit der Pistole schlug ihr gegen die Brust.
Nach dem Tunnel verlangte die Männerstimme hinter Jane, dass sie den Golf in den Brooklyn Queens Express steuerte und Richtung Norden zum Ufer des East Rivers fuhr.
„Wir können reden ...‟ Janes Stimme versagte. Sie schluckte und versuchte durchzuatmen. „Sagen Sie, was Sie wollen ... Geld?‟
„So gefällst du mir schon besser‟, knurrte der Mann hinter ihr. „Geld ist vielleicht keine schlechte Idee.‟
Die Ruinen des Sunset Parks tauchten auf. Kräne, Silos, Schornsteine, verrottete Werften – immer tiefer fuhr Jane in das ehemalige Industriegebiet hinein.
„Wir ... wir könnten zu einem Geldautomaten fahren ...‟, stammelte Jane. ‟... ich heb′ Ihnen ab, was Sie brauchen ... Sie sind sicher in Not, oder ...? Ich hab′ auch Schecks dabei ...‟ Jane dachte an die kleine Walther Pistole in ihrer Handtasche.
„Bieg erst mal in die alte Raffinerie da vorne ein‟, schnarrte die Stimme.
Janes tat, was er verlangte. Ihre Knie schlotterten, als sie an ein paar Autowracks vorbeifuhr. Ihre Hände waren schweißnass und rutschten ständig vom Leder des Sportsteuers ab.
„Halt an.‟ Jane würgte den Motor ab. Die linke Hintertür wurde aufgestoßen. Durch die Windschutzscheibe sah Jane die dunklen Wasser des East Rivers. Dahinter glitzerten die Lichter der Manhattan Skyline durch den Abenddunst. Ein Schatten tauchte vor dem Seitenfenster auf. Die Fahrertür wurde aufgezogen.
„Wir können das gleich regeln.‟ Jane, die zu lächeln versuchte, erschrak vor dem hysterischen Kichern. Kam das aus ihrem Mund? Ihre Hände nestelten schon an der Handtasche herum. „Sie werden sehen – ich hab′ alles dabei: Schecks, Kreditkarten, Bargeld ...‟ Ihre zitternde Rechte griff nach der Walther. Sie zog sie heraus.
Im gleichen Moment schloss sich eine harte, knochige Faust um ihr Handgelenk. Eine Faust in einem schwarzen Lederhandschuh.
„Du Miststück!‟, fauchte der Kerl. Er riss Jane aus dem Auto. Sie schrie, als er ihr das Handgelenk zurückbog. Die Walther prallte dumpf zwischen Grasbüscheln auf. Ein Stoß in den Rücken warf Jane ins Gestrüpp zwischen den breiten Bruchstellen des Asphalts.
„Aufstehen‟, schnarrte der Mann. Jane rappelte sich hoch. Im schmutzigen Licht der Dämmerung sah sie die drahtige Gestalt des Mannes. Die schmalen Augen in seinem zerfurchten Gesicht funkelten kalt. „Zieh dich aus ...‟
„Bitte nicht ...‟, keuchte Jane. „Ich ... ich ... ich bin lesbisch, wissen Sie ...‟ In ihrer Panik verlor sie jede Kontrolle über ihre Worte. Ein Redeschwall kam über ihre Lippen. Sie hätte eine Geschlechtskrankheit, sie hätte Krebs, ein Peilsender sei in ihrem Golf eingebaut, und so weiter und so weiter.
Der grauhaarige Kerl hob seine Pistole. „Ausziehen ...‟ Jane drehte sich um und rannte los. Die verrückte Idee, in den East River zu springen und nach Manhattan hinüber zu schwimmen, erschien ihr plötzlich einleuchtender als alles andere auf der Welt.
Hinter sich hörte sie die schnellen Schritte des Mannes. Ein Schuss peitschte über das ehemalige Raffineriegelände. Ein brennender Schmerz bohrte sich in Janes Oberschenkel. Dessen Muskulatur krampfte sich zusammen – sie schlug bäuchlings auf den aufgeplatzten Asphalt.
Das Gewicht des Mannes presste ihr die Luft aus den Lungen. Wie ein Grabstein lag er auf ihr. Sie konnte nicht einmal schreien. Von fern hörte sie eine Schiffssirene tönen. Dann spürte die Messerklinge an ihrer Kehle. Das hässliche Geräusch zerreißenden Fleisches schien aus einer anderen Welt zu stammen. Noch einmal versuchte Jane zu schreien. Kein Ton drang aus ihrem Mund. Nur ein feuchtes Gurgeln unter ihrem Kinn.
Jane starrte auf die dampfende Flüssigkeit, die von irgendwoher auf den zerplatzten Asphalt vor ihrem Gesicht sprudelte. Sie starb ohne zu begreifen, dass es ihr eigenes Blut war …
4
Wir saßen im Büro unseres Chefs. Orry, Milo und ich. Der Chef und Mandy hockten am Konferenztisch und lauschten unserem Bericht.
„Die beiden sind außer Lebensgefahr‟, sagte Milo leise. „Der Professor wird wohl den Rest seines Lebens nicht mehr aus dem Rollstuhl kommen.‟
„Furchtbar‟, seufzte Mandy.
„Sie können sich nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin, Sie lebend wiederzusehen.‟ Jonathan McKee faltete die Zeitung zusammen und atmete tief durch. „Als ich heute morgen den Bericht in der New York Times las, ist mir erst Mal klar geworden, in was für eine lebensgefährliche Situation Sie sich gebracht haben, Gentlemen.‟ Er schüttelte den Kopf und sah uns an, wie mein Vater mich als kleiner Junge angeschaut hat, wenn ich mal wieder trotz seines Verbots eine Nacht allein im Wald verbracht hatte. „Sie haben doch, weiß Gott, einen risikoreichen Beruf‟, sagte unser Chef. „Können Sie sich nicht etwas weniger gefährliche Hobbies suchen?‟
Wir schwiegen betreten. Er hatte mal wieder nicht ganz unrecht, unser guter Chef.
„Wenn dieser Brian nicht gewesen wäre ...‟ Orry beendete den Satz nicht.
„Was ist das für ein Mann?‟, wollte Mandy wissen.
„Macht Extremtouren in den Rockys und den kanadischen Urwäldern‟, erzählte ich. „Und bringt zivilisationsmüden Amerikanern bei, wie sie ohne Rasierapparat und TV-Gerät in der Wildnis überleben können.‟
„Ein New Yorker?‟, erkundigte sich der Chef.
„Soviel wir wissen‟, sagte Milo. „Nur können wir seinen Namen in keinem Adressbuch und seine Nummer in keinem Telefonbuch finden. Wir suchen nach ihm, weil wir uns gern noch einmal bei ihm bedanken möchten.‟
„Versuchen Sie es mal bei der Steuerbehörde‟, schlug der Chef vor. „Und grüßen Sie ihn von mir, wenn Sie ihn finden. Wenn ich ihm einen Gefallen tun kann, soll er sich bei mir melden.‟
In der Mittagspause saßen wir in unserer Stammpizzeria in der Spring Street. In Luigis „Mezzogiorno‟.
„Was macht ihr am Wochenende?‟, wollte Orry wissen.
„Vielleicht ins Theater gehen‟, sagte Milo, „Oder vor der Glotze abhängen.‟
„Oder eine kleine Ruderbootpartie auf dem Lake im Central Park‟, grinste ich.
„Vorschlag‟, sagte Orry. „Wir schnappen uns unsere Kanus, fahren in die Catskills und paddeln auf einem harmlosen Flüsschen herum.‟
Milo und ich sahen uns unschlüssig an.
„Das ist wichtig nach so einer Erfahrung‟, behauptete Orry. „Sonst setzt sich die Angst im Kopf fest.‟
Das leuchtete uns ein. Also fuhren wir am nächsten Wochenende in die Catskill Mountains. Es war ein gutes Wochenende. Unserem Chef erzählten wir nichts davon.
5
Pit Hager glaubte seinen Ohren nicht zu trauen. Zwanzig Millionen Schweizer Franken?! Er unterdrückte den Impuls, seine Camel aus dem Jackett zu kramen. Kühl musterte er den eleganten Mann auf der anderen Seite des schwarzen Designer-Schreibtischs. Seine Mundwinkel zuckten nicht, seine Brauen wanderten nicht nach oben. Sein braungebranntes Jungengesicht blieb so reglos, als hätten sie gerade über das Wetter in Zürich gesprochen.
„Ungewöhnlich, dass jemand sich nicht meldet, wenn ihm eine Erbschaft von zwanzig Millionen Schweizer Franken in Aussicht gestellt worden ist.‟ Hager sprach gelassen, fast gelangweilt.
Der Anwalt – ein angegrauter Endvierziger, glattrasiert, mit Lesebrille auf der feinen Nase und in einem hellen Seidenanzug – setzte wieder sein weltmännisches Lächeln auf.
„Ich habe der Rechtsnachfolgerin der Familie Silberbaum natürlich keine konkrete Summe genannt‟, sagte er. „Allerdings habe ich in meinem Brief angedeutet, dass es um eine durchaus beträchtliche Summe handelt. In Absprache mit der Bank selbstverständlich.‟
Der Anwalt widersprach nicht. Also hatte Hager doch richtig gehört – Zwanzig Millionen. „Und wenn ich den Fall annehmen würde, müsste ich diese ... wie heißt sie gleich?‟
„Jane Berkeley ...‟
„... diese Jane Berkeley suchen, um ihr die frohe Botschaft zu überbringen.‟
„Genau das wäre Ihr Auftrag, Herr Hager.‟ Wieder dieses überlegene Schmunzeln. Nichts, was einen Mann wie Hager beeindrucken konnte. So lächelten sie nicht nur hier in Zürich. So lächelten sie auch in Berlin, Hamburg, Frankfurt und München, wenn sie ihre millionenschweren Deals einfädelten. Die Verlogenheit einer machtbewussten und machtbesessenen Geldclique steckte hinter diesem Lächeln. Einer Clique, die es genoss, an den Hauptschaltern der europäischen Wirtschaftspolitik zu sitzen. Und die sich bereicherte, wo immer sie konnte.
Hager hatte als hoher Beamter des Bundeskriminalamtes jahrelang gegen Wirtschaftskriminalität gekämpft. Niemand konnte ihm etwas vormachen. Wenn die Schweizer Bank, vor deren Anwalt er hier saß, auch nur die kleinste Gesetzeslücke entdeckt hätte – kein Nachkomme irgendeines in deutschen KZs ermordeten Juden würde auch nur einen Franken aus dem Vermögen seiner Vorfahren zurückerhalten. Doch der politische Druck auf die Banken war einfach zu groß. Sie mussten die Konten der Nazi-Opfer offenlegen.
„Und nicht nur diese Jane Berkeley sollen Sie finden.‟ Der Anwalt kramte in seinen Unterlagen. „Es gibt da unter Umständen noch einen zweiten Rechtsnachfolger von Jakob Silberbaum. Seine Tochter, eine verheiratete Berkeley und Mutter der erstgenannten Erbin Jane Berkeley, hatte noch einen jüngeren Bruder. Zusammen mit seiner älteren Schwester wurde er neunzehn-einundvierzig über Norwegen in die Staaten verschickt. Er kann damals nicht älter als drei oder vier gewesen sein.‟
Hager nahm das Papier entgegen, das der Anwalt ihm reichte. „Bernhard Silberbaum‟, las er laut. „Können die amerikanischen Behörden Ihnen nicht weiterhelfen?‟
„Leider nicht.‟ Der Anwalt zuckte mit den Schultern. „Wir nehmen an, dass Silberbaum junior seinen Namen geändert hat. Wenn sie seine Nichte finden – vielleicht weiß sie Näheres über diesen Mann.‟
„Also gut.‟ Hager schob die Dokumentenkopien zusammen, die der Anwalt für ihn vorbereitet hatte. „Was sagten Sie? Ein Prozent der Summe geht im Erfolgsfall als Honorar an mich?‟
Diesmal lachte der Anwalt laut. „Ich entsinne mich von null Komma fünf Prozent gesprochen zu haben. Plus Spesen natürlich.‟
„Einverstanden.‟ Hager versenkte die Unterlagen in seiner dunkelbraunen Ledermappe. „Einhundertfünfzigtausend plus Spesen.‟
Der Anwalt zog die rechte Braue hoch. „Das wären null Komma sieben-fünf Prozent.‟
„Stimmt‟, sagte Hager. „Schicken Sie mir den Vertrag in mein Hotel. Vierzigtausend überweisen Sie bitte auf mein Konto als Vorschuss, beziehungsweise als Garantiehonorar.‟
„Sie sind ein hartnäckiger Mann, Herr Hager.‟ Etwas wie Anerkennung schwang in der Stimme des Anwalts. „Aber genau deswegen haben wir uns für Ihre Dienste entschieden. Das Detektivbüro Hager & Partner genießt den Ruf, die ihm anvertrauten Fälle mit allem Nachdruck zu bearbeiten.‟
„Das will ich meinen‟, knurrte Hager.
Eine Stunde später saß er an der Theke einer Bar in der Züricher Altstadt. Mit sich allein und einer Flasche Sekt feierte er den neuen Auftrag. Er kam gerade zur rechten Zeit. Seine Bank stand ihm seit zwei Wochen auf dem Schlips, weil er mit den Ratenzahlungen für seinen Kredit in Rückstand geraten war. Die Leasingraten für seinen Wagen hatte er auch schon zwei Monate nicht mehr bezahlt.
Einhundertfünfzigtausend – das war das bei Weitem höchste Honorar, seit er sich als Detektiv selbstständig gemacht hatte. Vor drei Jahren erst hatte er seinen Dienst beim „größten Saustall der Republik‟ quittiert. So pflegte Hager das Bundeskriminalamt in Wiesbaden zu nennen. Speziell das Dezernat für Wirtschaftskriminalität, dessen Hauptkommissar er sechs Jahre lang gewesen war.
Dank seiner Beziehungen in die Wirtschaftsetagen der großen Unternehmen hatte er sich in den vergangenen drei Jahren nicht mit Peanuts herumärgern müssen – Sicherheitsmanagement, Kaufhausschnüffelei, Observationen, Beziehungsmist und so weiter. Er hatte von Anfang an einen guten Ruf als Spezialist für Industriespionage, Beweismittelbeschaffung in Korruptionsfällen und im Aufspüren von untergetauchten Schuldnern. Nun ging es eben zur Abwechslung mal darum, Menschen aufzuspüren, denen eine Bank eine Kleinigkeit schuldet.
„Zwanzig Millionen Schweizer Franken ...‟, murmelte er. „Wahnsinn ...‟ Er hob das Glas und prostete dem Mann im Barspiegel zu. Dem Mann in der Lederjacke und dem grauen T-Shirt, dem grinsenden Mann mit dem vollen, grauen Lockenschopf und den weichen, jungenhaften Gesichtszügen. Man sah Hager nicht an, dass er fast fünfzig Jahre alt war.
‟... aber einhundertfünfzigtausend sind auch schon was, oder?‟, murmelte er und leerte sein Glas.
Einen Tag später stieg er abends in seinen Fünfer-BMW. Er fuhr Richtung Basel und dann über die A 5 nach Frankfurt. Dort hatte sein Detektivbüro seinen Hauptsitz. Noch einmal einen Tag später startete er mit PAN-Am nach New York City …
6
Rechte und linke Haken prasselten auf den schwarzen Boxer nieder. Untergruben seine Deckung, trafen sein Gesicht und zwangen ihn in die Seile. Die Menge tobte. Der Ringrichter drängte sich zwischen die beiden Boxer und trennte sie. Er schob den weißen Angreifer zur Seite. Dann begann er den Schwarzen auszuzählen.
Überall Schreie und Pfiffe auf den Rängen.
„Bullshit‟, knurrte Mood. „Los, Mann – reiß dich zusammen!‟
Der Boxer hing in den Seilen wie einer, der sich nicht mehr zusammenreißen konnte. Mood sah es genau. Er war selbst lang genug Boxer gewesen. „Los, Carlos!‟ brüllte er trotzdem. „Stopfe ihm sein großes Maul!‟
Der Mann neben ihm, ein kleiner, glattrasierter Schönling in einem weißen Sommertrenchcoat, grinste ihn an. „Was ist los, Louis? Hast deine Dollars auf den Schwarzen gesetzt?‟ Er schlug dem hageren Graukopf in der verblichenen Armeejacke auf die Schulter. „War wohl′n Griff ins Klo, was?‟
„Halt die Fresse, Jimmy‟, knurrte Mood. Der Glattrasierte zog die Schultern ein. Er dämpfte seinen Beifall erheblich.
Bei Vier kam der schwarze Champion wieder auf die Beine. Mood sah, dass er die Augen aufriss, als müsste er gegen die Ohnmacht ankämpfen. Blutiger Schleim triefte von seiner aufgeplatzten Lippe. Seine Haut glänzte wie eine Erdölpfütze.
Er torkelte durch den Rest der Runde. Mit nichts weiter beschäftigt, als seine Deckung aufrecht zu erhalten.
„Verflucht, Carlos!‟, brüllte Mood. „Jetzt greif ihn endlich an!‟
Nur der Newcomer griff an. Ein Weißer aus der Bronx, dessen Namen Mood nie zuvor gehört hatte. Wie ein Pitbull ging er auf Carlos Colonia, den amtierenden Champion, los. Endlich der Rundengong. Wieder grölte die Menge. Mood spuckte seinen Gum dem Trenchcoat vor die Füße.
„Bullshit, verdammter ...!‟ Er wartete noch den Beginn der nächsten Runde ab. Aber schon nach wenigen Sekunden ging der schwarze Champion – der ehemalige Champion – zu Boden.
Mood hatte genug gesehen. Fluchend schob er sich durch die Menge und verließ die Boxarena. Fünfzig Dollar waren futsch.
Vor der Sporthalle hängte er sich in eine der Telefonzellen. Er warf einen Quarter in den Automaten und wählte eine Nummer in Chelsea. Eine krähende Frauenstimme meldete sich. „Richardson?‟
„Ich bin′s‟, brummte Mood. „Wie sieht’s aus?‟
„Ich hab′ eine Vermisstenanzeige aufgegeben.‟
„Wird schon ein Weilchen dauern, bis sie jemand findet.‟ Mood blickte sich um. Ein paar Zuschauer liefen aus der Sporthalle auf die Straße und zu den Parkplätzen. Niemand beachtete ihn. Die beiden Nachbarzellen waren leer.
„Hast du′s gemacht wie abgesprochen?‟, wollte Donna wissen. Eine fast lüsterne Neugier schwang in ihrer Stimme.
„Genau so, wie du es wolltest‟, sagte Mood. Donna, am anderen Ende der Leitung, schwieg. Als würde sie darauf warten, dass Mood ihr die Bluttat bis in alle Einzelheiten beschreibt. „Wie soll’s jetzt weiter gehen?‟, fragte er stattdessen.
„Hast du die Bücher schon gelesen, die ich dir gekauft habe?‟
„Du spinnst wohl‟, knurrte Mood. „In dem Paket waren zwölf Schwarten! Soviel hab′ ich die ganzen letzten zehn Jahre nicht gelesen! Ich bin noch beim ersten!‟
„Du musst sie lesen, Louis – alle!‟ Donnas Stimme ging in ein ärgerliches Fauchen über. „Du musst sie auswendig können. Wenn es soweit ist, musst du alles über Survivaltraining und Extremtrecking wissen!‟
„Schon okay, Baby ...‟ Ein kicherndes Paar drängte sich in die Nachbarzelle.
„Es geht um eine Menge Geld, verflucht noch mal! Und nenn mich nicht Baby ...!‟
„Okay, okay ...‟ Mood senkte die Stimme. „Wie′s jetzt weitergeht, will ich wissen, verdammt noch mal!‟
Die Frau in der Nachbarzelle nahm den Hörer von der Gabel. Der Mann stand hinter ihr und griff ihr an die Brüste. Sie wand sich und kicherte. Mood bekam Stielaugen.
„Lies die Bücher. Und beobachte ihn. Was ist mit diesen beiden Frauen?‟
„Sie besuchen ihn regelmäßig. Von der einen hab′ ich den Namen und die Adresse ‚rausgekriegt. Faye Melendez. Sie wohnt in der nördlichen Bronx. Was zu schreiben in der Nähe?‟ Mood diktierte Donna Namen und Adresse der Frau.
„Okay‟, sagte Donna. „Ich kümmer′ mich um sie. Bleib am Ball. Wir müssen alles über ihn herausfinden – seine Lebensgewohnheiten, seinen Bekanntenkreis ...‟
„Hat weiter keinen ...‟
„... seine Hobbies, einfach alles.‟
„Und dann?‟ Der Bursche in der Nachbarzelle hatte jetzt beide Hände unter dem Pullover des Mädchens stecken. Es sah aus, als würde er ihre Brüste massieren. Mood atmete tief durch. „Und dann?‟, wiederholte er, weil Donna schwieg.
„Dann legen wir ihn um ...‟
7
Die Frau war schön. Ohne Zweifel. Schade nur, dass sie ständig von der Bibel und ihrem Jesus quatschte. Brian Silverwood riss die klapprige Tür seines Hausbootes auf, trat einen Schritt zur Seite und verneigte sich tief.
„Welch eine Ehre, Lady Josephine! Treten Sie näher!‟ Er sprach laut und in einem pathetischen Tonfall. Brian liebte große Gesten und geschraubte Sätze. War das Leben etwas anders als ein einziges Theaterspiel?
„O Mann, Brian!‟ Josephine Custer verdrehte die Augen. „Wie oft soll ich dir noch sagen, dass meine Freunde mich Jossey nennen!‟
Sie musterte den drahtigen Mann mit unverhohlen kritischem Blick. Er trug ein geripptes Unterhemd über einer grauen Jogginghose. Ein ärmelloses, ehemals weißes Unterhemd. Sein graues Brusthaar quoll aus dem Ausschnitt, wie schmutzige Schneeimitation, die man an Weihnachtsbäume hängt.
Jossey trat in den großen Raum und sah sich um. An den Holzwänden hingen Landkarten, Bücher lagen auf dem abgewetzten Teppich, auf einer Spüle stapelte sich schmutziges Geschirr, auf einem kahlen Holztisch stand eine Rotweinflasche neben einem halbvollen Glas und einem überquellenden Aschenbecher.
„Zuviel der Ehre!‟, tönte Brian. Er presste die Fingerbeeren seiner Rechten zwischen die grauen Augenbrauen und schloss die Augen. „Ich darf mich zu den Freunden dieser goldhaarigen Göttin zählen!‟ Er riss die Augen auf und sah in Josseys schönes Gesicht. Ihre blauen Augen funkelten spöttisch. „Ist das wirklich wahr, Lady Josephine ...?‟
Sie merkte, dass er im Begriff war, sich vor ihr hinzuknien und ging schnell an ihm vorbei. „Ich will nie mehr hören, dass du mich als Göttin bezeichnest, hast du verstanden, Brian? Es gibt nur einen Gott.‟
Brian drehte sich von ihr weg und schloss die Tür. Sie legte schon wieder ihre Lieblingsplatte auf.
„Was darf ich Ihnen anbieten, Lady Josephine – Rotwein? Kaffee? Whisky? Einen Joint?‟
„Cola, wie immer‟, sagte sie und warf ihr blondes Langhaar über die Schulter. Sie benahm sich wie eine Frau, die sich zu Hause fühlte auf diesem Hausboot. Warf ihren Jutebeutel auf das zerschlissene Sofa unter dem runden Fenster, raffte die Kleider von einem der Stühle und legte sie ebenfalls auf das Sofa, und zog sich zwei Stühle heran. Einen, um sich zu setzen, einen um ihre Beine darauf zu legen.
„Apropos Gott – ich hab′ dich schon wieder im Gottesdienst vermisst am Sonntag. Hast du mir nicht versprochen zu kommen?‟
Josephine Custer war Pastorin der Methodistengemeinde von Tarrytown. Brians Hausboot lag zwar am Hudson Ufer Tarrytowns, aber er war Jude. Zwar ohne jeden Bezug zu irgendeiner Spur von Religiosität – aber er war Jude und kein Protestant. Jossey war das vollkommen schnurz. Für sie war Brian einer der vielen Heiden auf ihrer Bekehrungsliste. Und Brian stand noch dazu ganz oben auf dieser Liste.
„Selbstverständlich habe ich das versprochen, Lady Josephine.‟ Brian riss die Tür seines schwarz angestrichenen Kühlschranks auf und holte eine Dose Cola heraus. „Und was ich verspreche, halte ich auch. Ich lass mir doch nicht die Gelegenheit entgehen, meine Göttin auf einer Kanzel zu bewundern ...‟
„Bitte, Brian!‟
„... und ihr goldenes Haar auf dem schwarzen Stoff eines Talars glänzen zu sehen. Aber ich habe mich nicht auf einen bestimmten Sonntag festgelegt. Stimmt’s?‟ Er legte den Bügel der Coladose um. Es knallte und zischte. Brian ahmte das Zischen mit gefletschten Zähnen nach. Jossey betrachtete ihn mit einer Mischung aus Faszination und Mitleid. Manchmal war sie sicher, dass den komischen Kauz auf dem Hausboot nicht mal mehr die Stärke seiner schmutzigen Fingernägel vom Wahnsinn trennte.
„Stimmt‟, sagte sie und setzte die Dose an ihren großen, sinnlichen Mund. Brian hob sein Rotweinglas und prostete ihr zu. „Und genau das ändern wir jetzt.‟ Sie beugte sich zur Couch, griff nach ihrer Tasche und kramte einen Kalender heraus. „Also? An welchem Sonntag kommst du?‟
Neben der rot lackierten Biedermeiervitrine ging eine Tür auf. Neugierig sah Jossey auf. Eine Frau erschien im Türrahmen. Klein, schwarzhaarig, wespenartige Taille und ein weißes, bauchnabelfreies T-Shirt. Das T-Shirt spannte sich über Brüste von Ausmaßen, von denen Jossey nur träumen konnte. Eine riesige Sonnenbrille verdeckte ihr bronzefarbenes Gesicht. Sie trug eine teure Lederjacke, schwarz, und graue Stretchhosen mit feinen, weißen Nadelstreifen. Ihre hochhackigen, schwarzen Pumps klapperten über die ausgetretenen Holzbohlen des Bodens.
„Ich geh′ dann mal‟, sagte sie leise.
Brian sprang auf. „Darf ich dir Faye vorstellen, Lady Josephine?‟ Er lief zu der kleinen, zierlichen Frau, und legte den Arm um sie. „Das ist Prinzessin Faye, mein guter Geist – und das ...‟, mit theatralischer Geste wies er auf Jossey, „... das ist Euer Ehrwürden, Lady Josephine!‟
Die beiden Frauen musterten sich schweigend. Brian sprang zu seiner rot lackierten Vitrine und riss ungefähr drei Schubladen auf. In einer fand er, was er suchte: Eine zusammengeknüllte Banknote. Jossey konnte ihren Wert auf die Entfernung nicht ausmachen. Es entging ihr aber nicht, wie er den Geldschein der jungen Frau mit vertrauter Geste in die Hand drückte.
„Sag′ schön bye, bye, Prinzessin.‟ Die Frau nickte in Josseys Richtung, und Brian schob sie zur Tür. Ziemlich rasch, wie Jossey fand.
Auf Wiedersehen, Faye‟, rief Jossey. Sie hätte gern ein paar Worte mit dem verschwiegenen Wesen gesprochen, doch schon flog die Tür zu, und sie hörte ihre Pumps draußen auf dem Holzsteg, der vom Hausboot zum Ufer führte.
„Dein Guter Geist?‟ Jossey runzelte die Stirn.
„Ja, mein guter Geist!‟ Brian setzte sich und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. „Sie kommt zweimal die Woche und macht bei mir sauber.‟
Jossey sah sich in der schmuddeligen Küche um. Eine steile Falte erschien zwischen ihren Brauen. „Sie scheint ihren Job nicht sehr ernst zu nehmen.‟
Brian hob den Zeigefinger. „An meine Küche lass ich niemanden ran.‟ Er beugte sich vor und machte ein verschwörerisches Gesicht. „Stell dir vor, sie klaut meinen Shit. Oder trinkt von meinem Rotwein. Oder findet meine Pornohefte in der Eckbank.‟
Jossey sog scharf die Luft durch die Nase ein. „Was bist du nur für ein Mensch, Brian?‟, sagte sie. „Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du bist noch nie jemandem begegnet, der dich geliebt hat, wie du bist.‟
„Oh – ganz bestimmt!‟, beteuerte er mit erhobenen Armen. „Ich war wahrscheinlich nur zu zerstreut, um es zu bemerkten.‟ Er kramte ein zerknautschtes Tabakpäckchen aus der Jogginghose und begann, sich eine Zigarette zu drehen.
„Kannst du nicht ein einziges Mal ernst sein?‟, seufzte Jossey.
„Ich bin todernst – wenn du wüsstest.‟
„Ich will dir jetzt von jemandem erzählen, der dich liebt, wie du bist.‟ Jossey griff wieder in ihre Tasche. Diesmal zog sie ein kleines, schwarzes Buch heraus. „Ich les′ dir eine Stelle aus dem Johannes-Evangelium vor.‟ Sie blätterte in der Bibel.
„Ich bin so beschämt‟, sagte Brian mit weinerlicher Stimme. „Du nimmst dir soviel Zeit für einen verkommenen Sünder wie mich.‟ Er schüttelte den Kopf und zog eine Miene, als würde er jeden Moment in Tränen ausbrechen. „Kein Mensch auf der Welt würde noch einen Pfifferling für mich geben, aber du ... aber du ... aber du gibst die Hoffnung nicht auf!‟
Jossey starrte ihn an. Sie war sich nicht sicher, wie ernst sie das nehmen konnte, was er da gerade von sich gab. Also wandte sie sich wieder der Bibel zu. „Also hör zu, Brian. Ich les′ dir vor, was der Apostel Johannes über die Liebe Gottes sagt ...‟
Plötzlich lag seine Hand auf ihrer. „Darf ich Sie was fragen, Lady Josephine?‟ Sie nickte. Ihre Augen leuchteten hoffnungsvoll. „Wann darf ich dich endlich ficken?‟
Jossey wurde erst blass, dann rot, und dann schlug sie das Buch zu. Sie stopfte Kalender und Bibel in ihre Tasche und stand auf.
„Ich war zu direkt, stimmt’s?‟ Brian sprang auf und lief hinter ihr her zur Tür. „Ich war viel zu direkt, es tut mir leid ...‟
An der Tür drehte Jossey sich um. „Glaub′ bloß nicht, dass du mich auf diese Weise loswirst, Brian!‟, zischte sie. „Gottes Gnade hat dich erwählt, dich, den Sohn Abrahams! Und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis du unter meiner Kanzel sitzt als einer, der zum Gott seiner Väter umgekehrt ist!‟ Sie drehte sich um und stolzierte über den Holzsteg ans Ufer, wo ihr alter Ford stand.
Brian drückte die Tür zu und feixte. Er ging zum Tisch, nahm die brennende Zigarette aus dem Ascher und steckte sie sich zwischen die Lippen. Draußen hörte er ihren Volvo anspringen. Lauthals prustete er los und schlug sich vergnügt auf die Schenkel.
Er trank seinen Rotwein aus und füllte das Glas erneut. Durch das runde Fenster blickte er auf den Fluss hinaus. Etwa einen Steinwurf weit entfernt hockte ein Angler in seinem Boot und hielt sich an seiner Rute fest.
„Komischer Kerl‟, grunzte Brian. Seit vier Tagen beobachtete er den Angler in der Nähe seines Hausbootes. Gestern streifte der Mann mit seiner Angel am Ufer entlang. „Muss ihn mal fragen, was er für Köder benutzt ...‟ Brian selbst fing selten etwas in der Umgebung seines Hausbootes. Mehr Gedanken verschwendete er nicht an den merkwürdigen Angler. Noch nicht …
8
Die Tote sah aus, als wäre jemand mit einer Mähmaschine über sie hinweggerollt. Ihr nackter Körper lag verkrümmt im Distelgestrüpp zwischen vier Autowracks. Benzin schillerte in der schwarzen Pfütze neben ihrem Kopf. Brust und Unterleib waren regelrecht zerfleischt von Messerstichen und von Schnittwunden. Das Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit zerschlagen und zerschnitten.
Schaudernd wandten Milo und ich uns ab.
„Himmel!‟, krächzte Milo. „Wer macht so etwas?‟
„Ein Wahnsinniger‟, flüsterte ich. Mir war übel. Ich sah mich um. Rostige Türme reckten sich in den blauen Frühsommerhimmel. Auf den Hallen entlang des Flussufers wuchsen kleine Bäume. Die Fensterscheiben der flachen Gebäude waren zum größten Teil zerbrochen. Möwen kreisten schreiend über dem Gelände der ehemaligen Raffinerie.
Ich stellte mir vor, wie die Frau hierher verschleppt worden war. Vielleicht kam sie gerade vom Einkaufen, vielleicht hatte sie gerade irgendein Büro, irgendeine Praxis verlassen, um nach Hause zu ihrer Familie zu fahren, als diese Bestie über sie herfiel. Ich stellte mir ihre Angst vor, und die verzweifelte Einsamkeit, die sie empfunden haben musste. Hier, inmitten der verlassenen Industrieruinen – ganz allein ihrem Peiniger ausgeliefert. Die Hölle war manchmal so bedrückend nah – ich hätte schreien können in diesem Moment.
Ein große, massige Gestalt schob sich aus einem alten Volvo. Alexis Silas, der Chefpathologe des Zentrallabors. Mit seiner altmodischen Arzttasche in der Rechten schaukelte er auf uns zu.
„Hi Jesse, hi Milo.‟ Er blieb neben uns stehen, als wäre er gegen eine Glaswand gerannt. Sekundenlang blickte er auf die Stelle zwischen den Autowracks, wo die Leiche lag. „Ihr werdet mir langsam unsympathisch‟, krächzte er. Er stelzte über Gestrüpp und alte Reifen. Wir drehten uns nicht um. An seinem Ächzen hörte ich, dass er seine 340 Pfund in die Hocke zwang. „Ich seh′ euch so selten und wenn, immer in der Nähe irgendwelcher menschlichen Überreste. Könnten wir nicht mal wieder einen trinken gehen?‟
Ich hatte keine Lust zu antworten. Milo auch nicht. Und Alex schien keine Antwort zu erwarten. Ich hörte das typische Geräusch, das Latexhandschuhe verursachen, wenn man sie dehnt, über die Hände streift, und gegen die Handgelenke schnalzen lässt.
Blitzlichter zuckten, Funkgeräte rauschten aus offenen Wagentüren, zwei Beamte schleppten einen Leichensack heran, ein Trassierband wurde um die Wracks gespannt, ein Abschleppwagen zog einen schwarzen Golf auf die Ladefläche, und eine halbe Stunde später kreuzten Pressefotografen und Kamerateams von CBS und NBC auf. Bald wimmelte es auf dem alten Raffineriegelände von Leuten wie auf der Terrasse im Central Park am Samstagnachmittag.
Alex streifte seine schmierigen Handschuhe ab. Von Weitem sahen wir zu, wie er seine Tasche packte, während die Kollegen die Tote in den Leichensack legten. Der massige Pathologe erhob sich ächzend und balancierte seinen fetten Körper an den Wracks vorbei zum Trassierband. Milo hob es an, damit er durchschlüpfen konnte.
„Und?‟, fragte ich.