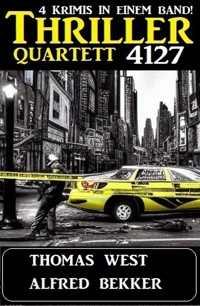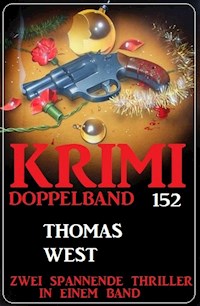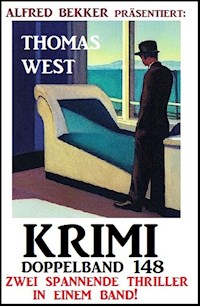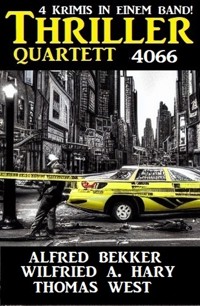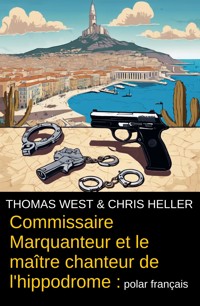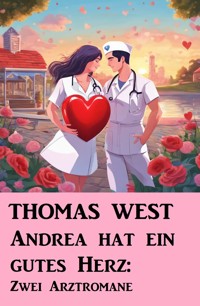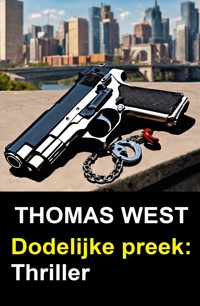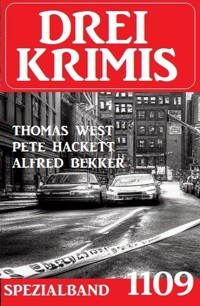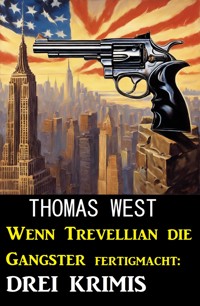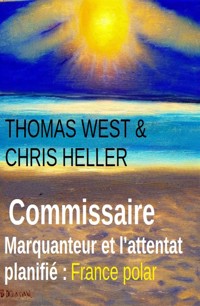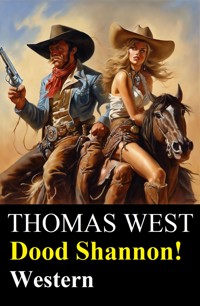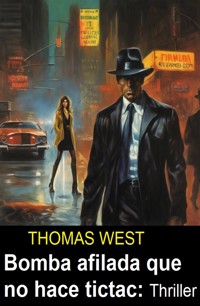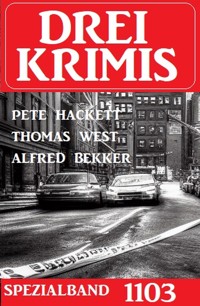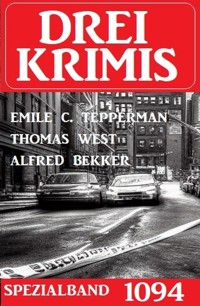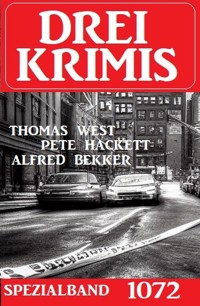
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis: (399) Trevellian und die falschen Mediziner (Pete Hackett) Mörderpost (Alfred Bekker) Dunkle Schatten auf weißer Weste (Thomas West) Attentate mit Sprengstoffbriefen verbreiten Angst und Schrecken. Opfer sind ausschließlich Angehörige der New Yorker Polizei. Für die Ermittler ein heikler Fall. Eine Mauer aus Schweigen und Gewalt begegnet ihnen. Führen die Syndikate einen Privatkrieg gegen missliebige Cops? Oder will sich da jemand für vermeintliches oder tatsächliches Polizei-Unrecht rächen? Ein packender Action Krimi von Henry Rohmer (Alfred Bekker). Henry Rohmer ist das Pseudonym eines Autors, der unter dem Namen Alfred Bekker vor allem als Verfasser von Fantasy-Romanen und Jugendbüchern bekannt wurde, sowie historische Romane schrieb. Daneben verfasste er Romane zu Spannungsserien wie Jerry Cotton, Cotton Reloaded, Kommisar X, John Sinclair und Ren Dhark.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Hackett, Alfred Bekker, Thomas West
Drei Krimis Spezialband 1072
Inhaltsverzeichnis
Drei Krimis Spezialband 1072
Copyright
Trevellian und die falschen Mediziner
Mörderpost
Dunkle Schatten auf weißer Weste
Drei Krimis Spezialband 1072
Pete Hackett, Alfred Bekker, Thomas West
Dieser Band enthält folgende Krimis:
Trevellian und die falschen Mediziner (Pete Hackett)
Mörderpost (Alfred Bekker)
Dunkle Schatten auf weißer Weste (Thomas West)
Attentate mit Sprengstoffbriefen verbreiten Angst und Schrecken. Opfer sind ausschließlich Angehörige der New Yorker Polizei. Für die Ermittler ein heikler Fall. Eine Mauer aus Schweigen und Gewalt begegnet ihnen. Führen die Syndikate einen Privatkrieg gegen missliebige Cops? Oder will sich da jemand für vermeintliches oder tatsächliches Polizei-Unrecht rächen?
Ein packender Action Krimi von Henry Rohmer (Alfred Bekker).
Henry Rohmer ist das Pseudonym eines Autors, der unter dem Namen Alfred Bekker vor allem als Verfasser von Fantasy-Romanen und Jugendbüchern bekannt wurde, sowie historische Romane schrieb. Daneben verfasste er Romane zu Spannungsserien wie Jerry Cotton, Cotton Reloaded, Kommisar X, John Sinclair und Ren Dhark.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Trevellian und die falschen Mediziner
Krimi von Pete Hackett
Der Umfang dieses Buchs entspricht 113 Taschenbuchseiten.
Kindesentführung. Ein Verbrechen, das alle Polizisten zu erhöhter Aufmerksamkeit bringt. Es gibt vier verschwundene Kinder und keine Lösegeldforderung. Der Gedanke an Kinderpornografie drängt sich auf – aber es gibt noch weitere Spielarten des Verbrechens, und die FBI Agenten Trevellian und Tucker werden mit dem Grauen in Person konfrontiert.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2021 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Mr. McKee rief mich an und bat mich, mit Milo sofort zu ihm zu kommen. Es war 8 Uhr 15, und wir hatten kaum den Dienst angetreten. Wenn es der Chef so eilig hatte, brannte es irgendwo lichterloh. Darum verloren wir auch keine Zeit. Und wenige Minuten später saßen wir an dem runden Tisch in seinem Büro und harrten der Dinge, die sich entwickelten.
Der Assistant Director war sehr ernst. Er war zwar meistens ernst, heute aber empfand ich es ganz besonders. Er schaute mich an, dann Milo, dann wieder mich und sagte schließlich: »Es geht um Kindesentführung. Nachdem ein drittes Kind in New York spurlos verschwunden ist, hat das Police Department den Fall an das FBI abgegeben. Ich möchte Sie mit dem Fall betrauen, Jesse und Milo.«
Kindesentführung! Eine unerfreuliche Angelegenheit. Ich dachte sofort an Kinderpornografie. Immer wieder gab es Zeitgenossen, die ihre verbrecherische Energie darauf verwendeten, entsprechende Pornoringe ins Leben zu rufen und ihre Schweinereien auch im Internet anzubieten. Eines der widerwärtigsten Verbrechen überhaupt.
»Der Name des Kindes ist Joey Stiller«, fuhr Mr. McKee fort. »Der Junge ist acht Jahre alt. Vor ihm sind Sandy O'Rourke, sechs Jahre, und Billy Osterman, zehn Jahre, verschwunden. Joey Stiller wurde auf dem Schulweg entführt, Sandy O'Rourke auf dem Kinderspielplatz, Billy Osterman war auf dem Weg zu einem Klassenkameraden, um mit ihm gemeinsam die Hausaufgaben zu machen.«
»Wo fanden die Entführungen statt?«, fragte ich.
Der Chef richtete den Blick auf seine Aufzeichnungen. »Joey Stiller verschwand zwischen der neunundzwanzigsten und der vierunddreißigsten Straße, wo sich die Schule befindet. Sandy auf dem Kinderspielplatz im East River Park, Billy auf dem Weg von der siebenundsiebzigsten Straße Ost zur zweiundachtzigsten. Die Akten werden von einem Boten überbracht. Ich werde Sie Ihnen sofort zuleiten, meine Herren.«
»Ist man an die Eltern mit Lösegeldforderungen herangetreten?«, fragte Milo.
»Bis jetzt nicht«, erwiderte Mr. McKee.
Ich verlieh meinen besorgten Gedanken Ausdruck: »Es ist nicht auszuschließen, dass es um Kinderpornografie geht.«
Meine Worte fielen wie Hammerschläge. Milo stieß scharf die Luft durch die Nase aus. Mr. McKee nickte. »Das ist auch meine Befürchtung, Jesse.«
Wir waren für das Erste entlassen und kehrten in unser gemeinsames Büro zurück. Milo und ich hatten erst vor einigen Monaten mit Pädophilen zu tun, und wenn ich nur daran dachte, stieg ein Gefühl des absoluten Ekels in mir auf.
Eine ganze Zeit schwiegen wir und hingen unseren Gedanken nach, dann sagte Milo: »Es muss sich nicht um Kinderpornografie handeln, Jesse. Vielleicht treten die Kidnapper noch mit einer Lösegeldforderung an die Eltern heran. Es ist nicht mal sicher, ob es sich um ein und dieselben Entführer handelt.«
»Du hast Recht«, erwiderte ich. »Lassen wir zunächst mal die Akten kommen. Und dann sehen wir weiter.«
Die Akten gaben nicht viel her. Joey Stiller verschwand am Morgen um halb acht Uhr, Sandy O'Rourke am Nachmittag gegen fünfzehn Uhr, und Billy Osterman um die Mittagszeit, so gegen dreizehn Uhr. Niemand hatte etwas beobachtet. Ein öffentlicher Aufruf, dass sich Zeugen an die Polizei wenden sollten, brachte keinerlei Resonanz.
Wir sprachen mit den Eltern der Kinder. Fehlanzeige. Die Mütter und Väter waren total aufgelöst und psychisch am Ende. Sie bangten um ihre Kinder, denn immer wieder brachten die Medien Meldungen von spurlos verschwundenen Kindern, die irgendwann tot aufgefunden worden waren. Wenn sich die Eltern Sorgen machten, dann war das mehr als verständlich – und auch begründet.
Also fütterten wir den Computer mit einigen Indizien, die in den drei Fällen bekannt waren, und das Programm spuckte eine Reihe von Namen aus. Es handelte sich um Männer – und ausschließlich um Männer –, die in der Vergangenheit als Pädophile oder Kidnapper in Erscheinung getreten waren.
Einige Namen konnten wir aussondern – jene Kerle, die sich noch hinter Gittern befanden und für ihre Verbrechen büßten. Es blieben aber einige Namen übrig, und diese Männer nahmen wir uns vor, zu überprüfen.
Der erste, den wir aufsuchten, war Kelly Miller. Er wohnte in der Clinton Street, Lower East Side. Miller war sechsundvierzig Jahre alt und dicklich. Über seiner Stirn lichteten sich die Haare. Seine Lippen waren aufgeworfen, die Augen wasserblau. Im Hinblick auf seine kriminelle Vergangenheit war mir dieser Mann aus tiefster Seele zuwider. Aber ich wollte Objektivität bewahren und versuchte meine Antipathie zu unterdrücken.
»Wir möchten Sie sprechen, Miller«, sagte ich.
Der Bursche hatte die Tür gerade so weit geöffnet, dass wir sein Gesicht sehen konnten. Er blinzelte. »Worum geht es denn?«
»Wollen wir das zwischen Tür und Angel besprechen, Mr. Miller?«
Natürlich hatten wir uns ihm vorgestellt, und er wusste, dass wir vom FBI waren. Sein Blick verriet Unruhe. Er leckte sich über die Lippen. »Kommen Sie herein«, sagte er widerwillig.
Wir betraten ein unaufgeräumtes Wohnzimmer. »Entschuldigen Sie«, sagte Miller mit einem betretenen Grinsen, »wenn es hier ein wenig unordentlich aussieht. Ich bin nicht dazu gekommen …«
Ich winkte ab. Von mir aus erstickte der Bursche in seiner Unordnung. »In New York wurden innerhalb der vergangenen zwei Wochen drei Kinder entführt«, begann ich. »Sechs, acht und zehn Jahre alt, zwei Jungs, ein Mädchen.«
Miller ließ sich in einen Sessel fallen. »Nehmen Sie doch Platz«, lud er uns zum Sitzen ein, aber wir verzichteten darauf. In Millers Mundwinkeln zuckte es, dann sagte er: »Ich habe damit nichts zu tun.«
»Sie haben sechs Jahre hinter Gittern verbracht«, sagte Milo. »Grund war, dass Sie …«
»Ich kenne den Grund!«, stieß Miller scharf hervor und unterbrach meinen Kollegen. Etwas gemäßigter fügte er hinzu: »Es – es war krankhaft. Ich befinde mich deshalb in psychiatrischer Behandlung.«
»Das ist eine Ihrer Bewährungsauflagen«, sagte ich.
»Ja. Ich habe mein Problem in den Griff bekommen.«
»Können Sie uns einen Tipp geben?«
Miller schüttelte den Kopf. »Ich habe mich aus der Szene völlig zurückgezogen.«
»Verraten Sie uns mehr über die Szene«, dehnte ich und ließ Miller nicht aus den Augen. Sein Blick irrte ab. Er knetete seine Hände. Unter seinem linken Auge zuckte ein Muskel.
»Ich – ich kann Ihnen nichts sagen. Wie gesagt, ich habe keinerlei Kontakte mehr.«
Da war nichts zu machen. Wir fuhren zu Steve Henders nach Queens. Als er hörte, wer wir waren, schlug er uns wortlos die Tür vor der Nase zu. Ich läutete erneut. »Verschwindet!«, schrie er durch die Tür. »Ich habe meine Strafe abgesessen und mir nichts mehr zuschulden kommen lassen. Ich muss euch nicht Rede und Antwort stehen.«
»Wir können ihnen auch eine Vorladung ins Field Office in den Briefkasten werfen, Henders!«, versetzte ich. »Wenn Ihnen das lieber ist.«
Die Tür ging wieder auf. »Um was geht es?« Nur ein Teil von Henders‘ Gesicht war zu sehen. Der halbe Mund, etwas von der Nase, das rechte Auge. Der Rest war hinter dem Türblatt verborgen.
»Drei Kinder wurden in Manhattan entführt.«
»Kommt herein und seht nach«, maulte Henders. »Ich hab sie nicht hier.«
»Wenn Sie die Tür freigeben«, sagte Milo.
Henders zog die Tür auf. Wir betraten die Wohnung. Der Pädophile drückte die Tür zu und lehnte sich dagegen. »Ich lebe hier in Ruhe und Frieden«, sagte er. »Niemand hier weiß etwas von meiner Vergangenheit. Meine Strafe habe ich abgesessen. Ich …«
»Sie gehörten damals einem Pornoring an«, sagte ich. »Einer Organisation, die sich der Kinderpornografie verschrieben hatte und ihre Brötchen damit verdiente. Wir haben Ihre Akte ausführlich studiert. Der Boss der Organisation hieß Fletcher Olbright. Er sitzt noch hinter Gittern.«
»Ich hab damit nichts mehr zu tun. Die Organisation ist zerschlagen. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber das ist Vergangenheit.«
»Wann wurden Sie aus dem Gefängnis entlassen, Henders?«
»Vor vier Wochen.«
»Kaum, dass Sie draußen sind, gehen die Entführungen los«, sagte ich. »Seltsam, nicht wahr?«
Henders trat von einem Fuß auf den anderen und rang seine Hände. Er machte ein Gesicht, als würde er jeden Moment zu weinen beginnen. Er trug einen Ohrring, und seine Augenbraue war gepierct. Henders war um die dreißig Jahre alt und ein asketischer Typ. Wenn ich mir vorstellte, womit sich dieser Mann früher mal die Zeit vertrieb, wurde mir richtig schlecht. Er hatte in Filmen mitgewirkt und hatte sich in perversester Art und Weise an Kindern vergangen, was in diesen Schmuddelstreifen festgehalten worden war.
»Sie haben doch sicher noch Kontakt zu Ihren alten Freunden«, sagte Milo. »Die Entführungen wurden von den Medien publik gemacht. Sicher haben Sie doch mit Ihren Freunden darüber unterhalten.«
»Ich habe mich von meinem früheren Bekanntenkreis distanziert«, murmelte Henders. »Warum wollen Sie mir denn nicht glauben?«
Wir suchen an diesem Tag noch fünf Männer auf. Aber keiner konnte uns weiterhelfen. Am Abend gaben wir auf. Wir waren keinen Schritt weitergekommen.
2
Es war morgens um sieben Uhr dreißig. Toby Warren löffelte seine Cornflakes in sich hinein. Im Radio lief Popmusik. Tobys Mutter stand an der Spüle und wusch das Frühstücksgeschirr. Sie hätte es auch in den Geschirrspüler geben können, aber es handelte sich nur um zwei Tassen und einen Teller, die sie sofort abspülte.
»Beeile dich, Toby«, mahnte seine Mutter. »Wenn du dich nicht beeilst, fährt dir der Schulbus vor der Nase weg.«
»Ich kriege ihn schon, Ma«, erwiderte Toby und schob einen Löffel voll Cornflakes in den Mund. »Bin sowieso schon fertig.« Er sprang von dem Stuhl, auf dem er saß. »Soll mir doch der Schulbus wegfahren«, sagte er kauend. »Wir haben in der ersten Stunde gleich eine Probe.«
»Wenn du sie versäumst, musst du sie nachschreiben«, meinte Mrs. Warren. »Wo läge also der Vorteil? Jetzt geh zu, sonst fährt dir der Bus wirklich noch davon.«
Toby zog seinen Anorak an, schnappte sich seine Schultasche, schwang sie sich auf den Rücken, dann ging er zu seiner Mutter, sie bückte sich zu ihm hinunter und küsste ihn. Dann verließ Toby das Haus in der Charles Street.
Die Bushaltestelle war nur zehn Minuten vom Haus entfernt. Der Schulbus kam um sieben Uhr fünfundvierzig. Toby ging zu dem Trödelladen, in dem eine echte Ritterrüstung ausgestellt war. Im Schaufenster lagen auch einige Schwerter und Degen, die den Jungen immer wieder aufs Neue begeisterten. Da waren auch ein paar alte Revolver und Dolche …
Toby drückte sich die Nase an der Fensterscheibe platt. Geld, wenn ich hätte, dachte er, würde ich mir die Ritterrüstung kaufen. Und ein Schwert. Ich wäre dann wie Ivanhoe, der schwarze Ritter. Der Neunjährige kannte den Film mit Robert Taylor, und er war von der Gestalt des Ivanhoe fasziniert.
Ein alter Chevy fuhr an den Straßenrand. Ein Mann stieg heraus und stellte sich neben den Jungen an das Schaufenster. »Gefällt dir das Zeug?«, fragte er.
Der Junge blickte zu ihm in die Höhe. Toby sah einen Mann, etwa fünfundzwanzig Jahre alt, ein sogenannter Dreitagebart wuchs in seinem Gesicht, auf seinem Kopf saß eine Baseballmütze, bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem beigefarbenen Blouson.
»Sehr«, antwortete Toby. »Diese Rüstung würde ich gerne haben. Dann würde ich mich jeden Tag nach der Schule verkleiden. Kennst du Ivanhoe?«
»Den schwarzen Ritter? Wer nicht? In der Serie hat ihn Roger Moore gespielt. Ich habe sogar das Buch zu Hause.«
»Er interessiert dich also auch?«, fragte Toby.
Der junge Mann nickte. »Ich besitze einige Schwerter und Dolche. Hast du schon mal etwas von König Arthur gehört?«
»Ja. Ich kenne fast alle Rittergeschichten.«
»Ich habe eine Nachbildung von Excalibur, seinem Schwert. Würde dich das interessieren?«
»Ja, sehr.« Toby verzog das Gesicht. »Leider muss ich zur Schule. Wir schreiben heute eine Probe. Mathematik.«
»Ich wohne gleich um die Ecke. Mit dem Auto sind wir in fünf Minuten dort. Ich fahre dich dann zur Schule. Du wirst pünktlich dort ankommen.«
Toby überlegte nicht lange. »Okay. Du fährst mich aber wirklich zur Schule.«
»Ehrensache. Als ich so klein war wie du stand ich auch immer vor dem Laden hier. Die Rüstung stand damals schon im Schaufenster. Sie ist unverkäuflich. Sie gehört zu dem Laden wie der alte Mann, der ihn betreibt.«
»Kennst du Mr. Leonhard?«
»Sicher. Ich war als Junge nach der Schule immer bei ihm im Geschäft. Ich durfte seine alten Schwerter und Dolche putzen.«
Sie gingen zum Auto. Der Mann, der hinter dem Steuer saß, war ebenfalls jung. Er lächelte Toby aufmunternd zu. »Morning, Kleiner. Alles klar?«
»Fahren wir zu mir. Ich will dem Kleinen meine Schwerter und Dolche zeigen. – Setz dich auf den Rücksitz, Kleiner. He, wie heißt du eigentlich?«
»Toby.«
»Ich heiße Arthur.« Er öffnete die hinter Tür.
Toby stieg in den Wagen. Arthur ließ sich auf den Beifahrersitz fallen. Der Wagen fuhr an.
3
Als Toby um siebzehn Uhr immer noch nicht zu Hause war, rief seine Mutter seinen Lehrer an. Sie erfuhr, dass Toby nicht in der Schule war. Sofort informierte Mrs. Warren ihren Mann, der bis 18 Uhr Dienst hatte. Und Mr. Warren schaltete die Polizei ein.
»In New York verschwinden wahrscheinlich täglich mehrere hundert Personen«, sagte der Polizist, der die Anzeige aufnehmen sollte. »Darunter sind auch Kinder, die von zu Hause weglaufen. Deshalb werden wir in solchen Fällen erst nach vierundzwanzig Stunden tätig. Wenn Ihr Sohn also bis morgen Mittag nicht wieder zu Hause auftaucht …«
Toby tauchte innerhalb der Frist von vierundzwanzig Stunden nicht auf. Die Eltern sprachen wieder auf dem Revier vor. Und nun wurde die Polizei tätig.
Um neunzehn Uhr dieses Tages brachten die lokalen Sender einen Aufruf. Wer sachdienliche Hinweise zum Verschwinden des Jungen machen könne, möge sich an die nächste Polizeidienststelle oder das FBI New York wenden, bat der Nachrichtensprecher.
Ein Bild von dem Jungen wurde eingeblendet.
Dann fuhr der Nachrichtensprecher fort: »Es handelt sich möglicherweise um den vierten Fall einer Serie von Kindesentführungen, die seit zwei Wochen New York in Atem halten. Zu den Entführern gibt es keine Spur. Lösegeldforderungen wurden nicht geltend gemacht. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Inzwischen wurde auch das FBI eingeschaltet. Die Eltern werden aufgeboten, ihren Kindern einzuschärfen, sich von Fremden fernzuhalten, mit niemandem mitzugehen und in kein fremdes Auto zu steigen.«
Ich spürte einen bitteren Geschmack im Mund. Entführung Nummer vier. Mein Herz schlug höher, und ich rief sofort Milo an. »Hast du die Sieben-Uhr-Nachrichten gesehen?«, fragte ich ihn.
»Nein. Ich komme gerade unter der Dusche hervor. Was gibt es denn? Du klingst ziemlich angespannt.«
»Es wurde wieder ein Kind entführt.«
»Was?«
»Ja. Acht Jahre. Ein Junge. Sein Name ist Toby Warren. Er verschwand in der Charles Street.«
»Gütiger Gott. Du denkst, dass er von denselben Leuten entführt wurde wie Joey, Sandy und Billy.«
»Es ist anzunehmen.«
»Vielleicht sollten wir mit den Eltern sprechen«, meinte Milo.
»Ich hol dich in einer halben Stunde ab.«
»All right.«
Ich rief das Police Department an und ließ mich mit dem Detective Bureau verbinden. Gleich darauf hatte ich einen kompetenten Mann an der Strippe. »Die Eltern wohnen in der Charles Street, Hausnummer hundertdreiundvierzig«, sagte der Mann. »Richard Warren und Evelyn. Sie haben bereits ausgesagt. Die Mutter hat erklärt, dass der Junge kurz nach sieben Uhr dreißig die Wohnung verlassen hat. Um sieben Uhr fünfundvierzig spätestens musste er an der Bushaltestelle sein. Er kam dort nie an. Dies haben Nachfragen bei seinen Schulkameraden ergeben.«
»Erfolgte schon eine Resonanz auf den Aufruf in Funk und Fernsehen?«
»Bis jetzt nicht.«
»Vielen Dank.«
Ich holte Milo ab und wir fuhren zu den Eltern. Sie waren bleich. Mrs. Warren hatte gerötete, verschwollene Augen. Sie konnte nur wiederholen, was sie schon vor der Polizei angegeben hatte.
Richard Warren hatte bereits um sieben Uhr das Haus verlassen. »Mein armer Junge«, murmelte er. »Ich würde jeden Preis der Welt zahlen …« Seine Stimme brach. Er schluchzte. Ich konnte mit ihm fühlen.
Wir ließen uns ein Bild von Toby geben. Ich hinterließ meine Visitenkarte, dann verabschiedeten wir uns.
Am folgenden Morgen erhielt ich einen Anruf. Es war ein Kollege aus dem Police Department. »Eine Frau hat sich gemeldet«, sagte er. »Es war ein dunkelblauer Chevy, in den der Junge stieg. Und zwar vor dem Geschäft von Mr. David Leonhard, einem Antiquitätenladen. Die Frau heißt Marcy Dixon und wohnt dem Laden gegenüber in der ersten Etage.«
Ich war wie elektrisiert. Wir fuhren sofort in die Charles Street. Bei Mrs. Dixon handelte es sich um eine übergewichtige, resolute Person mit Lockenwicklern in den Haaren. Sie war mit einer grünen Wickelschürze bekleidet und verfügte über eine rauchige Altstimme. »Ich habe mir sogar die Zulassungsnummer des Wagens aufgeschrieben«, sagte sie, ging zu einer Pinnwand, die an der Tür hing, und nahm einen gelben Notizzettel ab, den sie mir reichte. Ich warf einen Blick darauf, dann holte ich meine Brieftasche heraus und verstaute den Zettel.
»Ich habe alles beobachtet«, erzählte die Lady. »Der Junge schaute durchs Schaufenster in den Laden. Ich sehe ihn oft morgens vor dem Geschäft stehen. Dann fuhr der Chevy vor und ein junger Mann stieg aus. Ein zweiter junger Mann blieb hinter dem Steuer sitzen. Er sprach den Jungen an, und dieser stieg wenig später in den Wagen.«
»Warum haben Sie nicht sofort die Polizei alarmiert?«
»Ich dachte doch nicht an Entführung! Der Junge zierte sich nicht. Ich war der Meinung, er kennt die beiden Burschen aus dem Auto. Erst als ich in den Nachrichten davon hörte, besann ich mich und verständigte das Department.«
»Schon gut«, sagte ich. »Es sollte kein Vorwurf sein.«
Die Lady musterte mich mit einem Blick, der in etwa zum Ausdruck brachte: Dein Glück, junger Mann, dass du einlenkst. Sei froh, dass ich euch überhaupt verständigt habe. Statt mir dankbar zu sein, muss ich mir noch den Vorwurf gefallen lassen, nicht umsichtig genug gehandelt zu haben. Das ist nicht fair.
»Sie haben uns sehr geholfen«, gab ich zu verstehen.
Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich. Die Verkniffenheit löste sich auf, sie lächelte geschmeichelt. »Meinen Namen und meine Adresse haben Sie ja, G-men. Ich meine, für den Fall, dass es eine Belohnung gibt, steht diese wohl mir zu. Ich habe den entscheidenden Hinweis geliefert.«
»Natürlich. Wir melden uns wieder bei ihnen.«
Dann verließen wir die Wohnung.
»Wenn dieser Dragoner einmal scharf Luft geholt hätte, hättest du ihm quer vor der Nase gehangen«, meinte Milo grinsend, als er neben mir im Wagen saß.
»Das fürchte ich auch«, sagte ich und blies die Backen auf. »Checken wir, auf wen der Chevy zugelassen ist«, ergänzte ich, nachdem ich die Luft langsam abgelassen hatte.
Der Name des Mannes war Liam Ferris. Er wohnte in West 94th Street und war nicht zu Hause. Von einem Wohnungsnachbarn erfuhren wir, dass Ferris Medizinstudent an der Columbia Universität war und sich wahrscheinlich in der Vorlesung befand. Also fuhren wir zur Columbia University. Wir begaben uns ins Sekretariat, ich trug unser Anliegen vor, und dann wurde Liam Ferris per Lautsprecherdurchsage gebeten, sich im Sekretariat einzufinden.
Er kam nach zehn Minuten. Als er den Raum betrat und uns sah, stutzte er, dann warf er sich herum und warf die Tür hinter sich zu. Wie von einer Tarantel gestochen fuhr ich hoch und erreichte mit vier langen Schritten die Tür, riss sie auf, und sah gerade noch, wie Ferris am Ende des Flures hinter einer doppelflügeligen Glastür um die Ecke verschwand. Ich hetzte hinterher und stand schließlich bei der Treppe. Milo kam einen Herzschlag nach mir an. Die Flügel der Glastür schlugen. Ich war mir nicht sicher, ob Ferris nach unten oder nach oben gerannt war, ging aber davon aus, dass er wohl das Uni-Gelände verlassen wollte. Also machte ich mich auf den Weg nach unten. Milo kam hinterher. Wir nahmen immer drei Stufen auf einmal. Dann waren wir im Erdgeschoss angelangt und rannten zur großen Glastür, die nach draußen führte. Hinter der Rezeption in der Halle saß eine Frau mittleren Alters.
»Ist eben ein junger Mann hier vorbeigelaufen?«, fragte ich zwischen fliegenden Atemzügen.
»Ja. Er ist wie von Furien gehetzt nach draußen gerannt. Bis ich richtig zum Denken kam, war er verschwunden.«
Wir verließen das Gebäude und standen auf der Straße. Auf der anderen Seite begann eine Grünfläche, auf der Büsche und Bäume wuchsen und die von einem Kiesweg unterteilt war. Alle hundert Yards etwa waren Bänke aufgestellt. Da es nicht gerade warm war und die Sonne von dichten Wolken verdeckt wurde, saß niemand auf diesen Bänken. Einige Studenten hasteten vorüber. Ein Stück entfernt stand eine Gruppe und debattierte heftig. Milo und ich gingen zu den jungen Leuten hin, und ich erkundigte mich, ob Ferris vorbeigekommen wäre.
»Er rannte, als säße ihm der Leibhaftige im Nacken, in diese Richtung«, sagte einer der jungen Männer und streckte den Arm aus. »Sind Sie Polizisten? Hat er was ausgefressen?«
»Ja«, erwiderte ich, »wir sind Polizisten. Vielen Dank.«
Milo und ich trabten wieder los. Schließlich standen wir am Rand der 121st Street. Ein Stück weiter westlich war der Morningside Park zu sehen. Von Ferris keine Spur.
»Fahren wir zu seiner Wohnung«, schlug ich vor. »Er wird versuchen, sich abzusetzen. Es ist daher anzunehmen, dass er sich zu seiner Wohnung begibt, um sich mit ein paar Dingen wie Zahnbürste und Wäsche einzudecken.«
Wir fuhren zurück in die 94th Street. Ein Stück von dem Gebäude entfernt, in dem Ferris wohnte, stellte ich den Wagen ab. Dann postierten wir uns so, dass er einem von uns in die Arme laufen musste, falls er wieder die Flucht ergriff.
Während ich wartete, machte ich mir einige Gedanken. Das Verhalten von Ferris ließ den Schluss zu, dass er der Entführer des Jungen war. Aber handelte er aus eigenem Antrieb, oder führte er einen Auftrag aus? Was bezweckte der Kidnapper? Die erste Entführung lag mehr als zwei Wochen zurück, und der Kidnapper hatte sich nicht gemeldet. Es ging scheinbar nicht um die Zahlung von Lösegeld. Mein Denken blockierte, als sich wieder das Wort Kinderpornografie in den Vordergrund meines Bewusstseins schob. Mir drehte sich der Magen um. Aber gab es eine andere Erklärung?
4
»Das waren hundertprozentig Polizisten«, sagte Liam Ferris in sein Handy.
»Es war dumm von dir, zu fliehen. Damit hast du dich erst verdächtig gemacht.«
»Wie können sie auf mich gekommen sein?«
»Das weiß ich doch nicht. Aber das spielt jetzt auch nicht die große Rolle. Du musst Arthur warnen und dich dann absetzen. Es war dumm von euch, deinen Wagen zu benutzen, ist aber leider nicht mehr zu ändern.«
»Ich habe kaum Geld einstecken, ich brauche ein paar Dinge wie Zahnputzzeug und Rasierapparat. Außerdem Unterwäsche und Hemden. Ich muss in meine Wohnung, um mir diese Dinge zu holen.«
»Ich denke, das ist zu gefährlich.«
»Was soll ich tun?«
»Wir treffen uns in einer Stunde am Blockhaus im Central Park. Ich gebe dir genug Geld, so dass du dich einige Zeit in einem Hotel verkriechen und dann New York verlassen kannst. Besorg dir ein paar neue Kennzeichen für dein Auto und schraube sie an. Und gehe wo wenig wie möglich aus dem Hotel.«
»In Ordnung. In einer Stunde beim Blockhaus.«
Liam Ferris wählte eine andere Nummer. Ein Mann meldete sich. »Baldwin.«
»Ich bin‘s, Liam. Hör zu, Arthur. Es sieht so aus, als wären wir aufgeflogen. Vorhin kamen zwei Bullen in die Uni. Ich bin zumindest davon überzeugt, dass es sich um Bullen handelte. Ich verkrieche mich in New York, und wenn sich die Wogen ein wenig geglättet haben, setze ich mich ab. Ich weiß nicht, ob sie dich auch auf dem Kieker haben. Sei jedenfalls vorsichtig.«
»Verdammt! Wie sind sie auf uns gekommen?«
»Wahrscheinlich hat jemand meine Autonummer aufgeschrieben.«
»Wir sind leichtsinnig geworden, nachdem es dreimal gut gegangen ist. Verdammt! Vorher haben wir immer mit gestohlenen Kennzeichen gearbeitet. Wir haben uns zu sicher gefühlt. Und jetzt haben wir den Dreck.«
»Du bist wahrscheinlich aus dem Schneider. Ich wollte dir nur Bescheid gesagt haben. Halt dich von meiner Wohnung fern. Es ist möglich, dass sie überwacht wird.«
»Meldest du dich wieder?«
»Ja. Ich treffe mich in einer Stunde mit dem Boss. Er gibt mir Geld, damit ich für einige Zeit über die Runden komme.«
Liam Ferris beendete das Gespräch. Er holte seinen Chevy und fuhr zum Central Park North, wo er seinen Wagen abstellte und in Richtung Süden über den Rasen ging, bis er zu der Stelle traf, an der East und West Drive sich vereinten. Er überquerte die Straße und betrat wieder Grünfläche. Schon bald tauchte das Block House vor ihm auf, das älteste Gebäude des Parks.
Liam Ferris wartete.
5
Nachdem wir eine halbe Stunde gewartet hatten, ahnte ich, dass Ferris nicht mehr auftauchen würde. Ich stand mit Milo per Handy in Verbindung. Nun ging ich auf Empfang und sagte, nachdem Milo sich gemeldet hatte: »Er kommt wohl nicht mehr. Hat Lunte gerochen. Wir sollten uns mal in seiner Wohnung umsehen.«
»Ich bin dafür, dass wir noch eine Viertelstunde warten.«
»Wenn du meinst. Von mir aus. Aber dann brechen wir unsere Zelte hier ab.«
Die Viertelstunde verstrich. Wir begaben uns ins Haus und verschafften uns Zutritt zur Wohnung von Ferris. Es war eine Studentenbude. Ein Raum diente als Wohn-, Schlaf- und Arbeitsraum, es gab eine winzige Kochnische und ein Bad mit WC. Auf einem Tisch stand ein Laptop. Das Betriebssystem war nicht kennwortgeschützt und ließ sich hochfahren. Der Computer gab nichts her, was für uns von Interesse gewesen wäre. Ich hörte den automatischen Anrufbeantworter ab. Es gab zwei Gespräche. Bei dem einen hatte die Mutter von Ferris angerufen und ihren Sohn aufgefordert, sich bei ihr zu melden. Bei dem anderen Anrufer handelte es sich um einen gewissen Arthur, der versprach, am Abend noch einmal anzurufen. Ich nahm den Telefonhörer zur Hand. Es handelte sich noch um einen Festnetzanschluss mit Kabel. Man konnte sich also beim Telefonieren nicht frei in der Wohnung bewegen. Nachdem ich die Rufwiederholungstaste gedrückt hatte, erklang es: »Mia Ferris. Bist du es, Liam. Warum rührst du dich nicht. Seit drei Tagen …«
»Entschuldigen Sie die Störung, Ma‘am«, unterbrach ich die Frau. »Hier spricht Special Agent Trevellian vom FBI New York. Wir befinden uns in der Wohnung Ihres Sohnes.«
»Gütiger Gott, was hat Liam mit dem FBI zu tun?«
»Es ist eine Geschichte, die wir vielleicht unter vier Augen besprechen sollten, Ma‘am«, sagte ich. »Oder besser gesagt unter sechs …«
»Ich verstehe nicht?«
»Mein Kollege Tucker wird dabei sein.«
Die Frau nannte mir ihre Adresse, dann beendete ich das Gespräch. »Wir sollten die SRD verständigen, damit sie die Wohnung auf Spuren checkt«, sagte ich. »Es ist nicht auszuschließen, dass die Kinder vorübergehend in dieser Wohnung festgehalten wurden.«
»Noch besteht nur ein Zusammenhang zwischen Ferris und der Entführung von Toby Warren«, mahnte Milo. »Ob er mit der Entführung der anderen Kinder etwas zu tun hat, ist ungewiss. Außerdem glaube ich nicht, dass er den Jungen in seine Wohnung gebracht hat. Es wäre für ihn viel zu gefährlich gewesen.«
»Wir dürfen nichts außer Acht lassen.«
Milo holte sein Handy heraus und rief das Police Department an. Dann fuhren wir zur Wohnung von Mrs. Ferris. Sie bewohnte ein Apartment in Murray Hill. Schon nach wenigen Sätzen wussten wir, dass sie geschieden war und ihren Sohn alleine aufgezogen hatte. Ihr Mann war ein gottverdammter Schuft, der sie nur ausgenutzt und nie etwas für seinen Sohn übrig gehabt habe. Sie habe zwei Jobs ausgeübt, um sich und den Jungen über Wasser zu halten und es Liam zu ermöglichen, weiterführende Schulen zu besuchen und ein Studium durchzuführen.
»Er ist gut«, sagte sie. »Professor Dr. Ernest Wallace persönlich kümmert sich um ihn. Er hat ihn als wissenschaftlichen Assistenten angestellt und zahlt ihm dafür fünfhundert Dollar im Monat.«
»Ihr Sohn steht im Verdacht, einen Jungen entführt zu haben«, sagte ich.
Die Frau prallte regelrecht zurück. Ihre Gesichtszüge entgleisten, entgeistert starrte sie mich an. »Er – steht – was?«
»Im Verdacht, einen Jungen entführt zu haben. Sein Name ist Toby Warren, er ist acht Jahre alt. Er wurde zuletzt gesehen, als er in das Auto Ihres Sohnes stieg.«
»Das kann nicht sein. Nicht mein Junge. Er ist anständig. Wahrscheinlich hat man ihm das Auto gestohlen.«
»Das hätte er Ihnen sicherlich gesagt«, gab ich zu verstehen.
»Ich habe seit drei Tagen nichts mehr von Liam gehört.«
»Er muss Sie aber angerufen haben. Ich nahm mit Ihnen Verbindung über die Rufwiederholungstaste auf.«
Die Frau presste die Rechte gegen ihren Halsansatz. »Natürlich bin ich auch nicht immer zu Hause. Und über einen Anrufbeantworter verfüge ich nicht.«
»Hat Ihr Sohn Freunde? Eine Freundin vielleicht?«
»Ich weiß es nicht.«
Ich gab Mia Ferris eine von meinen Visitenkarten und fragte sie, ob sie mir ein Bild von ihrem Sohn zur Verfügung stellen könnte. Sie brachte eines aus neuerer Zeit, dann verabschiedeten wir uns und verließen sie. Wir ließen eine völlig fassungslose Frau zurück, die jedoch hundertprozentig von der Unschuld ihres Sohnes überzeugt war.
6
»Na endlich«, sagte Liam Ferris. »Die Stunde ist längst vorbei. Ich dachte schon, Sie kommen gar nicht mehr.«
»Der Verkehr. Es ist Irrsinn. Man kommt kaum durch.« Der Mann griff in die Innentasche seiner Jacke und holte seine Brieftasche heraus. »Ich gebe Ihnen tausend Dollar, Liam. Das reicht fürs Erste, denke ich.«
»Es tut mir leid, wenn ich die Sache vermasselt habe«, murmelte Liam Ferris.
»Machen Sie sich keine Gedanken. Lassen Sie Ihren Wagen einfach stehen, wo er ist, und verkriechen Sie sich. Wenn man Sie schnappt, bestreiten Sie ganz einfach, etwas mit der Entführung zu tun zu haben. Behaupten Sie, der Wagen sei Ihnen gestohlen worden.«
»Und aus welchem Grund bin ich geflohen?«
»Panik. Sie waren mit den Nerven am Ende. Erfinden Sie irgendetwas. Erzählen, dass man Sie bedrohte. Man wird Ihnen das Gegenteil nicht beweisen können.«
In Liam Ferris‘ Augen blitzte es auf. »Ich könnte mich ja stellen und diese Geschichte zum Besten geben. Man müsste mich laufen lassen.«
»Jetzt tauchen Sie erst mal unter. Alles andere wird sich ergeben.« Der Mann nahm ein Bündel Scheine aus der Brieftasche und reichte sie Ferris. »Noch etwas, Liam. Was immer auch kommt – nennen Sie niemals meinen Namen. Ich warne Sie.«
Liam Ferris schaute verblüfft drein. Dann sagte er: »Ich werde überhaupt nichts zugeben oder sagen. Wie Sie schon sagten: Die Polizei wird mir kaum etwas beweisen können. Und was den Wagen anbetrifft, der ist allenfalls noch fünfhundert Dollar wert.«
»Unabhängig davon erhalten Sie ihn zurück, wenn Ihnen die Polizei nichts am Zeug flicken kann.«
Ferris schob das Geld in die Tasche seines Blousons. »Ich melde mich bei Ihnen.«
»Gut. Hals- und Beinbruch.«
7
Der nächste Tag brachte nicht viel Neues. Der Wagen von Liam Ferris wurde von einer Polizeistreife am Central Park North entdeckt. Er wurde beschlagnahmt und zur SRD gebracht, wo er auf Spuren untersucht werden würde.
Wir fuhren noch einmal bei Mrs. Dixon vorbei und legten ihr das Bild von Liam Ferris vor. »Ja«, sagte die resolute Lady, »das ist der Bursche, der am Steuer gesessen hat. Ich erkenne ihn ganz deutlich. Ein Irrtum ist ausgeschlossen.«
Wir leiteten die Fahndung nach dem Studenten ein. Wahrscheinlich kannte jeder Streifenpolizist New Yorks das Gesicht des Burschen, von dem wir sicher waren, dass er zumindest Toby Warren gekidnappt hatte. Wobei ich persönlich davon überzeugt war, dass die Entführung der anderen drei Kinder dieselbe Handschrift trug. Auch in diesen Fällen war niemand wegen einer Lösegeldforderung an die Eltern herangetreten. Soviel Zufall gab es nicht.
Wir hatten die DNA von Joey Stiller, Sandy O'Rourke und Billy Osterman. Den genetischen Fingerabdruck Toby Warrens festzustellen hatten wir den Erkennungsdienst beauftragt.
Wir nahmen uns vor, das Umfeld von Liam Ferris zu durchleuchten. Von seiner Mutter wussten wir, dass er als wissenschaftlicher Assistent für Professor Dr. Wallace tätig war. Wir trafen den Professor in der Uni-Klinik an. Er bat uns in sein Büro und hörte sich an, was wir vorzutragen hatten. Dann sagte er: »Kaum zu glauben. Deshalb ist er wohl heute nicht in der Uni erschienen. Liam ist einer meiner besten Studenten, vielleicht sogar der beste. Er überrascht mich immer wieder aufs Neue. Von einer kriminellen Ader habe ich an ihm allerdings noch nichts bemerkt.«
»Wissen Sie, mit wem Ferris umgeht? Wenn Sie eng mit ihm zusammenarbeiten, gibt es doch sicher auch mal das eine oder andere private Gespräch. Hat er mal von einer Freundin erzählt? Von Freunden vielleicht?«
»Nein.« Der Professor lachte auf. »Wenn ich es mir richtig überlege, haben wir uns nie über private Dinge unterhalten. Seltsam, nicht wahr.«
»Was ist es für ein Job, den Ferris bei Ihnen ausübt?«
»Er macht alles Mögliche, geht mir bei meinen Forschungen zur Hand, schreibt medizinische Abhandlungen und Kommentare, die später unter meinem Namen veröffentlicht werden, wenn ich sie für in Ordnung befunden habe, und er arbeitet in meiner Klinik mit. Liam ist mit Herz und Seele Mediziner. Daher ist es für mich unvorstellbar, dass er sich auf gesetzeswidrige Machenschaften eingelassen haben soll.«
Auf dem Tisch des Arztes lagen Flyer, die auf grünes Papier gedruckt waren und meine Aufmerksamkeit erregten. Ich nahm einen der Handzettel und las.
Der Professor sagte: »Das Interview wird am kommenden Freitag auf CNN übertragen. Wenn Sie sich für die Gehirnforschung interessieren, dürfen Sie es sich auf keinen Fall entgehen lassen.«
Ich faltete den Flyer zusammen und schob ihn ein. »Sie haben eine eigene Klinik?«, fragte ich dann.
»Ja, auf Staten Island. Ich widme mich seit vielen Jahren der Erforschung des menschlichen Gehirns. Vor allen Dingen interessiert mich die Entwicklung desselben. Also das Stadium der Entwicklung des Gehirns von der Geburt eines Menschen an bis ins hohe Alter. Sie können meine Klinik gerne mal besichtigen.«
»Würde mich schon interessieren«, sagte Milo. Er hatte vor seiner Zeit beim FBI Medizin studiert und das Interesse an medizinischen Fragen bis heute nicht verloren.
»Wir können jederzeit etwas arrangieren«, erbot sich der Professor.
Ich wechselte das Thema: »Beschäftigen Sie weitere wissenschaftliche Assistenten?«
»Ja, mehrere junge Männer. Studenten. Arthur Baldwin, Sven Hollow, Dexter Horney. Baldwin gehört zum selben Jahrgang wie Liam Ferris. Hollow und Horney sind schon zwei Semester weiter. Ebenfalls vielversprechende junge Männer, die ihren Weg machen werden.«
Milo notierte die Namen und erkundigte sich bei dem Professor nach den Adressen. Wallace verwies uns an sein Sekretariat. Da wir keine Fragen mehr hatten, verabschiedeten wir uns.
Baldwin wohnte in der 118th Street. Es war ein Studentenwohnheim. Das Zimmer war verschlossen. Eine junge Frau, die uns auf dem Korridor begegnete, erklärte auf meine Frage, dass sie Baldwin gut kenne und er sich wohl in der Vorlesung befinde.
Wir beschlossen, am Abend noch einmal herzukommen.
Als wir um achtzehn Uhr noch einmal in das Studentenwohnheim kamen, trafen wir Baldwin an. »Privat pflegten Liam und ich keinen Kontakt«, sagte Baldwin. »Unsere Beziehung war rein medizinischer Natur, bedingt durch unsere Tätigkeit bei Professor Wallace.«
Wir erhielten auf keine Frage eine Antwort, mit der wir etwas anfangen hätten können. Baldwin schien von Ferris tatsächlich nicht mehr zu wissen, als dass es ihn gab und er für Professor Wallace arbeitete.
Als wir im Auto saßen, zogen wir Resümee. Wir hatten vier entführte Kinder, einen verdächtigen, aber flüchtigen Studenten und eine Mutter, die von der Unschuld ihres Sohnes überzeugt war. Dazu kamen ein Professor und ein anderer Student, die in einem engeren Kontakt zu Liam Ferris standen, die uns aber wenig, respektive gar nicht hilfreich waren.
Zwei Tage später war klar, dass Toby Warren in dem Wagen von Liam Ferris gesessen hatte. Einige Haare des Jungen, die auf dem Rücksitz gefunden worden waren, verrieten es. In dem Auto waren Fingerabdrücke festgestellt worden, hauptsächlich die Prints von Ferris, aber auch Fingerabdrücke, die im Archiv nicht registriert waren.
Die Fahndung nach Ferris hatte bisher keinen Erfolg gehabt. Es war, als hätte sich der Bursche in Luft aufgelöst. Eine Rückfrage bei seiner Mutter ergab, dass er sich nicht gemeldet hatte. »Wenn er wirklich kriminell geworden ist«, sagte Mia Ferris, »dann gerät er nach seinem Vater. Das war ein potentieller Krimineller. Er war skrupellos und ging über Leichen, wenn …«
Ich stoppte den Redefluss: »Informieren Sie uns, wenn sich Liam meldet«, sagte ich. »Eine Augenzeugin hat ihn übrigens als den Mann erkannt, der den Wagen fuhr, mit dem Toby Warren entführt wurde. Ihr Sohn wird ein ziemliches Problem haben, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.«
Mia Ferris gab einen Laut von sich, der sich anhörte wie trockenes Schluchzen.
Am späten Nachmittag des Tages erhielt ich einen Anruf. Es war ein Portier des Hostelling International, einem Hotel in der Amsterdam Avenue. Er sagte: »Mit ist soeben ein Gast aufgefallen. Er ging an der Rezeption vorbei und hat große Ähnlichkeit mit diesem Liam Ferris, von dem ein Bild in der New York Times veröffentlicht war. Der Bursche von eben scheint sich zwar seit einigen Tagen nicht mehr rasiert zu haben, aber ich bin mir sicher, dass es sich um Ferris handelt.«
Milo und ich fuhren sofort zum Hostelling International. Das Gebäude war an der Ecke zur 103rd Street errichtet worden. Wir sprachen mit dem Portier.
»Er verließ vor etwa anderthalb Stunden das Hotel und ist seither nicht wieder aufgetaucht. Da er nicht bei mir eingecheckt hat, kenne ich den Namen nicht, unter dem er hier wohnt, und ich weiß auch nicht, welches Zimmer er belegt hat.«
»Wir werden hier in der Halle auf ihn warten«, sagte ich.
Wir setzten uns in zwei der Sessel, die um einen niedrigen Glastisch herum gruppiert waren, und zwar so, dass wir von jemandem, der das Hotel betrat, nicht sofort gesehen wurden. Den Portier jedoch hatten wir im Auge.
Er gab uns eine halbe Stunde später ein Zeichen. Ich drehte den Kopf in Richtung Eingangstür und erkannte den Burschen, der das Hotel betrat, auf Anhieb. Es war Liam Ferris. Er trug eine Plastiktüte. Wahrscheinlich hatte er sich in irgendeinem Kaufhaus in der Nähe einige Dinge besorgt, die er benötigte.
Ich erhob mich und schnitt ihm den Weg zum Aufzug ab. Er sah mich und warf sich herum. Aber Milo blockierte schon die Tür nach draußen. Ferris wandte sich wieder mir zu. Geduckt, wie sprungbereit stand er da. Die Anspannung in seinen Zügen verriet mir, dass er krampfhaft nach einem Ausweg suchte. Sein Blick sprang hin und her.
»Geben Sie auf, Ferris«, sagte ich. »Sie entkommen uns nicht mehr.«
Seine Schultern sanken nach unten, er richtete sich auf, atmete tief durch und sagte: »Was wollen Sie von mir?«
»Wir sollten das im Field Office besprechen, Ferris. Nur soviel: Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht, zu schweigen. Wenn sie aber sprechen, mache ich Sie darauf aufmerksam …«
Ich klärte Ferris über seine Rechte auf. Milo glitt von hinten an ihn heran, Stahlspangen schlossen sich um die Handgelenke des Studenten, wir führten ihn ab. Den Beutel, mit dem Ferris ins Hotel gekommen war, trug Milo.
Wir brachten den Studenten in den Verhörraum im Zellentrakt des Federal Building, er musste sich an den Tisch setzen, ich ließ mich ihm gegenüber nieder, Milo baute sich halbrechts hinter mir auf. Sekundenlang herrschte Schweigen. Ferris verriet Unsicherheit. Unruhig rutschte er auf seinem Stuhl herum und massierte seine Hände. Unseren Blicken wich er aus.
»Sie stehen im Verdacht, zusammen mit einem Komplizen den achtjährigen Toby Warren in der Charles Street entführt zu haben«, eröffnete ich das Verhör.
»Ich entführe doch keine Kinder«, blaffte Ferris. »Was versuchen Sie mir da in die Schuhe zu schieben?«
»Es war Ihr Wagen, mit dem der Junge entführt wurde.«
»Der Chevy wurde mir gestohlen.«
»Aha. Sie haben den Diebstahl sicher der Polizei angezeigt.«
»Das wollte ich noch tun. Aber dann hörte ich im TV, dass die Polizei nach mir fahndet.«
»Als Sie in der Uni vor uns flohen, wurde nach Ihnen noch nicht gefahndet«, mischte sich Milo ein. »Warum haben Sie die Flucht ergriffen?«
»Ich bin erschrocken.«
»Sehen wir so fürchterlich aus?«, fragte ich.
»Man hat mir telefonisch gedroht«, murmelte der Student nach kurzer Überlegung. »Ich denke, es ist wegen eines Mädchens. Sein Name ist Laura Leighton. Jemand hat versprochen, mich fertigzumachen. Als ich Sie wahrnahm, geriet ich in Panik. Und dann sah ich im Fernsehen, dass nach mir gefahndet wird.«
»Warum haben Sie sich nicht gemeldet?«
»Ich hatte Angst. Was ist, wenn ich meine Unschuld nicht beweisen kann? Dann schickt man mich wegen eines Verbrechens ins Gefängnis, das ich gar nicht begangen habe.«
»In unserem Land gilt ein anderes Prinzip«, sagte ich. »Hier muss ein Mann seine Unschuld nicht beweisen. Man muss ihm eine Schuld nachweisen, damit er verurteilt werden kann. Rechtsstaatliches System; Sie haben sicher davon gehört.«
»Ich habe den Jungen nicht entführt.«
»Eine Augenzeugin hat Sie am Steuer des Wagens sitzen sehen, Ihres Wagens, Ferris. Und es ist erwiesen, dass Toby Warren mit Ihrem Wagen entführt wurde.«
Liam Ferris zog den Kopf zwischen die Schultern. Er erinnerte mich an einen geprügelten Straßenköter. In seinen Mundwinkeln zuckte es. Er hatte die Hände jetzt auf der Tischplatte liegen, hob sie jetzt aber, um sie nervös zu kneten. Sie hinterließen feuchte Flecken auf der Platte.
»Wer war noch dabei?«, fragte ich. »Sie waren zu zweit. Und in wessen Auftrag haben Sie Toby Warren entführt? Es war das vierte Kind einer Entführungsserie, die vor nicht ganz drei Wochen begann.«
»Ich weiß von nichts. Sie müssen mir einen Anwalt zur Verfügung stellen. Ohne Anwalt sage ich kein Wort mehr. Ich lasse mir von Ihnen nichts in die Schuhe schieben.«
»Das wollen wir nicht, mein Junge«, sagte Milo. »Ganz sicher nicht.«
»Wann wurde Ihnen der Bentley gestohlen?«
»Am zwölften März.«
8
Wir befanden uns wieder in unserem Büro und diktierten den Bericht über die Vernehmung von Liam Ferris. Da klingelte mein Telefon. Ich legte das Diktiergerät zur Seite und schnappte mir den Hörer. Es war ein Kollege von der SRD. »Eine weitere Auswertung der DNA-Hinweise in dem Wagen von Ferris hat ergeben, dass im Kofferraum Joey Stiller befördert wurde. Sie erhalten ein entsprechendes schriftliches Gutachten, Trevellian.«
Da der Lautsprecher meines Telefonapparates aktiviert war, hatte Milo mithören können, was der Kollege gesprochen hatte. Wir wechselten einen vielsagenden Blick. »Jetzt kommt er uns nicht mehr aus«, sagte ich. »Der Chevy ist ihm angeblich drei Tage vor der Entführung Toby Warrens gestohlen worden. Joey Stiller wurde aber schon viel früher entführt. Ich bin gespannt, was uns der Knabe zu sagen hat.«
Der Knabe schwieg verbissen. Er beantwortete weder Fragen nach Joey Stiller, noch nach Sandy O'Rourke, Billy Osterman oder Toby Warren.
Es war Freitag und um zwanzig Uhr wollte CNN das Interview mit Professor Dr. Ernest Wallace ausstrahlen. Ich hatte mir vorgenommen, ein wenig zuzuhören. Der Moderator, der den Professor interviewen sollte, hieß Larry Starbuck.
Er sagte in sein Mikro: »Hallo und herzlich willkommen bei diesem Forum. Unser Studiogast ist heute Professor Dr. Ernest Wallace. Professor Wallace ist der Leiter der psychiatrischen Klinik der Columbia Universität in New York. Außerdem betreibt er hier in Staten Island eine eigene Klinik.« Starbuck wandte sich dem Professor zu. »Ihr Hauptinteresse gilt dem Gehirn, Herr Professor. Was macht denn für Sie das Gehirn so interessant?«
»Das Gehirn ist mit Abstand unser spannendstes und auch unser kompliziertestes Organ«, sagte der Professor. »Man sagt ja auch oft, das Gehirn sei das komplizierteste Stück Materie, das es im Universum überhaupt gibt.«
»Das Gehirn hat zwanzig Milliarden Nervenzellen und es wiegt wohl an die eins Komma vier Kilo im Durchschnitt«, ließ wieder der Moderator seine Stimme erklingen. »Aber das Gehirn ist natürlich viel, viel mehr als nur diese Maße und Gewichte.«
»Ja.« Der Professor nickte mehrere Male. »Diese zwanzig Milliarden Nervenzellen findet man überall in Berichten über das Gehirn. Nebenbei gesagt sind es bei Männern dreiundzwanzig Milliarden Nervenzellen alleine im Kortex, also in der Gehirnrinde. Bei Frauen sind es neunzehn Milliarden Nervenzellen.« Der Professor lächelte. »Da Frauen freilich genauso intelligent sind wie Männer, rätselt seither die Wissenschaft, was die Männer mit ihren vier Milliarden Nervenzellen extra machen …«
Ich klinkte mich aus. Grundsätzlich interessierte mich das Interview nicht, und ich griff nach der Fernbedienung des Fernsehgerätes. Ich schaltete eine Reportage über Pinguine ein. Aber auch hier sah ich nur die Bilder. Mit meinen Gedanken war ich weit weg. Ich fragte mich, was einen jungen Mann vom Format eines Liam Ferris bewegen konnte, Kinder zu entführen. Sollte es etwa mit seinem Studium zusammenhängen? Brauchte man die Kinder für Forschungszwecke? Der Gedanke ließ mich nicht mehr los, und ich rief Milo an.
»Ich schaute mir gerade das Interview mit Professor Wallace an«, gab Milo zu verstehen, und mir war klar, dass er über die Störung nicht gerade erbaut war.
»Ich habe auch ein wenig hineingehört«, sagte ich. »Aber sicher verstehe ich zu wenig vom menschlichen Gehirn, um echtes Interesse dafür zu entwickeln. Bei dir mag das anders sein, Milo. Weißt du, was mir in den Sinn gekommen ist?«
»Spann mich nicht auf die Folter.«
»Dass die Kinder vielleicht für Forschungszwecke missbraucht werden.«
Sekundenlang schwieg Milo. Wahrscheinlich musste er erst verarbeiten, was ich gesagt hatte. Dann erklang seine Stimme: »Du denkst an Professor Wallace, nicht wahr?«
»Er beschäftigt sich mit der Entwicklung des menschlichen Gehirns. Liam Ferris geht ihm bei seinen Forschungen zur Hand.«
»Dann sollten wir vielleicht auch noch einmal Arthur Baldwin überprüfen«, murmelte Milo. »Vielleicht ist er der zweite Mann, den Mrs. Dixon in der Charles Street gesehen hat.«
»Wir werden morgen eine Gegenüberstellung veranlassen«, sagte ich. »Und dann sollten wir uns vielleicht wirklich einmal von dem Professor seine Klinik zeigen lassen.«
»Sollten wir nicht gleich mit einem Durchsuchungsbefehl aufwarten?«
»Dafür wird unser Verdacht nicht ausreichen«, versetzte ich. »Nein. Wir sehen uns einfach mal die Klinik an. Seinem Angebot entsprechend.«
»Falls Baldwin die Finger im Spiel hat und wir ihn festnehmen, dürfte der Professor, wenn er Dreck am Stecken hat, sämtliche Beweismittel verschwinden lassen.«
»Wir werden ihn und auch Baldwin in Sicherheit wiegen.«
Ich verabschiedete mich von Milo und spann meine Gedanken fort. Ich dachte noch darüber nach, als ich im Bett lag und einzuschlafen versuchte.
*
Am Morgen ließ ich Arthur Baldwin von der Universität abholen. Milo und ein anderer Kollege erledigten dies. Ich holte Mrs. Marcy Dixon in der Charles Street ab und brachte sie in den Raum, in dem wir die Gegenüberstellungen durchführten. Fünf junge Männer marschierten hinter der einseitig transparenten Wand auf. Sie hielten Nummern in den Händen. Hinter der Wand saß Mrs. Dixon auf einem Stuhl, Milo und ich standen neben ihr. Ich hatte die Arme vor der Brust verschränkt. Die fünf Probanden konnten uns nicht sehen.
»Erkennen Sie einen der Männer als den Entführer des Jungen wieder, Mrs. Dixon?«, fragte ich.
Sie nickte, nachdem sie die fünf Burschen eingehend gemustert hatte. »Der mit der Nummer zwei. Er hat den Kleinen in den Bentley dirigiert und dann auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Ich erkenne ihn hundertprozentig. Er war es – er und kein anderer.«
Es war Arthur Baldwin.
Ich war zufrieden.
Wir nahmen Baldwin mit in unser Büro. »Warum diese Gegenüberstellung?«, fragte er immer noch ziemlich ungehalten. »Wollen Sie mir nicht endlich die Antwort darauf geben?«
Natürlich wollte er schon vorher von uns wissen, aus welchem Grund er hierher gebracht worden war.
»Es ist unwichtig geworden, Baldwin«, erklärte ich lächelnd. »Sie können wieder nach Hause gehen.«
Verdutzt schaute er mich an.
»Warum war ich hier?«, fragte er noch einmal, diesmal mit noch mehr Nachdruck.
»Wir hielten Sie für einen Komplizen von Liam Ferris«, bekannte ich.
Er schluckte krampfhaft. Seine Augen begannen zu flackern. Zeichens seiner inneren Erregung.
»Aber unser Augenzeuge hat Sie nicht wieder erkannt«, fügte ich hinzu. »Sie sind aus dem Schneider und können nach Hause gehen.«
Fahrig tastete er sich mit der Linken über das Gesicht. Er schaute mich an, als wollte er mental in mich eindringen und mich hypnotisieren. »Hat Liam inzwischen ein Geständnis abgelegt?«, fragte er schließlich.
»Nein. Aber sicher haben wir ihn bald so weit. Ich glaube nicht, dass er den Kopf allein in die Schlinge steckt.«
Baldwin wandte sich ab, ging zur Tür, legte seine Hand auf die Klinke, drehte sich aber noch einmal herum und sagte: »Vielleicht ist Liam wirklich unschuldig.«
»Dann müsste sich unsere Augenzeugin schon sehr getäuscht haben. Außerdem sprechen eine Reihe anderer Beweise, die wir haben, für seine Schuld.«
Jetzt verließ Baldwin unser Büro.
»Er ist völlig von der Rolle«, sagte Milo grinsend.