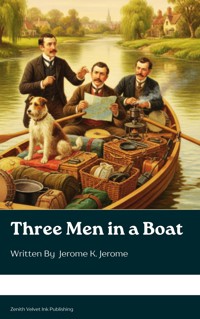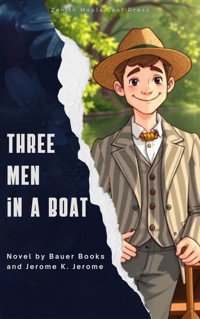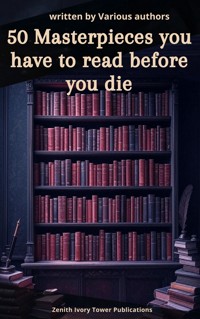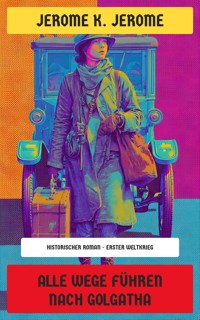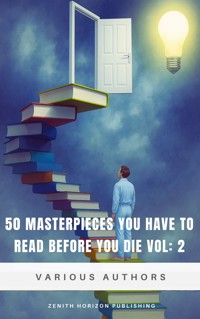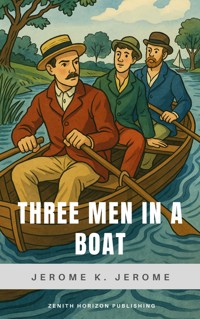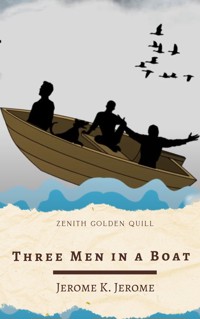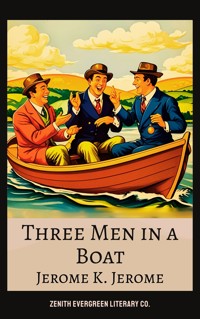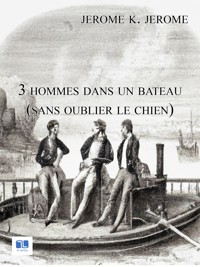17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Manesse Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Die Mutter aller Männerausflüge
Mit seiner Schilderung eines Campingurlaubs der drei Freunde George, Harris und J. und ihres Hunds Montmorency schuf Jerome K. Jerome 1889 einen der berühmtesten Klassiker britischen Humors. Dass ihr sympathischer, wenn auch sinnloser Kampf gegen die Tücken des Objekts heute so komisch ist wie eh und je, beweist Gisbert Haefs in seiner beschwingten Neuübersetzung.
Eine Bootsfahrt auf der Themse! Zu Zeiten von Königin Viktoria war das der Inbegriff des Ferienglücks. Auch unsere drei Freunde rudern auf der Suche nach Natur und Erholung zwölf Tage lang flussaufwärts: von Kingston nach Maidenhead, Marlow, Dorchester, Reading und Oxford – und dabei von einer Panne zur nächsten. Nichts kann die Freunde aus der Fassung bringen, sämtliche Missgeschicke, trocken serviert von Erzähler J., wissen sie mit Stil und Witz zu ertragen. Die Gentlemen trösten sich mit der reizvollen Atmosphäre der Themsestädtchen (und in deren Kneipen), bis der Regen sie vorzeitig in die Zivilisation Londons zurückspült.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
«Ein großes Buch – geschickt konstruiert, genau kalkuliert, einfach und perfekt bis ins Detail.» Harald Martenstein
Die Mutter aller Männerausflüge! Mit der Schilderung einer Bootsreise dreier Freunde schuf Jerome K. Jerome den berühmtesten Klassiker britischen Humors. Hier liegt er nun in beschwingter Neuübersetzung vor.
Eine Bootsfahrt auf der Themse: nicht nur zu Zeiten Königin Viktorias der Inbegriff von Ferienglück. Auch die drei Freunde George, Harris und J. rudern auf der Suche nach Ruhe und Erholung zwölf Tage lang flussaufwärts: von Kingston nach Maidenhead, Marlow, Dorchester, Reading und Oxford – und dabei von einer Panne zur nächsten. Begleitet von Hund Montmorency, kämpfen sie einen sympathischen, wenn auch hoffnungslosen Kampf gegen die Tücken des Objekts, gegen Zeltstangen, Dosenöffner und Schleppleinen. Da in der Ruhe bekanntlich die Kraft liegt, kann die drei tiefenentspannten Freunde nichts aus der Fassung bringen. Alle Missgeschicke wissen sie mit Witz und Stil zu parieren, bis der Regen sie vorzeitig in die Zivilisation zurückschwemmt.
Jerome K. Jerome
DREI MANN IN EINEM BOOT
Ganz zu schweigen vom Hund!
Roman
Aus dem Englischen übersetztvon Gisbert Haefs
Nachwort von Harald Martenstein
MANESSE VERLAG
Vorwort
Die Schönheit dieses Buches beruht weniger auf seinem literarischen Stil oder der Menge und Nützlichkeit der Informationen, die es enthält, als vielmehr seiner schlichten Wahrhaftigkeit. Seine Seiten enthalten den Bericht über Vorgänge, die sich tatsächlich ereignet haben. Diese wurden hier lediglich koloriert; und dafür wurde nicht einmal eigens Gebühr erhoben. George, Harris und Montmorency sind keine erdichteten Idealfiguren, sondern Wesen aus Fleisch und Blut – vor allem George, der knapp achtzig Kilo wiegt. An Gedankentiefe und Kenntnis der menschlichen Natur mögen andere Werke dieses übertreffen; andere Bücher mögen ihm an Originalität und Umfang gleichkommen; was jedoch seine hoffnungslose und unheilbare Wahrheitsliebe angeht, kann sich nichts bisher Entdecktes mit ihm messen. Mehr als alle anderen Reize wird wohl genau dies den Band in den Augen des ernsthaften Lesers kostbar machen und der Lektion, die diese Geschichte vermittelt, zusätzliches Gewicht verleihen.
London, August 1889
Kapitel 1
Drei Invalide – Die Leiden von George und Harris – Opfer von einhundertsieben tödlichen Krankheiten – Nützliche Rezepte – Heilung von Leberbeschwerden bei Kindern – Wir finden, dass wir überarbeitet sind und Ruhe brauchen – Eine Woche auf Meereswogen? – George befürwortet den Fluss – Montmorency erhebt Einwände – Ursprünglicher Vorschlag mit der Mehrheit von drei zu eins angenommen
Wir waren zu viert: George, William Samuel Harris, ich – und Montmorency. Wir saßen in meinem Zimmer, rauchten und redeten darüber, wie schlecht es uns ging – schlecht aus medizinischer Sicht, meine ich natürlich.
Wir fühlten uns alle ausgelaugt und wurden deshalb allmählich ziemlich nervös. Harris sagte, er werde zuweilen von solch außerordentlichen Schwindelanfällen übermannt, dass er kaum wisse, was er tue; und dann sagte George, auch er habe Schwindelanfälle, und auch er wisse kaum, was er tue. Bei mir war es die Leber, die nicht in Ordnung war. Ich wusste, dass meine Leber nicht in Ordnung war, weil ich gerade den Werbezettel für eine Leberpille gelesen hatte, auf dem die verschiedenen Symptome aufgezählt waren, anhand deren einer sagen konnte, ob seine Leber nicht in Ordnung sei. Ich hatte sie alle.
Das ist ganz merkwürdig, aber nie kann ich Werbung für ein neues Medikament lesen, ohne zwangsläufig zu dem Schluss zu gelangen, dass ich an der dort abgehandelten Krankheit leide, und zwar in ihrer schlimmsten Form. Die Diagnose scheint immer genau zu allem zu passen, was ich je verspürt habe.
Ich erinnere mich, wie ich eines Tages ins Britische Museum ging, um die Behandlung einer minderen Unpässlichkeit nachzulesen, von der ich befallen war – ich glaube, es war Heuschnupfen. Ich setzte mich mit dem Buch hin und las alles, was ich hatte lesen wollen; und in einem unbedachten Moment blätterte ich müßig weiter und begann, beiläufig Krankheiten ganz allgemein zu studieren. Ich weiß nicht mehr, was das erste Siechtum war, in das ich mich vertiefte – natürlich irgendeine furchtbare, alles dahinraffende Seuche –, und noch ehe ich die Liste der «frühen Symptome» zur Hälfte überflogen hatte, ging mir auf, dass ich zweifellos daran litt.
Ich saß eine Weile da, starr vor Entsetzen; dann blätterte ich mit der Mattigkeit der Verzweiflung weiter. Ich kam zu Typhus … las die Symptome … stellte fest, dass ich Typhus hatte, seit Monaten gehabt haben musste, ohne es zu wissen … fragte mich, woran ich sonst noch litt; stieß auf den Veitstanz … fand, wie erwartet, dass ich auch diesen hatte … begann mich für meinen Fall zu interessieren, beschloss, die Sache gründlich zu erforschen, und ging daher alphabetisch vor … las alles über Asthma und erfuhr, dass ich im Begriff stand, daran zu erkranken, und dass die akute Phase etwa in zwei Wochen einsetzen würde. Die Brightsche Krankheit1, stellte ich erleichtert fest, hatte ich nur in einer milderen Form und konnte, zumindest was das betraf, noch Jahre leben. Cholera hatte ich, mit kompliziertem Verlauf, und mit Diphtherie schien ich schon auf die Welt gekommen zu sein. Gewissenhaft wühlte ich mich durch die sechsundzwanzig Buchstaben, und die einzige Krankheit, die ich schließlich wohl nicht hatte, war das Dienstmädchenknie2.
Zunächst verletzte mich das sehr; irgendwie fühlte ich mich beinahe zurückgesetzt. Warum hatte ich kein Dienstmädchenknie? Weshalb diese gehässige Ausnahme? Nach einiger Zeit drangen jedoch weniger gierige Gefühle durch. Ich überlegte, dass ich ja jede andere pharmakologisch verzeichnete Krankheit hatte, mein Egoismus ließ nach, und ich beschloss, ohne Dienstmädchenknie auszukommen. Die Gicht schien mich in ihrer bösartigsten Form befallen zu haben, ohne dass ich mir dessen bewusst gewesen war, und an Zymosis3 litt ich offenbar schon seit meiner Kindheit. Nach «Zymosis» waren keine weiteren Krankheiten aufgeführt, und ich gelangte folglich zu dem Schluss, dass mir sonst nichts fehlte.
Ich saß da und grübelte. Ich dachte, welch interessanter Fall ich von medizinischem Standpunkt aus sein musste, was für eine Errungenschaft ich für ein Seminar wäre! Studenten müssten nicht mehr von Krankenhaus zu Krankenhaus ziehen, hätten sie mich. Ich allein war ja schon ein Hospital. Sie brauchten nur noch um mich herumzuspazieren und anschließend ihr Diplom zu machen.
Dann fragte ich mich, wie lang ich noch zu leben hatte. Ich versuchte, mich selbst zu untersuchen. Ich fühlte mir den Puls. Zuerst konnte ich überhaupt keinen Puls finden. Dann, ganz plötzlich, schien er loszulegen. Ich zog die Uhr hervor und stoppte die Zeit. Ich kam auf hundertsiebenundvierzig Schläge pro Minute. Ich versuchte, mein Herz zu fühlen. Ich konnte mein Herz nicht spüren. Es hatte zu schlagen aufgehört. Inzwischen bin ich zu der Ansicht gelangt, dass es doch die ganze Zeit da gewesen sein und geschlagen haben muss, aber garantieren kann ich es nicht. Ich tastete mich vorn überall ab, von meiner sogenannten Taille bis hinauf zum Kopf, und dann noch ein bisschen an den Seiten und ein wenig den Rücken aufwärts. Aber ich konnte nichts fühlen oder hören. Ich versuchte, meine Zunge zu betrachten. Ich streckte sie heraus, so weit es nur ging, kniff ein Auge zu und versuchte sie mit dem anderen zu untersuchen. Ich konnte nur die Spitze sehen, und das einzige Ergebnis war die zunehmende Gewissheit, dass ich Scharlach hatte.
Als fröhlicher, gesunder Mann hatte ich den Lesesaal betreten. Als hinfälliges Wrack kroch ich hinaus.
Ich ging zu meinem Medizinmann. Er ist ein alter Kumpel von mir, und wenn ich glaube, krank zu sein, fühlt er mir den Puls, schaut sich meine Zunge an, redet übers Wetter, und das alles kostenlos; deshalb dachte ich, ich würde ihm etwas Gutes tun, wenn ich jetzt zu ihm ginge. «Was ein Doktor braucht», sagte ich, «ist Praxis. Er soll mich haben. Er wird an mir mehr Praxis haben als an siebzehnhundert gewöhnlichen, alltäglichen Patienten mit jeweils nur einer oder zwei Krankheiten.»
Ich ging also gleich zu ihm, und er sagte: «Na, was fehlt dir?»
Ich sagte: «Ich will dir nicht die Zeit stehlen, mein Lieber, indem ich dir erzähle, was mir fehlt. Das Leben ist kurz, und du könntest hinscheiden, bevor ich fertig bin. Ich will dir stattdessen erzählen, was mir nicht fehlt. Ich habe kein Dienstmädchenknie. Warum ich kein Dienstmädchenknie habe, kann ich dir nicht erklären; aber die Tatsache bleibt, dass ich es nicht habe. Alles andere dagegen habe ich.»
Und ich erzählte ihm, wie ich dies alles entdeckt hatte.
Dann knöpfte er mich auf und betrachtete mich von oben, er packte mein Handgelenk, und dann schlug er mir auf die Brust, als ich nicht damit rechnete – ganz schön feige, möchte ich sagen –, und gleich darauf gab er mir einen Kopfstoß. Danach setzte er sich und stellte ein Rezept aus, faltete es, reichte es mir, und ich steckte es in die Tasche und verschwand.
Ich habe es nicht entfaltet. Ich lief damit zum nächsten Apotheker und gab es ihm. Der Mann las es, und dann gab er es mir zurück.
Er sagte, das führe er nicht.
Ich sagte: «Sie sind doch Apotheker, oder?»
Er sagte: «Ja, ich bin Apotheker. Wenn ich eine Kombination aus Lebensmittelmarkt und Familienhotel wäre, könnte ich Ihnen vielleicht weiterhelfen. Als bloßer Apotheker muss ich passen.»
Ich las das Rezept. Es lautete:
«1 Pfd. Beefsteak und
½ l Bier alle 6 Stunden.
1 Zehn-Meilen-Marsch jeden Morgen.
1 Bett um Punkt 11 Uhr jeden Abend.
Und zerbrich dir nicht den Kopf über Sachen, von denen du nichts verstehst.»
Ich befolgte die Anweisungen, mit dem – jedenfalls für mich – erfreulichen Ergebnis, dass mein Leben gerettet wurde und noch andauert.
Im vorliegenden Fall, um auf die Leberpillenwerbung zurückzukommen, hatte ich ohne jeden Zweifel die Symptome; deren auffälligstes war eine «allgemeine Abneigung gegen Arbeit jeder Art».
Was ich in dieser Hinsicht zu leiden habe, lässt sich gar nicht beschreiben. Seit frühester Kindheit bin ich, was das betrifft, ein Märtyrer. Als Junge war ich kaum je einen Tag frei von diesem Gebrechen. Damals wusste man ja nicht, dass es an meiner Leber lag. Die medizinische Wissenschaft war längst nicht so weit fortgeschritten wie heute, und man schrieb alles gewöhnlich der Faulheit zu.
«Also, du kleiner Teufel von Drückeberger», hieß es dann, «steh auf und tu was für deinen Lebensunterhalt, hörst du?» Natürlich wussten sie nicht, dass ich krank war.
Sie gaben mir auch keine Pillen; sie gaben mir seitlich Kopfnüsse. Und es mag zwar seltsam klingen, aber diese Kopfnüsse haben mich oft kuriert – vorübergehend. Ich weiß noch, dass eine einzige Kopfnuss größere Auswirkungen auf meine Leber hatte und mich weit begieriger werden ließ, sofort, ohne weiter Zeit zu vergeuden, loszulaufen und zu tun, was getan werden musste, als dies heute eine ganze Schachtel Pillen vermag.
Wissen Sie, das ist oft so; diese schlichten, altmodischen Heilmittel sind manchmal wirksamer als alles, was aus der Apotheke kommt.
Wir saßen eine halbe Stunde da und beschrieben einander unsere Krankheiten. Ich erklärte George und William Harris, wie ich mich morgens beim Aufstehen fühlte, und William Harris erzählte uns, wie er sich fühlte, wenn er zu Bett ging; und George stand auf dem Kaminvorleger und führte uns mit einem klugen und eindrucksvollen Schauspiel vor, wie er sich nachts fühlte.
George bildet sich ein, er sei krank; aber eigentlich fehlt ihm ernstlich nie etwas, wissen Sie.
An diesem Punkt klopfte Mrs. Poppets an die Tür, um zu fragen, ob wir bereit fürs Abendessen seien. Wir lächelten einander traurig an und sagten, wir sollten wohl besser versuchen, etwas herunterzukriegen. Harris sagte, ein bisschen was im Magen halte oft die Krankheit in Schach. Mrs. Poppets brachte das Tablett herein, wir zogen die Stühle näher an den Tisch und spielten mit einem kleinen Steak, Zwiebeln und etwas Rhabarbertorte herum.
Ich muss zu dieser Zeit sehr schwach gewesen sein, denn ich weiß, dass ich ungefähr nach der ersten halben Stunde das Interesse am Essen zu verlieren schien – sehr ungewöhnlich für mich –, und Käse wollte ich auch nicht.
Als dies pflichtgemäß erledigt war, füllten wir unsere Gläser nach, entzündeten die Pfeifen und nahmen die Diskussion über unseren Gesundheitszustand wieder auf. Keiner von uns konnte sagen, was wirklich mit uns los war, aber die einhellige Meinung lautete, dass alles – was auch immer es genau war – von Überarbeitung verursacht worden sei.
«Was wir brauchen, ist Ruhe», sagte Harris.
«Ruhe und einen kompletten Tapetenwechsel», sagte George. «Die Überlastung unseres Gehirns hat zu einer allgemeinen Depression geführt, die das ganze System erfasst hat. Ein Wechsel der Umgebung und eine Befreiung vom Zwang, nachzudenken, werden das innere Gleichgewicht wiederherstellen.»
George hat einen Vetter, der auf den Arrestlisten meistens als Medizinstudent geführt wird; und so hat er selbstverständlich eine etwas hausärztliche Art, die Dinge auszudrücken.
Ich stimmte George zu und schlug vor, uns einen entlegenen, weltverlorenen Flecken fern vom Getriebe der Menge zu suchen und dort zwischen verschlafenen Feldwegen eine sonnige Woche zu verträumen … irgendein halb vergessener Winkel, verborgen und verwunschen, außer Reichweite der lärmenden Welt … einen absonderlichen Horst hoch auf den Klippen der Zeit, wo die Brandungswogen des neunzehnten Jahrhunderts nur fern und schwach zu vernehmen wären.
Harris sagte, das wäre bestimmt der reine Trübsinn. Er sagte, er wisse genau, was für einen Ort ich meinte: wo alle um acht Uhr zu Bett gehen, wo man nicht für Geld und gute Worte einen Referee4 auftreiben kann und zehn Meilen weit laufen muss, um seinen Tabak zu bekommen.
«Nein», sagte Harris, «wenn man Ruhe und Ortswechsel haben will, geht nichts über eine Seereise.»
Ich sprach mich nachdrücklich gegen die Seereise aus. Eine Seereise tut einem gut, wenn man das ein paar Monate lang macht, aber für nur eine Woche ist es etwas Scheußliches.
Man bricht montags auf und hegt im Busen die Überzeugung, dass man es genießen wird. Man winkt den Jungs am Gestade ein hoheitsvolles Lebewohl zu, steckt sich die größte Pfeife an und stolziert auf Deck umher, als wäre man Captain Cook, Sir Francis Drake und Christoph Kolumbus in einer Person. Am Dienstag wünscht man sich, man wäre nicht an Bord gegangen. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag wäre man am liebsten tot. Am Samstag ist man in der Lage, ein wenig Fleischbrühe zu schlucken, an Deck zu sitzen und mit einem schwachen, höflichen Lächeln zu antworten, wenn mildherzige Leute einen fragen, wie es denn inzwischen geht. Am Sonntag beginnt man, wieder ein wenig umherzuspazieren und feste Nahrung zu sich zu nehmen. Und am Montagmorgen, wenn man mit Reisetasche und Schirm an der Reling steht und darauf wartet, an Land zu gehen, beginnt man die Reise richtig zu genießen.
Ich weiß noch, wie mein Schwager einmal aus gesundheitlichen Gründen zu einer kurzen Seereise aufbrach. Er nahm eine Koje London–Liverpool und zurück, und als er Liverpool erreichte, hatte er nur einen Wunsch: das Rückreisebillett zu verkaufen.
Es wurde in der ganzen Stadt mit gewaltigem Preisnachlass angeboten, wie ich hörte, und schließlich für achtzehn Pence einem gallig wirkenden jungen Mann verkauft, dem seine Medizinmänner gerade geraten hatten, an die Küste zu reisen und sich Bewegung zu verschaffen.
«Küste!», sagte mein Schwager, wobei er ihm die Fahrkarte liebevoll in die Hand drückte. «Also, Sie werden für Ihr Leben genug Küste haben, und was Bewegung angeht – Sie kriegen mehr Bewegung, wenn Sie da auf dem Schiff sitzen, als wenn Sie auf dem trockenen Land Purzelbäume schlagen.»
Er selbst – mein Schwager – reiste mit dem Zug zurück. Er sagte, die North Western Railway sei ihm gesund genug.
Ein anderer mir bekannter Kerl machte eine einwöchige Kreuzfahrt die Küste entlang, und vor dem Ablegen kam der Steward zu ihm und fragte, ob er für jede Mahlzeit einzeln zahlen oder vorab das Gesamtpaket buchen wolle.
Der Steward empfahl letzteres Vorgehen, da dies erheblich billiger sei. Er sagte, man werde ihn die ganze Woche für zwei Pfund fünf Shilling verköstigen. Er sagte, zum Frühstück gebe es Fisch, danach etwas vom Grill. Das Mittagessen um eins bestehe aus vier Gängen. Abendessen um sechs – Suppe, Fisch, Entree, Roastbeef, Geflügel, Salat, Süßspeise, Käse und Dessert. Und ein leichtes Nachtmahl – Fleisch – um zehn.
Mein Freund meinte, es sei besser, das Angebot für zwei Pfund fünf Shilling anzunehmen (er ist ein tüchtiger Esser), und so tat er dies auch.
Das Mittagessen begann, als sie gerade querab von Sheerness waren. Er war nicht so hungrig, wie er geglaubt hatte; deshalb gab er sich mit ein wenig gekochtem Rindfleisch und Erdbeeren mit Sahne zufrieden. Im Verlauf des Nachmittags dachte er sehr ausgiebig nach, und einmal kam es ihm so vor, als hätte er seit Wochen nichts als gekochtes Rindfleisch gegessen, und ein anderes Mal, als hätte er seit Jahren von Erdbeeren mit Schlagsahne gelebt.
Auch das Rindfleisch und die Erdbeeren mit Schlagsahne schienen nicht glücklich zu sein – wirkten eher verdrossen.
Um sechs Uhr kam man mit der Auskunft, das Abendessen werde jetzt serviert. Die Ankündigung löste bei ihm keinerlei Begeisterung aus, aber er hatte das Gefühl, etwas von diesen zwei Pfund fünf Shilling abarbeiten zu müssen, und sich an Tauen und anderen Dingen festhaltend, ging er nach unten. Ein ersprießlicher Duft von Zwiebeln und heißem Schinken, vermengt mit gebratenem Fisch und Gemüse, begrüßte ihn am Fuß des Niedergangs, dann trat der Steward mit öligem Lächeln zu ihm und sagte: «Was kann ich Ihnen bringen, Sir?»
«Schaffen Sie mich hier raus», war die schwache Antwort.
Sie beförderten ihn schnell nach oben, lehnten ihn an der Leeseite über die Reling und ließen ihn allein.
Die nächsten vier Tage führte er ein schlichtes, tadelloses Leben mit dünnem Kapitänszwieback (ich meine, der Zwieback war dünn, nicht der Kapitän) und Sodawasser; als sich dann aber der Samstag näherte, wurde er übermütig und machte sich an schwachen Tee und trockenen Toast, und am Montag mästete er sich mit Hühnerbrühe. Er verließ das Schiff am Dienstag, und als es vom Anleger davondampfte, blickte er ihm voll Bedauern nach.
«Da geht sie hin», sagte er, «da geht sie hin mit Essen im Wert von zwei Pfund an Bord, das mir gehört und das ich nicht zu mir genommen habe.»
Er sagte, wenn man ihm einen weiteren Tag gewährt hätte, glaube er, dass er die Rechnung hätte ausgleichen können.
Deshalb war ich gegen die Seereise. Nicht meinetwegen, wie ich erklärte. Ich sei da nie empfindlich. Aber ich sei besorgt um George. George sagte, er habe damit keine Probleme, und es würde ihm sehr gefallen, aber er rate Harris und mir, nicht einmal daran zu denken, da er sicher sei, dass wir seekrank würden. Harris sagte, ihm sei es immer ein Rätsel gewesen, wie Leute auf See krank werden könnten … sagte, sie täten das wohl absichtlich, aus Affektiertheit … sagte, er habe es sich oft gewünscht, aber es sei ihm nie beschieden gewesen.
Dann erzählte er uns Geschichten darüber, wie er den Ärmelkanal bei so argem Seegang überquert habe, dass man die Passagiere in den Kojen habe festbinden müssen, und er und der Kapitän seien als einzige Lebewesen an Bord nicht seekrank gewesen. Manchmal waren es er und der zweite Maat, die nicht seekrank waren, aber meist waren es er und ein anderer. Wenn nicht er und ein anderer, dann er allein.
Es ist seltsam, aber niemand wird je seekrank – an Land. Auf See begegnet man vielen, denen es wirklich ganz schlecht geht, ganzen Schiffsladungen; an Land habe ich hingegen nie einen getroffen, der gewusst hätte, was das eigentlich bedeutet, seekrank zu sein. Wo sich die Abertausende erkrankter Seeleute, von denen alle Schiffe voll sind, verstecken, wenn sie sich an Land befinden, ist mir ein Rätsel.
Wenn die meisten Leute so wären wie der Kerl, den ich einmal auf dem Boot nach Yarmouth getroffen habe, könnte ich mir dies scheinbare Mysterium ganz leicht erklären. Ich weiß noch, wir hatten gerade vom Southend Pier abgelegt, und er lehnte sich in einer sehr gefährlichen Haltung aus einer der Pforten in der Reling. Ich trat zu ihm, um ihn zu retten.
«He! Kommen Sie weiter rein», sagte ich und rüttelte ihn an der Schulter. «Sie gehen gleich über Bord.»
«O weh! Wär ich’s doch bloß schon», war seine einzige Antwort, und damit musste ich ihn zurücklassen.
Drei Wochen später traf ich ihn im Kaffeeraum eines Hotels in Bath, wo er von seinen Reisen erzählte und mit Begeisterung darlegte, wie sehr er das Meer liebe.
«Guter Seemann!», gab er zur Antwort auf die neidische Frage eines sanften jungen Mannes. «Also, ich habe mich einmal ein bisschen komisch gefühlt, muss ich gestehen. Das war vor Kap Hoorn. Am nächsten Tag ist das Schiff auseinandergebrochen.»
Ich sagte: «Waren Sie nicht an dem einen Tag nahe Southend Pier ein bisschen taumelig und wollten über Bord geworfen werden?»
«Southend Pier!», erwiderte er mit verblüffter Miene.
«Ja, auf der Fahrt nach Yarmouth, Freitag vor drei Wochen.»
«Oh, ach … ja», antwortete er; sein Gesicht hellte sich auf. «Jetzt weiß ich es wieder. An dem Nachmittag hatte ich Kopfschmerzen. Das war das eingelegte Gemüse, wissen Sie. Die scheußlichsten pickles, die ich je auf einem anständigen Boot probiert habe. Haben Sie auch welche gegessen?»
Was mich angeht, habe ich eine erstklassige Vorsorgemaßnahme gegen Seekrankheit entdeckt, indem ich balanciere. Man stellt sich mitten aufs Deck, und während das Schiff stößt und schwankt, bewegt man den Körper so, dass er immer senkrecht bleibt. Wenn der Bug des Schiffs sich hebt, beugt man sich nach vorn, bis die Nase fast das Deck berührt, und wenn das Heck sich hebt, lehnt man sich nach hinten. Für eine Stunde oder zwei ist das ganz gut, aber man kann so nicht eine Woche lang balancieren.
George sagte: «Wir sollten den Fluss hinauffahren.»
Er sagte, da hätten wir frische Luft, Bewegung und Stille; der dauernde Wechsel der Szenerie würde unseren Geist beschäftigen (einschließlich dessen von Harris, soweit davon die Rede sein könne), und die harte Arbeit werde für Appetit sorgen und uns gut schlafen lassen.
Harris sagte, er finde nicht, dass George etwas tun sollte, was ihn möglicherweise noch verschlafener mache, als er ohnehin immer sei, das könnte gefährlich werden. Er sagte, er verstehe nicht so ganz, dass George mehr schlafen wolle als jetzt schon, da doch jeder Tag nur vierundzwanzig Stunden habe, sommers wie winters; er meine aber, wenn er noch mehr schliefe, könne er ebenso gut tot sein und damit Kost und Logis sparen.
Harris sagte, dass ihm der Fluss aber wie ein «T» passen würde.5 Ich weiß nicht, was ein «T» ist (außer dem für sechs Pence, einschließlich Brot und Butter und Kuchen ad lib., und das ist für den Preis billig, wenn man nichts anderes gegessen hat). Es scheint jedoch allen zu passen, was sehr für es spricht.
Mir passte es auch wie ein «T», und Harris und ich sagten beide, es sei eine gute Idee von George, und wir sagten dies in einem Tonfall, der irgendwie zu implizieren schien, dass wir verblüfft seien, etwas so Vernünftiges von George zu hören.
Der Einzige, der nichts von dem Vorschlag hielt, war Montmorency. Er hat sich noch nie etwas aus dem Fluss gemacht.
«Das ist für euch ja schön und gut, Jungs», sagt er. «Ihr mögt das, aber ich nicht. Da gibt es nichts, was ich dort tun kann. Landschaft ist nicht meine Sache, und ich rauche auch nicht. Wenn ich eine Ratte sehe, haltet ihr nicht an, und sobald ich einschlafe, macht ihr Unfug mit dem Boot und kippt mich über Bord. Wenn ihr mich fragt, ich halte das Ganze für kompletten Blödsinn.»
Wir waren jedoch drei gegen einen, und der Antrag wurde angenommen.
Kapitel 2
Pläne werden erörtert – Die Wonne, in schönen Nächten draußen zu zelten – Dito in nassen Nächten – Ein Kompromiss wird erzielt – Montmorency, erster Eindruck von diesem – Befürchtungen, er sei zu gut für diese Welt, später als unbegründet verworfen – Sitzung vertagt
Wir holten Karten hervor und erörterten Pläne.
Wir beschlossen, am folgenden Samstag von Kingston aus aufzubrechen. Harris und ich würden uns morgens dorthin begeben und das Boot flussaufwärts nach Chertsey bringen, und George, der sich erst nachmittags von der Stadt loseisen konnte (George hält jeden Tag von zehn bis vier in der Bank sein Schläfchen, nur samstags nicht; da weckt man ihn um zwei und setzt ihn vor die Tür), würde dort zu uns stoßen.
Sollten wir draußen kampieren oder in Gasthäusern schlafen?
George und ich waren fürs Kampieren. Wir sagten, das wäre so wild und frei, irgendwie vorväterlich …
Langsam weicht die goldene Erinnerung an die verblichene Sonne aus den Herzen der kalten, tristen Wolken. Geräuschlos, wie bekümmerte Kinder, haben die Vögel ihren Gesang eingestellt, und nur des Moorhuhns klagender Schrei und das heisere Krächzen der Wiesenknarre stören das ehrfürchtige Schweigen rings um das Flussbett, wo der sterbende Tag seinen letzten Atem aushaucht.
An beiden Ufern kriecht aus den dunklen Wäldern die geisterhafte Armee der Nacht, graue Schatten, mit lautlosem Tritt, die letzte Nachhut des Lichts zu verscheuchen, und mit unhörbaren Schritten rückt sie unbemerkt vor über das schwankende Schilf und durch seufzende Binsen; und die Nacht auf ihrem düsteren Thron entfaltet die schwarzen Schwingen über der sich verfinsternden Welt, und schweigend herrscht sie von ihrem Phantompalast aus, erhellt von den fahlen Sternen.
Dann schieben wir unser kleines Boot in einen ruhigen Winkel, das Zelt wird aufgeschlagen, das frugale Abendmahl gekocht und gegessen. Dann werden die großen Pfeifen gestopft und entzündet, und heiteres Plaudern erfüllt mit tönendem Gemurmel die Runde, während in den Pausen unseres Gesprächs der Fluss, der das Boot umspielt, seltsame alte Geschichten und Geheimnisse ausplaudert und leise das alte Kinderlied singt, das er so viele Tausend Jahre lang gesungen hat – noch so viele Tausend Jahre singen wird, bis seine Stimme heiser und alt wird –, ein Lied, das wir, die gelernt haben, das wechselhafte Antlitz des Flusses zu lieben, die wir uns so oft an seinen sanften Busen geschmiegt haben, irgendwie zu verstehen wähnen, wenn wir auch die Geschichte, der wir lauschen, nicht in bloßen Worten erzählen könnten.
Und wir sitzen da, am Ufersaum, während der Mond, der den Fluss ebenfalls liebt, sich neigt, ihm einen geschwisterlichen Kuss gibt und ihn mit Silberarmen umschlingt; und wir schauen, wie er, immer singend, immer flüsternd, weiterfließt, hinaus, um seinen König, das Meer, zu treffen … bis unsere Stimmen in der Stille ersterben und die Pfeifen ausgehen … bis wir, durchaus gewöhnliche junge Männer, uns seltsam von Gedanken erfüllt fühlen, halb traurig, halb süß, und nicht reden mögen oder wollen … bis wir lachen, im Aufstehen die Asche aus unseren ausgebrannten Pfeifen klopfen, «Gute Nacht» sagen und, eingelullt von schwappendem Wasser und raschelnden Bäumen, unter den großartigen stummen Sternen einschlafen und träumen, die Welt sei wieder jung: jung und lieblich, wie sie einmal war, ehe Jahrhunderte des Verdrusses und der Sorge ihr hübsches Antlitz zerfurchten, ehe die Sünden und Torheiten ihrer Kinder ihr liebevolles Herz hatten alt werden lassen … lieblich, wie sie in jenen verflossenen Tagen war, als sie, eben erst Mutter geworden, uns, ihre Kinder, an der tiefen Brust nährte … ehe die Tücken der grell geschminkten Zivilisation uns aus ihren liebevollen Armen gelockt hatten und wir uns ob der giftigen Grimassen der Künstlichkeit des einfachen Lebens schämten, das wir mit ihr geführt hatten, und des einfachen, stattlichen Hauses, in dem die Menschheit vor so vielen Jahrtausenden geboren wurde.
Harris sagte: «Was, wenn es regnet?»
Harris lässt sich nicht aufwühlen. Harris hat keinen Sinn für Poesie – kein wildes Sehnen nach dem Unerreichbaren. Niemals «weint er und weiß doch nicht, warum»6. Wenn Harris’ Augen sich mit Tränen füllen, kann man darauf wetten, dass er gerade rohe Zwiebeln gegessen oder zu viel Worcestersauce über sein Kotelett geschüttet hat.
Wenn man nachts mit Harris am Strand stünde und sagte: «Lausche! Hörst du es nicht? Ist das nur der Gesang der Meerjungfrauen tief unter den Wogen, oder sind es traurige Geister, die Klagelieder singen für weiße, vom Tang umfangene Leichen?» Dann würde Harris einen am Arm nehmen und antworten: «Ich weiß, was das ist, mein Alter; du hast dir einen Zug geholt. Du gehst jetzt einfach mit. Ich kenne ein Lokal, hier gleich um die Ecke, wo du einen Schluck vom feinsten Scotch bekommst, den du je gekostet hast … bringt dich in null Komma nichts wieder auf die Beine.»
Harris kennt immer ein Lokal gleich um die Ecke, wo man ein ganz großartiges Getränk bekommt. Ich glaube, wenn man Harris oben im Paradies träfe (falls man ihn sich dort überhaupt vorstellen kann), würde er einen sofort begrüßen mit «Wie schön, dass du es hergeschafft hast, mein Alter; ich habe da ein nettes Lokal gefunden, gleich um die Ecke, wo du einen erstklassigen Nektar bekommst.»
Im vorliegenden Fall jedoch, und was das Kampieren angeht, war seine praktische Ansicht ein Hinweis zur rechten Zeit. Draußen kampieren ist bei Regen kein Vergnügen.
Es ist Abend. Man ist durchnässt, im Boot stehen gut zwei Zoll Wasser, und alles ist klamm. Man findet am Ufer eine Stelle, die nicht ganz so voller Pfützen ist wie die anderen, die man gesehen hat, man landet, schleppt das Zelt hin, und zwei von der Truppe wollen es aufschlagen.
Es ist durchnässt und schwer, fällt über einem zusammen, klebt am Kopf fest und macht einen verrückt. Dabei schüttet es die ganze Zeit unausgesetzt. Es ist schwie rig genug, ein Zelt bei gutem Wetter aufzuschlagen; wenn es regnet, wird die Sache zu einer Herkulesaufgabe. Man hat den Eindruck, als würde der andere, statt zu helfen, nur den Trottel spielen. Gerade wenn man die eine Seite wunderbar festgezurrt hat, zupft er an der anderen und ruiniert alles.
«He! Was hast du vor?», rufst du ihm zu.
«Und was hast du vor?», gibt er zurück. «Lass mal los, ja?»
«Zerr nicht so dran, du versaust alles, du blöder Esel», schreist du.
«Nein, ich nicht», schreit er zurück. «Lass du mal los!»
«Ich sag dir doch, du versaust alles!», röhrst du und wünschst, du könntest auf ihn losgehen; und dann ruckst du an deinen Schnüren, was ihm sämtliche Heringe herauszieht.
«Ah, dieser blöde Trottel!», hörst du ihn vor sich hin murmeln; dann folgt ein wüstes Zerren, und deine Seite des Zelts fliegt weg. Du legst den Hammer beiseite und willst auf die andere Seite gehen und ihm sagen, was du von der ganzen Sache hältst, aber gleichzeitig bricht er in dieselbe Richtung auf, um dir seine Sicht der Dinge darzulegen. Ihr folgt einander immer wieder im Kreis, beschimpft einander, bis das Zelt zu einem Haufen zusammenfällt und ihr einander über die Ruinen hinweg anschauen könnt, worauf beide im gleichen Atemzug empört ausrufen: «Da hast du’s! Hab ich’s dir nicht gesagt?»
Der Dritte, der inzwischen das Boot leer geschöpft, sich dabei Wasser in den Ärmel gegossen und die letzten zehn Minuten ausdauernd vor sich hin geflucht hat, möchte jetzt wissen, was bei allen Teufeln ihr eigentlich vorhabt und warum das verflixte Zelt noch immer nicht steht.
Auf die eine oder andere Weise kommt das Zelt schließlich doch zum Stehen, und ihr bringt eure Sachen an Land. Der Versuch, ein Holzfeuer zu machen, ist aussichtslos, deshalb zündet ihr den Gaskocher an und drängt euch dicht um ihn.
Hauptbestandteil des Abendessens ist Regenwasser. Das Brot besteht zu zwei Dritteln aus Regenwasser, die Rinderpastete ist davon gründlich durchtränkt, und Marmelade, Butter, Salz und Kaffee haben sich mit ihm zu einer Suppe vermischt.
Nach dem Essen stellt ihr fest, dass euer Tabak feucht ist und ihr nicht rauchen könnt. Zum Glück habt ihr eine Flasche von dem Stoff, der aufheitert und berauscht, wenn man ihn in der richtigen Menge zu sich nimmt, und das lässt euch wieder ausreichend Interesse am Leben gewinnen, um schlafen zu gehen.
Dann träumst du, ein Elefant habe sich plötzlich auf deine Brust gesetzt, und ein Vulkan sei ausgebrochen und habe dich auf den Meeresgrund geschleudert – wo der Elefant immer noch friedlich an deinem Busen schlummert. Du erwachst, und dir wird klar, dass wirklich etwas Schreckliches geschehen ist. Dein erster Eindruck: Das Ende ist gekommen; dann wieder meinst du, das könne nicht sein, es müsse sich um Diebe und Mörder handeln oder eine Feuersbrunst, und dieser Ansicht verleihst du auf die übliche Weise Ausdruck. Hilfe bleibt jedoch aus, und du weißt nur, dass Tausende Leute auf dir herumtrampeln und dass du zerquetscht wirst.
Auch jemand anders scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Du hörst seine schwachen Schreie unter deinem Bett. Entschlossen, dein Leben auf jeden Fall teuer zu verkaufen, zappelst du heftig, schlägst und trittst nach rechts und links und schreist dabei die ganze Zeit lauthals; endlich gibt etwas nach, und du findest dich mit dem Kopf an der frischen Luft wieder. Zwei Fuß entfernt siehst du undeutlich einen halb nackten Schurken, der nur darauf wartet, dich umzubringen, und du stellst dich auf einen Kampf um Leben und Tod ein, als dir langsam klar wird, dass dies Jim ist.
«Ach, du bist das, wie?», sagt er, da er dich im selben Moment erkennt.
«Ja», antwortest du und reibst dir die Augen. «Was ist passiert?»
«Das blöde Zelt hat’s umgeweht, glaube ich», sagt er. «Wo ist Bill?»
Dann hebt ihr beide die Stimme und ruft nach «Bill!», und unter euch wogt und bebt die Erde, und die erstickte Stimme, die du vorhin schon gehört hast, antwortet aus den Ruinen: «Geh runter von meinem Kopf, ja?»
Bill krabbelt hervor, ein verdrecktes, zertrampeltes Wrack, und er ist in unnötig aggressiver Stimmung – offensichtlich befindet er sich in dem Glauben, das alles sei mit Absicht angerichtet worden.
Morgens seid ihr alle drei sprachlos, was daran liegt, dass ihr euch in der Nacht gründlich erkältet habt; außerdem seid ihr ziemlich streitlustig und beschimpft einander das ganze Frühstück hindurch mit heiserem Flüstern.
Und also beschlossen wir, in schönen Nächten draußen zu schlafen und bei Nässe oder dem Wunsch nach Abwechslung wie ehrbare Leute Hotels, Gasthäuser oder Pubs aufzusuchen.
Montmorency begrüßte diesen Kompromiss mit viel Beifall. Er schwelgt nicht gern in romantischer Einsamkeit. Man gebe ihm etwas Lautes, und wenn es kurze Beine hat – umso besser. Sieht man sich Montmorency an, könnte man meinen, er sei ein Engel, der aus einem der Menschheit verborgenen Grunde in Gestalt eines kleinen Foxterriers auf die Erde gesandt wurde. Montmorencys Auftreten scheint zu sagen: «O was für eine böse Welt das ist, und wenn ich doch nur etwas tun könnte, um sie besser und edler zu machen», was frommen alten Damen und Herren schon die Tränen in die Augen getrieben hat.
Als er damals auf meine Kosten zu leben begann, hätte ich nie geglaubt, ich könnte ihn dazu bringen, lange zu bleiben. Ich habe mich oft hingesetzt und ihn betrachtet, wie er da auf dem Teppich hockte und zu mir aufblickte, und ich habe gedacht: «Ach, dieser Hund wird nicht lange leben. Ein schwebendes Gefährt wird kommen, ihn mitnehmen und in den hellen Himmel heben – genau dies wird mit ihm geschehen.»
Aber als ich für ungefähr ein Dutzend von ihm gemeuchelte Hühner bezahlt, ihn knurrend und zappelnd am Genick aus hundertvierzehn Straßenkämpfen gezerrt und eine tote Katze inspiziert hatte, die mir zu diesem Behuf eine erzürnte Dame brachte, welche mich einen Mörder nannte, und als ich vom übernächsten Nachbarn zum Rapport bestellt worden war, weil ich einen bösartigen Hund frei herumlaufen ließe, der ihn an einem kalten Abend zwei Stunden lang im eigenen Werkzeugschuppen belagert habe, sodass er zu verängstigt war, um auch nur die Nase aus der Tür zu recken, und nachdem ich erfahren hatte, dass ein mir unbekannter Gärtner dreißig Shilling gewonnen hatte, indem er darauf wettete, dass der Hund in einer bestimmten Zeit soundso viele Ratten töten könnte – da begann ich anzunehmen, dass man ihn vielleicht doch etwas länger hienieden verweilen lassen würde.
Sich vor einem Stall herumzutreiben, eine Bande der ruchlosesten Hunde der Stadt um sich zu scharen und sie auf einem Marsch durch die Slums anzuführen, um andere ruchlose Hunde zu bekämpfen, das ist Montmorencys Vorstellung von «Leben»; und deshalb fand der Vorschlag, Gasthäuser, Pubs und Hotels aufzusuchen, seine überaus emphatische Billigung.
Da nun die Vorkehrungen hinsichtlich des Schlafens zu unser aller – vierfachen – Zufriedenheit besprochen waren, blieb nur noch zu erörtern, was wir denn mitnehmen sollten; dies hatten wir eben zu erwägen begonnen, als Harris sagte, er habe jetzt für einen Abend genug vom Gerede; er schlug vor, auszugehen und gemeinsam ein Schlückchen zu trinken; er sagte, er habe da ein Lokal ausfindig gemacht, gleich um die Ecke am Platz, wo man einen wirklich trinkenswerten Tropfen irischen Whiskeys bekommen könne.
Whiskyglas-George sagte, er sei durstig (ich habe ihn nie anders erlebt); und da ich ahnte, dass ein wenig Whisky, warm, mit einer Zitronenscheibe, meiner Unpässlichkeit guttun würde, vertagten wir die Debatte unter allgemeiner Zustimmung auf den nächsten Abend. Die Versammlung setzte den Hut auf und ging aus.
Kapitel 3
Vereinbarungen getroffen – Harris’ Methode, etwas zu erledigen – Wie der ältliche Familienvater ein Bild aufhängt – George macht eine vernünftige Bemerkung – Die Wonnen des frühmorgendlichen Badens – Vorkehrungen gegen das Kentern
Also versammelten wir uns am folgenden Abend wieder, um unsere Pläne zu erörtern und zu arrangieren. Harris sagte: «Was wir zuallererst festlegen müssen, ist, was wir mitnehmen wollen. Also, besorg dir ein Stück Papier und schreib auf, J., und du holst den Lebensmittelkatalog, George, und jemand gibt mir bitte ein Stückchen Bleistift, und dann mache ich eine Liste.»
Das ist Harris, wie er leibt und lebt – jederzeit bereit, die gesamte Bürde zu übernehmen und sie anderen auf den Rücken zu packen.
Er erinnert mich immer an meinen armen Onkel Podger. Im ganzen Leben haben Sie noch kein solches Durcheinander in einem Haus erlebt, wie wenn mein Onkel Podger es auf sich nahm, etwas zu erledigen. Da war ein Gemälde vom Einrahmen zurückgekommen, stand im Esszimmer und wartete darauf, aufgehängt zu werden; Tante Podger fragte dann, was damit zu geschehen habe, und Onkel Podger sagte: «Ach, überlass das nur mir. Macht ihr anderen euch keine Gedanken deswegen. Ich übernehme das alles.»
Und dann zog er immer den Rock aus und fing an. Er schickte das Mädchen los, um für sechs Pence Nägel zu beschaffen, und dann einen der Jungen hinterher, der ihr sagen sollte, welche Größe sie holen sollte; und ab da arbeitete er sich nach und nach weiter vor und brachte das ganze Haus auf Trab.
«Also, geh du und hol mir den Hammer, Will», rief er. «Und du bring mir den Zollstock, Tom; und ich brauche die Trittleiter und am besten auch einen Küchenstuhl. Und Jim: Lauf du zu Mr. Goggles und sag ihm, liebe Grüße von Pa, er hofft, dem Bein geht’s besser, und ob er uns wohl die Wasserwaage leihen kann? Und geh du nicht weg, Maria, ich brauche doch wen, der mir das Licht hält; und wenn das Mädchen wieder hier ist, soll sie noch mal los und ein bisschen Bilderschnur besorgen; und Tom – wo steckt denn Tom? –, Tom, komm mal her; du musst mir das Bild reichen.»
Und dann hob er das Bild hoch und ließ es fallen; es löste sich aus dem Rahmen, er versuchte, das Glas zu retten, und dabei schnitt er sich; dann hüpfte er durchs Zimmer und suchte sein Taschentuch. Er konnte das Taschentuch nicht finden, weil es in der Tasche des Rocks steckte, den er ausgezogen hatte; er wusste nicht, wo er den Rock gelassen hatte, das ganze Haus musste aufhören, sein Werkzeug zu suchen, und anfangen, sich nach dem Rock umzuschauen; und die ganze Zeit tanzte er umher und stand allen im Weg.
«Weiß denn im ganzen Haus keiner, wo mein Rock ist? Mein Lebtag habe ich noch nie so einen wirren Haufen gesehen – Ehrenwort, wirklich nicht. Sechs seid ihr – und könnt nicht einmal einen Rock finden, den ich erst vor fünf Minuten ausgezogen habe! Also, was bei allem …»
Dann stand er auf und stellte fest, dass er darauf gesessen hatte, und er rief: «Ach, ihr könnt aufhören! Ich habe ihn schon selber gefunden. Ebenso gut könnte ich die Katze bitten, etwas zu suchen, wie von euch erwarten, dass ihr es findet.»
Und wenn man eine halbe Stunde damit zugebracht hatte, seinen Finger zu verbinden, ein neues Glas zu beschaffen, das Werkzeug, die Leiter und die Kerze herbeizubringen, machte er einen zweiten Anlauf, wobei die ganze Familie, einschließlich des Mädchens und der Putzfrau, hilfsbereit einen Halbkreis um ihn bildete. Zwei Leute mussten den Stuhl halten, ein Dritter half ihm hinauf und hielt ihn dort fest, ein Vierter reichte ihm einen Nagel, ein Fünfter gab ihm den Hammer, und er griff nach dem Nagel und ließ ihn fallen.
«Da!», sagte er dann in beleidigtem Tonfall. «Jetzt ist der Nagel weg.»
Und wir mussten alle auf Knien herumkriechen und suchen, während er auf dem Stuhl stand, knurrte und wissen wollte, ob man beabsichtige, ihn den ganzen Abend warten zu lassen.
Schließlich fand sich der Nagel, aber inzwischen hatte er den Hammer verloren.
«Wo ist der Hammer? Was habe ich denn mit dem Hammer angestellt? Lieber Himmel! Ihr steht da zu siebt herum und glotzt und habt keine Ahnung, was ich mit dem Hammer gemacht habe!»
Wir fanden seinen Hammer, aber dann konnte er die Markierung nicht mehr erkennen, die er für den Nagel an der Wand gemacht hatte, und jeder Einzelne von uns musste neben ihm auf den Stuhl steigen und nachsehen, ob wir sie finden konnten; jeder fand sie an einer anderen Stelle, und er nannte uns alle Idioten, einen nach dem anderen, und sagte, wir sollten vom Stuhl steigen. Er nahm den Zollstock, maß nach und stellte fest, dass er von der Ecke aus die Hälfte von einunddreißig Dreiachtelzoll brauchte; er versuchte, das im Kopf auszurechnen, und drehte durch.
Dann versuchten wir alle, es im Kopf auszurechnen; jeder kam zu einem anderen Ergebnis, und alle schnauzten einander an. In dem allgemeinen Aufruhr vergaßen wir die ursprüngliche Zahl, und Onkel Podger musste alles neu ausmessen.
Diesmal nahm er ein Stückchen Schnur, und im entscheidenden Moment, als der alte Narr sich in einem Winkel von fünfundvierzig Grad auf dem Stuhl vorbeugte und versuchte, einen Punkt zu erreichen, der drei Zoll außerhalb seiner Reichweite lag, glitt ihm die Schnur aus den Fingern, und er rutschte hinunter auf das Klavier, was, als er mit Kopf und Körper ganz plötzlich sämtliche Noten gleichzeitig anschlug, einen wirklich sehr schönen musikalischen Effekt ergab.