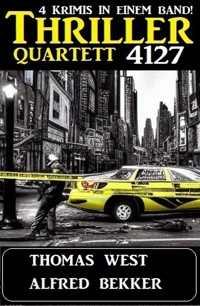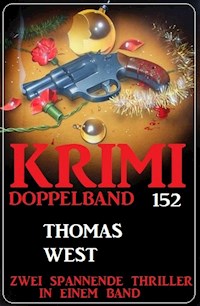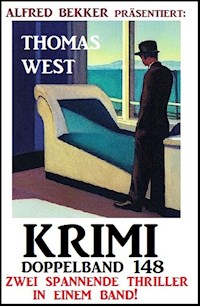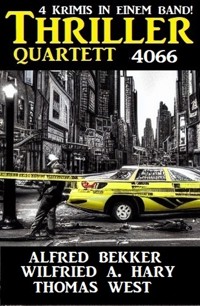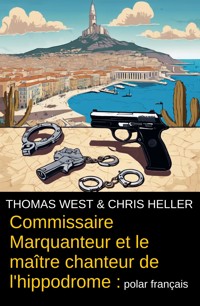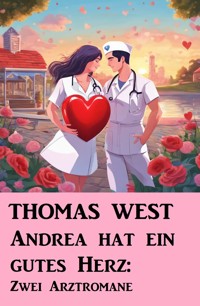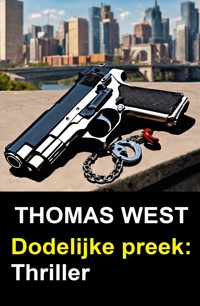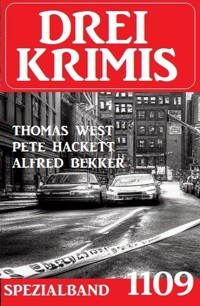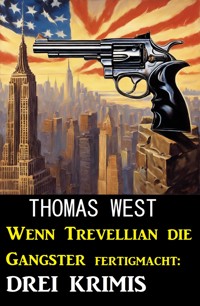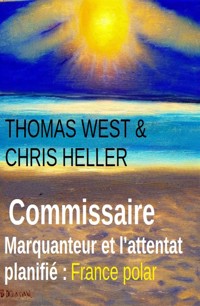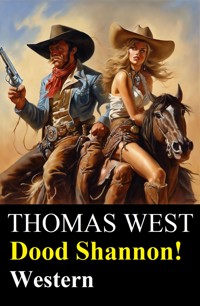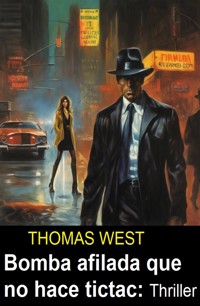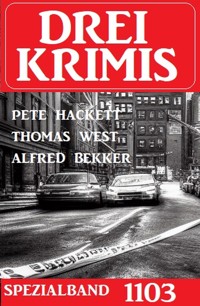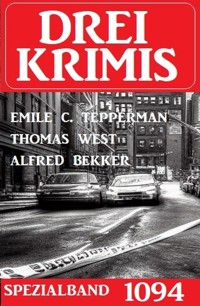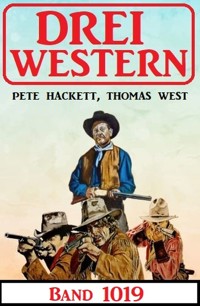
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Western: (399XE) Pony Express Rider (Thomas West) Santa Fe Express (Pete Hackett) Panhandle-Express (Pete Hackett) Ein greller Feuerblitz zerfetzte die Dunkelheit mit gleißendem Licht. Gleichzeitig erfolgte eine Explosion. Die Felswände schienen zu erbeben, die Erde zu erzittern. Brüllendes Getöse rollte durch die Schlucht und wurde tausendfach verstärkt. Schwellen wurden aus dem Schotterbett gerissen, Schienen verbogen sich. Gewaltige Massen von Gestein und Geröll prasselten in die Tiefe. Dichte Staubwolken quollen wie dichter Nebel. Im nächsten Moment erbebte die Erde erneut, etwa fünfzig Yards vom ersten Explosionsherd entfernt. Es war, als hätte eine Riesenfaust gegen den Felsen geschlagen. Gesteinsbrocken wurden aus den Felswänden zu beiden Seiten des Gleisbettes gerissen und krachten in die Schlucht, noch während das Echo der Detonation durch das Tal rollte. "Das wäre erledigt", rasselte ein heiseres Organ. "Verschwinden wir, ehe die Leute aus dem Camp auftauchen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Hackett, Thomas West
Drei Western Band 1019
Inhaltsverzeichnis
Drei Western Band 1019
Copyright
Pony Express Rider
Santa Fe Express
Panhandle-Express
Drei Western Band 1019
Thomas West, Pete Hackett
Dieser Band enthält folgende Western:
Pony Express Rider (Thomas West)
Santa Fe Express (Pete Hackett)
Panhandle-Express (Pete Hackett)
Ein greller Feuerblitz zerfetzte die Dunkelheit mit gleißendem Licht. Gleichzeitig erfolgte eine Explosion. Die Felswände schienen zu erbeben, die Erde zu erzittern. Brüllendes Getöse rollte durch die Schlucht und wurde tausendfach verstärkt. Schwellen wurden aus dem Schotterbett gerissen, Schienen verbogen sich.
Gewaltige Massen von Gestein und Geröll prasselten in die Tiefe. Dichte Staubwolken quollen wie dichter Nebel.
Im nächsten Moment erbebte die Erde erneut, etwa fünfzig Yards vom ersten Explosionsherd entfernt. Es war, als hätte eine Riesenfaust gegen den Felsen geschlagen. Gesteinsbrocken wurden aus den Felswänden zu beiden Seiten des Gleisbettes gerissen und krachten in die Schlucht, noch während das Echo der Detonation durch das Tal rollte.
"Das wäre erledigt", rasselte ein heiseres Organ. "Verschwinden wir, ehe die Leute aus dem Camp auftauchen."
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Pony Express Rider
von Thomas West
Zwei auf drei Meter – mehr maß der Raum nicht. Und er war nicht besonders hell. Nur auf den Rücken des Mannes neben der schmalen Pritsche malte sich ein kleiner quadratischer Lichtfleck. Vier dünne Linien durchkreuzten das helle Quadrat auf dem grauen Hemd – zwei senkrechte und zwei waagrechte. Nur morgens und am frühen Vormittag schien die Sonne durch das vergitterte Fenster. Etwas, woran Spencer Wallace sich nie gewöhnt hatte. Die ganzen Jahre nicht. Überhaupt war er ein Mann, der sich nur schwer an Dinge gewöhnte, die nicht so waren, wie sie sein sollten.
Auf die geballten Fäuste und die nackten Zehen gestützt, stemmte er seine knapp hundertzwanzig Pfund vom Boden hoch. Wieder und wieder. Vierzig Mal insgesamt. Wie jeden Morgen seit sieben Jahren. Damals, als er damit anfing, hatte er noch gut zwanzig Pfund mehr auf den Knochen gehabt.
Wallace war nicht besonders groß. Und auffällig schlank. Regelrecht mager sogar. Sein wirr nach allen Seiten abstehendes, dunkelblondes Haar und sein struppiger Bart waren so lang, dass sie den feuchten Steinboden sogar dann noch berührten, wenn er bei den Liegestützen die Arme durchdrückte.
Irgendwo knarrte eine Tür. Schwere Schritte näherten sich. Schlüssel klimperten, Metall schabte über Metall, zweimal schnappte das Schloss – die Zellentür öffnete sich quietschend.
Ein Mann mit Armeekappe und in ausgebleichter, ehemals schwarzer Uniformjacke stand im Türrahmen. Kein junger Mann mehr – Mitte fünfzig oder älter. Ein Infanterieveteran.
"Alles hat seine Zeit, Spence", sagte er. "Deine Zeit hier ist um." Sam Dully liebte es, die Bibel zu zitieren. Er war ein frommer Mann. An manchen Tagen war er mit dem dicken schwarzen Buch unter dem Arm sogar in Wallace' Zelle aufgekreuzt. Doch seine Versuche, den dreißig Jahre Jüngeren zu bekehren, blieben fruchtlos.
Spencer Wallace unterbrach seine Liegestützen. Ungläubig betrachtete er den Gefängniswärter. Die Stirn über seinem eingefallenen Gesicht legte sich in Falten. "Heute schon?"
Er sprang auf und trat neben die Zellentür. Unzählige schwarze Striche bedeckten die Backsteinwand neben dem Eichenholztürbalken. Die Stelle, die Tag für Tag als erstes von der Morgensonne beschienen wurde. Zweitausendfünfhundertsechsundfünfzig Striche insgesamt. In Zehnerblocks zusammengefasst.
"Tatsächlich", flüsterte der struppige, abgemagerte Mann. "Ich muss mich um einen Tag verzählt haben."
"Kann schon vorkommen, wenn man jeden Tag so viel zu zählen hat", feixte der Wärter. "Von mir aus kannst du auch gern noch einen Tag bleiben."
Er drehte sich um und schlurfte den Gang zwischen den Zellentüren entlang. Der Häftling raffte seine Habseligkeiten zusammen – Tabaksbeutel, ein Pokerblatt, ein paar Briefe, das vergilbte Foto einer Frau – und folgte ihm.
"Ich werde den Teufel tun und auch nur eine gottverdammte Stunde länger als nötig in diesem feuchten Loch bleiben", sagte er gleichmütig. Ein strafender Blick Dullys traf ihn.
Im Office des Gefängnisses händigte der Wärter ihm seine Sachen aus. Eine dunkle Leinenhose aus grobem Stoff, eine schwarze Lederweste, Stiefel, Wäsche, Patronengurt und so weiter. Und seinen Revolver. Einen Colt-Walker von 1847. Kaliber 44. Das einzige Erbstück seines Vaters. Der Texas Ranger war kurz vor Wallace' Prozess von Viehdieben erschossen worden.
"Kannst du einem Museum an der Ostküste verkaufen, falls du je in die Gegend kommst", brummte Sam Dully.
"Komme ich nicht." Wallace stieg in seine Hosen. Er ließ sich ein Messer von dem alten Soldaten geben, um ein Loch in den Gürtel zu bohren – die Hose war ihm viel zu weit. In der Trommel des alten Revolvers steckten noch drei Patronen. Drei hatte er damals abgefeuert. Als sie nachts sein Haus umstellten. Das hätte er nicht tun sollen. Glenn Powell, der Sheriff von Saint Joseph, hatte die drei Schüsse als Beweis für Wallace' Schuld gewertet.
Dully griff in die Innentasche seiner Uniformjacke und zog ein paar zusammengerollte Dollarnoten heraus. "Hier." Er warf das Geld auf den Tisch.
"Was soll das?"
"Von der Wells Fargo Company. Sie haben ihre Schulden an dich bei uns beglichen."
Wallace hatte der Wells Fargo acht Pferde verkauft. Kurz vor seiner Verhaftung. Er zählte die Scheine. Fünfzig Dollar. "Nur fünfzig!?" Zorn blitzte in seinen blauen Augen.
"Sei froh, dass du überhaupt was kriegst. Die Pacific Traffic Bank, die du überfallen hast, hat den Löwenanteil pfänden lassen. Das hier habe ich für dich gerettet. Gegen die Dienstvorschriften übrigens."
"Ich hab' keine Bank überfallen, Sam", knurrte Wallace. Er steckte das Geld ein und setzte seinen verstaubten Biberfellhut auf.
"Wie du meinst, Spence." Dully wandte sich zur Tür. "Aber du weißt ja – nur den, der seine Sünden bekennt, liebt der Herr."
"Leck mich am Arsch und bring mich endlich raus aus diesem Rattenloch."
Über den Gefängnishof führte der alte Soldat Wallace zum Außentor des ehemaligen Forts.
"Was wirst du als erstes tun, wenn du nun als freier Mann deiner Wege ziehen kannst?", wollte er wissen.
"Drei Dinge, von denen ich sieben Jahre lang Tag und Nacht geträumt habe: Endlich wieder ein Pferd reiten, endlich wieder eine Frau ficken, und endlich die Leute jagen, die mir sieben Jahre in diesem gottverdammten Knast eingebrockt haben!"
Der Gefängniswärter schüttelte trübsinnig den Kopf. "Du wirst noch in der Hölle braten, wenn du nicht umkehrst zum Herrn..."
"Besser als in einem Himmel ohne Pferde und Frauen singende Engel anglotzen."
Dully schnalzte tadelnd mit der Zunge und öffnete das Gefängnistor. "Gott segne dich trotzdem, mein Sohn..."
"Auf Nimmerwiedersehen, Sam." Er warf sich Felljacke und Ledertasche über die Schulter und stapfte durch den Staub des breiten Reitwegs, der von der Stadt ins alte Fort führte. Nach ein paar Schritten blieb er stehen, weil er die Blicke des Veteranen in seinem Nacken spürte. "Was ich dir noch sagen wollte, Sam..." Er drehte sich nicht um, wandte nur den Kopf ein wenig. "Bist ein netter Bursche, yeah, das bist du."
Er hörte Dully seufzen; das Tor schlug zu. Wallace setzte sich in Bewegung. Zunächst schleppend, als würde ihn ein unsichtbares Band mit dem Gefängnisfort verbinden. Dann immer schneller. Und mit jedem Schritt, den er sich von seinem Kerker entfernte, schob sich die unbegreifliche Wirklichkeit ein Stück weiter in sein Hirn: Er war ein freier Mann...
*
Bevor der Weg hügelabwärts zur Stadt hinunterführte, blieb er stehen. Fast andächtig betrachtete er die riesige Ansammlung von Häusern und Dächern. Kansas City war gewachsen in den sieben Jahren.
Rechts des Hügel wälzte sich der Missouri der Stadt entgegen. Ein riesiger Raddampfer schob sich flussaufwärts, viele kleinere Frachtkähne glitten über das Wasser.
Eine Stunde später stelzte Wallace über die dichtbevölkerte Mainstreet der Stadt. Vor der Filiale der Pacific Traffic Bank blieb er stehen. Ein blaues, unauffälliges Gebäude. In ihm hatte sich vor mehr als sieben Jahren das Drama abgespielt, das ihn aus seinen Träumen von einem ganz normalen Leben gerissen hatte. Zwei Männer waren damals erschossen worden. Ein Bankkunde und ein Kassierer. Beide Männer hatte er nie gesehen. Und trotzdem hatten sie ihn ins Gefängnis geschickt...
Die ersten fünfzig Cent seines Barvermögens investierte Spencer Wallace in eine Rasur und einen Haarschnitt. Als er danach auf die Straße trat, sah er ungefähr so alt aus, wie er war – neunundzwanzig Jahre.
Sein Magen knurrte, aber noch drängender brannte die Sehnsucht in ihm, endlich wieder ein Pferd zu besteigen. Wie von selbst trugen ihn seine Beine zum Viehmarkt.
Vor sieben Jahren noch pflegten die Cowboys aus Texas ihre Herden in den weitläufigen Koppeln unten am Hafen zusammenzutreiben. Dort wurde das Vieh in Schiffe verladen und Richtung Mississippi nach Saint Louis und bis nach New Orleans hinunter transportiert, um die Ostküste mit Steaks zu versorgen.
Wallace nahm an, dass sich das nicht geändert hatte.
Und vor sieben Jahren boten am Missouri-Hafen von Kansas City auch die Pferdezüchter aus Kansas ihre Pferde an. Wallace selbst hatte dort den ersten Hengst für seine Zucht gekauft.
Lange her. Ein ganzes Leben lang.
Je näher er dem Hafen kam, desto deutlicher hörte er das Gebrüll des Viehs. Und bald kroch ihm der scharfe Geruch der Tiere in die Nase. Er beschleunigte seinen Schritt.
Die breite, leicht abschüssige Straße war von Billardkneipen, Hotels, Friseurläden, Banken und Saloons gesäumt. Reiter preschten zum Hafen hinunter. Kutschen polterten an ihm vorbei. Wallace' sowieso schon feierliche Stimmung steigerte sich noch. Bald hatte er den Mund voller Staub.
Endlich kam das Ende der Straße in Sicht. Und das dunkle Band des Missouri – der Flusshafen.
Vieh stand dicht zusammengedrängt in engen Koppeln. Cowboys ritten hin und her. Menschen liefen daran entlang – und endlich entdeckte Wallace eine kleine Koppel, deren Zäune von einer dichten Traube johlender Cowboys belagert waren. Innerhalb der Koppel tobte ein Pferd herum und versuchte seinen Reiter abzuwerfen.
Wallace' Herz schlug höher. Er fiel in Laufschritt. Es war ihm gar nicht bewusst, dass er rannte.
Aus den Augenwinkeln nahm er einen hellen Fleck auf dem Bürgersteig wahr – das Blondhaar einer Frau. Sie stieg eben auf die Straße hinunter. Fast bis zu den Knien raffte sie ihr langes Kleid hoch, um es vor dem Staub zu schützen.
Wallace Schritte verlangsamten sich – wieder wie von selbst. Die Frau überquerte die Straße. Wenn er stehen blieb, würde sie keine zwei Schritte an ihm vorbeigehen. Er blieb stehen.
Ungeniert sah er der Frau entgegen. Sie trug ein blaues, schwarzgestreiftes Kleid, das nicht ganz billig gewesen sein konnte. Der Saum und das tief ausgeschnittene Dekolleté war in weiße Spitzen gefasst – Wallace Augen saugten sich an den Ansätzen ihrer Brüste fest. Sein Mund wurde trocken.
Die Frau bewegte sich mit großen, energischen Schritten – als wäre sie es gewohnt, ungehindert dorthin zu gehen, wo sie hingehen wollte. Wallace sah die Brüste unter ihrem Kleid auf und ab wippen, und er sah die wiegende Bewegung ihrer Hüften. Wie festgewachsen stand er mitten auf der Straße.
Jetzt entdeckte ihn die Frau. Weder änderte sie ihre Richtung, noch verzögerte sie ihren Schritt, noch wich sie seinem Blick aus. Nur ihre schmalen Brauen zuckten leicht.
Wallace schluckte. Er hatte seit sieben Jahren keine Frau mehr gehabt. Und höchstens zweimal im Jahr eine Frau gesehen – Kate Bloomdale. Sie hatte ihn ein oder zweimal im Jahr besucht. Ein Gitter hatte sie jedesmal getrennt. Und Kate pflegte weite Jacken und Hosen zu tragen, die ihre Figur nicht übermäßig betonten.
Diese Frau hier aber schien ihr Kleid ausschließlich zu diesem Zweck zu tragen. Und so ähnlich bewegte sie sich auch – als wollte sie die Rundungen ihrer Weiblichkeit zur Schau stellen.
Als sie an ihm vorbeirauschte, lächelte sie herausfordernd. Und er roch ihr schweres Parfüm. Er wollte etwas sagen, ihr einen Gruß, einen Scherz zurufen – aber seine Stimme gehorchte ihm nicht. Wie gebannt starrte er ihr hinterher. Ihr Kleid war so eng, dass er das Muskelspiel ihrer Oberschenkel und ihres Hinters sehen konnte...
"Hey, Mann – zur Seite!" Wallace fuhr herum.
Eine Kutsche! Er machte einen Satz, und der Vierspänner bretterte dicht an ihm vorbei. Eine Staubwolke hüllte Wallace ein.
"Was ham sie dir in den Whisky geschüttet?", rief der Kutscher.
Die Kutsche rollte zum Hafen hinunter, auf die Vieh- und Pferdekoppeln zu. Die Pferde – verdammt... Er klopfte sich den Staub von Hut und Kleidung und ging weiter – langsam und zögernd. Die Pferde würde er auch heute Nachmittag noch unten am Hafen finden. Aber die Frau...
Er drehte sich um. Die Frau stieg die beiden Stufen zum Bürgersteig hinauf und drückte die Schwingtür eines Saloons auf. Kurzentschlossen folgte Wallace ihr...
*
"Es ist ein Fehler, wenn er zurückkommt." Der alte Bloomdale stand auf der Vortreppe zum Haupthaus seiner großen Ranch. Strähnen schlohweißen Haares hingen ihm ins sonnenverbrannte Gesicht. "Ich spür's in allen Knochen, dass es ein Fehler ist."
Seine Tochter, Kate Bloomdale, schien ihm gar nicht zuzuhören. Seelenruhig spannte sie zwei Pferde vor den offenen Einachser.
"Hörst du nicht, was ich sage, Kate?" Amos Bloomdale stieg die Treppe hinunter und pflanzte sich vor seiner Tochter auf.
Der Viehzüchter war ein hochgewachsener Mann. Eine goldene Uhrkette hing aus der Westentasche unter seinem dunklen, fast knielangem Gehrock. Seitdem er zwei Jahre zuvor den Sturz von einem Pferd nur knapp überlebt hatte, stieg er kaum noch in den Sattel. Die Lederkluft und die harte Arbeit auf den Weiden überließ er seitdem ganz seinen Cowboys. Und seinem Sohn.
"Ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn er zurück nach Saint Joseph kommt. Ein verdammt schlechtes Gefühl! Verstehst du das, Kate?"
"Ich bin nicht taub, Dad." Kate lief die Treppe hinauf zum Eingangsportal. Auf der mit Schnitzereien verzierten Sitzbank neben der Tür lag ein Gewehr. Ihr Vater schlurfte hinter ihr her.
"Warum musstest du ihm die ganzen Jahre Briefe schreiben? Ihn sogar besuchen?" Die Frau griff sich das Gewehr und lief zurück zur Kutsche. Der alte Bloomdale hinter ihr her. "Glaubst du, die Leute in Saint Joseph hätten das nicht spitzgekriegt? Die zerreißen sich schon die Mäuler!"
Sie schob das Gewehr unter den Bock und drehte sich um. "Jeder tut, was er tun muss, Dad!"
Aus dunkelbraunen Augen blitzte sie ihn an. Ihr braungebranntes Gesicht war schmal und kantig. Über dem schmallippigen Mund saß eine kleine, scharfgeschnittene Nase. Die Bloomdale-Tochter war schlank, fast drahtig. Ihre Gesten und Bewegungen wirkten zielstrebig und sicher.
Man musste nur drei Sätze mit ihr sprechen, um eine Ahnung davon zu bekommen, wer Kate Bloomdale war: eine Frau, die wusste, was sie wollte.
"Ich bitte dich, Kate." Amos Bloomdale verlegte sich jetzt aufs Betteln. "Ich bitte dich inständig – spann die Pferde wieder aus und bleib hier! Bleib hier und streich den Mann aus deinem Gedächtnis."
"Nein." Sie schwang sich auf den Kutschbock. Anders als die meisten Frauen in der Gegend trug sie Rindslederhosen und hohe Schaftstiefel. Das schwarze Haar trug sie zu einem Knoten zusammengebunden im Nacken.
"Du bist wie deine Mutter", jammerte der alte Bloomdale. "Warum zum Teufel kannst du dir nicht einmal was sagen lassen?" Kate stülpte sich einen hellen Stetson über und griff stumm nach den Zügeln. Dabei hätte sie eine Menge antworten können. Zum Beispiel, dass ihr alter Herr sonst gottfroh war, jemanden auf der Ranch zu haben, der ihrer verstorbenen Mutter ähnelte.
Jemanden, der etwas von Zahlen verstand und die Geschäfte führen konnte. Jemanden, der den Cowboys Dampf machte, wenn sie nach durchzechten Nächten nicht von den Matratzen kamen. Und jemanden, der Rob auf die Finger sah.
"Fahr wenigstens nicht allein." Bloomdale gab auf. Wie schon so oft. "Dein Bruder soll dich begleiten."
"Rob wird nicht mit nach Kansas City fahren!", sagte sie scharf.
"Dann Jimmy!" Bloomdale winkte zwei Cowboys, die auf der anderen Seite des Hofes vor der Schmiede mit einem Pferd beschäftigt waren. "Ruft Jimmy!"
"Ich kann auf mich selbst aufpassen", sagte Kate.
"Verdammt, Kate – es sind fast fünfzig Meilen bis nach Kansas City! Und die Gegend ist unsicher in letzter Zeit."
Kate Bloomdale tat ihrem Vater den Gefallen und wartete. Sie wollte nicht, dass er sich Sorgen machte.
Ein paar Minuten später lief Jimmy McMillan über den großen Hof. Robs Busenfreund und Saufkumpan. Er trug weiten Lederschutz um die Hosenbeine. Aus Holstern an beiden Seiten seiner Hüften ragten die hölzernen Kolben von Revolvern. Das lange dunkle Haar klebte ihm schweißnass im Gesicht.
"Sattle dein Pferd!", blaffte Bloomdale. "Du begleitest Kate nach Kansas City."
Das verschwitzte Gesicht hellte sich auf. "Gern, Sir." Kaum jemand war unter den Cowboys, der die gutaussehende Bloomdale-Tochter nicht schon mit den Augen ausgezogen hätte. Und keiner, der sie nicht fürchtete.
Wenig später rollte Kates Wagen unter dem ausgestopften Bisonschädel des Torbogens hindurch aus der Farm. Jimmy McMillan ritt hinter ihr her.
Sorgenvoll blickte Bloomdale seiner Tochter nach. "Es ist ein Fehler, sag' ich", murmelte er. "Ein verdammter Fehler..."
*
"Zehn Dollar", sagte die Frau.
Wallace verstand nicht gleich. Er hatte sich neben sie an die Theke gesetzt und Speckbohnen mit Bratkartoffeln bestellt. Es war ihm schwergefallen, sie anzusprechen. Sieben Jahre Knast, und man vergisst die selbstverständlichsten Dinge.
Die Frau allerdings erwies sich als sehr gesprächig. Kontaktschwierigkeiten schienen nicht zu ihren Schwächen zu gehören. Schnell entwickelte sich eine zwanglose Plauderei.
Jetzt schlürfte er einen Becher Kaffee und rutschte sogar noch einen Barhocker näher an sie heran. "Zehn Dollar...?" Wenn er nur seine Augen in Schach halten könnte. Die ganze Zeit glitten sie über die prallen Wölbungen in ihrem Ausschnitt, über ihren schlanken Hals und über die Konturen ihrer Oberschenkel unter ihrem Kleid bis hinunter an dessen Saum, wo ein Stück ihrer Wade zu sehen war. Sie trug schwarze Netzstrümpfe.
Ihre vollen Lippen spitzten sich zu einem spöttischen Lächeln. Sie trank ihren Kaffee aus und rutschte vom Barhocker. Ihre Schenkel berührten sein Knie, so nah stand sie neben ihm. Wallace erschauerte.
Er hatte sich die Felljacke über die Schenkel gelegt. Aus lauter Angst, sie könnte die Ausbeulung in seiner Hose sehen. Unruhig rutschte er auf dem Barhocker hin und her. Sein Schwanz brannte vor Verlangen.
"Ja, Mister – zehn Dollar. Alles hat seinen Preis."
Ein paar Sommersprossen zogen sich von ihren Augenschatten bis zu ihren Wangenknochen. Ihre Augen waren grün – ein grüner Sumpf. Wallace versank rettungslos darin...
Sie wandte sich ab und schritt aus dem Saloon. Er starrte ihr hinterher. Und begriff.
"Zehn Dollar...", murmelte er. Er angelte ein paar Münzen aus seiner Lederweste, um ihren Kaffee und sein Essen zu bezahlen. Grußlos verließ auch er den Saloon.
Zehn Dollar – das war der halbe Wochenlohn eines gutbezahlten Cowboys. Oder eines Hafenarbeiters.
Er entdeckte sie zwischen den Passanten auf der breiten Straße. Bei jedem Schritt schwenkte sie ihr hochgerafftes Kleid hin und her, als wollte sie ihn locken. Er lief los. An der Tür des Hotels drehte sie sich um und wartete, bis er den Bürgersteig auf der anderen Straßenseite erreicht hatte. Dann verschwand sie in dem Gebäude. Die Tür schwang hinter ihr zu.
Wallace drückte sie auf. Die Frau stand an der ersten Stufe einer Wendeltreppe und blickte ihm entgegen. Die Lippen leicht geöffnet, so dass man ihre weißen Zähne sehen konnte, die Augenlider verengt und den Kopf ein wenig zur Seite geneigt, schien sie ihn zu belauern. Sie lächelte nicht. Ein angriffslustiger Zug lag auf ihrem schönen Gesicht.
Hinter ihr her stieg er die knarrenden Stufen empor. Das Rauschen ihres Kleides, ihre wiegenden Hüften, die Parfümwolke, die sie hinter sich herzog, selbst das Klappern ihrer Stiefel auf der Treppe – gierig sogen seine Sinne all das auf. Auch wenn er gewusst hätte, dass sie ihn direkt in die Hölle führte, wäre er ihr gefolgt.
Aber sie führte ihn in ein geräumiges, sauberes Hotelzimmer. Koffer standen neben einem Schrank, eine Tagesdecke war über dem Bett ausgebreitet, Narzissen standen in einer Glasvase auf dem Tisch. Und daneben ein rotes Metalldöschen, dessen Aufschrift Wallace nicht lesen konnte.
"Schließ die Tür ab", sagte sie. Wallace gehorchte. Mit dem Rücken gegen die Tür gelehnt, verschlang er sie mit seinen Blicken. Sein Atem flog.
Die Frau musterte ihn. Schweigend. Und fast kühl. Etwas wie Spott blitzte in ihren grünen Augen auf. Hinter ihrer Stirn schien sich eine Menge abzuspielen. Nichts davon spiegelte sich auf ihrer Miene wider.
Es interessierte Wallace auch nicht, was sie dachte. Sein ganzes Interesse, jeder Gedanke, seine gesamte Willenskraft war aus seinem Hirn zwischen seine Beine gerutscht und pochte und brannte in seiner Hose.
Sie senkte den Blick und betrachtete die Beule neben seinem Hosenschlitz. Mit einer Kopfbewegung deutete sie auf die Kommode am Fußende ihres Bettes. "Leg die zehn Dollar da hin."
Umständlich fummelte er eine Zehn-Dollar-Note aus seiner Hosentasche und warf sie neben eine Hutschachtel auf der Kommode.
Die Frau drehte sich um. Mit einer flinken Handbewegung löste sie ihr blondes Langhaar und zog es vom Rücken über die Schulter nach vorn. Die Knopfleiste ihres Kleides lag frei. Wallace starrte ihren Rücken an. Selbst die Umrisse ihrer Schulterblätter unter dem Kleid erregten ihn.
"Worauf wartest du? Zieh mich aus."
Langsam näherte er sich ihr. Mit ungeschickten Fingern löste er Knopf für Knopf ihres Kleides. Die weiße Haut ihres Rückens wurde sichtbar, ihr Nacken, ihre Wirbelsäule, der Verschluss ihres dunkelblauen Mieders. Er streifte ihr das Kleid über ihre Schultern. Wie über warmen Samt glitten seine Hände über die Haut ihrer Oberarme.
Das Kleid rutschte an ihr hinunter und fiel auf die Holzdielen des Zimmerbodens. Seine Hände strichen über ihre Schulterblätter, ihre Rippen entlang bis zu ihrer Taille hinunter – langsam, ganz langsam, als wollte er jeden Quadratzentimeter ihrer Haut genießen. Sein Herzschlag pulsierte unter seiner trockenen Zunge.
Als er ihre Taille mit beiden Händen umfasste, begannen ihre Hüften sanft zu kreisen. Eine Glutwelle schien durch seinen Körper zu schießen. Als würde eine ganze Flasche Whisky auf einmal sein Blut überschwemmen.
Er ging in die Knie, umfasste ihre Hüften und betrachtete verzückt den hin- und herschwingenden Frauenhintern zwischen seinen Händen. Ein dunkelblaues Seidenhöschen bedeckte ihn knapp. An kurzen Strumpfbändern waren die Netzstrümpfe daran befestigt.
Wallace zog ihren Hintern heran und küsste die Haut zwischen dem Höschenstoff und dem Saum der Stümpfe. Gleichzeitig zog er das seidene Stück über ihre Hüften. Wieder ganz langsam – wie einer, der ein Geschenk auspackt und die Überraschung so lange wie möglich hinauszögern will.
Er streifte den Stoff bis zu ihren Kniekehlen hinunter. Die Außenseiten ihrer Schenkel fühlten sich an wie das feuchte Fell eines neugeborenen Fohlens.
Nackt und prall schwebten ihre Gesäßbacken dicht vor seinen Augen. Er bohrte seine Finger in die kühlen Wölbungen und stöhnte. Dann zog er ihren Po heran und grub seine Zähne in das weiche Fleisch. Sie stieß einen leisen Schrei aus. Ihr Gesäß wollte wegzucken von seinem Gesicht, doch seine Hände schossen vor, umfassten ihre Hüftknochen und zogen ihr Becken wieder heran.
Seine Lippen saugten sich an ihren Backen fest, sein Kiefer bewegte sich kauend, als wollte er den Hintern verschlingen, seine Zunge bohrte sich in die Kerbe dazwischen und arbeitete sich hinunter bis zu den Ansätzen ihrer Schenkel.
Die Frau drückte ihr Becken gegen ihr Gesicht, ließ es kreisen, ließ es auf und ab tanzen – alles schweigend, keinen Ton gab sie von sich.
Er ließ seine Hände von ihren Hüftknochen hinuntergleiten, bis auf die Vorderseite ihrer festen Schenkel. Er spürte ihre Muskeln beben, während sie ihr Becken bewegte; seine Handflächen schoben sich zwischen ihre Schenkel. Statt Schamhaar ertasteten seine Finger die nackte Haut ihres gespaltenen Hügels, glitten zwischen ihre prallen Schamlippen und bohrten sich in die Höhle ihres Körpers.
Wieder stieß sie einen unterdrückten Schrei aus, presste aber ihr Becken wie verlangend gegen sein Gesicht. Für Wallace gab es kein Halten mehr. Sein Schwanz glühte und schrie nach Erlösung – er sprang auf und riss sich die Hose auf.
Die Frau beugte ihren Oberkörper nach vorn, stützte sich mit der Linken auf den Tisch und griff mit der Rechten nach dem Metalldöschen. Ihr Rücken bog sich durch wie der Rücken eines sich streckenden Pferdes, ihr Hintern kreiste wie ein angriffslustiges exotisches Tier.
Wallace ließ dieses weiße runde Tier keine Sekunde aus den Augen, während er Hose und Stiefel abstreifte. Sein Pfahl stand wippend und feucht von seinen Lenden ab. Er packte das weiße runde Tier und zog es über sein Glied.
Er bekam kaum mit, wie die Frau ein kirschgroßes Stück Fettsalbe aus dem roten Döschen bohrte. Er spürte, wie sich ihr Finger zwischen seinen Schwanz und ihre Schamlippen bohrten und die Salbe in ihren Schoß drückte und um seinen Schwanz rieb.
"Ich will dich...", keuchte er. Er presste ihren Oberkörper auf den Tisch. "Ich will dich ficken, verdammt noch mal..."
"Dann tu es doch! Tu es endlich...!" Ihre Rechte umklammerte die hintere Tischkante, ihre Linke hielt die schwankende Blumenvase fest.
Er fasste nach seinem Schwanz und schob ihn in sie hinein. Seine Finger quetschten das Fleisch seitlich ihrer Gesäßbacken zusammen, so fest hielt er sie, als er zustieß und zustieß, immer tiefer immer wilder. Wie rasend riss er ihr Becken gegen seine Lenden, schnell und kraftvoll, bis an die Schmerzgrenze.
Er bäumte sich auf und schrie laut. Feuer schien ihm von den Haarwurzeln bis in die Zehenspitzen zu schießen. Das brennende Verlangen aus sieben verzweifelt einsamen Jahren ergoss sich in ihren Schoß...
*
Der große bärtige Mann hatte schon den einen oder anderen Whisky intus, obwohl es erst Mittag war. Er lehnte schräg gegen den Tresen des "Green Water Billard Rooms" und hielt sich an seinem Glas fest, während er dem kleineren und älterem Gentleman neben sich wortreich erklärte, warum er die Bundesregierung für einen Haufen kleinkarierter Hohlköpfe und geldgieriger Bürokraten hielt. So ungefähr drückte er sich aus.
"Die Yankees sind neidisch", donnerte er, "das ist der schlichte Grund, warum sie die Sklaverei abschaffen wollen!" Die meisten Männer an der Theke nickten beifällig.
Der Bärtige bestellte einen weiteren Whisky. Den fünften oder sechsten an diesem noch jungen Tag. "Und ich will Ihnen genau erklären, warum sie neidisch sind, Sir." Die Gespräche an den Tischen verstummten nach und nach. Selbst die Pokerspieler hinter den Billardtischen sahen von ihren Karten auf.
Die meisten der Cowboys und Flussschiffer in Saint Josephs beliebtesten Saloon kannten den bärtigen Hünen mit der schwarzen Bärenlederjacke, dem breitkrempigen Biberfellhut und dem vierschrötigen Gesicht. Wenn sein rollender Bass durch den Saloon dröhnte, konnte man darauf wetten, dass nach den derben Worten die Stühle und dann die Fäuste flogen.
Der Mann hieß Jefferson Kelly. Nach seinem Heimatstaat nannten sie ihn Virginia-Jeff. Ein nagelneuer Colt-Karabiner mit Trommelmagazin hing über seiner Schulter. Und aus dem Holster an seinem Patronengurt ragte der abgegriffene Kolben eines Remington-Revolvers.
Sie kannten ihn, obwohl er höchstens einmal im Monat im "Green Water Billard Room" abstieg, um sich volllaufen zu lassen. Immer dann, wenn er eine Postkutsche von San Francisco über die Rockys durch die Wüste und die Prärie heil nach Saint Joseph gebracht hatte. Jefferson Kelly verdiente sein Geld als Begleitschutz bei der Wells Fargo Company.
"Hören Sie gut zu, Sir." Der Angesprochene – ein dicklicher Endfünfziger mit hellem Zylinder und großkariertem, dunklen Frack nickte. "Die Sache ist so..."
"Auf die Erklärung bin ich aber gespannt." Die jugendliche Stimme kam vom Pokertisch. Sie gehörte einem hageren Cowboy mit langem, zu einem Zopf zusammengebundenem Haar – blauschwarzes Haar. Ein herausforderndes Grinsen lag auf seinen Zügen. Robert Bloomdale kannte Virgina-Jeff noch nicht. Der Sechsundzwanzigjährige hatte erst vor drei Wochen seinen Abschied von der Kavallerie genommen.
Jefferson Kelly drehte sich kurz um und bedachte Bloomdale mit einem gelangweilten Blick. Dann wandte er sich wieder seinem Gesprächspartner zu. "Also – die Sache ist so: Mein Vater hat eine Tabakplantage in Virginia. Oben an der Grenze. Seine Nigger bewirtschaften ihm locker zwanzig Morgen. Und seine Nachbarn drüben in Kentucky krebsen auf ihren winzigen Farmen herum und arbeiten sich die Seelen aus dem Leib. In manchen Jahren können sie ihren Kindern nicht genug zu fressen geben, nur weil sie glauben, Nigger seien Menschen wie wir, die man nicht umsonst für sich arbeiten lassen dürfte." Er schlug mit der flachen Hand auf den Tresen. Gläser und Flaschen klirrten. "Deswegen, Sir, sind sie neidisch, die Yankees!"
Bloomdale knallte die Karten auf den Tisch und stand auf. "Du redest einen großen Scheißdreck, Mann!" Wie ein sprungbereiter Berglöwe bewegte er seinen drahtigen Körper zwischen den Billardtischen hindurch. Kelly betrachtete ihn gleichmütig.
"Wo der Mann recht hat, hat er recht", sagte einer der Männer am Tresen, ein Flussschiffer aus Louisiana. Und ein anderer rief. "Ich kauf' ein Joch Ochsen, ich kauf' einen Nigger – wo zum Teufel ist der Unterschied?!" Zustimmende Rufe der Männer am Tresen.
"Es geht nicht um die Schwarzen, ihr Idioten!" Breitbeinig blieb der junge Bloomdale vor den Billardtischen stehen. "Es geht um die Einheit unseres Landes!"
"Hast du diese dämlichen Sprüche bei der Army gelernt?", knurrte Jefferson Kelly. "Ein Grünschnabel wie du sollte sich ein wenig zurückhalten, wenn Männer diskutieren."
Er streckte den Arm nach seinem Whiskyglas aus. Im nächsten Moment explodierte ein Schuss, und das Glas zersprang unter seiner Hand in tausend Splitter.
Für Sekunden Totenstille im Saloon.
"Einen neuen Whisky auf die Rechnung dieses verdammten Grünschnabels", knurrte Kelly schließlich.
"Man sollte sie hängen, die Yank-Freunde!", schrie der Flussschiffer. "Hängen, wie sie John Brown gehängt haben!" Der militante Sklavenbefreier war wenige Monate zuvor in Georgetown, West-Virginia hingerichtet worden.
Einige Männer rutschten von den Barhockern. In drohender Haltung schoben sie sich auf Bloomdale zu. "Steck deine Bleispritze weg, Grünschnabel. Wir wollen sehen, was du in den Fäusten hast."
Der Wirt, ein langaufgeschossener Glatzkopf namens Phil Jenkins, huschte an der Theke entlang zu dem Gentleman mit dem Zylinder.
"Hol den Sheriff, Will", flüsterte er. "Um Gottes willen, hol den Sheriff, bevor sie mir wieder den Saloon zerlegen..."
Rückwärts schlich der Angesprochene aus dem Saloon.
Inzwischen hatten sich die Pokerspieler vom Tisch erhoben. Revolverhähne klickten.
"Setzt euch wieder auf eure verdammten Ärsche", zischte Hoss Woolback. Er arbeitete als Cowboy auf der Bloomdale-Ranch. In Saint Joseph war er wegen seiner schnellen Revolverhand und seines undurchdringlichen Pokergesichts gleichermaßen berüchtigt. "Ihr sollt euch hinsetzen!"
Einer der Flussschiffer riss seinen Revolver aus dem Holster. Ein Schuss – Holzsplitter spritzten zwischen Bloomdales Stiefelspitzen hoch. Dann krachten drei oder vier Waffen auf einmal los. Die Flussschiffer warfen sich flach auf den Boden. Einer wälzte sich stöhnend in seinem Blut. Und schließlich flogen Stühle und Flaschen durch den Saloon.
Als der Sheriff durch die Schwungtür trat, gab es keinen Mann im Saloon, der nicht mit Gewehrkolben, abgeschlagen Flaschenhälsen oder Fäusten auf einen anderen eindrosch. Abgesehen von Phil Jenkins, dem Wirt.
"Aufhören!", brüllte Glenn Powell, der Sheriff. "Verflucht noch mal – ihr sollt aufhören!" Niemand hörte auf ihn. Da zog er seinen Colt-Revolver und hieb wahllos mit dem Kolben auf die Streithähne ein. Erst als er Hoss Woolback und den hünenhaften Virginia-Jeff voneinander getrennt hatte, ließen auch die übrigen Männer voneinander ab.
Ein toter und ein verletzter Flussschiffer lagen zwischen umgekippten Tischen. Powell schickte den Wirt nach dem Arzt. "Was ist hier los, zur Hölle?!"
Beschuldigungen flogen hin und her. Der Sheriff nahm Jefferson Kelly und einem der Flussschiffer auf der einen Seite und Bloomdale und Woolback auf der anderen Seite die Waffen ab und die Männer vorläufig fest.
Eine halbe Stunde später kam er aus dem Office zurück in den Saloon. Der Totengräber und William Goldsmith – der dicke Gentleman mit dem Zylinder – trugen den erschossenen Flussschiffer aus Georgia heraus.
Auf einem Tisch lag der Verletzte. Er brüllte, während ihm der Arzt die Kugel aus dem Oberschenkel schnitt. Und er brüllte noch lauter, weil Jenkins ihm scharfen Rum in die Wunde goss. Glenn Powell winkte den Wirt zu sich an die Theke. "Was hat sich abgespielt?" Er sprach leise.
"Rob hat zuerst geschossen", flüsterte Jenkins. "Wer den Matrosen erwischt hat, kann ich nicht sagen. Aber Rob hat zuerst..."
Der Sheriff winkte ab. "Behalt es für dich, kapiert?" Der Wirt nickte stumm.
*
Sie lagen auf dem Bett und rauchten. Spencer Wallace in Hosen und mit nacktem Oberkörper, die Frau in die Tagesdecke gewickelt.
"Wird Zeit, dass du gehst", sagte die Frau, ohne ihn anzublicken.
"Sind die zehn Dollar schon ausgeschöpft?" Er blies den Rauch seiner Zigarette an die Decke.
"Schon seit über einer Stunde."
"Zwei Stunden Paradies für zehn Dollar", murmelte Wallace. "Nun gut – alles hat seine Zeit."
"Und seinen Preis. Geh jetzt."
"Wie heißt du?"
"Was spielt das für eine Rolle – du sollst jetzt verschwinden."
"Ich will es wissen." Wallace richtete sich auf und betrachtete die Frau. Ihre grünen Augen wirkten wie verschleiert, und ein bitterer Zug lag auf ihrem Mund.
"Sue."
"Okay, Sue." Er schob sich aus dem Bett. "Mich nennen sie Spence. Und Spence wird jetzt tun, was du verlangst: Er wird gehen." Wallace fischte Hemd und Weste vom Boden neben dem Bett und zog sich an.
Sie beobachtete ihn. "Entweder haben sie dich gerade aus der Armee entlassen, oder du kommst aus dem Gefängnis."
Verblüfft sah Wallace sie an. "Was hat dich auf diesen Gedanken gebracht?"
"Du hast mich angestarrt, als hättest du eine Ewigkeit keine Frau mehr gesehen. Unten, auf der Straße. Und im Saloon drüben. Und genauso bist du über mich hergefallen. Wie ein ausgehungerter Wolf."
"Hat es dir also nicht gefallen?" Er stülpte seine Stiefel über und sah sich nach seinem Hut um.
Sue stieß ein bitteres Lachen aus. "Gefallen? Von zehn Dollar lebe ich eine Woche lang. Das gefällt mir." Sie drückte ihre Zigarette in einem Teller auf dem Nachttisch aus. "Also – Army oder Gefängnis?"
Er stülpte sich den Hut auf den Kopf und ging zur Tür. "Was spielt das für eine Rolle?"
"Wohin gehst du jetzt?"
Er zuckte mit den Schultern. "Wer weiß schon, wohin er geht?" Seine Hand griff das kalte Metall des Schlüssels. Er schloss die Tür auf.
"Spence?"
Wallace drehte sich nach ihr um. "Du hast dir meinen Namen gemerkt?" Ein spöttisches Lächeln spielte um seine schmalen Lippen.
"Nimm deine zehn Dollar", sagte sie leise, "ich will sie nicht."
Sekundenlang musterten sie sich. Wallace fragte sich, was hinter ihre hübschen Stirn vor sich gehen mochte. Ihre grünen Augen klammerten sich in seinem Blick fest, als wollte sie ihn um etwas bitten. Doch ihre Lippen blieben stumm.
"Leb wohl, Sue." Wallace ließ die Zehn-Dollar-Note liegen, wo sie lag, und schloss die Tür hinter sich.
*
Unten am Hafen wurden Rinder über zusammengenagelte Holzrampen auf einen Dampfer getrieben. Wallace sah dem Spektakel eine Zeitlang zu. Wie lange hatte er keine Rinder mehr zu Gesicht bekommen!
Bis in die Nachmittagsstunden hinein waren die Cowboys damit beschäftigt, das Vieh zu verladen. Nach und nach sammelten sie sich wieder an der kleinen Pferdekoppel. Fast alle überragten Wallace um mindestens einen halben Kopf.
In der Nachbarkoppel standen etwa zwei Dutzend Stuten. Prächtige Pferde. Wallace' Kennerblick registrierte sofort, dass sie vor Kraft und Gesundheit strotzten.
Die Ähnlichkeit der Pferde fiel ihm auf – alle waren grau und hatten schwarze Hufe. Und keins war höher als vierzehn oder fünfzehn Handbreiten.
"Was sind das für Pferde?", fragte er einen der Cowboys.
"Was weiß ich?", antwortete der hochgewachsene Mann. Er musterte Wallace von oben bis unten. Die Geringschätzung in seinem Blick war nicht zu übersehen.
"Postpferde, hab' ich gehört", sagte ein anderer, der die Frage mitbekommen hatte. "Zwei Verrückte wollen eine Postlinie quer durch den Westen einrichten." Er tippte sich die Stirn. "Bis zum Pazifik. Unserm Boss soll's recht sein."
Wallace erfuhr, dass die fünfundzwanzig Stuten einen weiten Weg hinter sich hatten. Sie entstammten einer Pferdezucht in Alamo, Texas. Von dort hatte man sie nach New Orleans getrieben und dann den Mississippi und den Missouri hinauf nach Kansas City transportiert.
"Wir haben vier Wochen Zeit, sie einzureiten", sagte der Lange mit dem arroganten Blick. Er schwang sich über die Koppel, in der eine der grauen Stuten auf und ab tänzelte. Ein schneeweißer Fleck glänzte zwischen den Augen des Pferdes.
Der Cowboy stieg auf den fast mannshohen Zaun auf der anderen Seite der Koppel. Zwei Männer zerrten das widerspenstige Pferd an den Zaun, und der Cowboy sprang auf seinen Rücken.
Die Stute tobte in der Koppel herum, als hätte sich eine Schlange in ihrer Hinterteil verbissen. Kaum eine Minute lang konnte sich der Lange auf ihr halten. Die Männer grölten.
"Mistviech!" Er rappelte sich aus dem Staub, nahm Anlauf und schwang sich erneut auf den Rücken des Pferdes. Sofort warf es ihn wieder ab. Schadenfrohes Gelächter begleitete den Cowboy, als er zum Zaun hinkte und umständlich auf die Außenseite der Koppel kletterte.
"Lasst mich mal", sagte Wallace.
Ungläubige Blicke trafen ihn. "So verhungert, wie du aussiehst, wirst du es nicht einmal schaffen, auf den Rücken des Biests zu klettern", sagte einer. Gelächter kam von allen Seiten.
Wallace zog eine Zehn-Dollar-Note aus der Westentasche und klemmte sie zwischen den Zaunpfahl und ein Rundholz des Gatters. "Zehn Dollar, dass ich mich auf dem Pferd halten kann, bis es müde ist."
Wieder Gelächter. Der arrogante lange Bursche, der gerade an der Stute gescheitert war, zog ebenfalls zehn Dollar aus der Tasche. "Ich will nicht, dass man dich in einem Holzkasten hier wegträgt – aber ich wette zehn Dollar, dass du im Staub liegst, bevor die besten Schützen von uns zehn leere Flaschen getroffen haben, die hundert Schritte entfernt auf dem Zaun der Viehkoppel stehen!"
Die Männer johlten vor Begeisterung. Aber nur drei Cowboys trieben den Spaß soweit, dass sie auf Wallace setzten.
Zehn leere Flaschen wurden besorgt und auf den Zaunpfählen der leeren Viehkoppel gestellt, etwas mehr als hundert Schritte entfernt von dem Reitplatz. Drei Männer zogen ihre Revolver und spannten die Hähne. Ausschließlich die Cowboys, die auf Wallace gewettet hatten.
"Los, Kleiner!", schrie der Lange. "Lass sehen, was hinter deinem großen Maul steckt!"
Spencer Wallace schluckte die Kränkung herunter und kletterte über den Zaun. Von vorn näherte er sich der Stute.
"Okay, Mädchen", murmelte er, "es ist Scheiße, geritten zu werden, wenn man es nicht ums Verrecken will." Das Pferd beäugte ihn wachsam. "Ich weiß, wovon ich rede."
Er streckte seine Hand nach dem Pferd aus. Es schnappte danach. Gelächter klang vom Koppelzaun herüber.
"Du sollst den Gaul reiten und ihm keine Ammenmärchen erzählen!", rief der Lange.
Wieder streckte Wallace den Arm nach dem Pferd aus. "Wart doch ab, bis ich auf dir sitze – vielleicht magst du es ja..." Er tätschelte den Hals der Stute und arbeitete sich behutsam bis zu ihrer Vorderflanke vor. "Du wirst es nicht glauben, aber du bist nicht die erste, die ich heute reite", flüsterte er sanft. "Und wenn mich nicht alles täuscht, hat es der auch besser gefallen, als sie erwartet hat..."
Er duckte sich, sprang ab und saß auf dem Rücken der grauen Stute. Sofort peitschten Revolverschüsse über das Hafengelände.
Die Stute bäumte sich auf, und Wallace musste sich in ihrer Mähne festkrallen, um nicht sofort wieder herunterzurutschen. Er presste sich auf flach auf den Pferderücken, drückte die Schenkel zusammen und tastete nach dem Strick, der mit der Gebissstange des Pferden verbunden war.
Ein Schuss nach dem anderen pfiff über die leere Viehkoppel. Der Lärm machte die Stute noch nervöser, als sie sowieso schon war. Verzweifelt keilte sie aus, warf ihr Hinterteil hoch und galoppierte wie rasend durch die enge Koppel. Wallace hörte drei Flaschen zerspringen. Die Männer schrien laut, feuerten ihn an.
Endlich erwischte Wallace den provisorischen Zügel. Seine Faust schloss sich darum. Er konnte sich aufrichten und seine Bewegungen denen des Pferdes anpassen. Es machte Bockspünge, drehte sich im Kreis, bog den Rücken durch und warf das Hinterteil so hoch, dass Wallace bis auf seinen Hals geworfen wurde.
"Du Prachtgaul!", rief er. "Weißt du, wie ich dich nenne? Sue nenn' ich dich – Lady Sue!"
Schüsse krachten, Flaschen zersprangen, und Spencer Wallace tanzte mit der Stute. Irgendwann preschte sie zum Zaun. Ein Aufschrei ging durch die Menge der Cowboys – sie sprangen vom Zaun, um sich vor dem herangaloppierenden Pferd in Sicherheit zu bringen.
Wallace begriff sofort, was das Tier vorhatte. Bevor sein rechtes Bein zwischen Zaun und nassen Pferdeleib geriet, schwang er es über den Pferderücken und ließ sich auf die linke Seite des Pferdes rutschen. Vergeblich scheuerte das aufgeregte Tier seinen Leib gegen die Querhölzer des Zaunes. Die Cowboys applaudierten Wallace. Als er sich mit letzter Kraft zurück auf den Rücken des Tieres zog, sah er noch drei Flaschen auf den fernen Zäunen stehen. Die drei Männer, die auf ihn gewettet hatten, füllten gerade die Trommeln ihrer Revolver nach.
Wallace spürte, wie der Widerstand der Stute allmählich nachließ. Aber auch er konnte sich kaum noch auf dem Pferderücken halten. Noch einmal bäumte sich das Tier auf, warf den Kopf hoch, stellte sich auf die Hinterbeine und versuchte den lästigen Reiter abzuwerfen. Wallace spürte seine Finger kaum noch.
Nur beiläufig registrierte er die schwarze Kutsche, die seitlich der Koppel hielt.
Aus den Augenwinkeln sah er, wie der Lange sich den drei Männern, die auf ihn gewettet hatten, in die Schusslinie stellte. Als das Pferd sich wieder gegen den Zaun stemmte, riss Wallace seinen alten 45er aus dem Holster.
Kanonendonner gleich hallte der Schuss aus der großkalibrigen Waffe über die Viehkoppel. Eine Flasche zersprang. Die anderen drei Schützen nutzten die Überraschung des Langen und zertrümmerten die letzten beiden Flaschen mit ihren Schüssen.
Vielstimmiger Jubel erhob sich, als Wallace vom Pferd rutschte. Mit hängendem Kopf und Schaum vor dem Maul stand das Tier still. Seine Flanken zitterten. Wallace tätschelte ihm den Hals. "Dank dir, Lady Sue."
Seine Knie drohten nachzugeben, während er zurück zum Zaun stelzte. Anerkennende Ausrufe erklangen von allen Seiten, hilfreiche Hände streckten sich ihm entgegen und halfen ihm über den Zaun.
Er zog die beiden Zehn-Dollar-Noten aus dem Rundholzkreuz und steckte sie ein. Stumm nickte er dem Langen zu. Die Cowboys bildeten eine Gasse, um den Weg zur Straße hin freizumachen. Er spürte die vielen Hände kaum, die auf seine Schultern eindroschen.
Dann sah er den schwarzen Einspänner und die Frau auf dem Kutschbock. Als wäre er gegen eine unsichtbare Wand geprallt, blieb er stehen.
"Kate...", flüsterte er.
Sie sprang aus dem Wagen, lief im entgegen und warf sich an seinen Hals. Die Cowboys grölten laut. Einige applaudierten.
Kate kümmerte sich nicht darum. Sie hielt Wallace fest, schloss die Augen und drückte ihre Wange an seine.
"Ich war sicher, dass ich dich hier finde", seufzte sie.
Wallace wusste nicht recht, wie ihm geschah. Die Dutzend Mal, die sie sich im Gefängnis gesehen hatten, waren sie nie allein gewesen. In ihren Briefen hatte sie zwar nie einen anderen Mann erwähnt – ja sogar dass sie auf ihn warten würde, hatte sie geschrieben. Aber er hatte noch nie dazu geneigt, sich Illusionen zu machen.
Und nun hielt ihn diese Frau fest, als hätte sie jahrelang von diesem Augenblick geträumt. Nein – Wallace wusste wirklich nicht, wie ihm geschah. Offenbar gab es doch noch so etwas wie Liebe in dieser beschissenen Welt.
Zärtlich strich er ihr über das Haar und den Rücken.
"Dass du hier bist...", flüsterte er. Das Gesicht der blonden Hure erschien für einen Augenblick auf seinem inneren Auge.
Kate machte sich von ihm los. "Steig ein, Spence. Ich bin gekommen, um dich abzuholen."
Ohne nachzudenken, kletterte er in den Zweisitzer. Sie trieb die Pferde an und lenkte das Gespann die Straße hinauf.
Wallace drehte sich nach dem Reiter um, der ihnen folgte. Das Gesicht kannte er, aber der Name wollte ihm nicht mehr einfallen.
"Abholen? Wohin...?"
"Nach Saint Joseph."
"Was soll ich in diesem Nest? Es hat mir nichts als Unglück gebracht."
"Hab' ich dir etwa Unglück gebracht?"
Er hatte sie ein halbes Jahr nicht gesehen. Er beobachtete sie von der Seite. Als sie ihn zuletzt im Gefängnis besucht hatte, hatte sie älter ausgesehen als jetzt.
"Nein", murmelte er. "Du nicht."
"Siehst du." Zum ersten Mal lächelte sie. "Und außerdem habe ich in Saint Joseph einen Job für dich gefunden..."
*
Glenn Powell stieß die Schwingflügel der Eingangstür zum Saloon auf. Er sah sich kurz, und sofort traf sich sein suchender Blick mit dem eines stämmigen Mannes am Tresen. Edward Sucker hieß er. Der Sheriff hatte ihn vor zwei Wochen wegen einer Schießerei einbuchten müssen. Seit ein paar Tagen war er wieder auf freiem Fuß – Powell hatte die Bürgerwehr Saint Joseph überreden können, ihn für unschuldig zu halten.
Die Männer nickten sich einen Gruß zu. Powell schlenderte zum Tresen und orderte einen Whisky.
"Hör zu, Eddy", sagte er leise. "Es wär' gut, wenn du für ein paar Wochen aus der Stadt verschwindest. Ich hab' mit dem alten Bloomdale gesprochen – er ist einverstanden."
Sucker hatte bis zu der Schießerei auf Bloomdales Ranch gearbeitet. Er trug eine flache schwarze Melone und einen bis zu den Stiefelschäften reichenden Wildledermantel. Er war einer dieser grob wirkenden Männer, die man spontan für einen Metzger oder einen Schankwirt hielt, wenn man sie zum ersten Mal sah. Ein buschiger Schnurrbart wucherte in seinem roten quadratischen Gesicht, und auf den Speckwülsten im Nacken seines kurzen Halses sprossen vereinzelte Haare, wie Borsten auf einem Schweinebauch.
Ein 50er Spencergewehr lag quer über dem Barhocker neben ihm, und aus den Knopfleisten seines Mantel lugten die umgedrehten Kolben zweier Revolver hervor.
"Und wohin soll ich mich verdrücken?", fragte er. Seine Stimme klang ein bisschen, als würde ein Hund in einen leeren Blecheimer kläffen.
"Warte hier auf mich." Powell leerte seinen Whisky. "Ich hab' da eine Idee. Besuch aus Kansas City hat sich angesagt. Wenn er wieder weg ist, weiß ich mehr." Der Sheriff ließ eine Münze auf die Theke fallen. "Es kann ein Weilchen dauern."
Er ging zurück zu seinem Office. Auf der Holzbank neben der offenen Tür saß der alte Bloomdale. Er rauchte eine Zigarre und machte ein finsteres Gesicht.
Powell ließ sich neben ihm auf die Bank fallen.
"Wenn Rob nicht heute auf die Ranch zurückkehrt, bist du die längste Zeit Sheriff gewesen", raunte der weißhaarige Mann.
"Keine Sorge, Amos." Der Sheriff zündete sich eine Zigarette an. "In einer Stunde ist er frei. Und Hoss auch."
Nach ein paar Minuten sahen sie vier Reiter von Süden her in die Stadt galoppieren. Die Männer hielten ihre Pferde vor dem Office des Sheriffs an und banden sie fest. Es waren der Marshal von Kansas City, zwei seiner Assistenten und der Coroner des Bezirksgerichts.
Glenn Powell führte die Männer in den Zellentrakt. Zwei der vier Zellen waren besetzt. Eine mit dem jungen Bloomdale und Hoss Woolback, die andere mit Jefferson Kelly und einem Flussschiffer. Die Gefangenen erhoben sich von ihren Pritschen, als sie den Marshal und den Untersuchungsbeamten sahen.
"Ich hab' sie gestern festgenommen", sagte Powell. "Wegen einer Schießerei im Saloon. Ein Mann wurde getötet." Der Sheriff reichte dem Coroner ein Stück Papier. "Hier die Aussage von zwei Augenzeugen. Sie beschwören, dass Kelly das Feuer eröffnet und den Flussschiffer getötet hat. Mr. Bloomdale und Mr. Woolback haben in Notwehr geschossen..."
Jefferson Kelly stürzte sich auf die Gitterwand. "Verfluchte Lügner!" Wie ein Tobsüchtiger rüttelte er an den Gitterstäben. "Kein Wort ist wahr!" Der Sheriff und die Männer aus Kansas City zogen sich ins Office zurück. "Ich hab' ein paar Whisky zuviel gekippt und ein bisschen rumpolitisiert!" Kellys Bass donnerte aus dem Zellentrakt. "Der verdammte Grünschnabel hat mir das Glas unter der Hand weggeschossen...!"
Eine halbe Stunde später lag der Fall für den Coroner und den Marshal klar. Bloomdale und Woolback nahmen ihre Waffen in Empfang und schlenderten grinsend auf die Straße hinaus. Der Flussschiffer rannte hinunter zur Anlegestelle am Missouri, um sein Schiff noch zu erwischen. Und Jefferson Kelly sollte in Saint Joseph hinter Schloss und Riegel bleiben, bis der Richter in Kansas City den Fall geprüft hatte.
Zufrieden kehrte Powell in den Saloon zurück. Sucker blickte ihm erwartungsvoll entgegen. Der Sheriff schwang sich neben ihn auf den Barhocker.
"Zwei doppelte Whisky, Phil!", rief er dem Wirt zu. "Auf die Rechnung des Gentleman hier!" Er machte eine Kopfbewegung zu Sucker hin.
"Was soll das?", knurrte der.
"Die Wells Fargo Company sucht einen neuen Begleitschutz für die Strecke nach San Francisco", grinste Powell. "Morgen sitzt du auf dem Bock..."
*
Kate hatte ihm ein Zimmer in Saint Joseph besorgt. Für fünfzig Cent die Nacht. Zwei Tage lang lungerte Wallace in der mehr als schlichten Bude herum, bevor er sich endlich auf die Straße traute.
Es gab praktisch niemanden in der Stadt, der nicht wusste, wo er die letzten sieben Jahre verbracht hatte. Und ein paar Leute gab es, da war Wallace sicher, die würden ihn jetzt noch gern im Gefängnis von Kansas City eingekerkert wissen.
Kate hatte ihm immer noch nicht verraten, welche Art von Job sie für ihn aufgetan hatte. Er wusste nur, dass es um eine Arbeit ging, die mit Pferden zu tun hatte. Ansonsten tat sie sehr geheimnisvoll. Sie würde noch mit seinem zukünftigen Arbeitgeber verhandeln und so weiter.
Wallace konnte sich schon vorstellen, um was es in diesen sogenannten Verhandlungen ging. Niemand stellte freiwillig einen Mann ein, der sieben Jahre wegen Bankraubes gesessen hatte.
Am Morgen des dritten Tages nach seiner Rückkehr nach Saint Joseph also verließ Wallace sein Zimmer und ging hinunter auf die Straße. Kaum einer der Leute, denen er begegnete, grüßte ihn.
Der Sheriff hockte neben der offenen Tür seines Office und beobachtete ihn schweigend, während er vorbeiging. Aus dem Inneren des Office hörte er das heisere Gebrüll eines Gefangenen.
Vor dem "Green Water Billard Room" packten zwei Männer Koffer und Kisten auf die Gepäckpritsche einer Postkutsche. Sie befestigten das schwere Schutzleder über dem Gepäck.
Einen der Männer kannte Wallace – Eddy Sucker. Ein Revolvermann der übelsten Sorte. Vor sieben Jahren noch hatte er als Cowboy bei Kates Vater gearbeitet. Er stutzte, als er Wallace erkannte. Schnell wandte er sich ab und stieg auf den Kutschbock.
Während die Kutsche anrollte, betrat Wallace den Saloon. Er war noch menschenleer, bis auf den Wirt. Wallace setzte sich an die Theke und bestellte Kaffee und Eier mit Schinken.
Phil Jenkins, der Wirt, sprach kein Wort mit ihm. Dabei hatten sie früher nächtelang gepokert.
Nach und nach fanden sich ein paar Gäste im Saloon ein. Lauter Leute, die Wallace nicht kannte. Flußschiffer und Durchreisende. Und dann schaukelte ein dicker Mann mit Zylinder und in Schlips und Kragen durch die Schwingtür. Noch kleiner als er selbst. William Goldsmith. Wallace erkannte ihn sofort.
Der Geschäftsmann zögerte, als er Wallace sah. Doch dann setzte er sich neben ihn an die Theke. "Bring uns zwei Whisky, Phil!" Er betrachtete Wallace aufmerksam. "Bist schmal geworden, Spence."
"Und du noch fetter als vor sieben Jahren."
Goldsmith feixte. "Werd nicht frech, Spence, sonst bleibt's bei einem Whisky." Ob er wollte, oder nicht – Wallace war froh, dass in diesem verdammten Nest überhaupt jemand mit ihm sprach.
Mit grimmiger Miene knallte Jenkins die Gläser vor die Männer auf die Theke. Sie stießen an.
"Ich nehm' an, du brauchst Arbeit, Spence." Goldsmith wischte sich seinen kleinen Mund mit dem Handrücken ab. "Ich würd' dir gern eine geben, aber im Augenblick laufen die Geschäfte nicht. Ich kann kaum die Arbeiter in meiner Silbermine in Colorado bezahlen."
"Ich find' schon was, Will."
"Mal ehrlich, Spence – mir hat immer die Phantasie gefehlt, mir dich als Bankräuber vorzustellen."
Wallace senkte betroffen den Kopf. "Danke, Will. Du bist nicht der Einzige, der weiß, dass ich es nicht war. Bald werden es alle wissen. Ich finde die Schweine, die mir den Überfall in die Stiefel geschoben haben, glaub's mir."
"Lass gut sein, Spence – es hat keinen Sinn, in dem alten Dreck zu wühlen. Man muss nach vorne blicken, sonst kommt man auf keinen grünen Zweig." Goldsmith bestellte die nächste Runde Whisky.
"Manchmal kann man nur nach vorne blicken, wenn man den Mist, der hinter einem liegt, aufgespürt und im Missouri oder sonstwo versenkt hat."
"Schon möglich, Spence." Der Geschäftsmann wirkte nachdenklich. "Was mich immer beschäftigt hat, war die Sache mit dem Pferd. Einer der Bankräuber benutzte einen Hengst, der einem deiner Gäule aufs Haar glich."