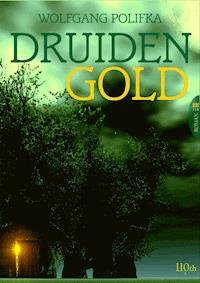
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 110th
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nach keltischer Vorstellung ist Blutrache eine heilige Pflicht. Doch der fünfzehnjährige Cyan (sprich: Sean), einziger Überlebender einer römischen "Befriedungsaktion" durch den späteren Kaiser Tiberius und dessen Bruder Drusus in den Nordalpen, ist dafür denkbar ungeeignet. Ein Stotterer, Träumer und Feigling, der nur der Not gehorchend zum Druiden ausgebildet wird. Dennoch folgt Cyan der Spur des Drusus. Es gelingt ihm, in dessen Gefolge aufgenommen zu werden, und er begleitet den römischen Feldherrn auf seinem Feldzug gegen die Germanen. Allerdings verläuft der für alle Beteiligten ganz anders als geplant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Druidengold
Impressum
Cover: Karsten Sturm, Chichili Agency
© 110th / Chichili Agency 2014
Foto: fotolia.de
EPUB ISBN 978-3-95865-322-1
MOBI ISBN 978-3-95865-323-8
Urheberrechtshinweis
Inhalt
Nach keltischer Vorstellung ist Blutrache eine heilige Pflicht. Doch der fünfzehnjährige Cyan (sprich: Sean), einziger Überlebender einer römischen „Befriedungsaktion“ durch den späteren Kaiser Tiberius und dessen Bruder Drusus in den Nordalpen, ist dafür denkbar ungeeignet. Ein Stotterer, Träumer und Feigling, der nur der Not gehorchend zum Druiden ausgebildet wird.
01.
Der Schrei des Adlers hallte von den Felswänden wider. Ich hob den Kopf und verfolgte seinen Flug, beobachtete, wie er sich vom aufsteigenden Wind in die Höhe tragen ließ und ohne Flügelschlag seine Kreise zog.
Von dort oben die Berge betrachten, die Klippen, in denen keine Pflanze Halt fand, dazwischen grüne Bergmatten, die sich talwärts senkten, ein sprudelnder Wasserlauf, in dem, wie der Alte sagte, die Wasserfeen hausten und zwei winzige menschliche Figuren nahe der kleinen Hütte. Wenn ich das könnte, dann wäre ich frei.
Der Wind zauste mir die Haare, wie er im Gefieder des Adlers spielte. Ich streckte die Arme aus, spreizte die Finger, folgte dem Rund seines Fluges und ahmte seinen krächzenden Ruf nach. So klein und doch so deutlich, wie ich den Käfer zu meinen Füßen sah, mochte der Adler von dort oben ein Schaf, eine Gams oder eine Bergziege wahrnehmen. Meine Augen waren ebenso scharf wie die des Adlers. Ich erkannte sechs Beine, die sich abwechselnd hoben, nach Halt suchten und den Körper unter den grünlich schillernden Flügeldecken vorwärts bewegten. Der Käfer erreichte eine felsige Stelle. Kein Grashalm, kein Moos hinderte mehr seinen Lauf. Jetzt war er mir und meinen Blicken ausgeliefert. Ich konnte ich ihn ergreifen, ohne dass er Gelegenheit hatte, sich in einer Erdspalte oder unter einem Blatt zu verbergen. Wie der Adler, der sich auf ein Lamm oder Zicklein stürzte, wenn es den Schutz der Herde verließ, und sich auf ein Plateau wagte, das keinerlei Deckung bot.
»Cyan«, holte mich die krächzende Stimme auf die Erde zurück. Ich ließ die Arme fallen. Der Wind trug mich nicht mehr. Der Käfer war verschwunden. Ich ging in die Hocke, starrte auf die steinige Fläche, die er eben noch deutlich sichtbar überquert hatte, doch ich fand ihn nicht mehr. »Cyan«, krächzte es wieder. Diesmal ganz nah.
Das Krächzen hatte nichts von dem Mut, der Kraft und dem Überschwang in der Stimme des Adlers. Es klang nur alt. Ich hörte die keuchenden Atemzüge, das Klirren der Bronzespitze, die auf einen Stein traf, schlurfende, sich nähernde Schritte.
Ich war sein Auge. Meine Arme, meine Hände, waren seine Arme und seine Hände. Meine Füße ersetzen oft seine Füße. Die Augen des Alten waren vom Alter getrübt, dennoch sah er Dinge, die ich nicht sah. Wesen, die in den Quellen hausten, Bäume und Felshöhlen des Gebirges bewohnten und Namen trugen, die ich nur schwer aussprechen konnte. Noch konnten die knochigen Arme des Alten den bronzebewehrten Stock mit solcher Macht schwingen, dass er einem vorwitzigen Wolf mit einem Schlag den Schädel zertrümmerte. Das hatte ich selbst gesehen. Aber abends, jetzt da sich der Sommer dem Ende zuneigte und die Nebel aus dem Tal herauf krochen, rieb er sich die schmerzenden Ellenbogen. Seine Hände zitterten pausenlos und die Finger waren zu leicht gekrümmten Krallen versteift. Doch ging es darum, ein gebrochenes Gebein zu ertasten, fanden seine bebenden Finger die im Fleisch verborgene Stelle mit unwandelbarer Sicherheit. Einen festen Knoten schlingen, um einen Sack zu verschließen, das konnten sie nicht. Dazu benötigte er meine Hände.
Sein schlurfender Schritt trug ihn zu jenen Plätzen, an den Bäume und Kräuter wuchsen, deren geheimnisvolle Kräfte, Linderung von Schmerz und die Heilung von Wunden versprachen. Ich sah diese Pflanzen auch, erkannte jedoch nicht ihren Wert, und taugte nur dazu, sie nach Hause zu tragen. Am späten Nachmittag, wenn der Alte die Blätter und Stängel zum Trocknen ausbreitete, ließ er mich die Namen dieser Gewächse wiederholen. Ich sollte aufsagen, welche Kräfte in ihnen steckten, und wie sie angewandt wurden. Meist schlief ich darüber ein. Dann deckte mich im Halbschlaf das Murmeln des Alten zu. Seine Worte webten eine Decke aus verschlungen Erzählungen, die sich über mich legte, ohne dass ich es gewahr wurde. Seltene Pflanzen kämpften in diesen Geschichten mit Krankheiten, die uns Menschen befielen. Doch es waren andere Schlachten als die, von denen die Männer in unserem Dorf berichteten. Der Krieg der Pflanzen mit dem Bösen in unserem Körper war leise. Einer, ohne den Lärm der Waffen.
Am nächsten Morgen hatte ich das Meiste vergessen. Über Nacht hatte sich in den Trockenkörben nicht nur Farbe und Form der Pflanzen verändert, auch ihre Namen hatten in meinem Kopf eine neue Gestalt angenommen. Wenn ich dann dem Alten meine Namen nannte, weil diejenigen, die er mir beigebracht hatte, im Dunkel der Nacht verflogen waren, schüttelte er ratlos den Kopf. Wie sollte ich ihm begreiflich machen, dass Worte und Namen sich in Luft auflösten wie Rauch und nur der Duft der Pflanzen eine Spur in meiner Erinnerung hinterließ? Manchmal lächelte der Alte über das, was ich hervorbrachte und hin und wieder entlockten ihm die von mir gewählten Bezeichnungen sogar ein beifälliges Kopfnicken. Ich war immer erleichtert, wenn er mich entließ, denn bei dem Versuch, mich an die richtige Bezeichnung der Pflanzen zu erinnern, verknotete sich meine Zunge stärker als sonst.
Nach der Morgenlektion schickte mich der Alte zu dem Bach, um die hölzernen Eimer mit Wasser zu füllen. Oft geriet ich auf Abwege. Ein gelb gefleckter Salamander, der Flug einer Libelle, eine Blüte die sich der Sonne entgegen reckte, ließen mich die Zeit vergessen und erst der Ruf nach Wasser erinnerte mich an meinen Auftrag. Dann verließ ich das, was ich meine Welt nannte. Ich kehrte zurück zu den Holzeimern, den getrockneten Pflanzen, die in kleine Säcke verpackt, in einem Mörser aus Stein zu Pulver zerstoßen, oder mit Fett vermischt in Tiegel abgefüllt werden mussten.
Die Schritte des Alten machten neben mir Halt. Ich blieb in der Hocke und hielt den Kopf gesenkt. Seine schmutzigen Füße steckten in Ledersandalen. Das Leder war rissig. Bald würde er neue brauchen. Seine Zehennägel waren gelblich verfärbt und abgebrochen. Die Bronzespitze am dicken Ende seines Stabes hatte sich in den weichen Stein gebohrt. Genau dort, wo ich eben noch den Käfer gesehen hatte.
»Cyan, warum antwortest du nicht?«, fragte er. Jetzt war seine Stimme weich. Wenn es so etwas wie ein weiches Krächzen gab.
»W, w, weil ich ein Adler bin. U, u, und einen Adler kann man nicht ru, ru, rufen«.
Sein Stock berührte mich. Es war kein Schlag, eher ein Streicheln. Fast wie die Berührung der Hand meiner Mutter.
Es bereitete dem Alten Mühe, den Rücken zu beugen. Der Stock mit der Bronzespitze war sein verlängerter Arm, wenn ich nicht zur Stelle war, oder, wie jetzt, auf dem Boden hockte. Am oberen Ende befand sich eine kleine Sichel. Mit der konnte er Pflanzen abschneiden, ohne sich zu bücken. Sie aufzuheben war meine Aufgabe. Ich sah nach oben. Seine trüben Augen waren auf mich geheftet, die Lippen zwischen dem grauweißen Bart zusammengepresst. Er sah nicht zornig aus, eher traurig. »Ach Cyan, was soll nur aus dir werden?«, sagte er.
Genau das, hatte auch mein Vater gesagt. Seine Stimme, obwohl viel kräftiger als die des Alten, klang dann ähnlich. Traurig, enttäuscht, dunkel und leise, ohne Kraft. Mutter schwieg. Doch ich wusste, sie stritt oft mit Vater über mich.
Wenn Vater mit meinem Bruder sprach, dann klang seine Stimme ganz anders. Freudig, hell, fordernd, so wie die des Adlers, der auf die Jagd ging und seinem Jungen Beute versprach.
Mein Bruder Khel, obwohl einen Sommer jünger als ich, hatte ohne zu zögern nach dem Schädel des erschlagenen Feindes gegriffen, den Vater mitgebracht hatte. Nichts hatte ihn daran gehindert, das blutverschmierte Haar zu packen und auf Geheiß meines Vaters das Innere des Kopfes mit seinem Dolch auszuhöhlen. Dabei waren die glasigen Augen des Mannes unverwandt auf ihn gerichtet. Khel hatte den Mund des Schädels geöffnet, damit dessen Geist ungehindert in die Anderswelt entweichen konnte. So ehrten wir einen getöteten Feind und ähnlich verfuhren wir mit unseren Toten. Die Schädel der Feinde wurden sichtbar aufbewahrt, unsere Toten tief im Erdreich begraben und mit einer Pyramide aus Steinen bedeckt.
Ich war davongelaufen. Verfolgt von den glasigen Augen. Mein Inneres kehrte sich nach außen. In der Nacht weckten mich die Augen des Schädels und der brennend, saure Geschmack im Mund. Zwei Tage lang hielt ich mich versteckt, ertrug Hunger und Durst, damit mir der Anblick der Köpfe, die auf langen Stangen zur Schau gestellt wurden, erspart blieb. Sie hatten mich nicht gefunden, obwohl das ganze Dorf nach mir suchte.
Die Jäger und Fährtensucher kamen mir so nahe, dass ich sie mit ausgestreckten Händen hätte berühren können. Einer der Hunde, der zur Jagd abgerichtet war, hob, als er mein Versteck in den Büschen erreichte, witternd den Kopf. Er blickte mir direkt ins Gesicht. Er musste mich sehen, meine Angst riechen, und ich erwartete, er würde Laut geben. Doch er wandte die braunen Augen ab, senkte die Schnauze auf den Boden und folgte einer anderen Spur. Damals hatte ich es zum ersten Mal gespürt.
Der Alte lachte röchelnd.
»Aber Adler hocken nicht auf dem Boden und sie verstecken sich nicht«. »A, a, aber sie können unsere Welt verlassen«, sagte ich, denn das hatte ich oft beobachtet. Immer höher schraubten sie sich in die Lüfte. Ihre riesigen Schwingen, der nach vorn gereckte Kopf und die langen Schwanzfedern wurden kleiner und kleiner und verschmolzen zu einem winzigen Punkt. Und dann kam der magische Augenblick. Der Adler verschwand vollständig, wurde selbst für das schärfste Auge unsichtbar. Er war in eine andere Welt übergetreten.
»So, so«, sagte der Alte. Es klang seltsam. Lachte er?
Er entdeckte mich immer. Obwohl halb blind, auf seinen Stock gestützt, an dem seine zittrigen Hände Ruhe fanden, und obwohl er tastend Schritt vor Schritt setzen musste. Warum konnte er mich aufspüren, andere aber nicht? Nicht einmal die Jagdhunde. Lag es daran, dass er Feen und Wesen aus der anderen Welt sah, sogar mit ihnen sprechen konnte, wie er immer erzählte? Ich hatte noch nie ein solches Wesen zu Gesicht bekommen. Nur ihre Stimmen hatte ich gehört. Ihr glucksendes Lachen, wenn sie im glitzernden Wasser eines Quells verborgen einen Schabernack ausheckten, oder nachts, wenn der Wind ihre Rufe um die Hütte trieb. Ich saß dann an die warme Mauer des Herdes gedrückt auf dem Holzboden, lauschte, und suchte ihre Botschaften zu enträtseln. Es gelang mir nicht.
Für die Wesen aus der Anderswelt und die Götter waren wir Menschen, so sagte der Alte, Spielzeug. Wir glichen den hölzernen Puppen, mit denen unsere Kinder spielten. Sie ließen uns Häuser bauen, gaben uns Vieh, schickten uns in Kriege, ließen uns töten oder wir wurden getötet. Wenn sie zornig oder unserer überdrüssig wurden, warfen sie uns vielleicht ins Feuer. Starben wir, gleich ob im Krieg, im Feuer oder weil Alter und Krankheit unser Leben beendeten, durften wir in die Anderswelt wechseln. Dort wurden wir einer von ihnen. Vor allem diejenigen, die in einem ehrenvollen Kampf gefallen waren. Dieses Wissen über die Anderswelt, die nach dem Tode auf uns wartete, machte die Krieger unseres Dorfes tapfer. Es machte ihnen das Sterben leicht. Mir nicht. Ich fürchtete mich vor dem Tod. Noch mehr als vor dem Leben. Deshalb war ich nicht darauf erpicht, ein Krieger zu werden, so sehr dies mein Vater auch wünschte.
»Flieg kleiner Adler, treib die Schafe und Ziegen zusammen, damit sie kein anderer holt«.
In der rauen Stimme des Alten war kein Zorn. Auch nicht der unterdrückte, der von Enttäuschung ausgelöste, wie ich ihn oft in meines Vaters Stimme hörte, wenn er sich abends am Herdfeuer flüsternd mit Mutter unterhielt.
Dabei hätte der Alte allen Grund zum Zorn gehabt. Selbst meine Aufgabe, seine Schafe und Ziegen auf den Berghängen nahe der Hütte zu hüten, erfüllte ich nur ungenügend. Stundenlang konnte ich bewegungslos auf der Erde sitzen, Käfer, Ameisen, Falter und die vielfältigen Pflanzen betrachten und merkte nicht, wie die Schafe und Ziegen langsam weiter zogen. Die Welt um mich herum verschwand. Nur der kleine Teil, den ich beobachtete, blieb übrig. Und offenbar verschwand auch ich aus dieser Welt. Wie sonst war es zu erklären, dass mich damals weder die Jäger noch die Hunde aufgespürt hatten, als ich vor den aufgespießten Köpfen floh?
Auch hier in den Bergen, auf den Wiesen mit ihren unzähligen Blumen, die im Sommer die grünen Matten mit ihren Farbtupfern durchsetzten, verschwand ich aus dieser Welt. Und hier gab es kaum Büsche, in denen ich mich verbergen konnte. Dennoch näherten sich mir die Gämsen oder Steinböcke, als sei ich ein Felsbrocken oder der Stumpf eines Baumes, vor dem man sich nicht in Acht nehmen musste. Sonst zeigten sie sich nur in weiter Ferne der Hütte. Saß ich allein und unbewegt unter den Ästen einer Kiefer, verließen sie ohne Angst ihre Felsverstecke, ästen so nahe bei mir, dass es für mich ein Leichtes gewesen wäre, sie mit einem Stein aus meiner Schleuder zu treffen.
»Eine Waffe für Kinder und Weiber«, hatte Vater meine Fertigkeit, die Steinschleuder zu handhaben, kommentiert. Die einzige Waffe, mit der ich besser umgehen konnte, als jeder andere im Dorf. Im Umgang mit dem Schwert, dem Wurfspeer und der Lanze übertraf mich selbst Khel, obwohl er einen halben Kopf kleiner war als ich.
»Dein Sohn ist ein Feigling, und normal sprechen, kann er auch nicht«, hörte ich Vater flüstern, nachdem ich aus dem Wald zurückgekehrt war. Den Kopf hielt ich von den frisch aufgespießten Schädeln abgewandt.
Wenn Vater zu Mutter „dein Sohn“ sagte, wusste ich, dass er mich meinte. Sprach er von „seinem Sohn“, war von Khel die Rede.
»Cyan ist nicht feige. Er ist nur anders«, verteidigte mich Mutter.
Aber auch sie wusste, ich taugte nicht zum Anführer wie mein Vater. Wie sollten mich die Männer des Dorfes als ihren späteren Führer akzeptieren, wenn all ihre Söhne tapferer waren als ich? Die betrachteten voller Stolz die Schädel, die ihre Väter aus den Kämpfen mitbrachten. Um nicht noch mehr Verachtung oder Enttäuschung meines Vaters auf mich zu ziehen, hielt ich mit meiner anderen Fähigkeit hinter dem Berg. Wie die Steinschleuder war auch der Dolch eine Waffe der Frauen. Krieger benutzten ihn nur, um einem erschlagenen Gegner den Kopf vom Rumpf zu trennen, oder als Werkzeug. Bestenfalls in einem Zweikampf, wenn kein Schwert zur Hand war.
Mein Dolch war ein sehr alter Dolch. Noch nicht aus Eisen geschmiedet, sondern aus Bronze gegossen, sorgfältig geschliffen und mit geheimnisvollen Zeichen versehen. Der Knauf endete in einem Adlerkopf. Dieser Adlerkopf bestand aus dem gelben Metall, das im steinigen Grund unsere Flüsse zu finden war. Die kleinen Körnchen eigneten sich, zusammengeschmolzen, nur zur Zierde, da das gelbe Metall beinahe so weich war wie Holz. Der Bronzegriff meines Dolches war mit einem Überzug aus Leder versehen, um zu verhindern, dass eine schweiß- oder blutbeschmierte Hand abglitt. Der Dolch war schwer. Wie die Steine, die meine Schleuder auf den Weg schickte, gelang es mir auch, diesen Dolch so zu werfen, dass seine Spitze das von mir gewählte Ziel traf. Das geschah beinahe von selbst. Weil der Dolch so schwer war, drang seine Klinge tief in das Holz der Bäume, deren Stämme mir als Zielscheibe dienten. Aber auch das war keine erstrebenswerte Fertigkeit für einen Krieger. Denn Bäume waren keine Feinde, die sich zur Wehr setzten. Nur Kinder benutzten Zielscheiben aus Holz.
Da ich so wenige Fähigkeiten besaß, die einen guten Krieger oder gar einen Anführer ausmachten, hatte man mich zu dem Alten geschickt. Vielleicht die einzige Möglichkeit, damit ich meinem Vater keine Schande bereitete. Welche Rolle der Alte - er schien keinen Namen zu haben, denn jeder nannte ihn nur „den Alten“ - in unserem Dorf spielte, war für mich schwer durchschaubar. Das höchste Ansehen genoss mein Vater. Nicht nur deshalb, weil unser Haus das größte war, er die meisten Knechte und Leibeigenen besaß und im Kampf der Anführer war. Schon sein Vater war der Anführer gewesen und mein Vater hatte sich bereits als Knabe durch besondere Tapferkeit hervorgetan. So wurde es, nicht von ihm, sondern von den anderen waffenfähigen Männern berichtet. Auch sie waren hoch geachtet.
Doch alle, auch mein Vater, traten ehrfurchtsvoll beiseite, wenn ihnen der Alte begegnete. Sie hörten seinen Rat in den Versammlungen und machten dem Alten Geschenke in Form eines Teils ihrer Jagdbeute oder von den Ernteerträgen. Dabei war das Haus des Alten im Dorf klein. Er besaß nicht einmal einen Leibeigenen oder einen Knecht und den Sommer verbrachte er mit seinen Schafen und Ziegen in der Hütte auf der Alm weit außerhalb des Dorfes, dort wo die steilen Gebirgshänge begannen.
Ich liebte den Alten nicht, aber vielleicht war ich einer der wenigen, die ihn nicht fürchteten. Welche Gefühle er mir entgegenbrachte, war mir nicht klar. Zumindest verachtete er mich nicht, weil ich anders oder, wie mein Vater sagte, ein Feigling war. Manchmal glaubte ich sogar, dass er mich gerade deshalb bei sich aufgenommen hatte.
»Treib die Herde zusammen. Wir gehen ins Tal«, forderte mich der Alte auf. Diesmal war die Berührung seines Stocks ein unmissverständlicher Stoß. Ich erhob mich. Der Sommer auf der friedlichen Alm war vorüber. Wir würden ins Dorf zurückkehren. Dort, wo die aufgespießten Schädel Zeugnis von der Tapferkeit und dem kriegerischen Erfolg seiner Bewohner ablegten. Der Adler war verschwunden. Keine Wolke zeigte sich am blauen Himmel. Doch eine seltsame Bedrohung schien hinter den Steinwänden des Gebirges zu lauern, die das Tal, in dem unser Dorf lag, nach Süden hin abschlossen.
02.
»Geh voran«, sagte der Alte und legte seine verkrümmten Finger auf meine Schulter. Der Sack mit den Pflanzen lastete schwer auf meinem Rücken. Dabei hatten wir nur einen geringen Teil dessen, was wir im Sommer zusammengetragen hatten, darin verstaut.
Der Alte besaß kein Pferd, denn hier oben auf der Alm gab es nur Futter für Schafe und Ziegen. Außerdem konnte sich ein Pferd leicht in einer Felsspalte ein Bein brechen. Ziegen und Schafe waren viel geschickter und vorsichtiger als Pferde.
Ich ging langsam, suchte einen Pfad, der dem Alten das Gehen erleichterte. Seine Finger hielten meine Schulter umklammert, die andere Hand stützte sich auf den Stock mit der Bronzespitze. Morgen würden einige junge Männer die Tiere des Alten ins Tal treiben und den Rest unserer Pflanzenernte mitbringen. Hoffentlich brach in dieser Nacht kein Wolf oder Bär in den Pferch ein. Doch schwerer als diese Sorge lastete die bange Erwartung auf mir, was mich bei meiner Rückkehr ins Dorf erwarten würde.
Immer hatte ich das Gefühl, dass die Dorfbewohner, selbst die Kinder, hinter meinem Rücken über mich tuschelten. Würde es einer der Männer offen wagen, mich einen Feigling zu nennen, mein Vater würde sofort das Schwert gegen ihn ziehen und ihn zum Zweikampf herausfordern. Das verlangte die Familienehre. Ich konnte kein Schwert ziehen. Gegen wen auch? Gegen meinen Vater vielleicht?
Vater war, wie die meisten Männer unseres Dorfes, groß. Das dunkle Haar trug er schulterlang, die Wangen unter den grauen Augen, deren strenger Blick mich verunsicherte, waren mit feinen Tätowierungen verziert. Angeblich glich mein Äußeres dem meines Vaters. Nur die Tätowierungen fehlten mir. Die Tätowierungen erhielten junge Männer dann, wenn sie bereit waren, in den Krieg zu ziehen. Khel, mein jüngerer Bruder, würde bald diese Muster der Tapferkeit auf den Wangen tragen, und er würde mit Freude meinen Vater und die anderen Männer auf den Feldzügen begleiten. So wie es mir erschien, war immer irgendwo Krieg.
Wegen dieser Tätowierungen, deren abschreckende Wirkung auf unsere Feinde im Krieg durch eine blaue Bemalung verstärkt wurde, und weil wir die Schädel unserer Gegner abschnitten und aufbewahrten, waren wir gefürchtet. Das behaupteten zumindest die Männer, die schon an Kämpfen teilgenommen hatten. Mit jedem Becher des süßen Honigweins stieg die Angst ihrer Feinde, erhöhte sich ihr eigener Mut, ihre Tapferkeit und das Maß ihrer Kriegstaten.
Auf mich wirkte ihre Begeisterung, mit der sie von geschlagen Schlachten berichteten, sich die noch zu führenden in leuchtenden Farben ausmalten, erschreckend. Es jagte mir Angst ein, wenn ich daran dachte, dass ich sie eines Tages begleiten müsste. Am liebsten hätte ich meine Ohren vor diesen Berichten verschlossen, oder mich davongestohlen. Doch das ging natürlich nicht, schließlich war ich der Sohn des tapfersten Mannes im Dorf. Auch die Erzählungen des Alten, was die Krieger in der Anderswelt erwartete, wenn sie im Kampf fielen, erschreckten mich. Dort ging der Krieg unvermindert weiter. Auf meine Frage, was mit den Gefallenen in der Anderswelt geschah, antwortete er: »Sie stehen auf und kämpfen in einer anderen Gestalt weiter.«
Wozu diese Kämpfe stattfanden, wagte ich nicht zu fragen. Doch eines wollte ich unbedingt herausfinden.
»W, w, wie groß ist denn die Anderswelt?«
»Warum willst du das wissen, Cyan?«
»W, w, weil …«, stotterte ich und merkte, wie meine Wangen heiß wurden. Das passierte mir immer, wenn ich in Verlegenheit geriet.
»W, w, wenn seit undenklichen Zeiten a, a, alle Männer, Frauen und Tiere na, na, nach ihrem Tod in die Anderswelt übergehen, da, da, dann ist dort vielleicht k, k, kein Platz mehr für mich.«
Der Alte lachte. »Die Anderswelt ist unendlich groß. Dort ist genug Platz für uns alle. Auch für dich Cyan«, war seine Antwort. Dabei sah er mich lange und nachdenklich an. Ich blickte zu Boden, damit er nicht sah, wie mein Gesicht glühte, denn meine eigentliche Frage lautete: Werden auch Feiglinge, wie ich, in die Anderswelt aufgenommen? Und was tun sie da, inmitten der Scharen von Helden? Was der Alte mit „unendlich groß“ meinte, ahnte ich nicht.
Nur einmal hatte ich Vater in die Dörfer weiter unten im Tal begleitet, sonst unser Dorf nur verlassen, um mit dem Alten den Sommer im Gebirge zu verbringen. Die Almen und seine Hütte betrachtete ich als mein wahres Zuhause. Dort war ich beinahe frei von Angst. Dass die Welt größer war, wusste ich schon. Nicht nur aus den Berichten der Männer, wenn sie nach einem Krieg, der glücklicherweise immer anderswo stattfand und uns verschonte, wieder heimkehrten. Hin und wieder besuchten Händler unsere Welt. Männer, die Schätze aus anderen Gegenden mitbrachten. Sie trugen nicht nur fremdartige Kleider, sondern unterschieden sich manchmal auch in ihrem Äußeren. Einige hatten Augen so braun wie die unserer Hunde, andere Haare hell wie Gold oder rötlich wie Bronze. Sie brachten uns das heiß begehrte Metall, das Eisen, aus dem der Schmied Werkzeuge und Waffen fertigte. Die Bearbeitung des Eisens war kompliziert. Insbesondere dann, wenn eine Waffe daraus entstehen sollte. Immer und immer wieder faltete der Schmied den gelb glühenden Metallstreifen, so lange bis er einen Block bildete und das nur, um diesen mit dem Hammer erneut in eine Form zu bringen, die bereits an eine Klinge erinnerte. Tagelang dauerte es, bis der Rohling eines Langschwertes fertig war.
Wir gaben den Händlern für das Eisen das begehrte Gold aus unseren Gebirgsbächen. Gold war bei uns nicht selten. Das lag an den hoch emporragenden spitzen Bergen. Ging abends die Sonne unter, berührten ihre goldenen Strahlen die scharfen Kanten und Grate der Felsen. Kleine Teile brachen aus den Sonnenstrahlen und fielen oben im Gebirge in das ewige Eis. Die Sonnenbröckchen durchdrangen mit ihrer Hitze selbst die dicksten Gletscher. Im Frühjahr und Sommer, wenn ein Teil des Eises schmolz, spülte das Wasser die erstarrten Sonnenkörner und Flitter dorthin, wo sie für uns erreichbar waren. Gold war ein Geschenk der Sonne an uns Menschen. Sein Anblick wärmte unsere Herzen, auch in kalten Winternächten.
Ich besaß im Gegensatz zu den meisten Männern und Frauen nur ein einziges Schmuckstück aus Gold. Einen winzigen Adler mit ausgebreiteten Schwingen, der an einer Lederschnur um meinen Hals hing. Dort hing er seit meiner Geburt. Nur dieser Vogel konnte so hoch in den Himmel steigen, um sich dort mit der Sonne zu vermählen. Er war uns heilig. Auch der Alte sammelte Gold, machte aber nur selten Gebrauch davon und trug keinerlei Schmuck.
Er sagte: »Die Sonne schenkt uns etwas viel Wichtigeres als Gold. Sie lässt die Pflanzen und Kräuter wachsen, derer wir bedürfen.«
Die Heil- und Würzkräuter, die der Alte mit meiner geringen Unterstützung sammelte, nahmen die Händler gern. Es hieß, der Bruder des Alten sei ebenfalls Händler, doch den hatte ich noch nie gesehen. Aus den Eisenblöcken, die uns manche Händler brachten, ließen sich bessere Waffen herstellen als die aus Bronze, deren Guss unser Schmied ebenfalls verstand. Mein Dolch, den ich von dem Alten erhalten hatte, war noch aus dem „alten Metall“, der Bronze hergestellt. Die Eisenwaffen waren härter. Genau das, was die Krieger brauchten. Khel besaß einen Dolch aus Eisen. Ein Geschenk unseres Vaters. Sicher würde er bald ein Schwert aus diesem Metall erhalten.
Ich zog die Schultern hoch und versuchte, dem schweren Sack auf meinem Rücken eine andere Lage zu verleihen. Die Lederriemen an meinen Schultern schnitten tief ein.
»Bedrückt dich etwas Cyan?«, fragte der Alte, der einen halben Schritt hinter mir ging. Seine Hand auf meiner Schulter wurde schwerer. Ich schüttelte den Kopf.
Er würde meine Sorgen nicht verstehen. Obwohl, fiel mir ein, auch der Alte trug keine Tätowierungen auf den Wangen. Das Zeichen der Tapferen. Der Krieger. War er irgendwann einmal jung gewesen? Ein Knabe in meinem Alter, der vielleicht sogar ähnlich dachte wie ich? Das war kaum vorstellbar. Seit ich ihn kannte, war er alt und hatte sich nicht verändert. Schon immer waren sein Haar weiß, sein Schritt schleppend und seine Hände verkrümmt gewesen. Und schon immer sammelte er Pflanzen und wurde zu Hilfe gerufen, wenn jemand im Dorf erkrankte oder die Männer verwundet aus dem Krieg heimkehrten. Nicht in jedem Fall konnte er helfen, wie ich mich erinnerte.
Die Verletzung, die ein Waffengefährte meines Vaters aus dem Kampf mitbrachte, war nicht schwer gewesen. Doch sie wollte nicht heilen. Den Alten rief man erst, als sich das Fleisch des Mannes rund um die Wunde aufblähte und den widerlich süßen Geruch von Aas verbreitete. Als der Alte das sah, schüttelte er den Kopf. Er schickte alle Frauen und Männer nach draußen, die das Lager des Kranken trotz des fürchterlichen Gestanks, der von der Wunde ausging, umringten. Er blieb mit ihm allein und sang ihm mit seiner krächzenden Stimme die Ballade von der untergehenden Sonne. Als er kurz darauf das Haus verließ, war unser Nachbar tot. Von dem Alten erlöst. Die Tür des Hauses ließ der Alte offen, damit der Geist des Toten ungehindert die Reise in die Anderswelt antreten konnte. Ich erinnerte mich genau. Ich war nicht von der Stelle gewichen und hatte die Tür des Nachbarhauses keinen Augenblick aus den Augen gelassen. Gesehen hatte ich nichts.
Der Sohn des Nachbarn, nur wenig älter als ich, begleitete die Männer in den nächsten Kampf. Den Kampf, aus dem mein Vater den Schädel eines Feindes mitbrachte.
Ich versuchte die bangen Ahnungen, die ich mit der Rückkehr ins Dorf verband, abzuwerfen und schritt schneller voran. Schon tauchte die alte Eiche auf, unter der sich die Männer unseres Dorfes zu ihren Beratungen versammelten - oder um Streitigkeiten zu schlichten. Von dort würde ich unser Dorf unten im Tal überblicken können.
Eine plötzliche Sehnsucht überfiel mich. Ich beschleunigte meine Schritte erneut. Gleich würden die braunen Schilfdächer auftauchen, das runde Auge des Teiches, in dem sich Sonne und Mond gleichermaßen spiegelten, meine Mutter würde aus dem Haus treten, die Arme ausbreiten und …
Da roch ich den Rauch.
03.
Ich schüttelte die Hand des Alten ab und stürzte vorwärts. Der Stamm der Eiche stellte sich mir in den Weg, als wolle mich der Baum aufhalten.
Unser Dorf brannte. Flammen schlugen aus den Dächern. Rauch schoss in mehreren Säulen in den Himmel. Das Kläffen und Jaulen der Hunde drang durch das Prasseln des Feuers. Ich sah, wie die Flammengeister ein neues Dach angriffen, sich gierig durch das Schilf fraßen, das Skelett der darunter liegenden Balken freilegten und dabei einen Funkenregen in die Luft warfen, um sich weiter auszubreiten.
Ich wollte den Abhang hinunter rennen, beim Löschen helfen. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind wurde jetzt gebraucht, um eine Kette zwischen dem Dorf und dem Teich zu bilden. Eine Kette, in der hölzerne Eimer mit Wasser gefüllt von Hand zu Hand schneller wanderten, als sie ein Einzelner tragen konnte. Wasser war der Feind der Feuergeister. Kamen sie mit ihm in Berührung, stießen sie fauchend weißen Atem aus und starben.
»Nicht Cyan, bleib hier«, zischte die Stimme des Alten hinter mir.
Er hatte mich eingeholt und seine knochigen Finger bohrten sich so tief in meine Schulter, dass es schmerzte. Ich wollte mich losreißen, als ich sie entdeckte. Keine einzelnen Männer, sondern eine geschlossene Masse, die sich langsam vorwärts schob. Die Schilde vor dem Körper, dahinter Helme, die Gesichter beschattet, schritten sie mit nach vorn gereckten Speeren voran. Wie auf ein Signal hin machten sie Halt. Die Speere flogen, trafen unsere Männer, Frauen und Kinder auf der Flucht, oder weil sie sich der gepanzerten Masse entgegen stellten. Die Wand aus Schildern klappte plötzlich auf. Jetzt konnte ich die Brustharnische und Beinschienen der einzelnen Soldaten erkennen. Schwertklingen blitzten hoch, stachen alles nieder, was nicht im Hagel der Speere zu Boden gegangen war.
Ich keuchte. Die ganze Zeit hatte ich die Luft angehalten. Die Angst loderte in mir wie unten das Feuer. War das der Krieg, von dem unsere Männer immer erzählt hatten? Waren das die heldenhaften Kämpfe, Mann gegen Mann, in denen der Bessere gewann und dann den Kopf des ehrenvoll Besiegten als Trophäe nahm? Das, was sich vor meinen schreckgeweiteten Augen abspielte, hatte nichts von einem Zweikampf an sich.
Die Reihe der gepanzerten Soldaten rückte weiter. Die Wand aus Schilden hatte sich wieder geschlossen. Sie steckten das nächste Haus in Flammen. Ganz gleich, was sich vor ihren Reihen bewegte, vor dem Feuer floh oder sich ihnen in den Weg stellte, es wurde niedergemacht.
Ein Hund, zähnefletschend seine Herrin verteidigend, wurde aufgespießt und hochgehoben. Mit allen vier Beinen zappelte er jaulend in der Luft. Mit einem Ruck wurde er zur Seite geschleudert. Die Spitze des Speers senkte sich erneut, rot vom Blut des Hundes und leckte nach einem neuen Opfer. Ein Schwert durchbohrte die Frau. Sie stürzte. Das Kleinkind, das sie auf dem Arm gehalten hatte, krabbelte über den Boden, richtete sich plärrend auf, tappte einen unsicheren Schritt nach vorn, ehe sein abgeschlagener Kopf in den Staub rollte. Unbeirrt marschierten die Soldaten weiter, trampelten über die Körper der Getöteten hinweg. Gleich ob Hund, Frau oder Kind.
Wo waren unsere Männer? Wo war mein Vater, der so tapfer war? Meine Mutter, mein Bruder Khel, unsere Nachbarn? Meine Hand tastete nach dem Bronzedolch. Ich musste dort hinunter. Gegen unsere Feinde kämpfen. Doch es waren nicht nur die Stimme und die Hand des Alten, die mich zurückhielten. Die Angst hatte mich bewegungslos gemacht. Ich japste nach Luft, wie nach einem schnellen Lauf und hatte das Gefühl zu ersticken. Die Angst vor dieser Masse an Soldaten, vor ihrer Art zu kämpfen, presste mein Herz zusammen und doch schlug es weiter. Seine Schläge dröhnten in meinen Ohren. Gleichzeitig nahm ich wahr, die Kämpfer dort unten stürmten nicht mit wildem Kriegsgeschrei durch unser Dorf, wie das unsere Männer laut ihren Erzählungen immer taten. Langsam, eher vorsichtig, schritten sie, von ihren Schilden gedeckt, voran.
»Sieh genau hin«, zischte der Alte hinter mir. »Das sind die Legionen Roms.«
Seine Stimme klang hasserfüllt. Kurz blitzte eine Erinnerung auf.
Einmal hatte der Alte von Rom erzählt. Von der mächtigen Stadt, die jenseits unserer Berge im Süden lag und von ihren Legionen. Damals konnte ich mir nichts unter einer Legion vorstellen. Die Erfahrung, die der Alte mit Rom gemacht hatte, schien keine Gute zu sein. Nie wieder hatte ich ihn von Rom erzählen hören. Doch das, was er über die Legionen, die Legionäre und ihre Art Krieg zu führen, berichtet hatte, löste bei unseren Männern Kopfschütteln aus. Die römischen Soldaten waren angeblich kaum größer als Zwerge. Aber sie traten in solchen Massen auf, waren so gut bewaffnet, bauten Straßen, umringten Dörfer, die sie belagerten, mit Dämmen oder errichteten Türme, welche die Mauern überragten, um sich Zutritt zu verschaffen. Jeder sollte sich vor ihnen hüten. Offen an dem zu zweifeln, was der Alte sagte, wagten unsere Krieger nicht, aber der Unglaube war deutlich auf ihren Gesichtern zu erkennen.
Und jetzt waren sie da. Jetzt sah ich, was eine Legion war und wie die Legionäre Krieg führten. Meine Knie wollten vor Entsetzen nachgeben, doch die knochige Hand des Alten umfasste mein Genick wie das eines Kaninchens und hielt mich aufrecht. Tränen schossen mir in die Augen. Ich hörte ein Wimmern, brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass ich es war, der diesen klagenden Laut ausstieß. Die Tränen machten mich beinahe blind. Ich wischte sie weg und schniefte, um atmen zu können.
Unten hatten die Legionäre inzwischen die Mitte des Dorfes erreicht. Dort stand das Haus meines Vaters. Wie alle anderen ging es in Flammen auf. Leistete den Flammengeistern, durch die Fackeln der Feinde verbreitet, nicht mehr Widerstand als die anderen Häuser. Niemand verließ das Haus.
Ich hob die tränenverschleierten Augen. Rund um den Erdwall, der unser Dorf schützen sollte, war eine Kette Reiter postiert. Sie standen so dicht mit Blickrichtung auf unser Dorf, dass sie sich hätten berühren können, wenn sie die Hände ausgestreckt hätten. Wahrscheinlich sollten sie jenen Dorfbewohnern, die versuchten über den Schutzwall zu entkommen, den Garaus machen. Ihre Pferde tänzelten unruhig in den dichten Rauchschwaden. Doch niemandem aus unserem Dorf war die Flucht geglückt. Keiner der Reiter verließ seinen Platz in der lang gezogenen Reihe. Der Erdwall mit der Bruchsteinmauer, zu unserem Schutz errichtet, war zur Falle geworden, aus der es kein Entrinnen gab. Kein Entkommen vor den Legionären im Inneren, denen es offenbar mühelos gelungen war, das hölzerne Tor am Eingang zu durchbrechen.
»Wo sind die Anführer?«, zischte mir der Alte ins Ohr.
»I, i, ich weiß nicht«, greinte ich.
»Sie sind nicht im Dorf, sondern außerhalb, auf einer Anhöhe«, sagte er, als wisse er das genau.
Nur mühsam gelang es mir, den Blick von den brennenden Häusern, den noch immer weiterrückenden Soldaten und den Reitern rund um den Wall zu lösen.
»Such nach dem Adler«, raunte der Alte.
Ich hob automatisch den Kopf, sah in den Himmel, um nach dem Vogel Ausschau zu halten.
»Nicht dort.« Der Alte versetzte mir eine Kopfnuss.
»Sie müssen irgendwo sein, wo sie das Dorf von oben einsehen können«. Mein von Tränen getrübter Blick irrte über die Abhänge rund um das Dorf. Ich sah nichts, was einem Adler glich. Dann wandte ich mich zur Seite und erschrak.
Ganz nah bei uns, nur getrennt durch eine Wiese und den schmalen Bach, der den Teich speiste, das mussten sie sein. Alle waren beritten. Einer, der im Hintergrund, hielte eine lange Stange in der Hand. Oben, an deren Ende, blitzte ein Adler. Golden wie das weiche Metall, das wir in den Flüssen fanden. Die Flügel des Adlers waren drohend gespreizt. Den Kopf hielt er angriffslustig nach von gestreckt, seine Krallen umfassten eine Querstange. Er sah so aus, als wolle er sich gleich in die Luft erheben und sich auf unser Dorf stürzen. Unter der Querstange befand sich ein Schild, auf das seltsame Zeichen gemalt waren. Vor dem Adlerträger standen sechs Reiter. Zwei der Pferde waren weiß wie Schnee. Noch nie hatte ich Pferde dieser Farbe und Größe gesehen. Die Gesichter der Männer konnte ich genau erkennen. Sie hatten die Helme abgesetzt und hielten sie vor sich auf den Oberschenkel gestützt. Die Brustpanzer der beiden Männer auf den weißen Pferden waren reich mit dem gelben Metall verziert. Mit meiner Steinschleuder würde ich sie erreichen. Sie lachten, scherzten und unterhielten sich und sahen dabei zu, wie ihre Soldaten unten das letzte Haus in Brand steckten. Obwohl sich keine Hand mehr zur Verteidigung rührte, hatten die Soldaten im Dorf ihre dicht gestaffelte, viereckige Aufstellung beibehalten. Sie schienen auf ein Zeichen zu warten.
Ein Greis kam durch die Tür des letzten Hauses gehumpelt. Das Dach brannte lichterloh. Ich erkannte den Vater unseres Nachbarn, dessen Bein bei lebendigem Leibe verfault war. Seine Kleidung hatte Feuer gefangen. Er zog eine Rauchfahne hinter sich her. Mit beiden Händen hielt er den Griff eines Langschwertes umklammert. Deutlich konnte ich an seinem vor Schmerz und Anstrengung verzerrten Gesicht erkennen, dass er kaum in der Lage war, die schwere Waffe zu heben, geschweige denn einen wirksamen Streich gegen die gepanzerten Legionäre zu führen.
Einer der beiden Männer auf den weißen Pferden lachte laut. Der andere fiel in das Lachen ein. Eine lässige Handbewegung und ein Reiter aus ihrer Begleitung preschte im Galopp den Abhang hinunter. Als er den Punkt erreichte, von dem er den Wall gerade noch überblicken konnte, parierte er sein Pferd und glitt zu Boden. Ohne Eile nahm er den Bogen vom Rücken, legte einen Pfeil an und hob den Bogen gegen den Himmel.
04.
»Das sollen die gefürchteten Vindelecier sein?«, fragte Tiberius und warf dem dicken Mann hinter sich einen verächtlichen Blick zu.
»Deswegen schreist du in Rom nach Hilfe, weil du ihrer nicht Herr wirst? Das ist doch nichts als ein Haufen von Bauern. Ich werde das in meinem Bericht an den Augustus erwähnen. Vielleicht liegt es nicht an den Legionären, sondern an dem Statthalter Roms, der sie hier befehligt?« Liburnus, der Statthalter wurde blass und schnaufte. Seine Hände umkrampften die Zügel.
»Sie kämpfen meistens aus dem Hinterhalt. Schneiden unseren Verbündeten die Köpfe ab und verbreiten so Angst und Schrecken«. Seine Stimme wurde fester und bekam einen gehässigen Unterton.
»Das hier war nur eine kleine Siedlung mit vielleicht fünfzig waffenfähigen Männern. Die südlichste und am höchsten in den Alpen gelegene, wie unsere Späher berichten. Außerdem haben wir sie zufällig überrascht. Warte nur ab, was geschieht, wenn du auf eine vorbereitete Armee triffst.«
»Wir haben sie überrascht?«, fragte Tiberius. Seine Stimme troff vor Hohn.
Der Statthalter hatte sie nicht auf diesen Blitzfeldzug begleiten wollen. Wäre es nach ihm gegangen, hätten sie Wochen damit verbracht, die nötigen Versorgungsfahrzeuge auszurüsten, und ihr Marschtempo wäre durch das Tempo von Ochsenkarren bestimmt worden. Die beiden Legionen, die er befehligte, marschierten mit leichtem Gepäck, denn er wollte das Überraschungsmoment nutzen. Das bedeutete Verzicht auf jeden Komfort. Besonders für die Offiziere, den fetten Statthalter, für Drusus und ihn, den Oberbefehlshaber. Er, Drusus und der Statthalter schliefen wie alle anderen in einem einfachen Zelt ohne jeden Bodenbelag. Die Klappbetten für ihn und die höchsten Offiziere waren das einzige Zugeständnis an die Bequemlichkeit, in das er eingewilligt hatte.
Sie aßen die gleiche Verpflegung wie die Legionäre und dieses einfache Leben im Felde war es, was dem Statthalter zu schaffen machte. Wahrscheinlich hatte er seine Villa, deren Luxus mit jedem vornehmen Stadthaus in Rom konkurrieren konnte, schon lange nicht mehr verlassen und von dort tatenlos zugesehen, wie dieser Teil der kaiserlichen Provinz Transalpina in Unordnung geriet. Was aber, und das würde er dem Kaiser beweisen, mit einer kurzen, schnell und richtig geführten Aktion leicht zu korrigieren war. Handeln und nicht verhandeln. Das sparte Zeit und das Blut der Legion. Tiberius lächelte böse vor sich hin. Er wusste, der Statthalter hatte Angst, sich die beiden Stiefsöhne des Augustus zu Feinden zu machen. Gleichzeitig konnte er seinen Ärger darüber nicht verbergen, dass man ihm einen jungen Truppenführer vor die Nase gesetzt hatte.
»Warum haben wir nicht erst mit ihnen verhandelt?«, quakte der Statthalter hinter ihm. Tiberius drehte sich um und musterte ihn spöttisch. Wie ein formloser Mehlsack hing Liburnus in dem für ihn offensichtlich ungewohnten Sattel. Wahrscheinlich ließ er sich sonst nur in einer Sänfte tragen. Kein Wunder, dass er seine Provinz nur aus Berichten kannte.
»Verhandeln? Worüber?«, fragte Tiberius und grinste, als er sah wie Liburnus mühsam beherrscht die Lippen zusammenkniff.
Er genoss dieses Gefühl der Macht, die er als Oberkommandierender innehatte. In Rom musste er sich jedem Befehl des Augustus beugen, selbst dann, wenn er jeglicher Logik entbehrte. Hier war er in seinen Entscheidungen frei. Teilweise zumindest und solange seine Unternehmungen von Erfolg gekrönt waren. Er brauchte den Ratschlag dieses unfähigen Verwalters nicht.
»Gaius Julius Cäsar, euer hochgeschätzter Vorfahr, hat immer erst verhandelt.«
»Ach, ja.«
Tiberius biss sich auf die Lippen, um seinen aufwallenden Zorn nicht sichtbar werden zu lassen. Etwas zu sagen was im Widerspruch zu den Annalen Cäsars stand, war unklug und außerdem gefährlich. Selbst dann, wenn es richtig war. Er wäre nicht der erste Heerführer, der wegen des Verdachts auf Hochverrat nach Rom zurückgerufen wurde und dieser Schleimer Liburnus wartete nur auf eine Gelegenheit, ihn bei Augustus anzuschwärzen. Eine unbedachte Bemerkung, ein Misserfolg und er wäre das Kommando los. Gerade deshalb wollte er schnell handeln Und Gegebenheiten schaffen, die jeder möglichen Anordnung des Augustus zuvorkamen. Er wusste, der Kaiser erhielt neben den offiziellen, von ihm verfassten Rapports, Geheimberichte aus der Hand des Liburnus. Sicher berichtete auch der Führer der Prätorianergarde Sejanus an Augustus, ohne dass er wusste, was.
»Hast du in den Annalen Cäsars auch über Vercingetorix gelesen?«, fragte Tiberius.
Liburnus senkte den Kopf. Jeder kannte Vercingetorix. Noch heute war dieser Name ein Stachel im ruhmreichen Fleisch der Legionen. Jahrelang hatte dieser Barbarenfürst die Legionen des Gaius Julius in Angst und Schrecken versetzt. Zweimal war Cäsar vor den Senat zitiert worden, um Rechenschaft über seine erfolglose Strategie abzulegen. Die hiesigen Barbarenstämme, so hatte Tiberius gelesen, waren damals an dem Aufstand nicht beteiligt gewesen. Nicht deshalb, weil sie besonders friedlich gesinnt waren, sondern weil die Nachricht über den Befreiungskrieg Galliens ihre abgelegenen Gebirgsdörfern zu spät erreicht hatte. Als sie davon hörten, war der Aufstand längst niedergeschlagen, der Anführer hatte sich ergeben, und seine Gebeine vermoderten in den Verliesen Roms. Das war schon lange her. Aber Mythen und Geschichten hatten ein langes Leben. Vor allem in den mündlichen Überlieferungen der Barbarenvölker.
»Sieben Jahre hat Cäsar gebraucht, um die Barbaren zu unterwerfen. Dutzende Abkommen hat er geschlossen. Keines davon war von Dauer. Du hast doch das Ergebnis von Verhandlungen selbst erlebt, verehrter Liburnus«. Tiberius hatte einen versöhnlichen Ton angeschlagen. »Außerdem wird ein positiver Ausgang dieses Feldzuges auch dir und deiner Reputation in Rom zu Gute kommen.«
Liburnus verkniffen Mine glättete sich.
Tiberius winkte den Kartographen heran. Der trieb sein Pferd mit einem Schenkeldruck neben Tiberius und entnahm dem Köcher, der an seinem Sattel befestigt war, eine Karte der hiesigen Region. Zwar waren die Karten nicht sehr genau, doch sie zeigten zumindest die wichtigsten Gebirgsübergänge und Täler. Es war die Aufgabe des Kartographen sie ständig zu ergänzen und genaue Kopien anzufertigen. Berittene Boten brachten diese Kopien zusammen mit seinen Berichten nach Rom. Dort wurden sie dem Militärarchiv einverleibt und standen für spätere Feldzüge zur Verfügung. Die Kenntnisse des Geländes und das Wissen, wo und wie der Gegner lebte, waren ein strategischer Vorteil. Ein Feldherr, der diesen Vorteil nicht nutzte, sondern seinem Gefühl folgte, war meist wenig erfolgreich. Er würde diesen Fehler nicht begehen.
Der Kartograph entrollte das Kartenblatt und reichte es Tiberius.
»Wir sind hier«, er wies auf ein enges Tal.
»Am oberen Ende. Der Siedlungsraum dieses Stammes reicht nach den Berichten unserer Verbündeten, bis hierher«.
Sein Finger umschrieb einen länglichen Streifen, ganz am Rande der kaiserlichen Provinz, entlang der nördlichen Alpen.
»Ein unbedeutender Stamm gallischer Herkunft. Wahrscheinlich gehören sie zu den Vindelecier, aber genau wissen wir das nicht. Strategisch ist diese Gegend hier von geringer Bedeutung«.
Eine Fehleinschätzung, die Liburnus und nicht sein Kartograph zu verantworten hatte, dachte Tiberius, schwieg aber. Ob strategisch wichtig oder nicht, das entschied er. Ruhe und Ordnung waren in seinen Augen sehr wohl ein strategisches Ziel.
Der Kartograph zeigte auf die sich anschließenden Täler und das davor liegende Flachland.
»Sie befinden sich in einer Art Dauerfehde mit den umliegenden Stämmen. Die germanischen Nachbarn fürchten die Vindelecier wegen ihrer Gewohnheit, die Köpfe ihrer gefallenen Gegner abzuschneiden, und zur Schau zu stellen«. Er schüttelte den Kopf. »Eine furchtbare, barbarische Sitte, die selbst unter den Germanen Angst und Schrecken verbreitet. In diese ständigen Streitigkeiten werden unsere eigenen Truppen immer wieder verwickelt und nie wissen wir, wer gerade mit wem Krieg führt.«
»Deshalb sind wir ja hier. Wir werden diesem Treiben ein für alle Mal ein Ende bereiten«, brummte Tiberius.
Ein Auflachen seines Bruders ließ ihn von der Karte aufsehen.
»Schaut euch das an. Einer der gefürchteten Gallier mit dem schrecklichen Langschwert. Schade nur, dass er nicht damit umgehen kann.«
Er zeigte hinunter auf das Dorf. Tiberius sah in Richtung des ausgestreckten Zeigefingers seines jüngeren Bruder Drusus.
Die häduische Kohorte, deren drei Manipeln das Dorf gestürmt hatten, schien ihre Arbeit beendet zu haben. Die Häuser waren verbrannt. Nur an den verkohlten Balkengerüsten flackerten noch Flammen und offenbar gab es keinen Überlebenden. Bis auf die einsame Gestalt. Ihr gegenüber stand die geschlossene Schilderwand der ersten Zenturie, wie er an deren Feldzeichen erkannte.
Tiberius stimmte in das Lachen seines Bruders ein. Es sah wirklich komisch aus. Die Kleidung des alten Mannes war in Brand geraten. Der Rauch, der von ihr aufstieg, erweckte den Eindruck, als sei die Gestalt von Nebel eingehüllt. Das Langschwert hielt er mit beiden Händen schlagbereit über dem Kopf. Er wankte unter dem Gewicht der Waffe.
»Überlass ihn mir«, bettelte Drusus. Tiberius schüttelte den Kopf.
Manchmal war Drusus wie ein Kind. Immer zu Späßen aufgelegt. Er brachte es fertig mit den einfachen Legionären herumzualbern, als sei er einer der ihren. Deshalb war er bei Legionären, Zenturios und Militärtribunen gleichermaßen beliebt. Beinahe vergötterten sie seinen jüngeren Bruder.
Tiberius’ Stirn umwölkte sich. Ihn liebten die Legionäre und Offiziere nicht. Wenn er sich zu ihnen gesellte, verstummten ihre Reden und Scherze. Sie rückten beiseite, machten ihm ehrerbietig Platz, während sie Drusus in ihrer Mitte umdrängten. Aber ihm gehorchten sie. Selbst dann, wenn das, was er von ihnen verlangte, ihren Interessen zuwiderlief.
Diesen Angriff auf das Dorf hatte die häduische Kohorte führen dürfen. Schon Gaius Julius Cäsar hatte die Häduer als Verbündete geschätzt, da sie nur selten abtrünnig wurden. Und er, Tiberius, verfolgte die Strategie, Barbaren gegen Barbaren kämpfen zu lassen, wo immer möglich, natürlich unter der Führung eines erfahrenen, römischen Zenturios. Angespornt durch diesen Vertrauensbeweis, hatten die Legionäre die Siedlung im ersten Anlauf überrannt. Die gefürchteten Langschwerter, die den angeblichen Ruhm der gallischen Waffenschmiede und der furchterregenden Kampfkraft ihrer Träger begründeten, waren an den Stoßlanzen und Wurfspeeren der Söldner gescheitert. Die Reiterei mit den wertvollen Pferden hatte nichts anderes zu tun gehabt, als darauf zu achten, dass keiner aus dem Dorf entkam. Das war wichtig. Er wollte vermeiden, dass sich die Nachricht von seinem Feldzug unter den Barbaren, gleich welcher Stammeszugehörigkeit, verbreitete wie ein Lauffeuer. Je schneller die Legionen marschierten, je unbarmherziger sie zuschlugen, desto geringer war das Risiko, dass sich eine feindliche Armee sammeln konnte. Das war sein Plan und so lauteten seine Befehle.
Die Hundertschaft hatte diesen Befehl genau befolgt. Keiner der Legionäre hatte es gewagt, sich während der Kampfhandlungen zu bücken, um einem der Gefallenen ein goldenes Schmuckstück zu entreißen. Keiner hatte die Formation der Zenturie verlassen, weil ihn die Aussicht auf Beute in eines der Häuser lockte. Alles war verbrannt, doch sie murrten nicht, hielten selbst jetzt, wo der Kampf vorüber war, Disziplin. Gerade diese im Krieg notwendige Selbstbeherrschung und absolute Pflichterfüllung gehörte nicht zu den Stärken seines Bruders. Außerdem neigte er zu kindlich-wagemutigen Aktionen, die eines zukünftigen Feldherrn unwürdig waren. Doch gerade dieses undisziplinierte Verhalten trug Drusus die Sympathie der einfachen Soldaten ein. Er liebte seinen Bruder nicht weniger als die Männer und war oft geneigt, dessen Eskapaden hinzunehmen, aber er und niemand anders, war für den Erfolg dieses Feldzuges verantwortlich.
»Du bleibst hier«, sagte er leise zu Drusus. Der verzog das Gesicht.
»Du bist ein Spielverderber, Tiberius«, schmollte er und zügelte widerstrebend sein Pferd.
Tiberius unterdrückte den Wunsch, seinem Bruder klar zu machen, dass dies hier kein Spiel war. Auch wenn die erste militärische Operation dieses Feldzugs fast ohne Verluste abgelaufen war. Der Weg über die Alpenpässe hatte mehr Opfer gefordert, als die Liquidierung dieses Dorfes. Aber, so einfach die Aufgabe auch war, so vollständig musste sie ausgeführt werden. Keine Kriegsgefangenen, hatte er angeordnet, auch wenn dies nach ihrer Rückkehr geschmälerten Ruhm und Gewinn für den Imperator bedeutete. Beute in Form von Silber oder Gold war hier in dieser ärmlichen Gebirgsgegend wahrscheinlich kaum zu erwarten, aber Kriegsgefangene brachten hohe Gewinne auf den Sklavenmärkten. Doch bis sie nach Rom geschickt werden konnten, mussten sie bewacht und verpflegt werden, banden so einen Teil der kämpfenden Truppe und verringerten die Marschgeschwindigkeit einer Legion.
Tiberius sah hinunter auf die verkohlten Überreste des Dorfes. Noch immer stand der Mann mit der brennenden Kleidung unbeweglich der Hundertschaft gegenüber. Er unternahm keinen Versuch, die Flammen in seinen Kleidern zu löschen, obwohl sie ihm unerträgliche Schmerzen bereiten mussten. Es war beinahe ein Wunder, dass er sich noch auf den Beinen halten konnte. Der Zenturio, der die Hundertschaft führte, hatte das offensichtlich auch erkannt. Anscheinend war er ein Mann mit Sinn für Humor und Dramaturgie. Er hielt seine Soldaten zurück, um abzuwarten, was geschah. Tiberius sah sich nach dem Legaten um, der diese Legion führte.
»Wie ist der Name des Zenturios? Ich will ihn in meinem Bericht lobend erwähnen«.
»Das ist Flavius. Der Mann, den ich dir als Primus Pilus der Legion vorgeschlagen habe«, sagte der Legat, froh darüber, dass Tiberius ihn nicht fragte, warum nicht er, sondern ein Zenturio, diesen ersten, wichtigen Angriff angeführt hatte.
Tiberius wandte sich wieder nach vorn. Aus dem, was sich da unten abspielte, würde eine kleine Anekdote am Rande ihres Feldzuges entstehen. Interessant genug um in seinem Bericht Erwähnung zu finden, und den Kaiser in Rom für einen Moment zu erheitern. Was ihm jedoch weitaus wichtiger war, diese Episode würde den Kampfesmut seiner Legionäre stärken.
Die Vindelecier fielen bereits beim Anblick einer Hundertschaft tot um, oder wurden vom Gewicht ihrer eigenen Schwerter erschlagen.
So, oder so ähnlich würde es an den Lagerfeuern die Runde machen. Die gefürchteten gallischen Bergstämme verwandelten sich durch diese Geschichte in komische Figuren, vor denen niemand Furcht haben musste. Er drehte sich zu Catalina um, seinem Freund und Befehlshaber der Reiterei.
Ähnlich wie Drusus, war es dem schwergefallen, von hier aus tatenlos zusehen zu müssen. So wie er Catalina kannte, hätte der sich lieber unter seine Reiter gemischt, auch wenn es für die nichts zu tun gab.
»Bist du immer noch so gut mit dem Bogen?«, fragte Tiberius. Catalina lachte.
»Besser als du allemal«. Tiberius grinste.
Catalina durfte sich solche Freiheiten im vertrauten Kreis herausnehmen. Außerdem war es keine Schande, von ihm im Bogenschießen übertroffen zu werden. Selbst unter den skythischen Bognern gab es nur wenige, die es mit Catalinas Treffsicherheit aufnehmen konnten.
»Er gehört dir«, sagte Tiberius und zeigte auf den Greis unten im Dorf.
Catalina trieb sein Pferd den Abhang hinunter. Er fand auf Anhieb den geeigneten Platz, so nahe, um sein Opfer mit dem Pfeil erreichen zu können und weit genug entfernt, damit ihm der Erdwall nicht die Sicht nahm, wenn er abgesessen war. Ohne Hast glitt er aus dem Sattel, legte den Pfeil in den Bogen und schickte ihn auf die tödliche Reise.
Ein Schrei ertönte. Tiberius wandte überrascht den Kopf zur Seite. Nur eine Bogenschussweite von ihnen entfernt unter einem weit ausladenden Baum stand ein Junge. Hinter ihm, das Gesicht im Schatten, ein Mann mit langem Bart. Einer der beiden musste geschrien haben. In einer Sprache, die er nicht verstand. Also waren sie Vindelecier.
Der Junge, eher schon ein junger Mann, starrte ihn an. Einen Moment lang erwiderte er den Blick, dann sah er hinunter zu Catalina. Der hatte den Schrei ebenfalls gehört. Tiberius zeigte auf die zwei Gestalten und rief Catalina zu.
»Hol sie mir her. Aber lebend. Ich will wissen, ob noch mehr von ihnen hier herumstrolchen.«
Catalina galoppierte los. Zwei seiner Reiter folgten ihm. Tiberius sah ihm nicht nach. Auf Catalina konnte er sich blind verlassen. Das zeigte der Alte, der dort unten lag. Catalinas Pfeilschaft ragte aus seinem Rücken.
05.
Mein eigener Schrei, der Stoß, den mir der Alte versetzte, und seine Aufforderung rissen mich aus der Erstarrung.
»Lauf Cyan, lauf so schnell du kannst«.
Und ich rannte. Schneller, als ich je zuvor in meinem Leben gerannt war. Ich flog den steilen Weg hinauf, den der Alte und ich gerade heruntergestiegen waren. Hinter mir hörte ich das Poltern von Pferdehufen auf dem Wiesenboden. Es näherte sich mit rasender Geschwindigkeit. Dann war es einen Moment still. Ich hörte nur meinen keuchenden Atem und das Geräusch meiner Füße, die kaum den Boden zu berühren schienen. Hinter mir ertönte ein krächzender Schrei. Metall traf auf Metall. Ich sah mich nicht um. Die Angst trieb mich weiter, hatte alle anderen Gedanken in meinem Kopf ausgelöscht.
Das Poltern der Hufe setzte wieder ein. Kam näher und näher. Noch einmal gelang es mir, meinen Vorsprung zu vergrößern, als ich den Steilhang hinaufhetzte, der zur ersten Alm führte. Die Huftritte wurden langsamer. Der Weg war steil. Ich verstand die Rufe und Flüche meiner Verfolger nicht, mit denen sie die Pferde antrieben, sie den steinigen Pfad hinaufzwangen, doch der Klang ihrer Stimmen war eindeutig. Sie würden nicht aufgeben, bis sie mich eingeholt und mit dem Speer oder dem Schwert durchbohrt hatten.
Ich erreichte das erste Plateau und sah mich um. Hinter mir schepperten Steine, loses Geröll von den Pferdehufen losgetreten. Meine Lunge brannte, in meiner Seite stach es und fühlte sich an, als ob einer der Reiter die Schärfe seines Schwertes an mir erprobte. Hier oben würden sie mich schnell einholen. Der nächste Steilhang, wo ich gegenüber den Pferden im Vorteil war, war unendlich weit entfernt. Die Almwiese stieg nur sanft an, stellte kein Hindernis für die Berittenen dar. Die dichten Brombeerbüsche, kleine Inseln im Gras, konnten sie leicht umreiten. Nie würde ich die Hütte erreichen. Und selbst wenn, die Hütte bot keinerlei Schutz vor drei bewaffneten Reitern.
Ich ließ mich vor einem Bromberstrauch zu Boden fallen. Kroch unter seine schützenden, dornenbewehrten Ranken, ohne zu spüren, wie sie meine Arme und Beine aufrissen. Ich hockte mich auf den Boden, machte mich so klein als möglich. Mein Herzschlag übertönte das Poltern der Hufe, mein pfeifender Atem das Keuchen der Pferde. Sie kamen näher.
Das Brombeerblatt direkt vor meinem Auge trug schon die Rotfärbung des Herbstes. Der leichte Wind bewegte es hin und her. Die Schleimspur einer Schnecke glänzte in der Sonne. Der feine Faden eines Spinnennetzes wurde im Licht sichtbar, verschwand vom Winde verweht. Und mit ihm verschwand ich aus dieser Welt. Mein Herz hörte nicht auf zu schlagen. Doch hatte es eben noch wie eine Trommel gedröhnt, glichen seine Schläge nun dem trägen Pulsieren eines Schneckenherzens. Unhörbar, selbst für das feinste Ohr. Mein stoßweiser Atem wurde flach, meine Brust hob und senkte sich kaum mehr. Dennoch hörte und sah ich alles um mich herum. Undeutlich zwar und verwaschen, so, als habe der Schleim der Schnecke alles mit einem zähen Belag aus fließender Langsamkeit überzogen.
*
Ein großer Schatten hält neben mir und verdeckt die Sonne. Ich spüre die feinen Schwingungen der Erde, das Zittern vier erschöpfter Beine. Die Atemzüge des Pferdes rasseln. Sein Schweißgeruch sticht mir in die Nase. Ein kleiner Schatten löst sich von dem Großen. Ich fühle jeden Schritt, als er sich nähert. Höre das Quietschen feuchten Leders, das bedrohliche Scheppern von Metall. Die Ranken vor meinem Gesicht werden auseinander geschoben. Ein leises Knurren, als ein Dorn die Hand ritzt. Über der Hand ein Gesicht. Die große Nase ist geformt wie der Schnabel eines Raubvogels. Auf der Stirn eine rot gefärbte Furche. Der Abdruck des Helmes. Schweißtropfen rinnen wie Tau über die Wangen. Tiefbraune Augen. Ein Lidschlag schließt sie unendlich langsam. Die Augen öffnen sich wieder, sehen mich an. Kein Zeichen des Erkennens, oder des Triumphes. Die Augen sehen durch mich hindurch, an mir vorbei, um mich herum. Der Ausdruck von Enttäuschung wandert wie der Schatten einer Wolke über das Gesicht. Wird abgelöst vom Nichtverstehen. Der zusammengepresste Mund öffnet sich. Worte quellen zwischen den Lippen hervor, die ich nicht verstehe. Die Lippen spucken Speichel aus. Das Gesicht weicht zurück. Die Hand verschwindet, hinterlässt einen Blutstropfen auf dem Blatt vor meinen Augen. Der Schatten richtet sich auf. Ein Geräusch. Metall schleift über Metall.
*
Dieses Geräusch holte mich in die Welt zurück. Ich ließ die Langsamkeit hinter mir. Der Mann hatte sein Schwert gezogen. Meine Hand zuckte zu dem Bronzedolch an meinem Gürtel. Mit aller Kraft stieß ich ihn durch den Fuß des Mannes. Ich hörte das Knacken kleiner Knochen, als die breite Klinge bis zum Heft im Widerrist seines Lederstiefels versank. Er brüllte auf, schrie, fluchte, aber das alles ging im Rascheln und Reißen der Brombeerranken unter, durch die ich mir auf allen Vieren den Weg bahnte. Ich erhob mich, rannte, rannte, erreichte den Steilhang und krabbelte hinauf. Unter meinen Füßen lösten sich Steinlawinen. Die zweite Alm, den Quellbach, die Hütte ließ ich hinter mir und stieg in die steilen Felsklippen. Als ich eine Felsspalte erreichte, zwängte ich mich hinein und ließ mich erschöpft zu Boden fallen. Ich wusste nicht, ob mir meine Verfolger noch immer auf den Fersen waren, oder ob ich sie in den Felswänden abgehängt hatte. Ich verkroch mich in den finstersten Winkel der Spalte, schlang die Arme um meine Knie, erstarrte zu einem Felsbrocken und wartete. Den mit Blut beschmierten Dolch hielt ich fest umklammert.
*
Ein seltsames Geräusch weckte mich. Es klang wie ein Schmatzen. Vor mir bewegte sich etwas in der Felsspalte. Ich wagte nicht mich zu rühren. Das Etwas war groß. Viel größer als ich. Langsam schälten sich vage Umrisse aus der Dunkelheit. Ein Kopf mit glühenden, gelben Augen, viereckigen Pupillen, riesigen, gebogenen Hörnern. Ein Wesen aus der Anderswelt, huschte es mir durch den Kopf. War ich selbst dort gelandet? Hatten mich die Römer eingeholt, getötet und liegen gelassen? Ganz sicher hatten sie nicht meinen Mund geöffnet, meinem Geist nicht erlaubt, ohne Umwege in die Anderswelt zu gelangen. Musste er deshalb hilflos herumirren, traf auf andere Geister, die ebenfalls verirrt den Zugang zur Anderswelt suchten?
Wieder ertönte ein lautes Schmatzen. Ich richtete mich auf. Der Geist war offenbar noch schreckhafter als ich. Er sank in sich zusammen, stieß ein Meckern aus und ergriff die Flucht. Vor dem hellen Hintergrund, dort wo sich die Felsspalte öffnete, erkannte ich die Umrisse eines Steinbocks. Doch was hatte er hier in der Felsspalte gemacht? Warum hatte er sich auf den Hinterläufen aufgerichtet und war mir deshalb so groß erschienen? Und warum hatte er so geschmatzt? Ich erhob mich, betastete den Fels in der Höhe, wo ich den Kopf des aufgerichteten Steinbocks gesehen hatte. Der Stein war glatt und feucht. Ich rieb mit dem Zeigefinger darüber und steckte ihn in den Mund. Es schmeckte salzig. Ein seltener Fund.
Die salzigen Steine waren in unserer Gegend nicht oft zu finden. Kratzte man mit einem scharfen Gegenstand an ihrer Oberfläche, lösten sich grauweiße Körner, die allen Speisen einen köstlichen Geschmack verliehen. Darüber sollte ich mich freuen, auch darüber, dass ich noch in der Welt der Lebenden weilte, wie mir jetzt bewusst wurde.
06.
Es war die Kälte, die mich am nächsten Morgen aus der Felsspalte vertrieb. Zitternd und mit klappernden Zähnen hatte ich die ganze Nacht im Schutz der Felsen verbracht.
Das geringste Geräusch hatte mich hochfahren lassen. Ein Steinchen, das sich löste, ein Wassertropfen, der am Boden aufprallte, jeder Laut versetzte mich in panische Angst und brachten mein Herz zum Rasen. Ich sah Schatten am Eingang der Felsspalte, Schwertklingen, die im Mondlicht aufblitzten, und glaubte den Schmerz in der Brust zu spüren, wenn die Klinge in meinen Körper eindrang.





























