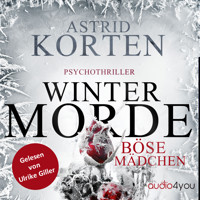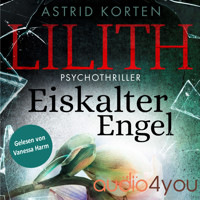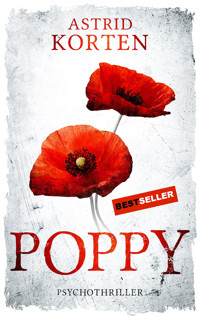4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Reisen ist, in jedem Augenblick geboren werden und sterben. (Victor Hugo) Till und Ida Faber machen mit ihren zwölfjährigen Zwillingen einen Roadtrip durch Kalifornien. Ida ist eine investigative Journalistin, Till Anwalt und Hobbymusiker. Die Zwillinge sind eine verschworene Einheit, mit Flausen im Kopf. Alles in allem sind die Fabers eine ganz normale Familie. Aber … Zu Beginn des Roadtrips zeigt die Ehe von Till und Ida bereits tiefe Risse. Während sich die Spannung auf den Vordersitzen des Autos steigert, haben die beiden Mädchen auf dem Rücksitz ihre eigenen Probleme. Seit sie von ihrer Mutter erfahren haben, dass sie eigentlich Drillinge waren, hören und sehen die Mädchen ihren kleinen Bruder FIF überall. Er mag zwar keinen Körper haben, aber in den Köpfen der Mädchen nimmt er eine immer gefährlichere Form an. FIF ist böse und so nimmt das nahende Unheil seinen Lauf … "Die Bestseller-Autorin Astrid Korten lässt einem Roadtrip zum Horrortrip werden, der mit einem erwartenden, fulminanten Showdown endet. Sehr lesenswert." Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Astrid Korten
DU
BÖSER
BÖSER
JUNGE
Psychothriller
Yesterday
(Auszug aus dem Song der Beatles)
Yesterday, love was such an easy game to playNow I need a place to hide awayOh, I believe in yesterday.
Gestern war die Liebe so ein einfaches Spiel.Jetzt brauch ich einen Ort, an dem ich mich verstecken kann.Oh, ich glaube an Gestern.
Für Angelika
Über das Buch
Reisen ist, in jedem Augenblick geboren werden
und sterben.
(Victor Hugo)
Till und Ida Faber machen mit ihren zwölfjährigen Zwillingen einen Roadtrip durch Kalifornien. Ida ist eine investigative Journalistin, Till Anwalt und Hobbymusiker. Die Zwillinge sind eine verschworene Einheit, mit Flausen im Kopf. Alles in allem sind die Fabers eine ganz normale Familie. Aber …
Zu Beginn des Roadtrips zeigt die Ehe von Till und Ida bereits tiefe Risse. Während sich die Spannung auf den Vordersitzen des Autos steigert, haben die beiden Mädchen auf dem Rücksitz ihre eigenen Probleme. Seit sie von ihrer Mutter erfahren haben, dass sie eigentlich Drillinge waren, hören und sehen die Mädchen ihren kleinen Bruder überall. FIF mag zwar keinen Körper haben, aber in den Köpfen der Mädchen nimmt er eine immer gefährlichere Form an. Das nahende Unheil nimmt seinen Lauf …
"Die Bestseller-Autorin Astrid Korten lässt einem Roadtrip zum Horrortrip werden, der mit einem erwartenden, fulminanten Showdown endet. Sehr lesenswert." WAZ
Teil 1
Zwei plus Eins macht Spaß
Zwei plus Eins
Aus der flimmernden Luft über dem Asphalt verfolgt uns ein Gespenst. Gerade als wir anfangen wollen zu schreien, sehen wir, dass es eine obdachlose Frau ist, die Plastiktüten voller Unglück mit sich trägt.
Wir essen auf irgendeiner Terrasse in der Nähe irgendeines Einkaufszentrums in irgendeiner Stadt zu Mittag. Es ist brütend heiß, die meisten Geschäfte sind geschlossen, es ist kaum jemand auf der Straße. Mom hat ihr Portemonnaie auf den Tisch gelegt, was ohnehin eine blöde Aktion ist. Die Obdachlose starrt es an wie eine hungrige Löwin einen Springbock.
Keine Chance, deuten wir mit unseren Augen an.
Ihr Rücken ist krumm wie der eines Kite-Surfers. Mom und Loser beachten die Frau nicht, was völlig bescheuert ist, denn die Frau steht so nah an unserem Tisch, dass wir die Poren in ihrem Gesicht zählen können und riechen, wie sie stinkt.
„Do you have some money to buy food?“, fragt die Frau.
„Wir haben kein Bargeld“, antwortet Mom schnell.
Die Obdachlose schaut wieder auf das Portemonnaie, das plötzlich prall gefüllt wirkt und Mom wie eine Närrin aussehen lässt.
„Please“, fleht die Frau Mom an. „I’m begging you.“
Die Kellnerin kommt heraus und klatscht in die Hände, als würde sie eine Katze aus dem Garten verscheuchen.
Die Bettlerin protestiert nicht einmal. Sie schlurft von der Terrasse und überquert die leere Straße. Ihr Gang ist mit einem Mal geschmeidiger und leichter. Als hätte sie das Unheil an unserem Tisch abgelegt.
Mom kaut auf ihrem Sandwich. Sie starrt weiter auf das Gebäude, hinter dem die Obdachlose verschwunden ist. Plötzlich steht sie auf, holt einen Zwanzig-Dollar-Schein aus dem Portemonnaie.
„Wie verzweifelt muss man sein, um ‚Ich flehe Sie an‘ zu wildfremden Menschen zu sagen? Das ist mir peinlich.“ Mit Schritten, die für ihre hohen Absätze zu groß sind, eilt sie davon.
Loser schaut überrascht auf, aber wir verstehen Mom.
Zehn Minuten später kommt sie errötet und verschwitzt zurück. Die Zwanzig-Dollar-Note hängt schlaff in ihrer Hand. „Verschwunden, einfach so.“ Mom streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. „In Rauch aufgelöst.“
„Bad Karma“, sagen wir.
„Ihr müsst mit diesem Karma-Gedöns aufhören“, knurrt Mom und steckt den Geldschein in ihr Portemonnaie. „Kommt, lasst uns weiterfahren. Ich will pünktlich im Hotel sein.“
Ida
„Gute Nachrichten“, sage ich. „Mein Artikel wird in dem Wochenmagazin der Zeitung veröffentlicht.“
Obwohl ich nie daran gezweifelt habe, dass die Redakteure eines der großen Meinungsmagazine dieses Mal zustimmen werden, ist es doch sehr erfreulich, dass die offizielle Bestätigung endlich da ist. Ich lasse mein Handy zurück in das Ablagefach der Autotür gleiten und schaue Till von der Seite an. Keine Reaktion.
„Aber erst, wenn wir wieder in München sind“, füge ich rasch hinzu.
Till atmet jetzt ein wenig kräftiger aus als sonst. Seine Schultern sinken ein paar Zentimeter, die Hände liegen noch immer entspannt auf dem Lenkrad.
Ich betrachte sein Profil, während ich den letzten Teil meiner dreistufigen Rakete in Umlauf setze. „Sie erwarten, dass ich jede Menge Staub aufwirbele. Ich muss für Interviews erreichbar sein.“
Till rührt sich nicht.
Mein betagter Freund Hakido würde sagen, dass ich mich zu einer Frau entwickelt habe, die um die Aufmerksamkeit ihres Mannes buhlt. Und alles, was Hakido behauptet, enthält ein Körnchen Wahrheit. Wegen dieser Gewissheit konsultiere ich ihn schließlich.
„Das überrascht mich nicht“, sagt Till schließlich. „Selbst die seriösen Magazine sind heutzutage ziemlich sensationsgeil. Erhöht die Auflagen.“ Er wendet sein Gesicht ein wenig von mir ab. Höchstens einen Zentimeter, aber es reicht aus, um seine Missbilligung zu symbolisieren.
„Wirklich nett, deine Begeisterung. Und dieser Erfüllungsstolz.“
Einmal mehr antwortet Till nicht sofort. Seine Unbeweglichkeit kontrastiert mit der Landschaft, die entlang des Highway 101 an uns vorbeigleitet. Wogende Felder in leuchtendem Sonnengelb und sattem Grün, Bäume, wie im erträumten Paradies. Farmen, Weinberge, hier und da ein Blick auf das große Blau des Ozeans. Mittlerweile verstehe ich, warum über Kalifornien viele Lieder komponiert wurden. Warum die Reichen der Welt dieses Fleckchen Erde als ihr Zuhause wählen.
„Nimm es mir nicht übel“, knurrt Till schließlich. „Ich mache mir nur Sorgen um deinen guten Ruf als Journalistin.“
„Über meinen Ruf?“ Es klingt schärfer, als ich es beabsichtige. Seine Reaktion überrascht mich nicht. Er hat mir in den vergangenen Monaten mehrfach zu verstehen gegeben, dass ich einer falschen Spur folge. Dass ich Gespenster sehe. Dass ich mich festbeiße, wie ein Pitbull. Dass ich durchdrehe. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, dass er ein persönliches Interesse daran hat, die Wahrheit über den HPV-Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs unter Verschluss zu halten.
„Mein Artikel enthält nur Fakten! Schlüssige nachvollziehbare Fakten!“
Jetzt seufzt er tatsächlich. Als Nächstes spielt er mit den Fingern der rechten Hand eine Zeit lang auf der Unterlippe Klavier. „Es kommt nur darauf an, welchen Farbfilter man vor die Lichter hängt, damit das Publikum das sieht, was es sehen soll.“
Okay, es geht los. Neuerdings erkenne ich den Moment, wenn wir den verbalen Boxring betreten. Achtzehn Jahre hing ich wie betäubt in den Seilen, bevor ich überhaupt daran dachte, mich zu verteidigen, aber jetzt bin ich wach und bereit, zurückzuschlagen.
„Du meinst, es gibt im Grunde keine Fakten?“
„Ich meine, dass alles, wirklich alles, immer wieder von privaten Meinungen und Annahmen gefärbt ist. Selbst Fakten.“
Jetzt bin ich mit dem Seufzen dran. Ich habe in meinem Leben Tatsachen aufgedeckt, die andere Menschen verheimlichen wollten. Ich wurde ausgebremst, sogar bedroht. Warum sollte ich mir die Mühe machen, wenn ein Fakt nur ein formbares Konzept wäre? Blödsinn!
„Dieses Auto ist blau“, kontere ich. „Unsere Kinder sitzen auf dem Rücksitz. Es ist Montag. Drei Fakten. Ich sehe keinen Spielraum für andere Interpretationen. Du vielleicht?“
„Das sind nur Fetzen von Informationen. Nicht vollständig genug, um faktisch korrekt zu sein. Du schränkst die Informationen ein, die du preisgibst, und in dieser Einschränkung liegt bereits deine Vision.“
„Bullshit!“ In die Defensive gedrängt, verschränke ich die Arme.
„Nehmen wir mal an, das Auto wäre komplett blau“, sinniert Till. „Innen und außen. Vom Gaspedal bis zur Hutablage. Das wäre dann etwas Besonderes. Aber weil du das Übliche, das Normale annimmst, erwähnst du diese Möglichkeit nicht. Du gehst davon aus, dass die Leute verstehen, dass nur die Außenseite des Autos blau ist.“
„Was auch zutrifft.“ Meine Stimme schießt in die Höhe.
„Oder ein anderes Beispiel“, fährt Till fort. „Unsere Kinder sitzen auf dem Rücksitz. Gut. Aber angenommen, wir hätten achtzehn Kinder. Das wäre seltsam, achtzehn Kinder auf dem Rücksitz. Dann bekommt so ein Fakt eine ganz neue Bedeutung. Das würde uns zu Kinderschändern machen. Es sei denn, wir fahren nicht mit einem Auto, sondern mit einem Bus. Das erzählst du aber den Leuten nicht.“
„Sei nicht so ermüdend, Till. Wir fahren nicht mit einem Bus. Und wir haben auch keine achtzehn Kinder. Du weißt sehr wohl, was ich meine.“
„In der Tat. Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Das Problem ist, dass du nicht verstehst, was ich meine!“
Ich schüttele den Kopf und versuche, meine Gedanken wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückzubringen. Es gelingt mir nicht. Mr. Anwalt hat es wieder geschafft.
„Wir haben zwei Kinder, Till. Und sie sitzen auf dem Rücksitz eines blauen Autos. Und heute ist Montag, verdammt noch mal!“
„Drei“, klingt es hinter meinem Rücken, „drei Kinder.“
„Tut mir leid, Babes.“ Ich drücke meine Fingerspitzen gegen meine Schläfen. „Drei Kinder, selbstverständlich.“
Zwei plus Eins
„Nur um das klarzustellen“, bedeutete Mom vor ein paar Monaten, als sie überlegte, ob wir uns gegen Grippe impfen lassen sollten. „Ich halte präventive Impfungen generell für sinnvoll und manchmal sogar für notwendig. Ich habe nichts gegen den wissenschaftlichen Fortschritt.“
Es war ein merkwürdiger Kommentar, ich habe nichts gegen den wissenschaftlichen Fortschritt. Als hätte Mom nichts gegen Häuser, oder gegen das Atmen.
„Wirklich nicht“, fuhr sie fort. „Immerhin verdanke ich es der Wissenschaft, dass ich euch am Ende doch noch bekam.“ Und erst da erzählte sie uns, dass wir ursprünglich Drillinge gewesen wären. Nicht, weil Mom glaubte, wir sollten es erst im Alter von zwölf Jahren erfahren, oder weil sie auf dem Sterbebett lag oder irgendetwas Interessantes in der Art, nein, nur weil es ihr erst jetzt in den Sinn kam, es uns zu sagen.
Der Arzt am Institut für künstliche Befruchtung hatte Mom zwei befruchtete Eizellen eingesetzt. Aber eine der beiden Eizellen hat sich in ihrem Bauch geteilt. Das waren wir, und das sieht man uns an: Wir sind eineiige Zwillinge. Der andere Fötus starb ein paar Monaten später. Wir wuchsen weiter, er wurde immer kleiner. Auf jedem Ultraschall war er immer schwieriger zu erkennen als auf dem letzten, bis überhaupt nichts mehr von ihm übrig war. Vanishing twins, so nennt man das. Oder FiF. Ein Fötus in föto, hat uns Mom erklärt. Das Wort gefällt uns besser, es könnte auch ein Vorname sein. Deshalb werden unseren kleinen Bruder Fif nennen. Und genau das ist passiert. Fif ist verschwunden. Oder, wie man bei Google nachlesen kann: Er wurde absorbiert. Zuerst dachten wir, das sei eine krasse Vorstellung, aber es hat auch seine Vorteile, zu wissen, dass er buchstäblich in unserem Fleisch und Blut übergegangen ist.
Jetzt verstehen wir, warum wir früher mit Dinosauriern und nicht mit Puppen gespielt haben. Warum wir heute mit den Jungs auf dem Schulhof Fußball spielen, anstatt uns in sie zu verlieben. Und warum wir an Leichtathletikwettbewerben teilnehmen und nicht an Dressurübungen.
Mom sagt, es sei nicht sicher, ob das dritte Kind ein Junge oder ein Mädchen war, aber wir wissen es besser. Wir haben schon unser ganzes Leben lang an ihn gedacht, selbst als wir noch nichts von der Existenz unseres kleinen Bruders wussten. Wir haben schon immer das getan, was er wollte. Er hat zwar keinen eigenen Körper, und doch ist er immer bei uns. Oder wahrscheinlich ist er immer bei uns, weil er keinen eigenen Körper hat – er kann ja auch nirgendwo anders hin.
Till
Verdammt! Sie werden Idas Artikel veröffentlichen. Darauf hätte ich auch noch verzichten können. Der Teufel hat sich dieses Mal meinen Garten für seinen Haufen Scheiße ausgesucht. Ich kann die Folgen noch nicht absehen, aber gut ist es allemal nicht. Ob ich mich später mit Andreas in Verbindung setzen soll? Vielleicht hat er einen Plan, wie wir diese Sache händeln können. Vielleicht sollte ich meinen Partner aus dem Spiel lassen, bis ich das Ausmaß des Problems erfasst habe. Vielleicht zieht es an mir vorbei. Vielleicht gibt es auch gar kein Problem.
Ich schaue zur Seite. Ida starrt demonstrativ aus dem Fenster. Sie wird erst wieder mit mir reden, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Ich kenne sie. Keine Ahnung, wohin wir fahren. Aber gut, dass es auf der Straße ruhiger wird. Der höllische Verkehrsknoten rund um Los Angeles war nicht gerade entspannend. Bist im Urlaub und steckst stundenlang in einer Abgaswolke fest. Aber okay. Wie ich Ida einschätze, wird es zweifellos eine schöne Reise. Das Organisieren von Urlauben ist eines ihrer Talente.
Ida ist klug, witzig und – seien wir mal ehrlich – eine heiße Braut. Noch immer. Sie ist jetzt Mitte vierzig, aber auch die jungen Kerle, die für mich arbeiten, strecken ihren Brustkorb unwillkürlich ein paar Zentimeter, wenn Ida ihnen ihre Aufmerksamkeit schenkt. Wie neulich, als wir das fünfzehnjährige Jubiläum von Faber & Gruber auf der Isarjacht feierten, dem größten Partyschiff, das wir buchen konnten. Ein endloses Angebot an Austern, Hummer, Kaviar und Champagner an Bord. Alle Mitarbeiter mit ihren Familien. Einige wichtige Geschäftskontakte. Ungefähr hundertfünfzig Leute, alles in allem. Ab und zu schaust du dich nach deiner Frau um, ob auch sie sich amüsiert. Zumindest tue ich das. Auf die meisten Männer trifft das nicht zu, da sie ihre Frauen an ihrer Seite haben wie Klebstoff. Sie gehen dorthin, wo ihre Ehemänner hingehen. Wie Schatten. Ida wird nie der Schatten von jemandem sein. Im Gegenteil, sie ist ein Lichtblick in jeder Gesellschaft, wie ich auf der Party wieder feststellen konnte. Der energetische Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, eine unerschöpfliche Quelle von Themen, über die jeder mitreden kann – wenn Ida in der Nähe ist, dann fühlt sich niemand verloren. Sie stand gewiss ganz vorne, als die Sozialkompetenzen verteilt wurden.
Ihre bisherige Arbeit zeigt auch ihr Auge für Details, eine originelle Sicht auf alltägliche Dinge und einen scharfen Verstand. Aber das war’s dann auch schon mit der Lobeshymne. Denn mit ihrer Recherche über den neuen HPV-Impfstoff scheint sie den Blick für die Realität verloren zu haben. Und das will sie nicht hören. Sie will nicht vor dem freien Fall von der renommierten und preisgekrönten Enthüllungsjournalistin zur – sagen wir mal – Kolumnistin für Teenagerallüren in einem Altweibermagazin bewahrt werden.
Beim ersten Freitagnachmittagsdrink nach der Jubiläumsfeier sprach ich mit einer Angestellten. Sie war neu in der Kanzlei und die Art von Frau, die Andreas Gruber gern einstellt: jung, intelligent und ehrgeizig. Sie glaubte vermutlich, dass sie unter dem Einfluss der Menge an Sauvignon blanc, die sie heruntergespült hatte, es sich leisten könne, nach dem Wohlbefinden meiner kleinen Kräuterfrau zu fragen.
„Meine was?“, hakte ich nach.
„Ihre Kräuterdame. Sie ist doch gegen das präventive Impfen, nicht wahr?“
Vermutlich hoffte sie, dass ihre unverschämte Bemerkung der Beginn eines guten Gesprächs über Idas Unzulänglichkeiten sein würde. Ein Gespräch, das wir in ihrer Wohnung fortsetzen würden, wo ich zwischen den unvermeidlichen Buddha-Statuen und Duftstäbchen meine Hose fallen lassen und ihren Bleistiftrock hochkrempeln würde. Es ärgerte mich, dass sie mich für einen solchen Klischeemann hielt, aber vor allem ärgerte es mich, dass ich aus ihren Worten schloss, dass Ida ihr Steckenpferd wohl ziemlich ungestüm auf dem Salonschiff geritten haben musste. Und dieses Geschwätz über ihre Recherche könnte sich angesichts der jüngsten Entwicklungen zu einem geschäftlichen Desaster für Faber & Gruber entwickeln. Der Geschäftsführer dieses verdammten HPV-Impfstoffherstellers hatte sich gerade mit äußerster Diskretion an uns gewandt, um ein Sondierungsgespräch über eine mögliche Zusammenarbeit zu führen. Es wäre klüger, wenn meine Frau sich nicht auf der Pharmafront ins Bild setzt.
„Was reden Sie denn da? Meine Frau ist überhaupt nicht gegen präventive Impfungen“, sagte ich dem Bleistiftrock. „Unsere Kinder haben bereits das ganze Programm durchlaufen. Und wenn Sie so leichtfertig falsche Behauptungen in Umlauf bringen, prophezeie ich Ihnen eine ziemlich kurze juristische Karriere bei Faber & Gruber.“
Ich bezahlte die Rechnung für den Haufen betrunkener Mitarbeiter und ließ sie in der Kneipe zurück. Ich machte mich auf dem Heimweg.
Zwei plus Eins
Das Hotel The Madonna Inn im kalifornischen San Luis Obispo sieht aus wie eine mit Zuckerstangen gefüllte Sahnetorte. Wir setzen unsere Sonnenbrillen gegen all das Rosa in der Lobby auf. Mom sollte ein Reisebüro gründen, sie weiß immer, wie man supercoole Orte findet, und sie sagt, sie macht es gerne. Das sagt sie nie über ihren Job als Journalistin. Er soll kompliziert und schwierig sein und bereitet ihr Kopfschmerzen.
Während Mom die Anmeldeformulare ausfüllt, schnappen wir uns den Zimmerschlüssel vom Tresen und laufen wieder hinaus. Loser wartet im Auto. Ihm fällt nicht einmal auf, dass wir unsere Koffer aus dem Kofferraum nehmen. Wie immer ist er über sein Smartphone gebeugt, so krumm wie die Bettlerin, die wir heute Nachmittag getroffen haben. Und immer sagt er, er hat Rücken, und nennt es Arbeitsstress. Darauf fallen wir schon lange nicht mehr rein. Mom aber immer noch.
Über einen Streifen klebrigen Asphalts sprinten wir zu unserem Zimmer. Genau wie im letzten Hotel stehen zwei große Betten nebeneinander. Das muss etwas typisch Amerikanisches sein. Ansonsten ähnelt nichts dem, was wir sonst in einem normalen Hotelzimmer gesehen haben. Der Teppichboden ist dick, weich und grün, das Bad ist eine Tropfsteinhöhle, die Bettdecken sind aus Pantherfellen und über den Betten hängen riesige Tigertrophäen.
Wir werfen unser Gepäck auf den Boden und wühlen nach unseren Badesachen. Wir sind erst seit drei Tagen unterwegs, aber die von Mom ordentlich gepackten kleinen Stapel sind längst dahin. Der Inhalt springt uns aus den Koffern entgegen, als wäre er schon viel zu lange eingeschlossen und darin fast erstickt. Beim Umziehen trösten wir unsere halbtoten Turnschuhe und Jeans und leisten Mund-zu-Mund-Beatmung an einem lila angelaufenen Toilettenbeutel.
„Alles in Ordnung, meine Babes?“ Mom kommt herein. „Das ist ein Safari-Zimmer.“
„Es ist superfett, Mom“, jubeln wir. „Wir haben einen Wasserfall statt einer Dusche. Jetzt wollen wir ganz schnell zum Pool.“
Mom lächelt. Sie mag es, wenn man ihr Komplimente für die Dinge macht, die sie organisiert hat. Als wir zum Pool laufen, schlürft uns Loser entgegen, immer noch über sein Telefon gebeugt. Der Koffer, den er hinter sich herzieht, scheint auch nicht in der Stimmung dafür zu sein.
„Kommst du auch zum Schwimmen, Papa?“, fragen wir ihn gleichzeitig.
Er schaut auf, als würde er uns zum ersten Mal in seinem Leben sehen. „Ja“, antwortet er dann. „Ich komme sofort.“
Obwohl an der Rezeption ein Schild steht, dass das Hotel ausgebucht sei, ist niemand zu sehen. Weder auf den Balkonen, noch im Fitnessraum, und das Schwimmbad haben wir ganz für uns allein. Es ist groß, sauber und blau. Das Wasser schwappt über den Rand, es gibt Palmen und einen Jacuzzi. Wir tollen wie in einer Reality-Show auf MTV. Hier ist unser Haus, rufen wir unseren Rapper-Freunden aus der Musikanlage zu. Wir springen vom Sprungbrett, tauchen unter und versuchen herauszufinden, wer unter Wasser mit einem Atemzug die meisten Punkte sammeln kann, bis plötzlich eine Bombe im Becken explodiert.
Als Loser wieder auftaucht, lacht er wie früher: laut und mit seinem ganzen Gesicht.
„Hi, how are ya?“, begrüßen wir Dad auf typisch amerikanische Art. „Welcome to our house, Mister from Munich.“
Ohne dass wir ihn darum bitten müssen, spreizt er Arme und Beine. Wir klettern auf den Baum, den unser Dad darstellt, springen von seinen Ästen, schwimmen durch die gespreizten Beine, genau wie damals als wir klein waren, wir brüllen und haben Spaß und bleiben im Wasser, bis unsere Finger verschrumpelt sind und die Sonne hinter dem weißen, geschwungenen Gebäude verschwunden ist.
Ida
Trübes Morgenlicht scheint durch die Ritzen der Holzjalousien. Die grünen Wände des Zimmers umschließen mich, als wäre ich in der Isar untergetaucht, wie früher, während der endlosen Sommer, die ich mit meinen Freunden an ihrem Ufer verbracht habe, eine Kassette von Earth, Wind & Fire im Ghettoblaster, mit meinem damaligen Freund knutschend, ausgestreckt auf einem sandigen, von der Sonne gewärmten Handtuch.
Das Display meines Telefons zeigt Viertel vor sechs an. In München ist es demnach bereits Viertel vor drei am Nachmittag. Den besserwisserischen Jetlag-Experten sollte man nicht glauben, dass sie stets recht haben. Es ist eine Meisterleistung meines Körpers: Erst drei Tage in Amerika und schon hat er sich meinem Schlafrhythmus angepasst.
Ich lausche dem Brummen der Klimaanlage und dem Atmen von Till neben mir. Das Rascheln der Bettdecke unserer Mädchen im Bett nebenan, sobald sich eines von ihnen im Schlaf umdreht. Meine Familie. Die drei wichtigsten Menschen in meinem Leben, alle zusammen in einem Hotelzimmer. Ich fühle mich sicher. Wenn jetzt ein Meteorit einschlagen würde, der von diesem exzentrischen Hotel nichts als einen rauchenden Krater in der Erde hinterließe, wäre alles in Ordnung. Wir sind zusammen. Keiner von uns wird allein zurückgelassen, es gibt also auch keinen Kummer, zumindest keinen, der zu groß ist, um ihn zu tragen.
Da ist wieder dieses Geräusch, das mich aufgeweckt hat. Eine tiefe Stimme, jemand, der schreien möchte, sich aber zurückhält. Schritte im Zimmer über mir. Das Knurren, aber nicht von einem Hund. Menschliches Knurren. Und dann plötzlich, laut und deutlich: „Hit me, motherfucker, hit me!“ (Schlag mich, du Wichser, schlag mich?) Wow. Dann ist da eine andere männliche Stimme, leiser, unverständlich, beschwichtigende Töne. Vater und Sohn? Ein schwules Pärchen? Brüder? Dann ein dumpfer Schlag. Die Decke vibriert sichtlich. Stille.
Till bewegt sich. Ich drehe mich um. Das Weiß seiner Augen leuchtet in der dämmrigen Dunkelheit, er sieht mich an. Ich kenne diesen Blick. Vor Ewigkeiten hat er ihn mir zugeworfen. In seinem geparkten Auto, in der Nacht, als wir uns kennenlernten. Er spielte mit seiner Coverband auf der Hochzeit von gemeinsamen Freunden. O Gott, ich mochte ihn sofort. Und er fand mich atemberaubend. Er brachte mich nach Hause und kurz bevor wir uns zum ersten Mal vor meinem Elternhaus küssten, war er da – dieser Blick.
Ich rutsche auf Tills Matratzenhälfte, er zieht mich näher an sich heran. Mein linker Arm ist zwischen unseren Bäuchen eingeklemmt, ich strecke ihn über meinen Kopf, was für meine Schulter nicht angenehm ist, aber so ein Arm muss ja irgendwo hin. Es kommt mir vor, als ob Körper am Anfang einer Beziehung problemlos zusammenpassen und später alle möglichen Ausstülpungen und Vorsprünge entstehen, die eine geschmeidige Umarmung erschweren. Obwohl man doch erwarten könnte, dass man auch körperlich zusammenwächst.
„Guten Morgen“, flüstert er.
Ein Hauch von fauligem Geruch ist in seinem Atem. Das zwingende Bedürfnis, sich die Zähne zu putzen, bevor der andere wach ist, oder zumindest einen subtilen Versuch zu unternehmen, sich die Nacht mit der Zunge aus dem Mund zu streichen, verschwindet mit dem ersten Kuss. Wir küssen uns gegenseitig. Ganz sanft, nicht leidenschaftlich. An Sex ist nicht zu denken, wenn die Zwillinge in dem Bett neben uns liegen. Jedenfalls waren unsere Küsse nie wieder so spektakulär wie der erste, nach der Hochzeit, in seinem Auto. Wie sehr wünsche ich mir, dass es anders wäre. Vielleicht ist die Sehnsucht nach der Elektrizität der Anfangsphase ein fester Bestandteil jeder längeren Beziehung.
Aber ich kann mich nicht beklagen, denn wenn ich gut informiert bin – was ich vermutlich bin, da das Sammeln von Informationen mein Beruf ist – dann ist es eine Ausnahme, dass Ehepaare sich nach achtzehn Jahren noch küssen wie Till und ich es tun. Obwohl ich bei dieser mentalen Süßholzraspelei die Tatsache ignoriere, dass unser Sexleben seit Jahren auf Eis liegt und dass die aktuelle Wiederbelebung zweifellos auch etwas mit der Tatsache zu tun hat, dass Casper aus meinem Leben verschwunden ist. Denn in den Armen von Till hoffe ich, das wiederzufinden, was Casper mitgenommen hat. So wie ich zuvor in Casper das gesucht habe, was Till und ich verloren hatten. Aber im Nachhinein sind das alles Theorien. Eine überflüssige Erklärung für das einfache Ziel, meine Ehe mit Till aufrechtzuerhalten. Ich möchte mit ihm alt werden. Das Leben genießen, mit ihm, mit unseren Kindern, unseren Freunden. Das ist es, was ich will. Das ist es, worauf ich setze.
Zwei plus Eins
Bis zu unserem nächsten Hotel ist es nur eine halbe Stunde Autofahrt. Mom hat das absichtlich so geplant, weil sie im Internet entdeckt hat, dass man dort Unterricht im Stand-Up-Paddling nehmen kann. Sie dachte, das wäre etwas für uns, sozusagen das Projekt für den heutigen Tag. Die Idee gefällt uns.
Neulich in München, als wir von der Straßenbahnhaltestelle nach Hause liefen, sahen wir etwa vierzig oder fünfzig extrem hübsche Mädchen auf der Isar paddeln. Wir hingen über dem Geländer der Brücke, ignorierten unseren kleinen Bruder, der unbedingt unten planschen wollte, und fragten die Mädchen, was sie da machten. Ein Mädchen in einem schreiend hellblauen Surfanzug antwortete, dass sie Werbung machten. Sie hat nicht gesagt, wofür sie geworben haben. Vielleicht für den perfekten Körper. Oder für Haarverlängerungen.
Die Welt hinter dem Autofenster wird immer grauer. Die Sonne wohnt in den Bergen und hat keine Lust, mit uns an die Küste zu fahren. Als wir aus dem Auto aussteigen, werden wir von eisigen weißen Gespenstern überfallen. Unsere Körper zucken zusammen. Wir machen uns so schmal wie möglich, die Arme vor der Brust verschränkt, die Knöchel überkreuzt und die Beine zusammengedrückt, aber sie schneiden mit Leichtigkeit durch unsere Sommerkleidung, Haut und Organe, als wären wir noch durchsichtiger als sie es sind.
„Was für eine neblige Angelegenheit hier“, sagt Mom.
Zitternd betreten wir das Büro, wo wir uns anmelden müssen. Die Frau sieht freundlich aus, sagt aber, dass wir erst drei Stunden später einchecken können.
„Aber was sollen wir denn in den nächsten Stunden anfangen?“, fragen wir sie.
Sie schaut uns an, als hätte sie uns gerade den Schlüssel für den Vergnügungspark übergeben.
„Herumhängen. Das Wetter ist großartig!“
Auf dem Parkplatz suchen wir in unseren Koffern nach den wärmsten Klamotten, die wir finden können. Weiter als ein T-Shirt mit kurzen Ärmeln und Jeans kommen wir nicht. Alle hielten uns für verrückt, mitten im Sommer in den Südwesten der Vereinigten Staaten zu fahren. Viel zu heiß, sagten sie. Unerträglich heiß. Also dachte Mom, wir könnten unsere Jacken und Pullis zu Hause lassen. Sie reist gerne mit so wenig Gepäck wie möglich und wir müssen mitmachen.
Der Boulevard ist menschenleer, genau wie die Stand-Up-Paddling-School. Die Kälte schmerzt zwischen unseren Schulterblättern und der Nebel riecht nach Fisch. Der Steg am Rande des Dorfes knarrt und wackelt, Wasser schwappt gegen alte Boote. Ein Mann zeigt auf eine Uhr aus Pappe, die die nächste Abfahrtszeit für eine Bootstour in der Bucht anzeigt. Er bewegt die rostigen Ziffern, so dass sein Boot plötzlich auf dem Abfahrtszeitpunkt steht.
„Wollen wir?“, fragt Mom. „Wir haben nicht wirklich etwas Besseres vor.“
Wir wickeln uns in die Decken, die auf den Holzbänken liegen, und lassen uns durch den Nebel schippern. Reggae-Musik klingt aus einem altmodischen Radio. Sie hallt über dem Wasser nach und verebbt, als würden die Töne einen viel besseren Ort kennen. Der Skipper verhält sich wie ein Entdeckungsreisender, aber seine Welt ist nicht so groß. Auf der einen Seite liegt das Dorf, auf der anderen eine Sandbank, und die Pforte zum offenen Meer wird von einem bedrohlichen Felsen bewacht. Behaarte Seeotter schwimmen auf dem Rücken, die Vorderbeine über dem Bauch gefaltet. Sie glauben auch, dass das Wetter heute großartig ist. Die Otter sind eigentlich supersüß, aber das System in unserem Gehirn, das sich mit der Zuneigung befasst, funktioniert offenbar nicht bei minus siebentausend Grad.
Loser schiebt sein Handy immer wieder mit ungeduldigen Bewegungen in die Gesäßtasche, als ob es ihn selbst irritiert, dass er es ständig benutzt, aber innerhalb von zehn Sekunden hat er es vergessen und holt es wieder heraus. Moms Lächeln ist auf ihrem Gesicht eingefroren.
Nach der Rundfahrt müssen wir noch anderthalb Stunden die Zeit totschlagen. Das ist ein seltsamer Ausdruck: Zeit totschlagen. Als ob man die Zeit erschießen, erwürgen oder an einem Balken auf dem Dachboden aufhängen könnte. In der Vitrine eines Restaurants lesen wir, dass sie die beste clam chowder in ganz Kalifornien servieren. Wir wissen nicht, was das ist, clam chowder, aber wir machen nie viel Aufhebens, wenn wir neue Gerichte testen.
Die Kellnerin bringt uns lauwarmes, rotziges Zeug in einem Behälter. Wir haben noch nie Sperma gesehen, aber es muss so etwas wie das hier sein. Hieraus entstehen also Kinder. Unser kleiner Bruder träumt davon, dass wir ihm einen eigenen Körper geben. Er möchte, dass wir gleichberechtigt sind. Aber das ist nicht möglich, schließlich hat er die Körpergröße eines Däumlings. Es ist bestimmt auch viel ruhiger, wenn wir nicht mehr zu dritt in zwei Körpern sind. Auch ehrlicher. Er kann nichts dafür, dass er ein FiF ist und dass wir ihn absorbiert haben.
Wir würgen, schieben die Schüssel mit dem quietschenden Zeug von uns weg und fragen Mom, ob wir Pommes bestellen dürfen. Wir dürfen. Unsere nackten Unterarme kleben an der Plastiktischdecke. Die Kellnerin schiebt die Türen zur Terrasse noch weiter auf. Wir frösteln übertrieben und ziehen die Schultern hoch, so dass sie nicht einmal daran denkt, uns zu sagen, dass das Wetter super ist, aber sie grinst und tut es trotzdem.
Als wir, mit vor Kälte erstarrten Armen und Beinen, endlich zurück zum Motel laufen, entdecken wir einen Laden mit einem Schild an der Tür, auf dem in fröhlichen Buchstaben „Sunwear & Fogwear“ steht. Das ist es also. Die Leute glauben, dass der Nebel hier genauso schön ist wie Sonne. Ja, dann ist es immer schönes Wetter, das versteht selbst unsere Nase. Wir kaufen vier Fleece-Jacken, möglichst unterschiedlich, denn nichts ist so bescheuert wie Familienmitglieder, die die gleiche Kleidung tragen. Darin sind sich alle einig.
Im Motel haben wir wieder ein Zimmer mit zwei großen Schlafinseln auf einem Meer aus weichem Teppich. Die Fenster reichen bis zum Boden, auf der anderen Seite des Fensters schwimmen Enten im Wasser der Bucht.
Loser zündet den Gaskamin an, wir wickeln uns wie Raupen in die Steppdecken und legen uns auf den Boden in die Nähe des Feuers.
Mom lässt sich in den Sessel fallen, die Beine über die Lehne geschleudert, und greift nach ihrem Handy. „Zuhause ist da, wo das Wifi ist.“
Loser macht ein Nickerchen. Seine Atmung vermischt sich mit dem Züngeln der Flammen im Ofen. Ansonsten ist es still.
„Langweilig“, quengelt Fif.
„Halte einfach mal fünf Minuten die Klappe!“, nörgeln wir.
Nach einer Weile sind wir alle aufgetaut.
„Wer möchte einen Spaziergang machen und den Surfern am Strand zuzusehen?“
„Ich.“ Loser steht gähnend auf.
Wir sind gespannt, ob er sich seit dem letzten Mal, als wir seine Facebook-Seite gecheckt haben, bei Habibi Hetti noch mehr Ärger eingehandelt hat. „Wir bleiben lieber hier“, sagen wir. „Dürfen wir ein Spiel auf dem Laptop spielen?“
Ida
Till legt seinen Arm um meine Schultern, aber ich schaffe es nicht, mit ihm im Gleichschritt zu gehen, oder er schafft es nicht, so dass wir bei jedem Schritt unangenehm gegeneinanderstoßen. Nach etwa zwanzig Metern gibt er auf. Ich schaue zur Seite, um deutlich zu machen, dass ich seinen Versuch der körperlichen Berührung ohnehin nicht schätze, aber er hat sein Gesicht bereits abgewandt.
Wir gehen am fransenähnlichen Rand des Dorfes entlang: stille Touristenläden, ein einzelner Fischer am Steg, drei Schornsteine eines Kraftwerks am Horizont. Auf der Terrasse eines Restaurants singt eine gutaussehende Frau in den Fünfzigern ein Lied, von einem Mann auf einem Keyboard begleitet. Eine Handvoll Einheimischer starrt sie an, als würden sie es seit dreißig Jahren auf die gleiche Weise tun. Sie hat die Daumen in die Taschen ihrer Jeans eingehakt, deutet mit dem Absatz eines Cowboystiefels elegant den Takt der Musik an und schaut in die Ferne, an allen vorbei, an uns vorbei. Sie singt nicht für die Leute, sie singt nicht für uns, sie singt für niemanden, allenfalls für die Möwen. Vielleicht hat sie einst gehofft, von einem Plattenboss oder Agenten entdeckt zu werden, der hierher kam, um sich vom überhitzten Los Angeles abzukühlen, aber inzwischen hat sie begriffen, dass die Welt ein pulsierender Nachtclub außerhalb ihres Biotops ist und der Morro Rock, der vulkanische Plug an der Mündung der Bucht, ein Türsteher, an dem man nicht einfach vorbeikommt.
Der beeindruckende Felsen liegt noch im Nebel. Im Internet habe ich vorhin gelesen, dass die eisige Kälte vom Meer heranrollt, sobald in den umliegenden Gebieten warmes Sommerwetter herrscht. Jeder weiß das, außer mir. Strafpunkte für Ida Travel – mein Spitzname in unserem Freundeskreis, der meint, ich hätte den wahren Spürsinn.
Ich liebe nichts mehr, als mit Freunden den Urlaub zu verbringen und dafür ideale Bedingungen zu schaffen. In den vergangenen Jahren haben die Zwillinge und ich die Sommer in Ferienvillen in Italien und Frankreich verbracht. Möglichst weit im Süden, als Garant für gutes Wetter und doch nahe genug, um Till zu ermöglichen, nach Hause zu fliegen, wenn seine Arbeit es erforderte, und ein geeigneter Ort für unsere Freunde, die sich uns für einen Teil des Urlaubs anschließen und ansonsten getrennte Wege gehen konnten.
Privater Pool, Tennisplatz, beeindruckende Aussicht und die Nähe zu einem charakteristischen Dorf standen ebenso auf der Wunschliste wie mindestens sechs Schlafzimmer und drei Bäder, damit jeder genügend Privatsphäre hatte. Und das Ganze sollte pro Familie nicht teurer sein als eine Wohnung in irgendeinem langweiligen Ferienpark. Eine unmögliche Aufgabe, dachten alle und, dass Ida Travel aber ein besonderes Talent besaß, solche Kleinode aufzuspüren. Ich lasse sie das gerne glauben, aber um ehrlich zu sein, besteht mein Talent einfach darin, weit im Voraus zu buchen, wenn die Rosinen im Luxusvillen-Angebot noch da sind.
„Sollen wir weitergehen?“ Till nickt in Richtung Strand, der uns aus der Ferne anlächelt.
Ich werfe einen letzten Blick auf die Sängerin. Sie schaut tatsächlich zurück. Stolz flackert in ihren Augen. Sie glaubt, dass ich ein verwöhntes Touristenmädchen bin und sie selbst durch das Leben in diesem Dorf abgehärtet ist, wo der Meeresdunst einen nicht umhüllt, sondern bis in die Knochen dringt, und die Ausweglosigkeit des Daseins durch eine Nebelwand physisch geprägt ist. Ich ziehe mir die Kapuze der neuen Fleecejacke über den Kopf und schätze mich glücklich, dass ich Morro Bay morgen verlassen werde.
Zwei plus Eins
Vor zwei Monaten, an einem Samstagabend, als Loser noch einfach nur Papa war und kurz bevor Mom uns von unserem kleinen Bruder erzählte, waren wir allein zu Hause. Wir wollten das Internet nutzen, fern sehen und Chips essen, nicht in dieser Reihenfolge, aber alles zur gleichen Zeit. Unser Computer steht im Schlafzimmer und ist so beweglich wie ein Felsen im Meer, so dass wir damit nicht auf der Couch chillen können. Mom versteckt ihren Laptop in einer Schreibtischschublade in ihrem Arbeitszimmer, wenn sie ihn nicht benutzt, und dieses Arbeitszimmer ist für jeden tabu, der nicht Ida Travel heißt. Der Laptop von Loser ist eine andere Geschichte. Er streift im Haus herum wie eine kontaktfreudige Katze. Die Vereinbarung lautet, dass wir ihn benutzen können, wenn Loser ihn nicht braucht. Folglich taten wir in dieser Nacht nichts, was nicht erlaubt war.
Als wir Facebook öffneten, landeten wir direkt auf Losers Account. Er hatte vergessen, sich abzumelden, oder vielleicht weiß er nicht einmal, wie das funktioniert. Er hat ein Konto erstellt, hauptsächlich um uns online im Auge zu behalten. Wir waren seine ersten Facebook-Freunde und er hat nicht sehr viele hinzugefügt. Manchmal antwortet er auf Nachrichten von anderen, aber er postet nie selbst etwas. Alles nur Banalverkehr. Und nun waren wir plötzlich in seinem Account und hatten Stunden Zeit, uns zu entscheiden, mit welchem Status-Update wir ihn necken konnten. Während wir uns vor lauter Vorfreude in die Arme fielen, ertönte das Geräusch, das eine private Message ankündigt. Im Postfach erschien eine Nachricht von einer Hetti Lohmann.
„Online? Kannst du chatten?“
Wir sahen uns an. Aus dem Cyberspace rollte ein Einkaufswagen voller Süßigkeiten ins Wohnzimmer. Bevor wir überhaupt darüber gesprochen hatten, welche Streiche wir spielen könnten, ohne hunderttausend Jahre Hausarrest zu bekommen, kam die Antwort von Loser.
„Bin mit I. unterwegs. Melde mich später.“
Loser und Mom waren gemeinsam auf einer Party, so dass wir sofort verstanden, wer I. war. Genauso begriffen wir sofort, dass I. so etwas wie ‚mit dieser Person‘ bedeuten musste, denn es erforderte kaum Anstrengung, auch die restlichen Buchstaben von Ida zu tippen.