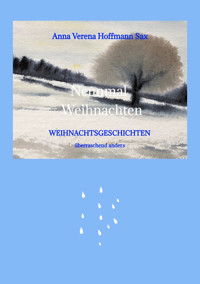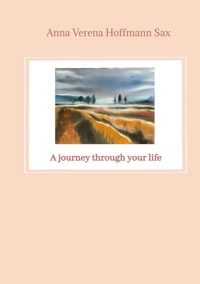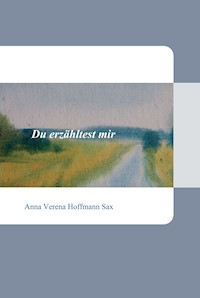
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leichtfüssig und offen erzählt die Autorin Anna Verena Hoffmann Sax Geschichten aus dem Leben des Protagonisten Laurent. Seine Kindheit verbrachte er im familiären Umfeld im Zürcher Industriequartier in der Schweiz. Der gesellschaftliche Wandel in den 70er Jahren und der wirtschaftliche Aufschwung formten seine Lebensgeschichte. Worte werden zu lebendigen Bildern und lassen in ein Leben blicken, das erzählt werden will - ein ganz besonderes Lesevergnügen, von der ersten bis zur letzten Zeile.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Anna Verena Hoffmann Sax
Du erzähltest mir
© 2021 Anna Verena Hoffmann Sax
Umschlagillustration: Aquarell der Autorin
Lektorin: Sonja Thränert
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-30935-7
Hardcover:
978-3-347-30936-4
e-Book:
978-3-347-30937-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Teil 1
Eine lange Winternacht. Anfangs fiel noch Regen. Gegen Morgen ging er in Schnee über. Er bedeckte die Gärten, verwandelte sie in diesen winterlichen Zauber, der die Stille mit sich bringt. In den frühen Morgenstunden wird Laurent geboren. Alles normal, Gewicht, Grösse, seine Haut sanft, seine ersten Schreie willkommen. Willkommen in der Welt von Mutter und Vater. Eine kleine Familie beginnt zu leben und sich auf das Neue einzurichten. Auf Laurent. Seine Mutter ist gutaussehend, hochgewachsen, und auch nach einigen sonnenarmen Winterwochen sieht man, dass die Haut an viel Sonne gewöhnt ist. Ihre Haare sind modisch geschnitten, nach dem Wochenbett wahrscheinlich hochgesteckt, wie es die Mode verlangt und für ihren Beruf von Vorteil ist.
Hedi führt zusammen mit ihrem Bruder Ernst einen Friseursalon im Eckhaus an der Neugasse. Eine gute Lage. Die Kundschaft ist aus dem Quartier. Lebhaft geht es hier zu und her. Viele kleine Läden. Bäckereien, Metzgereien, Handwerksläden, Kleingewerbe versuchen die schwierige Zeit der Kriegsjahre des Zweiten Weltkriegs zu überstehen. Nachbarschaftliche Hilfe ist willkommen, oder dann und wann Besuche von Verwandten vom Lande. Sie bringen Kartoffeln, Salate, Früchte, und wenn Metzgete war, Würste und ein wenig Fleisch. Die Lebensmittelmarken reichen kaum. Man ist froh um jeden Wink, wo Süsses oder etwas Spezielles aufzutreiben wäre.
Hedi und Theodor melden sich im Winter 1940 beim städtischen Gartenbauamt an, für die Bewilligung eines Schrebergartens. Ein kleines Stück Land ist zu bebauen. Hedi versucht es im Frühling. Neben der Arbeit im Friseursalon schiebt sie so oft sie kann den Kinderwagen den Hügel hoch, pflanzt und jätet. Das Giessen wäre wichtig. Viel Zeit bleibt nicht und das Gärtnern ist nicht Hedis Stärke. Karotten und Zwiebeln gedeihen einigermassen. Die Kartoffeln haben jedoch den Käfer, sie sollten abgelesen werden.
Theodor ist im Aktivdienst. Europa brennt. Die Schweiz in Alarmstellung. Der Krieg tobt. Deutsche Siegesmeldungen und Kriegslügen verunsichern. Viele Schweizer sind in ihrer Meinungsbildung gespalten. Die Zweifel sind gross. Kann der Widerstand aufgebaut und gehalten werden, mental und materiell. Theodor ist vor dem Krieg Schweizer geworden. Er hat sich eingekauft und die Rekrutenschule bei den Motorfahrern absolviert. Motoren, Fahrzeuge, und im Speziellen liegen ihm Motorräder. Während des Aktivdienstes kommt er wie alle anderen Soldaten regelmässig nach Hause. Die Freude über das Gedeihen von Laurent ist gross. Hedi und Theodor sind glücklich. Die Welt ist im Krieg, aber das kleine Glück ist da, wo man es festhält. Die Gegenwart.
Hedi und Theodor erwägen einen Umzug, obwohl ihre Wohnung an der Röschibachstrasse gross genug ist. Die Vermietung ist eine bündnerische Stiftung. Der Verwalter räumt Vorteile ein, er mag Hedi. Ihre frische Art und ihre gepflegte Erscheinung haben es ihm angetan. Und doch die Entscheidung ist gefallen. Sie kündigen die Wohnung und mieten eine Bleibe ganz in der Nähe von Hedis Mutter, wo sich auch der Friseursalon befindet. Nun wird die Grossmutter Laurent hüten, während Hedi im Damensalon arbeitet. Die Wohnung ist geeignet und gut, alles in nächster Nähe, auch Fluss und Bäume.
Hedi mag den Schrebergarten nicht. Der Daumen wird einfach nicht grün. Theodor findet kaum Zeit zum Helfen und Hedi zieht es vor, mehr im Salon zu arbeiten. Diese Arbeit liegt ihr. Sie ist begabt und hat das Gefühl für Menschen. Junge Frauen lassen sich gern frisieren und sind offen und redselig.
Auch die junge Frau, die erzählt, dass sie an diesem Morgen bereits zum zweiten Mal beim Friseur sei. Das erste Mal habe sie als Unkundige in der Stadt einen Friseursalon ganz in der Nähe des Elternhauses ihres Bräutigams aufgesucht. Die Friseurin empfing sie und rief gleich ihrem Mann zu: "Mach heisses Wasser, wir haben eine Kundin." Das war der Augenblick, der nichts Gutes verhiess, sie hatte wohl den falschen Salon gewählt. Das Resultat nach zweistündiger Prozedur war schrecklich. Das Haar klebte, die Aufsteckfrisur lotterte und so entschied sie, einen zweiten Versuch zu machen – nun bei Hedi. Eine langjährige Kundentreue nimmt so den Anfang.
Der Friseursalon läuft gut. Hedis Bruder Ernst betreut den Herrensalon und Hedi den Damenteil. Beide Salons haben gute Kundschaft, auch während der Zeit des Krieges. Hedi kann arbeiten und Laurent wird grösstenteils ihrer Mutter überlassen. Laurent ist glücklich dort. Seine Grossmutter ist eine warmherzige Frau und hat den quirligen Bub lieb, aber auch im Griff. Der Grossvater ist gut zu ihm, obwohl seine Scherze für einen kleinen Jungen nicht immer geeignet sind.
Während des Krieges sind in jedem Haushalt Gasmasken vorhanden. Zum Scherz zieht der Grossvater eine solche über und versteckt sich hinter einer Türe. Laurent erschrickt und schreit. Er erkennt seinen Grossvater nicht dahinter. Ein ungutes Erlebnis, das nicht vergessen wird, wahrscheinlich beidseits. Der Grossvater umarmt Laurent. Putzt ihm die Tränen ab. Laurent schnäuzt ins Taschentuch. Noch ein, zwei stockende Atemzüge, dann beruhigt er sich. Diese Erinnerung ist eingebrannt, sie bleibt. Der Grossvater verspricht nun etwas Gutes zu kochen, geht in die Küche, hantiert mit den Pfannen, macht Teig für Omeletten, kehrt diese gekonnt mit Schwung inmitten der Küche. Die Omeletten werden mit viel Zucker bestreut und eingerollt. Laurent sieht dem Grossvater vergnügt zu, wenn er akrobatisch mit den Küchengeräten umgeht, sich dreht, im Rhythmus in der Küche tanzt und zugleich kocht.
☆☆☆
Grossvater Gottlieb ist gelernter Koch. Er arbeitete als junger Mann in Bern in einem bekannten Hotel und kochte für illustre Gäste aus der Politik. Es war ein grosses, nobles Haus mit Bildern und polierten Möbeln. Er erinnert sich, dass in der Empfangshalle ein grossformatiges Bild hing. Oft schaute er es sich im Vorbeigehen an und blieb manchmal stehen. Ein Bergsee, umsäumt von Tannen. Im Hintergrund liegt mächtig ein Berg mit steilabfallenden Felswänden. Der See wirkt bedrohlich. Die Tannen im Vordergrund sind abgeknickt, Strünke mit Moos bewachsen. Der Himmel grau, nur ein Lichtstrahl fällt auf die Felswand in der Ferne. Das Bild berührte und beeindruckte ihn, die gemalte Szene widerspiegelt Verlorenheit, Einsamkeit. Gottlieb verbrachte nur ein paar wenige Jahre in Bern. Freunde hatte er keine.
Im Zug von Bern nach Zürich lernte er Rosette kennen, eine hübsche, kluge Frau. Sie redete über ihre Kindheit und schilderte ihm, wie das Leben war auf dem Bauernhof in der Ostschweiz, wo sie mit 12 Geschwistern aufwuchs. Sie erzählte, dass sie in ihren frühen Jugendjahren einen Mann kennenlernte, den sie liebte. Aber er war gebunden, eine Trennung kam nicht in Frage. Und das Kind, der Bub kam zur Welt. Gottlieb hörte zu, betrachtete diese junge Frau. Sein Herz hörte mit und die Liebe fiel auf beide. Bald einigten sie sich für ein gemeinsames Leben und heirateten.
Rosette zog mit ihrem Bub weg vom elterlichen Bauernhof in die Stadt. In Zürich wohnte sie zusammen mit Gottlieb und dem Bub Fritz in einer kleinen Wohnung im Niederdorf, in der obersten Wohnung eines älteren Hauses an der Zähringerstrasse. Fritz, der Bub, war nicht lange allein. In wenigen Jahren wuchs die Familie. Kurz nacheinander kamen Paul, Ernst und dann das Mädchen Hedi zur Welt. Sie belebten die kleine Wohnung, es wurde eng. Die Familie zügelte auf die andere Seite der Stadt, nach Wiedikon. Dort fanden sie ein neues Zuhause. Einige Jahre lebten sie dort, die Kinder gingen im Ämtlerschulhaus zur Schule. Gottlieb arbeitete als Koch in einem Hotel. Er verdiente nicht viel. Es war die Zeit vor dem ersten Weltkrieg, und um besser leben zu können, musste er sich etwas einfallen lassen.
Er erwog einen Stellenwechsel. Nach Suchen und Umdenken nahm er die Stelle als Verwalter des Stadtgefängnisses in Winterthur an. Die Familie zügelte nun weg von Zürich, in eine Beamtenwohnung in der Nähe des Gefängnisareals.
Gottlieb arbeitete sich in seinem neuen Job ein. Langsam begriff er, dass das Leben als Gefängnisverwalter zwar viel Administratives beinhaltet, jedoch die Schicksale der Sträflinge oft im Vordergrund sind. Kleinkriminelle rutschen häufig wegen des Alkohols in die Tiefe und verheddern sich im Gestrüpp der Gesetze. Das eine zieht das andere mit sich. Ein Insasse bat Gottlieb um die Bewilligung, dass ihn seine Tulpe, wie er seine Frau nannte, öfter besuchen dürfe. Sie bringe ihm wichtige Informationen, wie es im Geschäft laufe, das sie während seiner Abwesenheit leiten müsse. Und ob er seine Kinder, vor allem Kätterli, mehr sehen dürfe, sie bringe ihm Süssigkeiten und kleine Bastelarbeiten. Gottlieb war mit vielen Schicksalen konfrontiert. Ein Sträfling fiel ihm besonders auf. Auf jedes Blatt, das ihm in die Hände kam, machte er Zeichnungen. Nun begann er auf die Wände zu kritzeln. Kleine Szenen, die sein Leben in ihm drinnen beschrieben oder Szenen, die die Realität festhielten. Ein guter Zeichner. Die Skizzen sollten aufbewahrt werden, aber sie mussten weg, nur wenige blieben. Die Wände wurden übermalt. So war die Vorschrift.
Rosettes und Gottliebs Kinder wurden erwachsen und fanden Lehrstellen. Fritz war geeignet für den kaufmännischen Bereich und Paul lernte Bäcker/Konditor. Für Ernst und Hedi tat sich die Möglichkeit auf, den Friseurberuf zu erlernen. Paul hatte ehrgeizige Ideen, er wollte in La Chauxde-Fonds eine eigene Bäckerei/Konditorei eröffnen. Vater Gottlieb war gerne freigebig und gab ihm Geld für die erste Zeit. Aber offenbar kauften die Welschen ihre Brote lieber beim einheimischen Bäcker als bei einem zugezogenen "Stiegenblätz", wie die Deutschschweizer dort genannt werden. Paul zog weg. Er brach auf zu Neuem und meldete sich in Zürich für die Polizeischule an; er wurde Stadtpolizist und später Polizeivorsteher. Ernst und Hedi hatten gemeinsame Pläne. Sie wollten in Zürich einen Friseursalon eröffnen. Vater Gottlieb öffnete auch diesmal bereitwillig seine Schatulle.
☆☆☆
Laurents Vater Theodor arbeitete nun als Karosseriespengler. Der Krieg dauerte an, die Schweiz erstarrte in der Angst um ihre Existenz. Ein versehentlicher Bombenabwurf erschreckte das Stadtquartier. Der Alarm schrillte durch das Haus. Alle eilten in den Keller und warteten – oder doch nicht alle. Bei Theodor war die Neugier stärker als die Geduld und Bange. Er nahm Laurent auf den Arm und stieg schnell die Treppe hoch. Im Treppenhaus öffnete er ein Fenster. Er sah nichts. Stille und Dunkelheit. Am nächsten Tag vernahm man aus dem Radio, dass eine Bombe im benachbarten Quartier, in Wipkingen, eingeschlagen hatte. Es gab Tote, die Kriegsangst blieb.
Auf dem nahen Flugplatz wurden oft Kriegsflugzeuge von der Schweizer Luftwaffe zur Landung gezwungen. Man hörte von Abstürzen und Notlandungen. War es wieder Neugier oder Sensationslust, auf jeden Fall radelte Theodor eines Tages mit Laurent zum Flugplatz. Als sie sich dem Flugfeld näherten, hörten sie ein dumpfes Brummen. Der Himmel war leer, ruhig, ein paar Wolken. Plötzlich erschien wie aus dem Nichts ein Bomber im Tiefflug und stürzte in wenigen Sekunden ab. Theodor warf Laurent vom Fahrrad auf den Boden. Vom Schrecken erfasst, lagen beide da im Gras und waren Zeugen vom Absturz eines Bombers, der seine Mission nicht erfüllen konnte.
Der Krieg ging weiter. Theodor rückte wieder ein. Es war Winter. Viele Einsätze waren geplant. In einer vereisten Kurve verlor Theodor die Herrschaft über sein Motorrad mit Seitenwagen und stürzte. Das Knie wurde erst nach langen Therapien wieder gut. Die Therapiezeit in Chur war erträglich und oft kurzweilig. Die Patienten wurden Kollegen und bildeten eine Schicksalsgemeinschaft.
☆☆☆
In der Zeit im Bündnerland denkt Theodor oft an seinen fremden Vater und auch an seine Mutter, beide sind deutsche Staatsbürger. Sie lernten sich in den Schweizer Bergen beim Arbeiten in einem Hotel in Davos kennen. Wolfgang, Theodors Vater, befand sich auf Wanderschaft, weil er den elterlichen Bauernhof nicht übernehmen wollte. Die Alternative, Arbeit in einer Fabrik anzunehmen, lag weit weg von seinen Lebensvorstellungen. Freiheit und Abenteuerlust lockten ihn, auf Wanderschaft zu gehen, und so unterzog er sich den Regeln des Wanderburschen.
In der traditionellen Zimmermannstracht machte er sich auf den Weg. Er verliess sein Zuhause und suchte da und dort Arbeit. Auf Bauernhöfen in Dörfern in Deutschland und in der Schweiz nahm er Arbeiten als Schreiner an oder half gelegentlich auch im Heuet oder in der Ernte als Knecht. In einem kleinen Bauerndorf in der Schweiz kam er gerade rechtzeitig zur Obsternte. Birnen, Äpfel, Zwetschgen waren zu pflücken. Teils zum Brennen, teils zum Einmachen, Dörren oder zum täglichen Verzehr. Der Bauer musste zum Aufbessern des Lebensunterhalts in der Aluminiumfabrik in der Giesserei arbeiten. Die Bäuerin, ein Knecht und sechs Kinder übernahmen weitgehend die Arbeiten auf dem Feld und im Stall. Zwei Kühe, zwei Schweine, Hühner, Kaninchen und zwei Schafe reichten beinahe zur Selbstversorgung. Wolfgang konnte bleiben. An den Sonntagnachmittagen spielte der Bauer auf dem Schweizerörgeli. Er lehnte sich mit dem Rücken an den warmen Ofen und bewegte seinen Hintern im Takt zur Musik. Seine Söhne begleiteten ihn auf den Klarinetten.
Die Musik erfüllte Wolfgang mit Lust aufs Tanzen. Der Gedanke, eine Frau im Arm zu halten, sie zu spüren und gespürt zu werden, steigerte seine Lust. Aber die Musik erklang einzig zur Freude der Musikanten und für das spärliche Publikum aus der Nachbarschaft. In dieser Stimmung ging er jeweils zu einem Mädchen ins luzernische Nachbardorf. Den Kaffeeschnaps nahmen sie in der Küche. Sie wusste, dass um diese Zeit niemand mehr im Stall war. Er packte sie schnell und heftig. Unter der Stalltüre ordnete er seine Kleider. Der Abschied war knapp.
Wolfgang blieb den ganzen Winter auf dem Hof. Er fand Arbeit beim Schreiner im Dorf. Jeden Morgen in der Frühe kochte die Bäuerin Hafermus, streute Zimt und Zucker darüber und verteilte Butterflocken auf den Brei. Unter der Stubenlampe, die nur gerade das Licht über den Tisch gab, ass er langsam und gemächlich. Die Enkelin, die schon früh am Morgen der Grossmutter zusehen wollte, sass ihm gegenüber, betrachtete ihn beim Essen und staunte, als er alte Zeitungen zur Wärmedämmung vorne in den Kittel stopfte und dann über den Schnee in den kalten Wintermorgen stapfte.
Als der Frühling kam, nahm Wolfgang seinen Wanderstab und zog weiter. Er hörte in der Gaststube, dass in den Bergen Arbeit zu finden sei. Über den Winter waren viele Engländer und Deutsche in den Hotels und den Höhenkliniken angekommen. Einige Wochen später kam er in Davos an. Er hatte Glück und fand gleich Arbeit in einem Hotel mit angegliederter Klinik. Seine Aufgabe war es, die Gartenanlage zu pflegen, Bäume zu schneiden, Blumenbeete anzulegen und Unkraut zu jäten. Der Bergfrühling war gekommen, er streute blaue und gelbe Blumen ins Gras. Die sanften, milden Winde hoben an und die Sonne wärmte die Erde.
Die Wiese wurde von den Gästen mit Liegestühlen belegt. Viele waren an Tuberkulose erkrankt. Sie kamen aus den grossen Städten aus England und Deutschland. Wolfgang sprach manchmal mit ihnen, so auch in holprigem Englisch mit dem kleinen schmalen Kind. Sein Vater war ein bekannter englischer Schriftsteller und hatte sein krankes Kind herbringen lassen. Die frische Luft, die Berge, das gesunde Klima sollten ihm guttun. Der Kleine schrieb an seinen Vater: When I'm looking through the window, I can see the Matterhorn. Er hoffte sehnlichst, es möge seinen Vater interessieren und er würde ihn doch einmal besuchen. Aber der Vater fürchtete die Ansteckung der Krankheit. Er kam nicht. Das bleiche Kind hustete sich alleine ins Grab.
Wolfgang sah Leute kommen und gehen. Er hatte sich an die Anonymität gewohnt. Kontakt suchte er nicht. Als ihm jedoch die neu angekommene Hausbeamtin einige Aufgaben im Haus übertrug, erwachte seine Aufmerksamkeit. Er beobachtete sie. Sie war tüchtig, hatte den Überblick über ihren grossen Aufgabenbereich. Sie sprach Hochdeutsch. Das spornte Wolfgang an, auf sie zuzugehen. Ihre Gesichtszüge waren gleichmässig, sie war schlank, ihre lebendigen Augen verrieten Klugheit. Nach zwei Anläufen hatte er Erfolg. Sie trafen sich und befragten sich gegenseitig über Herkunft und Alltägliches. Waltraut erzählte, dass ihre Eltern von dem kleinen bayerischen Dorf Niederlamitz ins Württembergische gezogen waren und sich dort niederliessen, und dass sie dann in Baden-Württemberg aufgewachsen sei. Wolfgang verriet wenig über sein Zuhause, er war Deutscher bis in die Wurzel. Er redete über die Politik. Sie sei in ganz Deutschland angeheizt. Man spreche von Überfremdung, vor allem durch die Polen, und dass eine schlagkräftige Armee territoriale Gewinne erzielen könne. Es herrsche Aufbruchsstimmung in Deutschland. Waltraut hörte zu, äusserte sich nicht dazu. Politik und Deutschland waren nicht das, was sie beschäftigte. Sie wollte hier ihre Arbeit gut machen. Waltraut und Wolfgang schliefen miteinander.