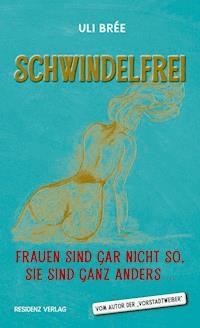Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Fräulein Goldstaubs Gespür für Schmerz Seit Tabata Goldstaub als Mädchen ins Grab ihrer ermordeten Mutter gefallen ist, verfolgen sie dunkle Ohnmachten. Jahre später wird sie Polizistin: eine unkonventionelle Einzelgängerin, die stets an ihre Grenzen geht. Als die junge Frau in eine Mordserie verwickelt wird, steht plötzlich alles auf dem Spiel – auch das Leben ihres ungeborenen Kindes, das ihre einzige Hoffnung ist, endlich wieder etwas zu empfinden. Tabata ahnt nicht, dass ihr der Mörder näher ist, als sie denkt und dass ihre Schicksale auf fatale Weise miteinander verknüpft sind … Ein verstörender und zugleich feinsinniger Roman voll dunkler Geheimnisse, greller Albträume und tiefer Abgründe: überraschend, brutal und poetisch. "Uli Brée ist nicht nur als Drehbuchautor eine Wucht!" Bernhard Aichner, Thriller-Autor "Ein außergewöhnlicher Roman über zwei zerstörte, verlorene Seelen und ihre Erlösungssehnsucht. Nichts für schwache Nerven. Düster und spannend bis zum Schluss." Philipp Hochmair, Schauspieler
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ULI BRÉE
DU WIRSTMICH TÖTEN
ROMAN
Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at
© 2021 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Johanna Uhrmann
Umschlagmotiv: Bild von Alejandro Casanova (alecasanova.com) nach einer Vorlage von Jan Frankl (janfrankl.com) © Uli Brée
Lektorat: Susann Rehlein
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
ISBN 978-3-99050-206-8
eISBN 978-3-903217-79-9
Inhalt
OHNMACHT
GEFÜHLSHÜRDEN
STERNSTUNDENHOTEL
DER STÄRKSTE MANN DER WELT
INS LEBEN STECHEN
ONLY ONE PERSON
FRONTALCORTEX
5461
VERACHTUNG
BÄRENFELL
EISENHERZ
ACAPULCO
FRÄULEIN GOLDSTAUBS GESPÜR FÜR SCHMERZ
BLUTLEER
JOSEFA
LEICHT WIE FRISCH GEFALLENER SCHNEE
RISSE IM VERSTAND
CINNAMON SWIRL FRAPPUCCINO
BLAUE FLECKEN
VATERGLÜCK
NICHT ALLEIN
MAUSOLEUM
LIEBE
FORD CAPRI
MEKKA
EIN KALTES LEBEN
KREATUR
SEELENSPENDER
DIE AKTE GOLDSTAUB
305
PAPIERFLIEGER
FUNKENFLUG
SCHWANENMÄDCHEN
HOCHSEILAKT
SCHÄM DICH
ERINNERUNGSTÄUSCHUNG
PARIS, ZÜRICH, AMSTERDAM
LAISSEZ-FAIRE-BANKROTTEUR
PRIESTERLOCH
ORINOCO
WUNSCHRAUM
SCHWANENSEELE
6148
HERR UND FRAU BATALOVIC
FURNIERTE LÜGEN
HOCHSEILSCHWINDLER
TIEFKÜHLPIZZA
SEELSORGER
DAS FUCHSLUDER UND DER TANZENDE BÄR
WAHRHEITEN
DER DUFT VON AMBRA
DIE ASCHE SEINER MUTTER
PHÖNIX
INS LEBEN STECHEN
DU WIRST MICH TÖTEN
SONNELE GOLDSTAUB
Axel Kopido gewidmet.
Wenn dein Herz aus ängstlichem Zwirn gemacht ist, weht es dich ohnmächtig über die Meere hinweg. Eine Lebensreise lang befindest du dich in Seenot, zu feige, ein SOS auszusenden oder eine Leuchtrakete in den Himmel zu schießen. Es könnte ja jemand deinen inneren Schiffbruch entdecken und der Welt von deinem Scheitern berichten. Also lässt du dein Schicksal geschehen und duckst dich unter dem zufälligen Wind deiner Furcht.
Es sei denn, du wirst zum Sturm, der alles zerstört. Denn den Sturm fragt niemand nach seinen Ängsten.
Uri Goldstaub
OHNMACHT
Just in dem Moment, als Pfarrer Gabriel ein Loblied auf die Verstorbene anstimmen wollte, fiel die zehnjährige Tabata Goldstaub direkt ins offene Grab, mitten auf den glänzenden Sarg ihrer entseelten Mutter. Ungebremst krachte sie mit dem Gesicht auf den Holzdeckel, Blut rann aus ihrer kleinen Nase und versickerte im frisch gefallenen Schnee.
Tabata lag ohnmächtig da, ihre Arme hingen an beiden Seiten des Sargs herunter. Den Trauernden oben am Rand des Grabes bot sich ein seltsames Bild. Es war, als würde Tabata ihre Mutter ein letztes Mal umarmen und sie nicht gehen lassen wollen. Als würde sich die Tochter zu ihrer Mutter ins Totenbett legen, um mit ihr gemeinsam begraben zu werden. Die Leute kannten die Wahrheit nicht. Sie wussten nichts von den Abgründen, die weit tiefer reichten als das Grab, in das sie in diesem Moment ratlos und verlegen starrten. Schließlich stieg Uri Goldstaub zu seiner Tochter hinab in das Erdloch. In seinen Armen war sie leicht wie der frisch gefallene Schnee.
Tabatas Vater war ein Buch, ein mageres Bändchen, dem im Laufe der Zeit die schönen Worte abhandengekommen waren. Je älter er wurde, umso weniger konnte er sich einen Reim auf das machen, was das Leben ihm andichten wollte. Mit seinen verdreckten Schuhen trat Uri achtlos auf den Sarg. Er reichte seine bewusstlose Tochter dem Pfarrer hoch wie ein Opfer. Hilflos und überfordert von so viel körperlicher Nähe, blickte sich der Geistliche verwirrt um, bis schließlich der stämmige Messdiener sein stilles Flehen erhörte und das zarte Nichts entgegennahm. Der junge Mann schob den linken Arm vorsichtig unter ihre Kniekehlen und barg ihren Kopf in seiner Rechten, tastete sanft nach dem Atlaswirbel. Dann legte er Tabata zwischen den Trauerkränzen ab, als wäre sie nur ein weiteres Bukett.
Umgeben von Rosen und Schleifen kam das Mädchen langsam wieder zu sich. Tabata hob den Kopf und bemerkte das Blut auf ihrem Mantel. Sie war umgeben von einer zähen Masse, in der Stimmen und Töne dumpf aus der Ferne zu ihr drangen. Auch der Schrei, den sie beim Anblick des Blutes hervorstieß, klang verzerrt und dumpf. Doch allmählich verlor sich die Zähigkeit. Sie war zurück aus ihrer Ohnmacht.
Als Uri das Blut vom Mund seiner Tochter wischen wollte, bemerkte Tabata die zwei Männer. Sie mussten schon die ganze Zeit dort gestanden haben. Sie legten ihrem Vater Handschellen an. Unter Tränen klammerte Tabata sich an das Sakko ihres Vaters, während die Trauernden nutzlos danebenstanden.
Die Männer zerrten den Vater weg wie einen Sack Kohlen. Das sollte das letzte Mal sein, dass sie weinte.
Seit jenem Tag vor über achtzehn Jahren hatte Tabata diese Momente. Sie konnte unvermittelt in Ohnmacht kippen. Da lag sie dann wie tot. Katatonisch nannte man das im Fachjargon. Sie hatte es nachgelesen. Manchmal nur für ein paar gefühlt leere Sekunden, die anderen Male einen bitteren, scheinbar ewig währenden Traum lang. Die Erinnerung an die steinerne Starre war immer die gleiche: Sie fiel in den offenen Sarg ihrer Mutter. Die Tote hatte die Hände wie zum Gebet gefaltet, das Kruzifix, das sie hielt, war so spitz wie ein Messer. Kaum dass sich das scharfe Kreuz in Tabatas Brust gerammt hatte, füllte sich auch schon das Grab mit Blut. Wie eine erdene Wanne. Sie hatte Angst, darin zu ertrinken, schluckte Blut und schlug panisch um sich. Danach wachte sie jedes Mal auf.
GEFÜHLSHÜRDEN
Achtzehn Jahre später trat das Mädchen von damals hinaus auf die Straße. Sie war immer noch zierlich. Ihre schwarzen, vollen Locken, der kurze Pony, die dunklen, runden Augen, die strahlend weißen Zähne und ihre markante Nase ergaben eine Kreuzung aus Audrey Hepburn und einem gewitzten Rabbi. Sie trug zahlreiche, ganz verschiedene Ringe an allen acht Fingern. Auf den ersten Blick waren sie einfach nur als Schmuck auszumachen, wenn Tabata jedoch die Fäuste ballte, wirkten sie wie zwei Schlagringe. Ihr Vater, Uri Goldstaub, war Jude. Daher stammte ihr Familienname. Auch wenn es längst keine Familie mehr gab. Und auch keinen Glauben.
Von ihrer Mutter hatte sie nur zwei Dinge mitbekommen: den verhassten Vornamen und eine Persönlichkeitsstörung: ihre Gefühlshürden. Jedenfalls nannte sie es so. Gefühlshürden. Vielleicht war sie auch so etwas wie eine Gefühlslegasthenikerin. Aber sie sagte lieber »meine Gefühlshürden« dazu. Sie hatte oft das Gefühl – oder eben kein Gefühl –, dass sie immer erst eine Hürde nehmen musste, um an Gefühle zu gelangen. Sie musste sich ihre Gefühle regelrecht verdienen. Manche Hürden erschienen ihr durchaus überwindbar, andere nicht. In ihren Tagträumen sah sie sich immer wieder hilflos vor einer unfassbar hohen und nie enden wollenden Mauer stehen, hinter der sie Gefühle vermutete. Nachdenklich ging sie durch das nächtliche Wien in Richtung U-Bahn.
Sie bemerkte nicht, dass ihr jemand folgte.
Ob ihre Gefühlshürde, ihre Persönlichkeitsstörung auch genetisch bedingt war wie zum Beispiel bei Menschen mit Downsyndrom der Gefühlsüberschwang? Downies starben aus, hatte sie letztens gelesen, weil praktisch jede Schwangere abtreibt, wenn Trisomie 21 beim Fötus festgestellt wird. Wäre ihnen allen, ihrem Vater, ihrer Mutter und nicht zuletzt ihr selbst, nicht vieles erspart geblieben, wenn ihre Mutter sie damals abgetrieben hätte? Aber wo führte das hin, wenn man alle, die eventuell nicht ganz ins Bild passten, abtreiben würde! Und hatte es so ein Grauen nicht schon mal gegeben? Gedanken, so viele Gedanken. Die herannahende U-Bahn trieb tote Luft vor sich her und umwehte Tabata mit abgestandener Wärme. Ihr war zum Kotzen.
Sie strich sich mit der flachen Hand sanft über den Bauch. Sie war nun im sechsten Monat. Sie stellte sich vor, wie ihr Baby jetzt wohl gerade schwerelos im Fruchtwasser herumschwamm, wie ein kleiner Höhlentaucher in einer Grotte. Sie hatte nicht vor, einen dieser Fruchtwassertests zu machen. Im Gegenteil, vielleicht hatte sie ja Glück und ihr Baby war ein Downie, dann könnte es ihr frostiges Herz mit Wärme füllen. Dann gäbe es endlich jemanden, den sie bedingungslos umarmen und küssen wollen würde. Und umgekehrt genauso. Jemanden, der sie nie verlassen würde. Im Stillen war das ihre Hoffnung. Dass sie durch ihr Baby all das bekam, was sie vermisste, und ihm all das geben würde, was bisher keiner von ihr hatte haben wollen. Sie hatte einiges riskiert für das Baby. Niemand ahnte ihr Geheimnis. Niemand interessierte sich dafür.
Die U-Bahn war voll, und sie fand gerade noch einen freien Platz.
Sie hätte einfach den Mund halten sollen. Sie kannte das Phänomen aus diversen Komödien, in denen irgendein Tollpatsch aus einem Stapel Dosen die unterste herauszog und so alles zum Einstürzen brachte. In diesem Fall war sie selber der Tollpatsch und dieser Tag nichts anderes als ein großer Haufen verbeulter Konserven. Wenn sie doch nur ein einziges Mal den Mund gehalten hätte.
Klar kannte sie das. Wenn sie im Rudel auftreten, dann fühlen sie sich stark. Er war vielleicht sechzehn, höchstens siebzehn. Inländer mit Migrationshintergrund. Er sprach im Comic-Stil.
»Hey Motherfucker, ich mach dich Notaufnahme!«
Sie fand das eigentlich ganz amüsant. Er war ihr fast sympathisch. Sie fand ihn lustig, wie er da stand in seiner viel zu großen Hose, die unter seiner unbehaarten, rosa Baby-Arschritze hing, vielleicht damit jeder lesen konnte, dass seine Unterwäsche von Calvin Klein stammte. Dazu trug er einen viel zu großen weiß-goldenen Sweater mit Kapuze und eine überdimensionale Cap mitsamt fürchterlich großem Schirm, der wie ein mobiles Flachdach einen Schatten über sein ausbaufähiges Hirn warf. Während er sprach, bewegte er sich wie diese vorbestraften Rapper aus der Bronx. Seine Bewegungen waren fließend, die äußeren Finger seiner Hände spreizte er ab, und die inneren klappte er ein, um den Teufel zu grüßen. Wahrscheinlich wusste er gar nicht um die Bedeutung. Er prahlte lauthals, wie er irgendeine »Bitch« »flachgelegt« und ihr es »so richtig von hinten besorgt« hatte. Gleich dreimal.
»Gleich dreimal? Echt? Du siehst gar nicht so aus«, hörte sie sich unvermittelt sagen.
Stille.
Die Typen drehten sich zu ihr um. Hatte die Alte das jetzt wirklich gesagt?
»Ach so, wie seh ich denn aus, Bitch?«
Tabata antwortete durchaus freundlich, frei von jeglichem Zynismus, was die Sache noch viel schlimmer machte.
»Na ja, du siehst so aus, wie du eben aussiehst. Wie ein kleiner, ungeliebter Junge, der auf dicke Hose macht. Aber die Hose ist dir einfach nur viel zu groß. Deshalb rutscht sie dir wahrscheinlich auch immer runter. Und der Haken, an dem sie hängen bleiben könnte, ist wahrscheinlich viel zu klein.«
Dazu machte sie auch noch eine Geste mit ihrem kleinen Finger.
Zu Tabatas Überraschung nahmen er und seine Kollegen ihren netten Kommentar recht ernst. Plötzlich waren der kleine Junge und seine Freunde nicht mehr ganz so entspannt. Auf einmal hatten sie alle Messer und Schlagringe in der Hand.
»Ich hab noch nie ne angebrütete Bitch gefickt. Wird echt Zeit.«
Und schon hielt er die Spitze seines Messers breit grinsend an ihren Bauch.
In dem Moment nahm der Riese neben Tabata Platz. Sie hatte keine Ahnung, wie lange er sie schon beobachtet hatte. In dem Augenblick, in dem er sich neben sie setzte, zogen sich die Typen augenblicklich zurück wie eingeschüchterte Hyänen.
Tabata und der Riese sprachen kein Wort, er griff nur in aller Ruhe nach ihrer Hand. Damit war alles gesagt. Als die U-Bahn am Karlsplatz hielt, stiegen die Kerle aus. Tabata und der Riese blieben noch eine ganze Weile stumm nebeneinandersitzen. Natürlich war er kein echter Riese. Er war nur groß. Aber in diesem Augenblick erschien er ihr wieder riesig und unbesiegbar. Wie schon einmal. Als die U-Bahn in die Kettenbrückengasse einfuhr, drückte sie zum Dank seine Hand. Dann stieg sie aus.
STERNSTUNDENHOTEL
Tabata ging den Naschmarkt entlang. Die Marktstände waren bereits geschlossen. Einzelne Lokale hatten noch geöffnet, Musik, lautes Reden und Gelächter drangen nach draußen. Sie hörte ihre Schuhe auf dem alten Kopfsteinpflaster klacken. Nein, sie hatte keine Angst. Wovor auch. Dann bog sie in die kleine Seitengasse ein. Sie kannte den Weg in- und auswendig. Jede Kante, jede Stufe, jeden Mülleimer, jedes Graffiti und jeden Kellner, der vor der Türe eine Zigarettenpause einlegte. Sie ging diesen Weg jede Woche einmal. Es war ihr Weg. Hunderte Menschen mochten im Laufe des Tages hier entlanggehen, aber keiner von ihnen teilte ihre stille Sehnsucht.
Sie betrat ihr Hotel. Das Beethoven war eines jener aus der Zeit gefallenen Häuser. Stumm und leise war es stehen geblieben, während die Welt sich immer schneller und lauter drehte, hatte sich weggeduckt, sodass es niemandem aufgefallen war. Irgendwann in den Sechzigern des letzten Jahrhunderts hatten seine Besitzer beschlossen, es so zu belassen, wie es war. Niemand hatte sich an ihm vergangen und geglaubt, es den Siebzigern, Achtzigern oder gar den fantasielosen Neunzigern anpassen zu müssen. Tabata mochte, dass alles darin so blieb, wie es war. Sie hatte mit Mode, Zeitgeist und Hipstern nichts am Hut. Sie wollte nur jede Woche einmal ihr Zimmer, in dem sie ihr Glück in der Stille fand und die Welt aussperrte. Sternstunden, die ganz allein ihr gehörten.
Der Portier reichte Tabata stumm den Zimmerschlüssel. Er war ein sympathischer, gescheiterter Student um die dreißig. Einer, der nichts wirklich angefangen und schon gar nichts beendet hatte. Einer, der sein Leben mit Zwischenlösungen füllte und gerade noch jung genug war zu behaupten, das Richtige noch nicht gefunden zu haben. Dabei wusste er in seinem Innersten sehr genau, dass sein Leben aus vorübergehenden Jobs und Partnerschaften bestehen würde. Bis zu seinem Tod. Ja, selbst seine Grabstätte wäre nur vorübergehend. Und das war in Ordnung so. Zumindest für ihn. Aber welche Frau wollte das schon hören? Also behielt er es für sich und schmiedete in romantischen Nächten mit vorübergehenden Liebschaften Pläne für eine Zukunft, die es niemals geben würde. Aber dann wieder war er sich auch nicht sicher, ob die Frauen ihn nicht durchschauten, als würden sie sich untereinander absprechen und ihn aufnehmen wie einen günstigen Überbrückungskredit, bis sich eine nachhaltige, längerfristige Investition finden würde.
Einmal in der Woche kam Tabata her. Von ihrem Sehnsuchtsort, ihrem Hotel der inneren Sternstunden, wusste niemand etwas, nicht einmal der vergängliche Portier.
Für ihn war sie nur die zarte, schöne Frau, die jeden Dienstag zur gleichen Zeit erschien und stumm ihren Schlüssel verlangte. In seinen Augen war sie ein Stammgast ohne Worte. Nicht dass sie ihm gleichgültig war. Er interessierte sich für sie. Durchaus. Aber er wagte es nicht, sie anzusprechen. Sie war so fern, so unglaublich abwesend. Er hätte sie gern umarmt. Nein, das wurde der Wahrheit nicht gerecht. Er hätte sie gern umarmt, geküsst und geliebt. Und das nicht nur vorübergehend.
Aber dazu war er zu unmutig.
Als Tabata den Aufzug rief, sah sie durch das große Fenster im Foyer den Riesen auf dem Gehsteig stehen. Er senkte den Blick wie ein Kind, das man bei etwas Verbotenem ertappt hatte.
DER STÄRKSTE MANN DER WELT
Sein Vater hatte früher die Gänse immer selber geschlachtet. Dabei schlug er ihnen mit einer Eisenstange gezielt auf den Hinterkopf, um sie zu betäuben. Dann stach er der Gans mit einem spitzen Messer durch den Schnabel direkt »ins Leben«, um sie, mit dem Hals über die Tischkante gehängt, ausbluten zu lassen. »Ins Leben stechen«, so nannte es der Vater immer, ohne groß darüber nachzudenken. Torben überwältigte diese Vorstellung: Da also saß das Leben. Hinten im Kopf. Unauffällig griff er sich mit dem Finger an den Hinterkopf, dort wo Nacken und Kopf ineinander übergehen, in der Hoffnung, endlich sein eigenes Leben zu spüren. Zumindest spürte er diese unbändige Erregung im Schritt, die ihn verwirrte und alles andere auslöschte. Dann musste er warten, bis der Vater den Schlachtraum verließ, um das warme, sämige, süße Blut direkt aus der Schüssel zu trinken und sich gleich darauf hinten auf dem Abort von dem inneren Druck lustvoll zu befreien. Das ging ganz schnell. Danach fühlte er sich elend.
Als Junge stand er oft hinter dem großen, rotbärtigen Vater und betrachtete das routinierte Schlachten. Er hätte auch gerne das gespürt, was die Gänse spürten, wenn ihr warmes Leben in die Schüssel rann. Einmal hatte er seinen ganzen Mut zusammengenommen und den Vater gefragt, ob das bei den Menschen auch so sei. Ob bei den Menschen das Leben hinten im Kopf zu Hause wäre? Sein Vater lachte lauthals und presste ihm die Spitze des Schlachtermessers an die Brust.
»Dein Leben sitzt hier, wollen wir wetten?«
Dann drückte Taddäus Batalovic mit dem Daumen sachte aufs Heft des Messers, während er dem Sohn kalt in die Augen sah. Torben spürte durch sein Hemd den Stich in der Haut und das warme Blut, das an seiner Brust hinunterrann. Ihm gefiel das. Irritiert ließ der Vater von ihm ab, als er Torbens merkwürdigen Blick wahrnahm. Das Kind war ihm oft nicht geheuer. Dass er Angst vor der Eigentümlichkeit des Jungen hatte, machte ihn wütend und brutal.
Torben wuchs zu einem stämmigen, großen Mann mit groben Zügen und feiger Seele heran, wie sein Vater einer war. Seine Wangenknochen standen vor, sein Brustkorb war mächtig, seine Schultern breit – er schien es mit der ganzen Welt aufnehmen zu können. Seine blasse Haut, die Sommersprossen und sein rotes Haar gaben ihm etwas sympathisch Koboldhaftes. Wäre er vor hundert Jahren ins Leben gefallen, dann wäre er wohl auf den Jahrmärkten als »der stärkste Mann der Welt« aufgetreten. Sein Lächeln machte ihn liebenswert und leicht. Er schien ein sympathischer Bär zu sein. Niemand, wirklich niemand, ahnte von seinem inneren Schaudern. Das unterschied ihn von seinem Vater. Dieser schmiss laut polternd mit seiner Wut um sich, während Torben die Welt heimlich bluten ließ.
Torben lernte, sich trotz seiner Erscheinung unsichtbar zu machen. Die Menschen, insbesondere die Frauen, liebten ihn für seine einfühlsame und ruhige Art. Etwas, womit er nicht gerechnet hatte. Diese dummen Gänse, dachte er bei sich. Diese einfältigen dummen Gänse. Schließlich wurde er geheiratet. Er war an eine sanfte, liebevolle Frau geraten, die nur einen Makel hatte: Ihre Liebe machte ihm Angst. Liebe war ihm fremd. Aber er lernte, sich zu verstellen und so zu tun, als wäre er wie sie, als wäre er einer von denen, die ihr pochendes Herz auf dem rechten Fleck trugen.
Manchmal stellte er sich vor, was wohl passieren würde, wenn er sich mit dem Messer in sein eigenes Leben stechen würde, wie einst sein Vater bei den Gänsen. Dann sah er, wie sein Leben wie ein dunkelroter, großer Blutschwall mit voller Wucht aus ihm herausspritzte. Es würde aus ihm herausplatzen, sich über den Boden ergießen und alles rot färben. Und er würde sich endlich spüren, er würde endlich leben. Endlich!
Heute war er ihr gefolgt. Er wusste, dass er das nicht hätte tun sollen, nicht hätte tun dürfen. Aber dann war sie in diese Situation geraten. Ein paar Idioten hatten sie belästigt. Er hatte dagesessen und zugesehen. Er dachte sich, wenn ich jetzt nach vorne zu ihr gehe und sie beschütze und diese Typen einfach zusammenschlage, wer weiß, vielleicht muss ich dann alles, was ich schon getan habe, in Zukunft nicht mehr tun.
Er setzte sich zu ihr und ergriff ihre Hand. Er fühlte ihren Pulsschlag und versuchte, seinen dem ihren anzupassen. Sie beide lächelten die Kerle einfach nur an. Er spürte deren Furcht. Da war es wieder. Das gute, selig machende Gefühl.
Die U-Bahn fuhr in die Station ein, und die Typen stiegen aus. Erst jetzt ließ sie seine Hand los. Sie sprachen kein Wort, und doch sprachen sie die gleiche Sprache. Das musste sie doch spüren.
Manchmal fürchtete er sich vor sich selbst. Er hatte Angst, dass er seine in sich hineingestopfte Wut irgendwann nicht mehr würde halten können. Dass alles noch viel schlimmer werden würde als sowieso schon. Wie diese winzig kleinen Beutel, in die man ganze Daunen-Schlafsäcke stopfte. Ihm schien, als würde er in seligen Nächten in seine Wut gehüllt schlafen, um sie dann am nächsten Morgen mit aller Gewalt in einen kleinen Beutel zu stopfen, damit niemand sie entdecken würde. Er fürchtete, dass diese Wut noch weit größer wäre als die Angst und die Sehnsucht, der Neid und die Lust, die ihn schon jetzt wie falsche Freunde begleiteten und ihn antrieben. Er wusste: Irgendwann würde der kleine Beutel aufplatzen und sich die blutrote Wut über alles ergießen.
INS LEBEN STECHEN
Tabata öffnete die Zimmertüre und betrat den Raum, ihre Ohnmacht, wie sie es für sich nannte. Ihr stilles Versteck. Ein paar Quadratmeter, wo die Welt keine Macht über sie hatte.
Vielleicht stand der Riese ja immer noch unten auf der Straße. Vielleicht blickte er herauf. Vielleicht hatte er nur gewartet, in welchem Zimmer das Licht anging, um herauszufinden, wo sie ihren Frieden suchte. Sie wagte es nicht, ans Fenster zu treten. Wenn sie sich vorsichtig hinter der Gardine postieren würde, ohne sie zu berühren, dann könnte sie vielleicht einen Blick hinunterwerfen. Ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Erleichtert stellte sie fest, dass er verschwunden war.
Im selben Augenblick klopfte es sanft an die Tür. Kaum hörbar. Und doch klopfte es an ihr Herz, an ihr Reich, an ihr Geheimnis, ihr Refugium, ihre Insel, ihre Seltenheit, ihr glückliches Ich.
Tabata ging leise zur Tür und lehnte ihre Stirn daran. Sie spürte, wie der Riese es ihr auf der anderen Seite gleichtat. Sanft strich er mit der Hand über die Tür. Es war ihr, als streichelte sie ihn, als streichelte er sie, während sie sich an seine Schulter lehnte und sich geborgen fühlte.
Sie wusste nicht, warum sie es tat. Sie ließ ihn herein. Es war gegen ihre Natur. Es schien ihr, als öffnete sie ihr Herz und nicht einfach nur eine Türe.
Behutsam trat er ein und schloss die Türe hinter sich. Tabata lehnte sich wortlos an ihn. Dabei legte sie ihre Hand sanft auf seine Brust. Später lagen sie wie ohnmächtig auf dem Bett. Er hatte seinen mächtigen Arm um sie gelegt. Irgendwann schlief sie ein.
Torben strich mit seiner Fingerspitze über ihren gewölbten Bauch und war für einen Augenblick wie elektrisiert. Behutsam fuhr er über ihre Brust den Hals entlang, den Nacken hinauf bis zum Hinterkopf, hielt kurz inne, drückte sanft seinen Zeigefinger in die kleine Mulde und fragte sich, ob wohl dort ihr Leben zu Hause sei.
ONLY ONE PERSON
Sie fiel in den offenen Sarg, direkt auf das messerscharfe Kruzifix. Es bohrte sich in ihr Herz und innerhalb weniger Sekunden füllte sich alles mit Blut. Tabata drohte darin zu ertrinken und schlug verzweifelt um sich. Genau in dem Moment riss das Klingeln sie aus ihrem Traum. Völlig verschreckt und nass geschwitzt blickte sie sich um. Um sie herum war es finster. Sie konnte nichts sehen. Wo war sie? Ach ja, in ihrem Sternstundenhotel.
Draußen war es noch dunkel, auch im Zimmer brannte kein Licht. Sie musste eingeschlafen sein. Keine Ahnung, wie spät es war. Das Telefon klingelte unablässig auf sie ein. Sie drehte sich hastig zur Seite, sie war allein, es war niemand da. Er war weg. Der Riese war gegangen. Oder hatte sie sich das alles nur eingebildet? Vielleicht hatte sie ihn sich nur herbeigesehnt. Die Nähe, die geteilte Hilflosigkeit, die gemeinsame Angst, die umarmte Stille.
Schließlich nahm sie den Anruf entgegen.
»Wo bist du verdammt?«, schrie es aus der Leitung. »Weißt du, wie lange ich schon versuche, dich zu erreichen? Beweg deinen Arsch hierher. Jetzt! Ich schick dir die Wegbeschreibung. Ist ein bisschen kompliziert.«
Und schon hatte er aufgelegt. So war er. Aufbrausend. Schnell wütend. Eigentlich ein Arsch. Aber dann auch wieder nicht. Für ihn war sie ein vertracktes Rätsel, und er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, es zu lösen. Auf dem Handy erschien Sekunden später die Nachricht.
Tabata stand im Finstern auf und tastete sich zum Bad vor. Dort schaltete sie das Licht ein und sah in den Spiegel. Es war wie ein Schlag ins Gesicht, so als wäre sie noch einmal, wie damals, schutzlos kopfüber auf den Sarg geprallt. Sie war voller Blut. Ihre Bluse, ihre Brust, ihr Hals, alles war voller Blut. Alles.
Das bildete sie sich nur ein, der Traum war noch nicht vorbei, sie war noch gar nicht wach. Sie schrie. Sie wusste, dass das half. Sie schrie immer weiter und weiter, bis ihre Kehle brannte. Nach dem Schreien wachte sie immer auf. Sie schrie markerschütternd laut, aber sie wachte nicht auf. Das war ein Traum, das musste ein Traum sein. Da, es klopfte an der Türe. Auch das konnte nur ein Teil des Traums sein. Aber warum, warum verdammt noch mal, wachte sie diesmal nicht auf? Von außen hörte sie den farblosen Portier rufen.
»Alles in Ordnung?«
Sie hörte sich antworten. »Ja, ja, alles in Ordnung, ich habe mir nur wehgetan.«
»Brauchen Sie Hilfe?«
»Nein, nein, alles bestens. Ich bin nur erschrocken.«
»Sind Sie sicher?«
»Wer ist das schon?«
Beide schwiegen nach dieser Frage, die eigentlich eine Antwort war. Sie wagten nicht, sich zu bewegen.
Er dachte sich, dass er jetzt gern zu ihr ins Zimmer gehen und sie umarmen und ihr den Schrecken nehmen wollte. Er hätte einfach reingehen können, er hatte einen Universalschlüssel. Aber er tat es dann doch nicht und antwortete in betont oberflächlichem Singsang »Ja, wer ist das schon …« und musste dabei zwangsläufig an seine Mutter denken, die ihn als Kind immer mit schiefem Kopf beim Spielen beobachtet hatte und sich nicht wirklich sicher gewesen war, was sie von ihrem seltsamen Sohn halten sollte. Oder seine Mathe-Schularbeiten, bei denen er sich nie sicher war, was die richtige Lösung war. Oder seine erste Liebe, die gar keine war. Die ihn nur wollte, weil die Guten schon vergeben waren. Oder die Sneakers, die er letztens gekauft hatte, bei denen er sich nicht wirklich sicher war, ob sie passten oder nicht. Seine Größe war aus, aber sie gefielen ihm.
Als er aus seinen Gedanken wieder auftauchte, schob er noch ein desillusioniertes »Wenn Sie was brauchen, einfach die Null-Eins wählen« hinterher und machte sich auf den Rückweg ins Parterre. Tränen schossen ihm ein, und er wusste nicht, warum. Vielleicht weil er sie um dieses Schreien beneidete.
Tabata starrte auf ihr Spiegelbild. Woher kam das ganze Blut? Sie hob den Saum der Bluse an und schnüffelte daran. Sie drehte sich vor dem Spiegel. Sie war nirgendwo verletzt. Sie hatte sich weder geschnitten, noch hatte sie Nasenbluten. Und den Riesen, den Riesen hatte sie sich bestimmt nur herbeigeträumt, herbeigesehnt oder eingebildet. Sie hätte ihn doch nie in ihr Innerstes eingelassen.
Hastig zog sie die Bluse aus und stopfte sie in ihre Handtasche. Sie wusch sich das Gesicht und zog einfach die Jacke über ihren nackten Oberkörper. Als sie das Zimmer verlassen wollte, bemerkte sie das Blut auf dem Betttuch. Sie zögerte, überlegte kurz, dann ging sie hinaus.
Sie nahm den winzigen Fahrstuhl. Seit einer gefühlten Ewigkeit hing dort ein vergilbter, nachlässig mit Klebeband befestigter Zettel, auf den jemand mit Kugelschreiber »Only one Person« gekritzelt hatte. Sie legte die flache Hand auf ihren Bauch.
Am liebsten wäre sie wortlos an dem vermaledeiten Portier vorbeigegangen und hätte den Schlüssel einfach nur auf die Theke geworfen, aber dann hielt sie inne und fixierte ihn. Verlegen versuchte er, ihrem Blick auszuweichen.
»Ich hatte Nasenbluten. Tut mir leid, die Bettdecke hat was abbekommen.«
»Kein Problem«, stotterte er und versuchte sich in einem Scherz. »Sie können sich gar nicht vorstellen, was die Leute sonst so alles auf der Bettwäsche hinterlassen.«
»Doch, kann ich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wahrscheinlich sogar besser als Sie. Aber das ist jetzt nicht das Thema.«
»Okay!«, antwortete er kurz und knapp. Einen klitzekleinen Moment lang war ihr danach, über seine liebenswerte Unsicherheit zu lachen.
»Wie spät ist es?«
Er wagte einen vorsichtigen Blick zur Wanduhr. Tabatas Blick folgte seinem. Die Uhr, die noch aus den Sechzigern stammte, zeigte sieben nach vier Uhr morgens an. Ihr Blick glitt durch das große Fenster nach draußen, auf den dunklen Gehsteig.
»Gestern Abend …«
»Ja?«
»Ist mir da jemand gefolgt? Nach oben? Mit dem Lift?«
Verunsichert blickte er sie an.
»Ein Riese.«
»Ein Riese?« Er musste sich das Lachen verkneifen.
»Ein großer, stämmiger Mann.«
»Nein. Nein, das wäre mir aufgefallen.«
»Sicher?«
»Ja, sicher. Ich meine, wem würde das nicht auffallen, wenn hier plötzlich ein Riese reinschneien und sich in unseren winzigen Lift zwängen würde. Ich war die ganze Zeit hier. Ich war nur mal kurz auf der Toilette. Das ist alles.«
»Masturbieren?«
»Was? Wie kommen Sie drauf?« Er wurde rot im Gesicht.
»Ich sehe es Ihnen an.«
»Blödsinn.«
»Ich miete das Zimmer durch. Bis nächsten Dienstag. Ich will, dass Sie nichts verändern, keine neue Bettwäsche, kein Saubermachen, kein Betreten, kein Garnichts!«
»Ähm …«
»Ist das klar?«
»Klar.«
»Niemand betritt das Zimmer. Auch Sie nicht.«
»Geht klar.«
Sie fixierte den armen Kerl erneut. Tabata nahm in aller Ruhe den Schlüssel mitsamt dem großen Anhänger und steckte ihn in ihre Handtasche. Er beobachtete sie dabei. Als sie die Tasche öffnete, bemerkte er die blutdurchtränkte Bluse. Sie wechselten Blicke. Er stellte sich vor, dass sie unter der Jacke nackt war. Keiner von beiden sprach ein Wort. Tabata machte unvermittelt einen Schritt auf ihn zu, küsste ihn auf den Mund und griff ihm dabei in den Schritt. »Wusste ich’s doch!«, hauchte sie leise. Eine Sekunde später war sie zur Türe hinaus und er vorübergehend sprachlos.
FRONTALCORTEX
Sie wusste sofort, dass er es war. Vielleicht wegen der übergroßen Hose, die ihm endlich nicht mehr runterrutschen konnte. Kein Wunder, er hing ja auch kopfüber mit dem rechten Fuß an einem Haken. Komisch, dachte sie, dass man in so einem tragischen Moment so einen Blödsinn denken kann. Aber vielleicht hilft das, die tragischen Momente besser zu ertragen. Sie liebte diese extremen Situationen. Sie liebte es, auf Beerdigungen zu gehen oder sich einfach so in die Notaufnahme im Krankenhaus zu setzen, um darauf zu warten, dass ein Schwerverletzter eingeliefert wurde. Nein, nicht um sich am Schmerz des anderen zu weiden, im Gegenteil, um etwas zu empfinden, um mitzuleiden. Und das konnte sie nun einmal am besten in Extremsituationen. Irgendwann hatte sie das für sich entdeckt, nach dem Ende ihrer Mutter. Sie studierte heimlich Todesanzeigen, und bei einem besonders tragischen Fall, zum Beispiel als ein junges Ehepaar die beiden Zwillinge durch plötzlichen Kindstod verlor, schlich sie sich heimlich aus ihrem neuen Zuhause, von ihren Behelfseltern davon und ging zu deren Beerdigung. Dort schummelte sich Tabata unter die Verzweifelten, ergriff irgendeine Hand und fühlte etwas. Das war einfach wunderbar. Sie spürte sich, sie spürte den Schmerz, sie spürte Mitgefühl. Es war, als würden die Trauernden ihr Übermaß an Gefühlen auf sie übertragen, als würden Schmerz und Leid und Trauer zu ihr herüberschwappen, und sie saugte all diese Gefühle auf wie eine Verdurstende.
Sie brauchte die Extreme. Es kam ihr manchmal so vor, als würde sie nur in den Spitzen etwas spüren. In den Fingerspitzen oder in den Haarspitzen. Und beim Sex. Beim Sex spürte sie sich auch. Am meisten, wenn es wehtat. Vielleicht war sie deshalb Polizistin geworden. Weil sie es dort mit viel Schmerz zu tun hatte. Während ihren Kollegen davor graute, den Hinterbliebenen von Mordopfern die tragische Nachricht zu überbringen, war sie dankbar für diese Aufgabe. Das waren die Momente, wo sie jemanden in den Arm nehmen konnte, wo Gefühle sie elektrisierten bis in ihre Finger- und Haarspitzen. Krankenschwester in einem Kinder-Hospiz wäre auch ein Job für sie gewesen, aber die Mordkommission erschien ihr am stimmigsten. Hier gab es alle Arten von Gefühlen, an denen sie teilhaben konnte. Sei es bei den Tätern oder den Angehörigen der Opfer. Wut, Schmerz, Angst, Rache, Verlust, Trauer und Erlösung griffen nach ihr wie Verbündete.
»Was ist mit dir? Wo bist du gewesen?«
Ansgar riss Tabata aus ihren Gedanken. Tabata antwortete nicht, sie starrte einfach nur auf den jungen Kerl aus der U-Bahn, der jetzt in diesem kalten, dunklen Verbindungstunnel kopfüber an einer rostigen Kette von der Decke hing. Sein Kopf baumelte einen Meter über dem Boden. Jemand hatte ihm ein spitzes, langes Messer durch den Mund in den Hals gerammt, um ihn dann langsam ausbluten zu lassen. Auf dem Boden unter ihm lag seine Cap wie eine Schüssel, angefüllt und durchtränkt mit Blut.
»Der Mörder dürfte ihn bewusstlos geschlagen haben.«
Ansgar deutete auf die Wunde am Hinterkopf des Burschen.
»Und dann hat er ihn mit einem Flaschenzug an dem Haken da raufgezogen. Wie beim Schlachten. Wirkt wie ein Ritual, das Ganze.«
Tabata hörte ihm nicht wirklich zu. Wie ein altes Karussell drehte sich alles scheppernd, umgeben von ihrem inneren Nebel. Auf den Karussellpferdchen saßen der kleine räudige Motherfucker und seine Kollegen, der Riese, der so groß war, dass er sich ducken musste, ja, sogar der harmlose Portier saß auf einem der Holzpferde. Sie alle johlten und kreischten ihr zu und streckten die Hände nach ihr aus, wenn sie wieder an ihr vorbeikamen. Ihr wurde schwindelig, der Atem blieb stecken, dann fiel sie um und tauchte in ihre Ohnmacht ab.
»Dein Frontalcortex ist einfach nur ein bisschen langsam. Wie ein alter Commodore 64.« Ansgar klopfte ihr grinsend mit dem Zeigefinger auf die Stirn, »der braucht auch ewig, bis er wieder hochgefahren ist. Und ein Update zahlt sich nicht mehr aus. Was du brauchst, ist eine komplett neue Festplatte zur Regulierung deiner emotionalen Prozesse. Aber bis sie so was hinkriegen, leben wir zwei nicht mehr.«
Einmal, nachdem sie gerade Sex gehabt hatten und verschwitzt in die Kissen gefallen waren, hatte er ihr ins Ohr geflüstert, dass er sie liebte, und die stumme Erwartung drangehängt, dass sie ihm nun das Gleiche sagen sollte. Aber sie konnte nicht. Sie hatte das noch nie zu jemandem gesagt. Sie empfand etwas in der Art für ihren Vater, aber in Bezug auf andere war es nur eine Geschenkverpackung ohne Inhalt. Das wusste er. Genau das reizte ihn. Das wusste sie. Sie wusste aber auch, dass sein »Ich liebe dich« auch nur aus hauchdünnem Geschenkpapier bestand und genauso viel wert war wie die Antwort, die sie ihm schuldig blieb. Sie waren sich bei der Arbeit nähergekommen. Es war gleich bei ihrem ersten gemeinsamen Fall. Sie fuhren schweigend zum Tatort, keiner redete was. Er gefiel ihr schon länger, aber die Chefin hatte sie eindringlich vor ihm gewarnt.
»Schwieriger Typ! Lass die Finger von dem. Den gibt es nur im Doppelpack.«