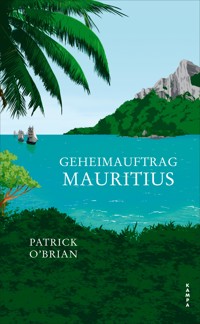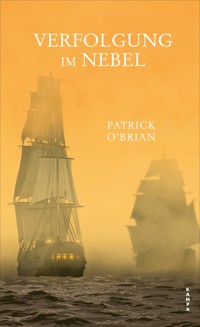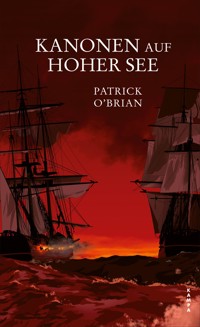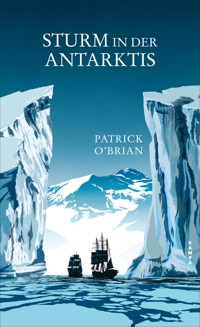Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Abenteuer von Aubrey und Maturin
- Sprache: Deutsch
Jack Aubrey vertritt den Kapitän der Lively beim Blockadedienst im Mittelmeer. Gerade noch hat er mit der Besatzung auf Sophies und seine Verlobung angestoßen, als sich der Wind für ihn dreht: Das Preisgeld für Aubreys jüngste Eroberung an der portugiesischen Küste fällt wesentlich niedriger aus als erwartet, und Jack steckt elftausend Pfund tief in den Schulden. Zwar bekommt sein Schiffsarzt Stephen Maturin ihn vorerst aus dem Gefängnis frei, doch Sophies Mutter besteht darauf, dass die Heirat verschoben wird. Ein unerwarteter Auftrag gibt dem Kapitän neuen Auftrieb: Mit der H. M. S. Surprise soll Aubrey einen britischen Botschafter nach Ostasien befördern. Stephen ist natürlich mit dabei;er hofft, in Indien seine große Liebe Diana wiederzusehen. Ihre Reise führt die beiden Freunde quer über den Atlantik und rund um das Kap der Guten Hoffnung durch den Indischen Ozean, an fremdartige Orte wie Brasilien und die Gewürzinseln und bringt sie mit exotischen Pflanzen, Tieren und Düften in Kontakt. Weit weg von zu Hause erwarten sie Gefahren, die alle ihre bisherigen Abenteuer in den Schatten stellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick O’Brian
Duell vor Sumatra
Das dritte Abenteuer für Aubrey und Maturin
Roman
Aus dem Englischen von Jutta Schumann-Wannemacher
Kampa
1
»Aber ich gebe zu bedenken, Mylord, dass Prisengeld für die Navy von entscheidender Bedeutung ist. Nichts spornt die Findigkeit, die Aktivität und die ständige Aufmerksamkeit jedes einzelnen Seemanns so nachhaltig an wie die Chance – und sei sie noch so klein –, durch einen glanzvollen Handstreich sein Glück zu machen. Ich bin sicher, dass die aktiven Marineoffiziere des Direktoriums«, damit blickte er in die Runde, »mir in diesem Punkt recht geben.« Mehrere der uniformierten Gestalten am Tisch schauten hoch, zustimmendes Gemurmel wurde laut. Allerdings war die Zustimmung nicht allgemein. Einige Zivilisten behielten ihre steife, unverbindliche Miene bei, und zwei oder drei Marineoffiziere wandten den Blick nicht von den Papieren vor ihnen auf dem Tisch. Die kollektive Stimmung der Konferenz ließ sich nur schwer definieren, falls sich überhaupt schon ein allgemeiner Trend herausgebildet hatte. Denn dies war nicht die übliche, auf wenige Teilnehmer beschränkte Sitzung Ihrer Lordschaften der Admiralität, sondern die erste Vollversammlung des neuen Marinedirektoriums, die erste seit Lord Melvilles Ausscheiden, mit mehreren neuen Mitgliedern, vielen Abteilungsleitern und Delegierten anderer Führungsstäbe. Man agierte mit Vorsicht, gab sich politisch reserviert, hielt sein Feuer noch zurück. Obwohl er die Atmosphäre also nur schwer einschätzen konnte, spürte er doch, dass die Teilnehmerrunde nicht ganz hinter ihm stand; andererseits fühlte er auch keine entschlossene Opposition – eher nur Unschlüssigkeit – und hoffte deshalb, sich mit der Kraft seiner eigenen Überzeugung gegen die laue Abneigung des Ersten Seelords durchsetzen und seinen Punkt doch noch machen zu können.
»Ein oder zwei aufsehenerregende Ausschüttungen dieser Art wären in unserem sich so lange hinziehenden Krieg Anreiz genug, die ganze Flotte trotz ihres harten Seedienstes auf Jahre hinaus zu neuem Eifer anzustacheln. Hingegen müsste die Ablehnung zwangsläufig zu einem … zu einer gegenteiligen Wirkung führen.« Sir Joseph war ein tüchtiger und erfahrener Chef des Marinegeheimdienstes; aber er war kein begabter Redner, schon gar nicht vor einem so zahlreichen Publikum. Die goldenen Worte, die zündende Phrase hatte er noch nicht gefunden. So blieb er sich einer gewissen negativen, zögerlichen Stimmung seiner Zuhörer bewusst.
»Ich kann nicht ganz glauben, dass Sir Joseph völlig recht hat, wenn er den Offizieren unserer Marine lediglich Gewinnstreben als Motiv unterstellt«, bemerkte Admiral Harte mit einer devoten Kopfneigung zum Ersten Seelord hin. Die anderen Marineoffiziere sahen ihn kurz an und tauschten dann vielsagende Blicke. Denn Harte war allgemein bekannt als der eifrigste Profiteur an jeder Prise, als der gierigste Prozentjäger bei allem, was sich erbeuten ließ, vom holländischen Heringslogger bis zum kleinen bretonischen Fischkutter.
»Mir sind die Hände durch Präzedenzfälle gebunden«, sagte der Erste Seelord, und sein breites, glattes Pokergesicht wandte sich von Harte wieder Sir Joseph zu. »Da gab es den Fall der Santa Brigida …«
»Der Thetis, Mylord«, flüsterte sein Sekretär.
»Der Thetis, wollte ich sagen. Und nach Ansicht meiner juristischen Berater ist es die einzig richtige Entscheidung. Wir unterliegen der Marinegesetzgebung: Falls eine Prise vor der Kriegserklärung erbeutet wurde, fällt sie an die Krone. Die Krone hat einen Rechtsanspruch darauf.«
»Der Buchstabe des Gesetzes ist das eine, Mylord, das Billigkeitsrecht jedoch das andere. Von Justiz versteht der Seemann nichts, aber es gibt keine andere militärische Gruppe, die so eisern an überkommenen Bräuchen festhält, so energisch auf Billigkeit und Naturrecht pocht. Die Lage, wie ich sie sehe – und wie die Seeleute sie sehen werden –, ist doch die: Ihre Lordschaften verloren in der Kenntnis, dass Spanien in den Krieg eintreten, sich Bonaparte anschließen würde, keine Zeit und packten die Gelegenheit beim Schopf. Für eine einigermaßen effektive Kriegsführung benötigte Spanien das vom Río Plata verschiffte Gold; deshalb befahlen Ihre Lordschaften, die Schatzschiffe abzufangen. Entscheidend dabei war sofortiges Handeln, doch der Zustand unserer Kanalflotte war so … Kurzum, wir konnten lediglich ein Geschwader abstellen, das aus den Fregatten Indefatigable, Medusa, Amphion und Lively bestand. Es hatte Order, die überlegene spanische Streitmacht abzufangen und nach Plymouth einzubringen. Durch beispielhafte Tapferkeit und – wie ich hinzufügen darf – dank eines außergewöhnlichen Geheimdiensterfolges, an dem das Verdienst allein den Agenten zukommt, nicht mir, erreichte unser Geschwader noch rechtzeitig das Kap Santa Maria, griff die spanischen Schiffe an, versenkte eines davon und eroberte die anderen in einem tapferen Gefecht, das nicht ohne beklagenswerte Verluste unsererseits abging. Sie führten ihre Befehle aus; sie schlugen dem Feind die Mittel aus der Hand, wirksam gegen uns Krieg zu führen; und sie brachten fünf Millionen spanische Golddollars nach Hause. Wenn man ihnen jetzt sagt, dass diese Dollars, diese Goldpiaster, entgegen den Gepflogenheiten der Marine gar keine Prisen sind, sondern dem Rechtsanspruch der Krone anheimfallen – dann, ja dann wird dies eine höchst beklagenswerte Auswirkung auf die gesamte Flotte haben.«
»Da das Gefecht jedoch stattfand, bevor die Kriegserklärung erging …«, begann ein Zivilist.
»Und wie war das mit der Belle Poule im Jahr 1778?«, rief Admiral Parr dazwischen.
»Die Kriegserklärung kümmert die Offiziere und Matrosen unseres Geschwaders keinen Deut«, fuhr Sir Joseph fort. »Sie hatten sich nicht in Staatspolitik einzumischen, sondern die Befehle des Direktoriums auszuführen. Der Gegner eröffnete als Erster das Feuer. Da taten sie ihre Pflicht, wie man es von ihnen verlangte, und zwar unter hohen Verlusten für sie und mit großem Gewinn für unser Land. Und falls sie jetzt ihres herkömmlichen Lohns verlustig gehen, das heißt, falls das Direktorium, unter dessen Befehl sie standen, ihnen das Prisengeld verweigert, dann muss dies eine bedauerliche Wirkung auf unsere Offiziere haben, die man bisher in dem Glauben ließ, sie hätten ausgesorgt, hätten ein Vermögen verdient, und die in diesem guten Glauben zweifellos bereits Verbindlichkeiten eingegangen sind. Es wäre … wäre …« Ihm fehlten die Worte.
»Erbärmlich«, sagte ein Konteradmiral der blauen Territorien.
»Jawohl, erbärmlich. Und die allgemeine Wirkung auf die Flotte, die man eines leuchtenden Beispiels dafür beraubt, was mit entschlossener Tapferkeit erreicht werden kann, sie wäre noch viel verhängnisvoller. Die Entscheidung liegt in Ihrem Ermessen, Mylord – die Präzedenzfälle sind widersprüchlich, und in keinem einzigen Fall erging ein gerichtliches Grundsatzurteil –, deshalb plädiere ich mit großem Ernst dafür, den Handlungsspielraum des Direktoriums zugunsten der betroffenen Offiziere und Matrosen zu nutzen. Dies läge im Interesse aller Beteiligten, wäre kein großer Nachteil für das Land, und das anspornende Vorbild würde die Kosten hundertfach aufwiegen.«
»Fünf Millionen Golddollar«, sagte Admiral Erskine sehnsüchtig in das unschlüssige Schweigen hinein. »Waren es wirklich so viele?«
»Wer sind die fraglichen Kommandanten?«, wollte der Erste Seelord wissen.
»Die Kapitäne Sutton, Graham, Collins und Aubrey, Mylord«, antwortete sein Sekretär. »Hier sind ihre Personalakten.«
Während der Erste Seelord die Akten las, trat Stille ein, gestört nur durch das Kratzen von Admiral Erskines Feder, der fünf Millionen Piaster in Pfund Sterling umrechnete, das Ergebnis in die üblichen Prisenanteile zerlegte und Summen herausbekam, die ihm einen verblüfften Pfiff entlockten. Beim Anblick der Personalakten begriff Sir Joseph, dass seine Sache verloren war: Der neue Erste Seelord mochte nichts von der Marine verstehen, aber er war ein alter Parlamentarier, ein ausgefuchster Politiker, und zwei dieser Akten trugen Namen, die auf die gegenwärtige Regierung wie ein rotes Tuch wirken mussten. Durch Sutton und Aubrey kam verhängnisvolle Parteipolitik ins Spiel, und damit würde sich die noch ausbalancierte Waage zu ihrem Nachteil neigen. Die beiden anderen Kommandanten besaßen keine Gönner in der Regierungspartei, hatten weder dienstlichen noch gesellschaftlichen Einfluss im Parlament und konnten das Unheil nicht mehr wenden.
»Sutton kenne ich aus dem Hohen Haus«, sagte der Erste Seelord, spitzte den Mund und kritzelte eine Notiz. »Und Captain Aubrey … Der Name klingt irgendwie vertraut.«
»Der Sohn von General Aubrey, Mylord«, flüsterte sein Sekretär.
»Ach ja, richtig. Der Abgeordnete von Great Clanger, der Mr Addington so wütend angegriffen hat. Ich erinnere mich, dass er in seiner Tirade gegen die Korruption diesen Sohn namentlich erwähnte. Überhaupt spricht er oft von ihm. Ja, ja.« Damit klappte er die Personalakten zu und nahm sich den allgemeinen Bericht vor. »Sagen Sie bitte, Sir Joseph«, fragte er nach einer Weile, »wer ist eigentlich dieser Dr. Maturin?«
»Er ist der Gentleman, über den ich Eurer Lordschaft letzte Woche eine Aktennotiz sandte«, sagte Sir Joseph. »Eine Aktennotiz in gelbem Umschlag«, fügte er mit leichter Betonung hinzu: Zu Lord Melvilles Zeiten wäre ihr Äquivalent ein Wurf mit dem Tintenfass nach des Ersten Seelords Kopf gewesen.
»Ist es denn üblich, Medizinern den Rang eines Vollkapitäns zu verleihen, wenn auch nur auf Zeit?«, erkundigte sich der Erste Seelord, dem Sir Josephs Untertöne völlig entgingen und der die Bedeutung eines gelben Umschlags vergessen hatte. Alle Marineoffiziere blickten alarmiert auf; gespannt wanderten ihre Blicke zwischen den beiden hin und her.
»Bei Sir Joseph Banks und Mr Halley verfuhr man ebenso, Mylord, und auch bei einigen anderen Wissenschaftlern, denke ich. Es ist eine besondere Ehre, aber keinesfalls etwas Außergewöhnliches.«
»Oh«, machte der Erste Seelord, der jetzt an Sir Josephs kaltem, angeödetem Blick merkte, dass er sich eine Blöße gegeben hatte. »Dann hatte er also mit diesem speziellen Fall nichts zu tun?«
»Nicht das Geringste, Mylord. Und falls ich kurz auf Kapitän Aubrey zurückkommen darf, so kann ich behaupten, ohne Widerspruch befürchten zu müssen, dass die Ansichten des Vaters sich mit denen des Sohnes nicht decken. Im Gegenteil.« Dies sagte er nicht in der Hoffnung, die negative Entscheidung noch abwenden zu können, sondern um den Fauxpas des Vorsitzenden zu überspielen und die allgemeine Aufmerksamkeit davon abzulenken. Dabei kam es ihm durchaus gelegen, dass Admiral Harte im Versuch, sich einzuschmeicheln und zugleich einer privaten Gehässigkeit zu frönen, die Frage stellte: »Wäre es zulässig, Sir Joseph zu der Klarstellung aufzufordern, ob er an dieser Angelegenheit ein materielles Interesse hat?«
»Nein, Sir, das wäre es nicht!«, rief Admiral Parr, und sein Portweingesicht lief dunkelrot an. »Es wäre eine höchst ungehörige Einlassung, bei Gott!« Die Stimme versagte ihm, erstickt von einem Hustenanfall und wütendem Grunzen, zwischen dem nur die Worte »impertinente Unterstellung – neues Mitglied – bloß Konteradmiral – Giftzwerg« verständlich waren.
»Falls Admiral Harte andeuten wollte, dass ich auf irgendeine Weise an Kapitän Aubreys persönlichem Wohlergehen interessiert bin«, sagte Sir Joseph mit eisiger Miene, »dann irrt er sich. Ich habe den Herrn nie kennengelernt. Es geht mir allein um das Wohl der Marine.«
Harte war entsetzt über die Reaktion auf seine Bemerkung, die er für sehr raffiniert gehalten hatte, und zog sofort den Kopf ein – einen Kopf mit unsichtbaren Hörnern, die ihm, zusammen mit einem Schock anderer Galane, besagter Kapitän Aubrey aufgesetzt hatte. Sofort erging er sich in Entschuldigungen: Er hatte es nicht so gemeint, hatte nichts unterstellen wollen, was er hatte sagen wollen, war … jedenfalls nichts Ehrenrühriges gegen den hochgeschätzten Gentleman.
Der Erste Seelord schlug, milde angewidert, mit der flachen Hand auf den Tisch. »Jedenfalls«, sagte er, »kann ich mich keineswegs der Meinung anschließen, dass fünf Millionen Dollar eine Kleinigkeit für die Staatskasse sind. Und wie ich bereits ausführte, versichern mir meine Juristen, dass sie unter den Rechtsanspruch der Krone fallen. Auch wenn ich als Privatmann nur zu gerne der in vieler Beziehung stichhaltigen Argumentation Sir Josephs folgen würde, muss ich doch befürchten, dass uns durch Präzedenzfälle die Hände gebunden sind. Es geht hier ums Prinzip. Das sage ich mit tiefstem Bedauern, Sir Joseph, denn ich bin mir bewusst, dass diese Operation, diese glänzend erfolgreiche Operation, unter Ihrer Regie stattfand. Und niemand könnte den Herren unserer Marine mehr Wohlstand und Reichtum wünschen als ich selbst. Aber leider sind wir nicht frei in unserer Entscheidung. Andererseits wollen wir nicht die tröstliche Tatsache vergessen, dass immer noch eine beträchtliche Gratifikation zur Aufteilung übrig bleibt. Sie reicht natürlich nicht an Millionen heran, ist aber immer noch stattlich genug, will ich meinen. Und mit diesem versöhnlichen Gedanken sollten wir nun unsere Aufmerksamkeit …«
Sie wandten ihre Aufmerksamkeit den praktischen Problemen der Zwangswerbung, der Versorgungstender und Wachschiffe zu – alles Themen, die Sir Joseph nicht betrafen, weshalb er sich auf seinem Stuhl zurücklehnte, die verschiedenen Redner beobachtete und dabei ihre Qualitäten abschätzte. Insgesamt ziemlich kläglich, fand er. Der neue Erste Seelord war ein Narr, ein politischer Taktierer, mehr nicht. Sir Joseph hatte unter Chatham, Spencer, St. Vincent und Melville amtiert, und dieser Mann gab neben ihnen eine jämmerliche Figur ab. Auch seine Vorgänger hatten ihre Schwächen gehabt, besonders Chatham, aber keiner hatte so blind den Kern der Sache übersehen: dass in diesem Fall alle Kosten zulasten der Spanier gegangen wären. Es wären die Spanier gewesen, die der Royal Navy das leuchtende Vorbild von vier jüngeren Fregattenkapitänen geschenkt hätten, deren Tapferkeit durch einen goldenen Regen belohnt wurde. Und das Gold wäre im Lande geblieben. Reichtum war unter Marineoffizieren dünn gesät. Wenn Vermögen erworben wurden, dann meist von Admiralen auf einträglichen Posten, die ihren Anteil an unzähligen Prisen einsteckten, für deren Eroberung sie persönlich keinen Finger gerührt hatten. Die Kommandanten der Schiffe, die den Feind bekämpften – das waren die Männer, die man ermutigen musste. Vielleicht hatte er diesen Punkt nicht klar und zwingend genug hervorgehoben. Aber er war nicht in bester Form nach dieser schlaflosen Nacht, in der er sieben Agentenberichte aus Boulogne hatte auswerten müssen. Und dennoch – kein anderer Erster Seelord außer vielleicht St. Vincent hätte es zugelassen, dass bei einer solchen Frage Parteipolitik mit ins Spiel kam. Und ganz gewiss wäre keiner von den vieren mit dem Namen eines Geheimagenten herausgeplatzt.
Sowohl Lord Melville (ein großartiger Marinechef, der den Geheimdienst wirklich verstanden hatte) als auch Sir Joseph schätzten Dr. Maturin ungemein. Er war ihr Berater in puncto Spanien und besonders Katalonien, ein völlig uneigennütziger Geheimagent, mutig, peinlich genau, durch und durch zuverlässig und hervorragend qualifiziert, der niemals auch nur den geringsten Lohn für seine Dienste akzeptiert hatte – und welch hervorragende Dienste! Er war es auch gewesen, der ihnen die nötige Information geliefert hatte, um den vernichtenden Schlag gegen die spanischen Schatzschiffe zu führen. Sir Joseph und Lord Melville hatten ihn zum Kapitän auf Zeit ernannt, um ihn taktvoll mit einem Vermögen aus der spanischen Kriegskasse zu entschädigen. Und jetzt war sein Name öffentlich ausposaunt worden – nicht im relativ diskreten, engen Kreis des Admiralitätsdirektoriums, sondern vor einer bunt gemischten Vollversammlung –, als Anlass einer direkt an den Geheimdienstchef gerichteten Frage. Das war unentschuldbar. Sich auf die Verschwiegenheit dieser Marineoffiziere zu verlassen, deren einziges Rezept gegen einen so raffinierten Feind wie Bonaparte aus vollen Breitseiten bestand, das kam verbrecherischer Dummheit gleich. Ganz zu schweigen von den Zivilisten, den geschwätzigen Politikern, die sich schon für gefährdet hielten, wenn sie auf den Klippen von Dover ein Teleskop ausrichteten und schaudernd Bonapartes Invasionsarmee beäugten, die mit ihren zweihunderttausend Mann auf dem anderen Ufer kampierte. Sir Joseph musterte die Männer rund um den langen Konferenztisch: Sie redeten sich die Köpfe heiß über Zuständigkeitskonflikte zwischen der regulären Zwangswerbung und den Pressgangs unterbemannter Schiffe – die Admiräle brüllten einander mit einer Lautstärke an, die bis Whitehall zu hören sein musste –, und der Erste Seelord schien völlig die Kontrolle über die Sitzung verloren zu haben. Immerhin mochte sein Fauxpas darüber in Vergessenheit geraten, sagte sich Sir Joseph hoffnungsvoll. Aber trotzdem, dachte er, während er die verschiedenen Entwicklungsstufen eines imaginären Admirals auf seinen Notizblock kritzelte – Ei, Raupe, Puppe und schließlich den fertigen Prachtfalter –, wie soll ich vor Maturin hintreten und ihm das erklären? Wie kann ich ihm jetzt noch ins Gesicht sehen?
In Whitehall weinte der Himmel feine graue Tropfen auf die Admiralität herab, aber in Sussex war es trocken – trocken und windstill. Der Rauch aus dem Kamin im kleinen Salon von Mapes Court stieg als kerzengerade Wolkensäule in die Luft, deren Spitze erst in dreißig Meter Höhe als blauer Dunst davontrieb, um sich hinterm Haus in den Senken der Downs niederzulassen. Die Blätter hingen noch an den Bäumen, gerade noch, denn von Zeit zu Zeit fiel langsam eines leuchtend gelb aus dem Geäst vor dem Fenster und senkte sich, um die eigene Achse wirbelnd, sachte auf den goldenen Teppich um die Baumwurzeln. Es war so still, dass man die flüsternde Landung jedes einzelnen Blattes zu hören meinte – so still und friedlich wie ein leichter Tod.
»Beim ersten Windhauch werden diese Bäume völlig kahl sein«, bemerkte Dr. Maturin. »Und doch ist der Herbst nur ein Frühling in Verkleidung. Denn jedes Blatt, das zu Boden fällt, wird von der eigenen keimenden Knospe abgestoßen. Im Süden ist das ganz deutlich zu erkennen. In Katalonien zum Beispiel, wo Sie und Jack mich gleich nach Kriegsende besuchen müssen, lässt der Herbstregen die Grashalme wie eine Armee kleiner Speere sprießen. Und selbst hier in England … Bitte nicht so viel Butter, meine Liebe. Ich bin schon ganz eingefettet.«
Stephen Maturin hatte mit den Ladys von Mapes gespeist – Mrs Williams, Sophia, Cecilia und Frances –, und die Spuren der braunen Windsorsuppe, des Heilbutts, der Taubenpastete und des Vanillepuddings zeigten sich auf seinem Halstuch, seiner tabakbraunen Weste und seiner sandfarbenen Kniehose; er bekleckerte sich stets beim Essen und hatte seine Serviette schon nach dem ersten Gang verloren, trotz aller Bemühungen Sophias, sie zu retten. Nun saß er auf der einen Seite des Kamins und trank Tee, während ihm Sophia auf der anderen kleine Fladen röstete, wobei sie sich konzentriert der rötlichsilbernen Glut zuneigte und die Gabel mit dem Gebäck gewissenhaft wendete, damit nichts verkohlte. Im schwindenden Licht hob der Feuerschein ihren runden Arm und ihr liebliches Gesicht hervor, betonte die hohe Stirn und den wundervollen Schwung der Lippen und schmeichelte ihrer blühenden, makellosen Haut. Die Sorge um den Fladen ließ sie ihre gewohnte Contenance vergessen; wie bei ihrer jüngeren Schwester zeigte sich die rosa Zungenspitze zwischen den Lippen, wenn sie sich konzentrierte, und das verlieh ihr im Verein mit so viel Schönheit etwas Rührendes. Als Stephen sie in aller Muße betrachtete, spürte er, wie sich sein Herz seltsam zusammenzog, und er stellte überrascht ein Gefühl bei sich fest, das er nicht zu benennen wagte. Denn Sophia war verlobt und würde Kapitän Aubrey heiraten, seinen besten Freund. Außerdem war sie seine Patientin. Sie standen einander so nahe, wie ein Mann und eine Frau sich nur nahestehen konnten, ohne ineinander verliebt zu sein, und waren vielleicht sogar enger befreundet als Verliebte.
»Ein leckeres Küchlein, Sophie«, sagte er. »Aber es muss das letzte sein. Und auch Ihnen möchte ich raten, keines mehr zu essen, meine Liebe. Noch vor sechs Monaten waren Sie jämmerlich hager, aber der Brautstand scheint Ihnen gut zu bekommen … Sophie, warum spießen Sie noch einen Fladen auf? Für wen tun Sie das? Wer soll den essen, he?«
»Ich, mein Lieber. Jack sagt, ich muss handfester werden – er liebt Charakterfestigkeit. Er meint, dass Lord Nelson …«
Aus weiter Ferne drang durch die stille, fast frostige Abendluft der Klang eines Jagdhorns auf den Polcary Downs zu ihnen herein. Beide wandten sich dem Fenster zu. »Ob sie wohl ihren Fuchs erlegt haben?«, fragte Stephen. »Wenn Jack da wäre, wüsste er’s, dieser Schlächter.«
»Oh, ich bin heilfroh, dass er nicht auf diesem bösartigen Braunen da draußen ist«, sagte Sophia. »Das Biest wirft ihn doch jedes Mal ab, und ich fürchte immer, dass er sich ein Bein bricht, genau wie der junge Mr Savile. Stephen, würden Sie mir helfen, die Vorhänge zuzuziehen?«
Wie erwachsen sie doch geworden ist, dachte Stephen. Laut fragte er mit einem Blick aus dem Fenster, die Vorhangkordel noch in der Hand: »Wie heißt eigentlich dieser Baum? Der schlanke, exotische mitten auf dem Rasen?«
»Wir nennen ihn den Pagodenbaum. Natürlich ist er kein echt indischer Banyan, wir nennen ihn nur so. Mein Onkel Palmer, der Weltreisende, hat ihn gepflanzt und gesagt, dass er einem Banyan sehr ähnlich sieht.«
Sowie ihr das Wort entschlüpft war, hätte sich Sophia die Zunge abbeißen können. Sie bedauerte es, noch ehe sie den Satz beendet hatte, denn sie wusste, welche Assoziationen jetzt bei Stephen entstehen mussten.
Und sie hatte recht mit ihrem unbehaglichen Verdacht. Für jeden, der auch nur die entfernteste Verbindung zu Indien besaß, musste der Pagodenbaum die Vorstellung dieser Weltgegend heraufbeschwören. »Pagodas« nannte man auch die kleinen indischen Goldmünzen, die seinen Blättern so ähnlich sahen, und »den Pagodenbaum schütteln« war eine Redewendung dafür, in Indien sein Glück zu machen, ein reicher Nabob zu werden. Sowohl Sophia als auch Stephen dachten oft an Indien, weil sich Diana Villiers dort aufhielt, zusammen mit ihrem Geliebten und Gönner Richard Canning. Diana war Sophias Cousine und einst ihre Rivalin um die Gunst von Jack Aubrey gewesen, aber vor allem war sie das Objekt von Stephens verzehrender, unglücklicher Liebe – eine feurige junge Frau von überraschendem Charme und eisernem Willen, die bis zu ihrem skandalösen Verschwinden mit Mr Canning ihrem engsten Kreis angehört hatte. Nun war sie natürlich das schwarze Schaf der Familie, eine gefallene Frau, und ihr Name durfte auf Mapes nie mehr erwähnt werden. Erstaunlich, wie gut man dort trotzdem über ihr Ergehen unterrichtet war und welch breiten Raum sie in aller Gedanken einnahm.
Eine Menge hatten sie aus den Zeitungen erfahren, denn Mr Canning war ein Mann des öffentlichen Lebens, ein reicher Reeder mit Schiffen in der Ostindischen Handelskompanie, ein bekannter Politiker (er und seine Verwandten besaßen drei heruntergekommene Grafschaften und stellten dafür Abgeordnete im Parlament – beauftragte Vertreter, denn als Juden blieb ihnen das passive Wahlrecht versagt), und er war ein Gesellschaftslöwe mit guten Freunden in der Entourage des Thronfolgers. Gerüchte, die Mapes aus der Nachbargrafschaft erreichten, wo Cannings Vettern, die Goldsmids, lebten, hatten das Bild ausgeschmückt. Dennoch reichten die Kenntnisse der Familie Williams bei Weitem nicht an die Informationen heran, die Stephen Maturin besaß, denn trotz seiner weltfremden Erscheinung und seiner ungeheuchelten Leidenschaft für die Naturwissenschaften besaß er breitgestreute Verbindungen, die er mit großem Geschick nutzte. Er kannte den Namen des Ostindienfahrers, mit dem Mrs Villiers gesegelt war, die Nummer ihrer Kabine, die Namen ihrer beiden Kammerzofen, deren Herkunft und Verwandte (eine davon war eine Französin und hatte einen Bruder, der als Soldat gleich zu Beginn des Krieges in Gefangenschaft geraten war und jetzt in Norman Cross einsaß). Er kannte die Zahl der offenen Rechnungen, die Diana hinterlassen hatte, und die Gesamthöhe ihrer Schulden. Ebenso wusste er genau Bescheid über den Sturm, der so heftig in den Familien Canning, Goldsmid und Mocatta getobt hatte (und immer noch tobte), denn Mrs Canning, eine geborene Goldsmid, hielt nichts von Vielweiberei und hatte mit dem Zorn der Gerechten all ihre zahlreichen Verwandten mobilisiert. Dieser Sturm, der nicht abflauen wollte, hatte Canning bewogen, sich im Zuge einer offiziellen Mission nach Indien abzusetzen, die in Zusammenhang stand mit den französischen Besitzungen an der Malabarküste, einer Gegend, die sich zum Pagodassammeln prächtig eignete.
Sophia behielt also recht: Der Name des unseligen Baums hatte tatsächlich all diese Assoziationen in Stephens Hirn ausgelöst – diese und viele andere, weshalb er nun im Schein des Kaminfeuers saß und schwieg. Nicht, dass es viel brauchte, ihn an Diana zu erinnern. Der Gedanke an sie verließ ihn nie lange, er überfiel ihn jeden Morgen, sobald er erwachte und sich fragte, warum er so todtraurig war. Und selbst wenn Diana nicht im Vordergrund seines Bewusstseins stand, war sie unterschwellig doch immer präsent, machte sich bemerkbar durch einen seltsamen Schmerz in der Zwerchfellgegend, einer Stelle, die er mit der Handfläche abdecken konnte.
In einer Geheimschublade seines Schreibtischs, so voll, dass sie sich nur schwer öffnen oder schließen ließ, lagen zwei etikettierte Aktenordner, betitelt Villiers, Diana, Witwe von Charles Villiers, Esq., ehemals Bomba und Canning, Richard, Park Street & Coluber House, Bristol. Die Angaben darin waren so gründlich dokumentiert wie die Akten des gefährlichsten Staatsfeindes, der für Bonaparte spionierte. Und obwohl die meisten Informationen darin aus freundlich gesinnten Quellen stammten, hatte er doch viel davon im Verlauf seiner Agententätigkeit erworben und eine Menge Geld dafür bezahlt. Nein, Stephen hatte keine Kosten gescheut, um sich selbst noch unglücklicher, seinen Status als abgewiesenen Verehrer noch eindeutiger zu machen.
Warum horte ich all diese Wunden?, fragte er sich. Was ist mein Motiv? Gewiss, im Krieg bringt die Anhäufung von Geheimmaterial Vorteile, und man könnte dies einen Privatkrieg nennen. Will ich mir damit beweisen, dass ich immer noch um sie kämpfe, obwohl ich doch klar aus dem Feld geschlagen wurde? Das wäre zwar eine rationale Erklärung, aber sie ist zu glatt, zu einfach und deshalb falsch. Das murmelte er auf Katalanisch, denn als Sprachgenie war es ihm vergönnt, seine Gedankengänge stets in dem Idiom zu formulieren, das am besten zu ihnen passte. Seine Mutter war eine katalanische Spanierin gewesen und sein Vater ein irischer Offizier, weshalb er Katalanisch, Englisch, Französisch und Kastilisch wie Muttersprachen beherrschte und sich darin so selbstverständlich ausdrückte, wie er atmete, ohne eine davon zu bevorzugen, es sei denn für ein bestimmtes Thema.
Ach, hätte ich doch nur den Mund gehalten, sagte sich Sophia. Besorgt musterte sie Stephen, der vorgebeugt dasaß und in die rote Glut starrte. Der liebe, arme Kerl, dachte sie, er bräuchte dringend eine heilende Hand, jemanden, der sich um ihn kümmert. Er taugt wirklich nicht dazu, allein durchs Leben zu gehen, es spielt diesen weltfremden Menschen so übel mit. Wie konnte Diana nur so grausam sein? Es war, als hätte sie ein Kind geschlagen, ein wehrloses Kind. Wie die Gelehrsamkeit doch einen Mann verblenden kann – er ist so lebensuntüchtig. Dabei hätte er im letzten Sommer nur zu ihr sagen müssen: Bitte sei so gut und heirate mich, und sie hätte ihn genommen. Ich hab’s ihm geraten, aber er hat nicht auf mich gehört. Nicht dass er jemals glücklich geworden wäre mit diesem … »Biest« war das Wort, das sich ihr aufdrängte, aber sie unterdrückte es. Wie mir dieser Pagodenbaum jetzt verhasst ist! Wir saßen so gemütlich beisammen, und nun … Als wäre das Feuer ausgegangen, und das wird es auch, wenn ich nicht gleich Holz nachlege. Dunkel ist es außerdem. Ihre Hand tastete nach dem Glockenzug, zögerte und sank dann wieder in ihren Schoß. Schrecklich, dass manche Menschen so leiden müssen, sinnierte sie. Wie bin ich doch glücklich dran im Vergleich dazu. Manchmal macht mein Glück mir richtig Angst … Jack, du mein Liebster … Strahlend erstand vor ihrem geistigen Auge das Bild Jack Aubreys: hochgewachsen, kerzengerade, heiter, übersprudelnd vor Lebensfreude und ungestümer Liebe, mit seinen blonden Locken, die bis auf die Kapitänsepaulette fielen, und dem kräftig gefärbten, wettergegerbten Gesicht, das sich zu einem Grinsen intensivsten Vergnügens verzog; sie erkannte sogar die furchtbare Narbe, die von der linken Kinnbacke bis hinauf unters Haar verlief, sah jede Einzelheit seiner Uniform vor sich: die Medaille aus der Schlacht von Abukir und den schweren, gebogenen Ehrensäbel, den ihm die Patriotische Gesellschaft für die Vernichtung der Bellone verliehen hatte. Wenn er lachte, verschwanden seine klaren blauen Augen fast zwischen den Lidern, wurden zu funkelnden Schlitzen, die im animiert geröteten Gesicht noch heller strahlten. Mit niemandem hatte sie jemals so viel Spaß gehabt wie mit ihm, keiner konnte so herzhaft lachen wie er.
Das schöne Bild verblasste, als sich die Tür geräuschvoll öffnete und ein Schwall Licht aus der Diele hereinfiel. Die dicke, kurze Gestalt von Mrs Williams stand schwarz im Rahmen, und ihre aufdringliche Stimme rief laut: »Was – was soll denn das? Ganz allein im Dunkeln zu sitzen!« Ihr Blick huschte misstrauisch von einem zum anderen, gespeist durch den Verdacht, der in ihr gewachsen war, seit nebenan dieses Schweigen herrschte – ein Schweigen, das ihr sehr wohl auffiel, denn sie hatte in der Bibliothek dicht vor einem Wandschrank in der Täfelung gesessen. Wenn dessen Tür offen stand, hörte man jedes Wort, das im kleinen Salon nebenan fiel. Doch ihre Reglosigkeit und die unschuldigen Gesichter, die sich ihr überrascht zuwandten, ließen Mrs Williams ihren Irrtum erkennen, und sie sagte auflachend: »Ein Herr sitzt allein bei einer Dame im Dunkeln – zu meiner Zeit hätte sich das nicht geziemt, niemals! Der Familienvorstand hätte von Dr. Maturin eine Erklärung dafür gefordert. Wo ist Cecilia? Sie hätte euch doch Gesellschaft leisten sollen. Ganz allein im Dunkeln … Aber du hast bestimmt Kerzen sparen wollen, Sophie. Braves Mädchen. Sie würden ja nicht glauben, Doktor …« Damit wandte sie sich an ihren Gast – in höflichem Ton, denn obwohl Dr. Maturin kaum an seinen Freund Kapitän Aubrey heranreichte, so war er doch der Besitzer einer marmornen Badewanne und einer Burg in Spanien – einer Burg in Spanien! –, und für ihre zweite Tochter mochte er durchaus infrage kommen; hätte Cecilia mit Dr. Maturin im Dunkeln gesessen, wäre sie niemals so hereingeplatzt. »Sie würden ja nicht glauben«, wiederholte sie, »wie der Preis für Kerzen in letzter Zeit gestiegen ist. Zweifellos wäre Cecilia auf denselben Gedanken gekommen. Alle meine Töchter sind zu strikter Sparsamkeit erzogen, Dr. Maturin. Bei uns wird nichts verschwendet. Nein, mein Bester, Sie ahnen gar nicht, wie teuer Wachs geworden ist, seit wir Krieg haben. Manchmal bin ich fast versucht, mich mit Talg zu begnügen. Aber so arm wir auch sind, ich kann mich einfach nicht dazu durchringen, jedenfalls nicht in den Gesellschaftsräumen. Immerhin habe ich zwei Kerzen in der Bibliothek brennen und gebe Ihnen gern eine davon ab. Hier braucht John die Kandelaber gar nicht erst anzuzünden … Ich musste zwei Kerzen haben, Dr. Maturin, denn ich habe die ganze Zeit mit meinem Geschäftsführer gearbeitet, fast die ganze Zeit. Der Schreibkram, die Verträge und die Abtretungserklärungen sind so furchtbar langwierig und kompliziert, und ich bin ja hilflos wie ein Kind in diesen Dingen.« Der Grundbesitz des »hilflosen Kindes« reichte weit über die Grenzen der Pfarrei hinaus, und bis hinüber nach Starveacre verstummten die Babys der Pächter vor Schreck, wenn man ihnen drohte: Gleich kommt Mrs Williams und holt dich! »Aber Mr Wilbraham hat mir ernsthaft ins Gewissen geredet wegen unserer Saumseligkeit, wie er’s nannte, obwohl das bestimmt nicht unsere Schuld ist. Wenn Captain A. doch so weit weg ist …«
Mit geschürzten Lippen wieselte sie davon, um die Kerze zu holen. Die geschäftliche Regelung zog sich in die Länge, nicht weil Mr Wilbraham Schwierigkeiten machte, sondern weil Mrs Williams eisern entschlossen war, die Jungfräulichkeit ihrer Tochter und ihre Mitgift von zehntausend Pfund nur zu opfern, wenn ihr eine »angemessene Versorgung« garantiert und ein bindender Ehevertrag aufgesetzt, unterschrieben und besiegelt war – und vor allem, wenn das Geld bar auf dem Tisch lag. Gerade Letzteres ließ aber seltsam lange auf sich warten. Jack hatte sich mit allen Klauseln einverstanden erklärt, auch mit den halsabschneiderischen; er hatte sein ganzes Vermögen, seinen Sold, alles künftige Einkommen und Prisengeld für immerdar seiner Witwe und den aus dieser Verbindung hervorgehenden Sprösslingen überschrieben, so freigiebig wie ein Bettelarmer. Und dennoch war der fragliche Betrag noch nicht aufgetaucht, weshalb Mrs Williams keinen Finger zu rühren gedachte, ehe sie ihn nicht in Händen hielt, und zwar in bar, nicht in Versprechungen oder Schuldverschreibungen.
»Hier bitte«, sagte sie, mit der Kerze zurückkehrend, und warf einen scharfen Blick auf das Holzscheit, das Sophia ins Feuer gelegt hatte. »Eine reicht doch, nicht wahr, wenn ihr nicht gerade lesen wollt. Aber ich wette, ihr habt noch eine Menge zu besprechen.«
»Ja«, sagte Sophia, als sie wieder allein waren, »ich möchte Sie gern noch etwas fragen, Stephen. Deshalb wollte ich Sie schon die ganze Zeit, seit Sie kamen, beiseitenehmen … Schrecklich, wenn man so unwissend ist, und ich möchte mich vor Kapitän Aubrey um nichts in der Welt blamieren. Meine Mutter kann ich nicht fragen, aber bei Ihnen ist’s was anderes.«
»Mit seinem Arzt kann man über alles sprechen«, sagte Stephen und setzte eine ernste, professionelle Miene auf, während der Ausdruck starker, persönlicher Zuneigung etwas in den Hintergrund trat.
»Seinem Arzt?«, rief Sophia. »Ach so, ja – natürlich. Aber was ich Sie fragen wollte, mein Lieber, betrifft diesen Krieg. Er dauert jetzt schon so lange, viele, viele Jahre, abgesehen von diesem kurzen Frieden – oh, wie wünsche ich mir den Frieden herbei. Aber sie kämpfen immer weiter, und ich fürchte, ich habe mich nicht so gründlich damit beschäftigt, wie ich sollte. Natürlich weiß ich, dass die Franzosen die Schurken sind. Aber dieses Kommen und Gehen – mal sind die Österreicher dabei, die Spanier, die Russen, und mal nicht. Sagen Sie mir, stehen die Russen jetzt auf unserer Seite? Es wäre doch furchtbar – praktisch schon Landesverrat –, wenn ich die falschen Leute in meine Gebete mit einschließen würde. Dann sind da noch all diese Italiener mit dem armen lieben Papst. Und am Tag vor seiner Abreise erwähnte Jack sogar Papenburg; dass er die Flagge von Papenburg als Kriegslist gesetzt habe. Demnach muss Papenburg doch ein Land sein? Ich schäme mich jetzt noch, dass ich heuchelte und nur schlau nickte, als wüsste ich Bescheid. ›Papenburg, aha‹, sagte ich, doch ich fürchte, er hat mir nicht geglaubt. Ich könnte es nicht ertragen, wenn er mich für beschränkt hielte. Bestimmt gibt es eine Unmenge junger Frauen, die genau wissen, wo Papenburg liegt, ebenso Batavia und diese ligurische Republik. Aber bei Mrs Blake haben wir all diese Länder nie behandelt. Ach ja, und das Königreich beider Sizilien. Eines davon hab ich auf der Karte gefunden, das andere nicht. Bitte, Stephen, erklären Sie mir den gegenwärtigen Zustand der Welt.«
»Den Zustand der Welt, meine Liebe?« Stephen lächelte, und von seinem Arztgesicht war keine Spur mehr geblieben. »Na ja, im Augenblick stellt er sich ganz einfach dar. Auf unserer Seite stehen Österreich, Russland, Schweden und Neapel, was dasselbe ist wie Ihre beiden Sizilien. Und Napoleon hat diesen ganzen Klüngel kleiner Staaten auf seiner Seite, dazu Bayern, die Niederlande und Spanien. Aber all diese Allianzen haben nicht viel zu besagen, nicht auf Dauer. Die Russen waren mit uns verbündet und dann wieder gegen uns, bis sie ihren Zaren umbrachten, und jetzt sind sie wieder für uns. Und ich wette, sie werden erneut die Seite wechseln, wenn der Drang sie überkommt. Die Österreicher schieden erstmals 97 aus dem Krieg und dann noch einmal, im Jahr eins, nach Hohenlinden. Das Gleiche kann jederzeit wieder passieren. Von Bedeutung für uns sind nur die Niederlande und Spanien, denn sie besitzen eine Kriegsmarine. Und falls England diesen Krieg jemals gewinnen sollte, dann wird es auf See sein. Bonaparte verfügt über fünfundvierzig Linienschiffe, wir haben achtzig und ein paar darüber, was sich zunächst gut anhört. Aber unsere Schiffe sind über die ganze Welt verstreut, seine dagegen nicht. Die Spanier ihrerseits besitzen siebenundzwanzig, von den Holländern ganz zu schweigen. Deshalb kommt es darauf an, sie an der Bündelung ihrer Kräfte zu hindern. Falls Bonaparte nämlich eine überlegene Flotte im Kanal sammeln kann, selbst nur für kurze Zeit, dann wird seine Invasionsarmee in England einfallen, was Gott verhüten möge. Deshalb kreuzen Jack und Lord Nelson mit ihren Schiffen vor Toulon hin und her, sperren Monsieur de Villeneuve mit seinen elf Linienschiffen und sieben Fregatten ein und hindern sie daran, zu den Spaniern in Cartagena, Cádiz und Ferrol zu stoßen. Und dort werde ich mich ihm auch anschließen, sobald ich erst in London war, um die eine oder andere geschäftliche Angelegenheit zu regeln und einen größeren Vorrat an Färberwurzeln zu kaufen. Falls Sie also eine Nachricht für ihn haben, dann geben Sie mir die jetzt, Sophie, denn ich bin auf dem Sprung.« Er erhob sich, nach allen Seiten Krümel verstreuend, als die Stutzuhr auf der schwarzen Kommode die volle Stunde schlug.
»Oh, Stephen, müssen Sie wirklich schon gehen?«, rief Sophia. »Hier, lassen Sie mich Ihren Rock abbürsten. Können Sie nicht zum Abendessen bleiben? Bitte bleiben Sie doch – ich mache Ihnen auch überbackenen Käse.«
»Ich kann nicht, meine Liebe, obwohl es mir bei so viel Güte sehr schwerfällt.« Stephen stand da und ließ sich striegeln wie ein Pferd, ließ Sophia seinen Kragen ordentlich umlegen und seine Krawatte zurechtzupfen. Seit seiner Enttäuschung mit Diana war er in seinem Äußeren nachlässig geworden, er bürstete weder seine Kleider noch seine Stiefel, und auch sein Gesicht und seine Hände wirkten unsauber. Er fuhr fort: »In London findet ein Treffen der Insektenforscher statt, zu dem ich vielleicht gerade noch zurechtkomme, wenn ich mich beeile. Schon gut, meine Liebe, schon gut, das reicht. Heilige Mutter Gottes, ich muss doch nicht vor Gericht! Die Entomologische Gesellschaft legt keinen Wert auf Schönheit. Und jetzt seien Sie nett, geben Sie mir einen Kuss zum Abschied, und sagen Sie mir, was ich Jack ausrichten soll.«
»Ach, wenn ich doch nur mitkommen könnte! Ich wünschte … Aber es hätte wohl keinen Sinn, wenn ich ihn bäte, vorsichtig zu sein und nicht so viel zu riskieren, oder?«
»Ich richte es ihm aus, wenn Sie möchten. Aber glauben Sie mir, mein Engel, Jack ist kein unvorsichtiger Mann, jedenfalls nicht auf See. Er geht niemals ein Risiko ein, ohne die Chancen vorher genau abzuwägen, denn er liebt sein Schiff und seine Leute viel zu sehr, als dass er sie blindlings aufs Spiel setzen würde. Er ist keiner von diesen wilden, draufgängerischen Feuerfressern.«
»Er würde also nichts Unbedachtes tun?«
»Nie im Leben. Es ist wahr, Sophie, glauben Sie mir«, fügte er hinzu, weil Sophie nicht überzeugt schien, dass Jack auf See ein ganz anderer Mensch war als an Land.
»Tja …« Sie schwieg kurz. »Aber wie lang mir die Zeit wird! Alles scheint sich endlos hinzuziehen.«
»Unsinn!«, rief Stephen bemüht munter. »In zwei Wochen haben wir Parlamentsferien. Dann kehrt Kapitän Hamond auf sein Schiff zurück, und Jack sitzt wieder an Land. Sie werden ihn nach Herzenslust sehen können. Also, was soll ich ihm sagen?«
»Dass ich ihn über alles liebe. Und bitte, bitte geben auch Sie gut auf sich acht, Stephen.«
Dr. Maturin betrat den Konferenzraum der Entomologischen Gesellschaft gerade, als Pastor Lamb sein Referat über eine unbekannte Käferart begann, die 1799 am Ufer von Pringle-juxta-Mare entdeckt worden war. Er nahm im Hintergrund Platz und hörte eine Weile aufmerksam zu. Aber dann begann der Redner vom Thema abzuschweifen (womit alle gerechnet hatten) und langweilte seine Zuhörer mit seiner Theorie zur Überwinterung von Schwalben, für die er einen neuen Beweis gefunden hatte: Nicht nur, dass sich Schwalben in Schwärmen sammelten, im Flug immer engere Kreise beschrieben und sich dann en masse in die Tiefen abgelegener Teiche stürzten, nein, sie suchten auch Zuflucht in den Schächten alter Zinnminen: »In kornischen Zinnminen, meine Herren!« Stephens Aufmerksamkeit ließ nach, sein Blick wanderte über die Reihen der unruhig gewordenen Insektenforscher, von denen er einige kannte: den hochgeschätzten Dr. Musgrave, der ihn mit einer prächtigen Carena quindecimpunctata beglückt hatte; dann waren da noch der für seine Forschung an Hirschkäfern berühmte Mr Tolston und der gelehrte Schwede Eusebius Piscator. Und schließlich dieser breite gebeugte Rücken mit dem gepuderten Zopf darauf, der ihm so vertraut vorkam. Eigenartig, wie das Auge unzählige Proportionen und Dimensionen wahrnahm und speicherte: Solch ein Rücken war fast so unverwechselbar wie ein Gesicht. Das Gleiche galt für Körperhaltung, Gestik, Kopfbewegungen: Wie unendlich viele Varianten gab es da zu unterscheiden! Aber dieser Rücken war in seltsam verkrampfter Haltung von ihm abgekehrt, und sein Besitzer hatte die Hand an die Wange gehoben, fast so, als wollte er sein Gesicht verdecken. Zweifellos fielen gerade diese Abweichungen dem Auge besonders auf. Denn in all den Jahren ihrer Zusammenarbeit hatte Stephen nie erlebt, dass Sir Joseph sich verlegen drehte und wand.
»Und damit, meine Herren, kann ich wohl in aller Bescheidenheit behaupten, dass das Rätsel der Überwinterung von Schwalben und allen Schwalbenartigen restlos geklärt ist«, schloss Mr Lamb mit einem herausfordernden Blick ins Auditorium.
»Dafür sind wir alle Pastor Lamb zu größtem Dank verpflichtet«, sagte der Vorsitzende in die allgemeine Unzufriedenheit hinein, erntete aber nur gereiztes Scharren und Gemurmel. »Und obwohl wir nun, wie ich fürchte, in Zeitnot geraten sind – wahrscheinlich müssen wir auf einige der angekündigten Referate verzichten –, möchte ich Sir Joseph Blaine bitten, uns an seinen Erkenntnissen über den Echten Scheinzwitterschmetterling teilhaben zu lassen, den er kürzlich seiner Sammlung eingliedern konnte.«
Sir Joseph erhob sich halb von seinem Platz und bat, für diesmal entschuldigt zu werden – er hatte seine Notizen daheim vergessen, fühlte sich nicht ganz wohl und wollte den Versammelten einen Vortrag aus dem Stegreif ersparen –, ja er bat sogar darum, sich zurückziehen zu dürfen. Es war nur ein vorübergehendes Unwohlsein, versicherte er beruhigend, obwohl sich die Versammlung selbst dann nicht weiter beunruhigt hätte, wenn er die grassierende Lepra gehabt hätte. Denn drei andere Insektenforscher waren schon auf dem Weg zum Rednerpult und brannten darauf, sich in den Annalen der Gesellschaft unsterblichen Ruhm zu sichern.
»Was soll ich denn daraus schließen?«, fragte sich Stephen, als Sir Joseph mit einer knappen Verbeugung an ihm vorbeischlich. Und während des nun folgenden Vortrags über Leuchtkäfer, die frisch aus Surinam eingetroffen waren – ein faszinierendes Referat, das er später bestimmt mit großem Gewinn nachlesen würde –, stieg eine böse Vorahnung in ihm auf.
Diese Unruhe begleitete ihn auch nach der Konferenz. Doch kaum hatte er hundert Meter zurückgelegt, fing ihn ein diskreter Bote ab und überreichte ihm eine kodierte Karte mit einer Einladung, nicht in Sir Josephs Amtsräume, sondern in ein kleines Haus hinter Shepherd Market.
»Wie schön, dass Sie kommen konnten«, sagte Sir Joseph und führte Stephen zu einem Sessel neben dem Kamin seines Arbeitszimmers. Es diente ihm zugleich als Bibliothek und Salon und war bequem, sogar luxuriös möbliert – in einem Stil, der vor fünfzig Jahren modern gewesen war. Kästen voll aufgespießter Schmetterlinge teilten sich die Wände mit pornographischen Stichen: eindeutig ein privater Wohnsitz. »Wirklich sehr freundlich von Ihnen.« Sir Joseph wirkte nervös und sagte noch einmal: »Wirklich sehr freundlich …« Stephen erwiderte nichts. »Ich habe Sie hierhergebeten«, fuhr Sir Joseph fort, »weil dies meine private Zuflucht ist und weil ich glaube, dass ich Ihnen eine private Erklärung schulde. Als ich Sie heute Abend erkannte, war ich überrascht. Mein schlechtes Gewissen versetzte mir so etwas wie einen groben Fußtritt, was mich außer Fassung brachte, denn ich habe äußerst schlechte Nachrichten für Sie. Liebend gern würde ich sie Ihnen von jemand anderem beibringen lassen, doch leider muss ich es selbst tun. Ich hatte mich darauf vorbereitet, Sie bei unserem für morgen angesetzten Treffen zu informieren, aber als ich Sie so plötzlich auftauchen sah, in einer Atmosphäre, die … Kurz gesagt«, schloss er und legte den Schürhaken beiseite, mit dem er im Feuer gestochert hatte, »kurz gesagt, es hat in der Admiralität eine grobe Indiskretion gegeben. In einer Vollversammlung wurde Ihr Name erwähnt, in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gefecht vor Cádiz.« Stephen verbeugte sich, schwieg aber noch immer. Nach einem schrägen Seitenblick fuhr Sir Joseph fort: »Natürlich überspielte ich diese Indiskretion sofort und gab später ganz allgemein zu verstehen, dass Sie sich nur zufällig an Bord aufhielten, dass Sie mit einem wissenschaftlichen oder quasi diplomatischen Auftrag nach dem Fernen Osten unterwegs waren, weshalb Ihre Ernennung zum Kapitän auf Zeit für die Verhandlungen notwendig geworden war, wobei ich auf das Vorbild von Banks und Halley verwies. Ihre Anwesenheit bei dem Gefecht sei unbeabsichtigt und rein zufällig gewesen, lediglich durch den extremen Zeitdruck bedingt. Letzteres habe ich als die geheime Erklärung der ganzen Sache hingestellt, geheimer noch als das Abfangen der Spanier, die nur den Eingeweihten bekannt sei und unter keinen Umständen verbreitet werden dürfe. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Sie trotz meiner nachträglichen Tarnmanöver sozusagen geplatzt sind. Und damit werden zwangsläufig alle unsere weiteren Pläne infrage gestellt.«
»Wer waren die anwesenden Herren?«, fragte Stephen, und Sir Joseph reichte ihm eine Liste. »Aha, eine große Versammlung … Es zeugt von unglaublicher Leichtfertigkeit«, sagte er kalt, »von unverantwortlicher Dummheit, Menschenleben und eine ganze Geheimdienstoperation derart zu gefährden.«
»Völlig Ihrer Meinung«, rief Sir Joseph. »Es ist eine Ungeheuerlichkeit! Und diese Feststellung ist für mich umso schmerzlicher, als ich nicht ganz ohne Schuld bin. Ich hatte den Ersten Seelord eingehend ins Bild gesetzt und fest auf seine Diskretion vertraut. Aber zweifellos war es mein Fehler, dass ich dabei gewohnheitsmäßig von einem Marinechef ausging, der unbedingt vertrauenswürdig war – nie gab es einen verschwiegeneren Mann als Lord Melville. Die parlamentarische Regierungsform ist der Feind aller Geheimdienste: Ständig stoßen neue Leute dazu, die eher Politiker als Experten sind, und wir müssen wieder bei Punkt Null beginnen. Die Diktatur ist das einzig Wahre für einen Geheimdienst. Bonaparte wird weit, weit besser bedient als Seine Majestät … Aber ich muss leider noch auf ein zweites leidiges Thema zu sprechen kommen. Zwar wird es binnen weniger Tage öffentliches Aufsehen erregen, aber ich fühle mich doch verpflichtet, Sie vorher persönlich zu unterrichten: Das Direktorium hat den spanischen Goldschatz zum rechtmäßigen Eigentum der Krone erklärt, was bedeutet, dass er nicht für die Verteilung von Prisengeldern herangezogen wird. Ich unternahm alles, was in meiner Macht stand, um diese Entscheidung zu verhindern, aber ich fürchte, sie ist unwiderruflich. Das sage ich Ihnen in der Hoffnung, dass es Sie davor bewahren wird, aufgrund gegenteiliger Erwartung hohe Verbindlichkeiten einzugehen. Selbst wenige Tage Vorwarnzeit sind vielleicht besser als gar keine. Außerdem informiere ich Sie darüber, wieder mit dem größten Bedauern, weil mir bewusst ist, dass Sie auch noch andere Interessen in dieser – dieser Angelegenheit verfolgen. Ich kann nur hoffen, wenn auch ohne viel Zuversicht, dass meine Warnung einen gewissen Effekt … Sie verstehen. Und was meine persönliche Enttäuschung betrifft, mein tiefes Mitgefühl und meine Besorgnis, so kann ich Ihnen nur auf Ehre versichern, dass ich sie kaum in die starken Worte zu fassen vermag, die hier angebracht wären.«
»Sie sind ungemein freundlich«, antwortete Stephen, »und ich weiß diesen Vertrauensbeweis sehr zu schätzen. Ich will nicht vorgeben, dass der Verlust eines Vermögens mir gleichgültig wäre. Im Augenblick empfinde ich jedoch nur kleinlichen Ärger, obwohl sich das bestimmt noch ändern wird. Aber das anderweitige Interesse, auf das Sie so taktvoll anspielten, möchte ich doch mit Ihrer Erlaubnis erklären: Ich hatte den dringenden Wunsch, meinem Freund Aubrey zu helfen. Sein Prisenagent ist mit allen ihm anvertrauten Geldern durchgebrannt; das Appellationsgericht hat ihm außerdem zwei seiner Prisen als angeblich neutrales Eigentum abgesprochen, sodass er nun auf elftausend Pfund Schulden sitzt. Und das alles zu einer Zeit, als er sich gerade mit einer höchst liebenswerten jungen Dame verlobt hat. Die beiden empfinden tiefste Zuneigung füreinander; aber weil ihre Mutter, eine Witwe mit beträchtlichem eigenem Vermögen, eine strohdumme, raffgierige, engstirnige, geizige, verbohrte Pfennigfuchserin ist, eine gewissenlose Halsabschneiderin und Furie, stehen ihre Heiratsaussichten schlecht, solange seine Finanzen nicht bereinigt sind und er ihr nicht die geringsten Sicherheiten bieten kann. Das ist der Konflikt, von dem ich mir schmeichelte, ihn aus der Welt schaffen zu können; oder vielmehr, den man durch Ihr Wohlwollen, ein günstiges Geschick und die glücklichen Umstände hätte bereinigen können. Davon gingen alle aus, die es betraf. Aber was soll ich Aubrey jetzt sagen, wenn ich auf Menorca zu ihm stoße? Werden ihm denn überhaupt noch Vorteile aus diesem Gefecht erwachsen?«
»O ja, gewiss. Gewiss wird ein Anerkennungsbetrag ausgeschüttet werden. Zur Begleichung der Schulden, die Sie erwähnten, könnte er reichen. Doch Reichtum wird er ihm leider nicht einbringen, bei Gott nicht. Keine Rede davon. Aber mein Bester, Sie sprachen soeben von Menorca. Muss ich daraus schließen, dass Sie trotz dieses elenden und völlig überflüssigen Zwischenfalls an unseren ursprünglichen Plänen festhalten wollen?«
»Ich denke doch.« Stephen studierte die Namensliste. »Unsere neuen Kontakte könnten sich als überaus nützlich erweisen. Und so viel ginge verloren, wenn wir nicht … Die Zeitfrage scheint mir in diesem Fall die entscheidende Rolle zu spielen: Was das allgemeine Geschwätz und die Gerüchteküche betrifft, so werde ich bestimmt schneller sein als sie, zumal ich schon morgen Abend aufbreche. Bei derlei durchsickernden Informationen ist es unwahrscheinlich, dass sie einen zur Eile entschlossenen Reisenden überholen. Außerdem haben Sie die neugierigsten Schwätzer mit Ihrer Legende über mich schon abgelenkt. Dies ist der einzige Name«, damit deutete er auf die Liste, »den ich fürchte. Wie Sie wissen, ist er ein Homosexueller. Nicht dass ich ihn persönlich dafür verdamme – jeder Mann muss selbst entscheiden, worin für ihn die Schönheit liegt, und je mehr Liebe auf der Welt ist, desto besser –, aber es ist allgemein bekannt, dass manche Homosexuelle gewissen Pressionen ausgesetzt sind, die andere nicht zu fürchten haben. Falls die Treffen dieses Herrn mit Monsieur de la Tapetterie diskret überwacht würden, und vor allem, wenn Tapetterie für eine Woche neutralisiert werden könnte, hätte ich keine Bedenken, unsere bisherigen Pläne in die Tat umzusetzen. Selbst ohne diese Vorsichtsmaßnahmen würde ich wahrscheinlich daran festhalten. Schließlich handelt es sich lediglich um Spekulationen. Und es hat keinen Zweck, Osborne oder Schikaneder zu schicken – Gomez wird seinen Kopf in keines anderen Mannes Hände legen als in meine. Aber ohne ihn fällt unser neues Netz in sich zusammen.«
»Das stimmt. Und natürlich kennen Sie die Situation vor Ort viel besser als jeder andere von uns. Aber der Gedanke, Sie diesem erhöhten Risiko auszusetzen, widerstrebt mir.«
»Es ist nur ein geringes Risiko, falls es im Augenblick wirklich schon besteht. Wir dürfen es vernachlässigen, wenn ich günstigen Segelwind habe und Sie das Loch hier stopfen können – ein rein theoretisches Loch. Für diese eine Reise fällt es überhaupt nicht ins Gewicht, verglichen mit den bekannten Alltagsgefahren unserer Profession. Später, wenn das alberne Geschwätz seine gewohnten Wirkungen zeitigt, werde ich Ihnen natürlich eine Zeit lang nicht von Nutzen sein können – jedenfalls so lange nicht, bis Sie mich mit Ihrer quasi diplomatischen oder wissenschaftlichen Mission zum Khan der Tatarei rehabilitiert haben, ha, ha. Wenn ich davon zurückkomme, werde ich so viele geschwätzige Referate über die Sporenpflanzen von Kamtschatka ausposaunen, dass man mich niemals wieder zum verschwiegenen Geheimagenten stempeln kann.«
2
Hin und zurück, hin und zurück, vom Kap Sicié bis zur Halbinsel Giens, dann eine Wende und wieder nach Westen, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, bei jedem Wetter. Nach dem abendlichen Kanonenschuss hielten sie aufs offene Meer hinaus und kehrten im Morgengrauen wieder zurück, damit das küstennahe Fregattengeschwader Toulon observieren konnte, als Auge einer Flotte aus Linienschiffen, deren Bramsegel den südlichen Horizont sprenkelten, wo Nelson darauf wartete, dass der französische Admiral einen Ausbruchversuch wagte.
Der Mistral wehte nun schon drei Tage, und die See leuchtete eher weiß als blau, weil der ablandige Wind kurze steile Wellen aufwarf, deren Gischt immer wieder über die Reling flog und das Deck nässte. Mittags hatten die drei Fregatten ihre Segel gerefft, aber sie machten immer noch sieben Knoten Fahrt und lagen so stark über, dass ihre Backbordrüsten durch die Wellenkämme zogen.
Das ihnen bis zum Überdruss vertraute Kap Sicié rückte näher und näher. In der glasklaren Luft unter dem wolkenlosen Himmel erkannten sie die kleinen weißen Häuser darauf und die Pferdekarren, die auf der Straße zum Semaphorenturm und zu den Festungsbatterien hinaufkrochen.
Noch näher, bis sie fast in Reichweite der hoch oben postierten Zweiundvierziger-Kanonen waren. Jetzt kam der Wind, von den Hügeln gestört, in unberechenbaren Böen.
»An Deck!«, rief der Ausguck im Masttopp. »Die Naiad hat das Manöversignal gesetzt, Sir.«
»Klar zur Wende«, befahl der Offizier der Wache, eigentlich nur der Form halber, denn die Besatzung der Lively war nicht nur seit Jahren aufeinander eingespielt, sondern hatte schon mehrere Hundert Mal in diesen Gewässern gewendet und brauchte kaum noch Befehle. Ihr Eifer war durch die Routine etwas abgestumpft, dennoch musste der Bootsmann sie bremsen und warnend: »Sinnig, sinnig dort mit der verdammten Schot, nicht zu hastig!« rufen. Denn die Besatzung war derart auf lautlose Perfektion gedrillt, dass die Fregatte in Gefahr geriet, mit ihrem Klüverbaum die Heckreling der Melpomene aufzuspießen, deren Seetüchtigkeit und Segelmanöver ihr kein gutes Zeugnis ausstellten.
Trotzdem wendeten alle drei glatt in Folge, wobei jedes Schiff genau an der Stelle drehte, wo sein Vorgänger über Stag gegangen war. Ihre Segel fingen den Wind ein, und sie formierten sich wieder zu einer exakten Kiellinie, die erneut auf Giens zuhielt: die Naiad, die Melpomene und die Lively.
»Wie ich dieses Wenden im Geschwader hasse!«, sagte ein magerer Kadett zu seinem ebenso mageren Kameraden. »Das lässt einem ja nicht die geringste Chance … Von den armen Würstchen ist keines zu sehen«, fügte er hinzu, durch das Gewirr der Leinen und Segel nach der Lücke zwischen der Halbinsel und der Île Porquerolles Ausschau haltend. »Kein einziges, nicht mal ein Zipfel.«
»Würstchen?«, rief sein Kamerad gequält. »Oh, Butler, wie gemein von dir, mich daran zu erinnern.« Auch er beugte sich über die Finknetze mit den zusammengerollten Hängematten und spähte nach vorn. Denn jetzt konnte jeden Moment die Niobe von ihrem Abstecher zurückkehren. Sie hatte in der Straße von Piombino Wasser gebunkert und war dann an der italienischen Küste entlang zurückgekreuzt. Auf dem Weg hatte sie den Feind angegriffen, wo immer sie ihn fand, und alles an Proviant beschlagnahmt, was ihr vor den Bug geriet. Als Nächstes sollte die Reihe an die Lively kommen. »Würstchen!«, überbrüllte der Kadett den Mistral, während er weiter auf See hinausspähte. »Heiße, knackige, saftige Würstchen – mit Speck – und dazu Pfifferlinge!«
»Halt’s Maul, Dickarsch«, flüsterte sein Freund und boxte ihn schmerzhaft in die Rippen. »Der Herr ist mit uns!«
Als der wachhabende Seesoldat klatschend seine Muskete präsentierte, hatte sich der Offizier der Wache auf die Leeseite zurückgezogen. Im nächsten Augenblick trat Jack Aubrey aus dem Niedergang, in seine Pelerine gehüllt, ein Teleskop unterm Arm, und begann auf der geheiligten, dem Kommandanten vorbehaltenen Luvseite des Achterdecks auf und ab zu gehen. Von Zeit zu Zeit blickte er zu den Segeln auf – rein gewohnheitsmäßig, denn natürlich fand er nichts zu beanstanden. Die Lively wäre eine durch und durch effiziente, reibungslos arbeitende Kriegsmaschine. Bei diesem Dienst hätte sie auch optimal funktioniert, falls er den ganzen Tag in seiner Achterkajüte geblieben wäre. Nein, es gab nichts zu tadeln, selbst wenn er so galliger Laune gewesen wäre wie Luzifer nach seinem Sturz. Doch davon konnte keine Rede sein: Seit Wochen und Monaten herrschte das beste Einvernehmen zwischen ihm und der Besatzung, trotz des zermürbenden engen Blockadedienstes, der in der Marine als härteste Schinderei verhasst war. Obwohl Reichtum vielleicht nicht glücklich machte, so schenkte doch die Aussicht darauf eine Vorfreude, die dem Glück sehr nahe kam; denn im vergangenen September hatten sie eines der am reichsten beladenen Schiffe erobert, die zurzeit auf den Meeren schwammen. Folglich verriet Jack Aubreys Gesicht nichts als Wohlwollen und Zustimmung, auch wenn es nicht die spontane Liebe ausdrückte, wie er sie für sein erstes Schiff, den kleinen, plumpen Dwarsläufer Sophie empfunden hatte. Denn die Lively gehörte ihm nicht, er kommandierte sie nur auf Zeit, solange ihr regulärer Kommandant, Kapitän Hamond, seinen Sitz im Parlament von Westminster wahrnahm, wo er den Bezirk Coldbath Fields für die Whigs vertrat. Auch wenn Jack die Tüchtigkeit der Livelys und ihre lautlose Disziplin bewunderte und lobte – sie konnten in drei Minuten, zweiundvierzig Sekunden Vollzeug aufziehen, ohne dass ein anderer Befehl als »Segel setzen!« ergangen wäre –, fiel es ihm doch schwer, sich an sie zu gewöhnen. Die Lively war ein schönes, ein bewundernswertes Beispiel dafür, was beste Whig-Mentalität zuwege bringen konnte. Doch Jack war ein Tory. Deshalb bewunderte er sie zwar, aber mit einer gewissen inneren Distanz, als wäre ihm die Frau seines Bruders anvertraut: ein elegantes, tugendhaftes, phantasieloses Wesen, dessen Lebensführung auf rein physikalischen Gesetzen beruhte.
Inzwischen hatten sie Kap Cépet querab. Er warf sich das Fernrohr am Riemen über die Schulter, hievte sich in die Wanten hoch, die unter seinem Gewicht durchhingen, und enterte grunzend zum Großmars auf. Der Ausguckposten dort hatte ihn schon erwartet und ein Leesegel als Sitzpolster für ihn zusammengefaltet. »Danke, High Bum«, sagte er. »Ziemlich frostig, wie?« Mit einem letzten Grunzen ließ er sich nieder, stützte sein Glas auf die achterste Jungfer einer Stengewant und richtete es auf Kap Cépet aus: Hell und klar sprang die Signalstation in sein Gesichtsfeld und rechts davon der östliche Teil der Großen Reede mit den fünf verankerten Linienschiffen, alles Vierundsiebziger und drei davon den Engländern abgenommen: die Hannibal, die Swiftsure und die Berwick. An Bord der Hannibal übten sie Reffen, und auf der Swiftsure krochen eine Menge Leute ins Rigg hinauf, wahrscheinlich Landlubber in der Ausbildung. Die Franzosen verankerten ihre Beuteschiffe fast immer auf der Außenreede, um die Engländer zu ärgern, was ihnen auch gelang. Zweimal täglich reizte ihr Anblick Jack bis aufs Blut, denn er stieg jeden Morgen und jeden Nachmittag hier hinauf, um einen Blick auf die Reede von Toulon zu werfen. Das tat er teils aus Gewissenhaftigkeit – obwohl ein Ausbruchversuch höchst unwahrscheinlich war, solange nicht unsichtiges Schlechtwetter herrschte und ein schwerer Sturm die englische Flotte von ihrer Station vertrieb –, teils der körperlichen Ertüchtigung wegen. Er setzte schon wieder zu viel Fett an. Trotzdem wäre es ihm nicht im Traum eingefallen, sich so zu schinden wie manche dicke Kommandanten, die ständig verbissen in den Wanten auf und ab rannten. Aber das Gefühl der straffen Taue in seiner Hand, die Elastizität des lebendigen Riggs, das Hin- und Herschwingen im Seegang machten ihn glücklich.
Als auch der Rest der Reede in Sicht kam, schwenkte Jack stirnrunzelnd das Glas, um die gegnerischen Fregatten zu mustern: Alle sieben waren noch da, und nur eine davon hatte sich seit gestern bewegt. Wunderschöne Schiffe, aber mit zu viel achterlichem Mastfall für seinen Geschmack.
Jetzt kam der entscheidende Moment. Der Kirchturm stand fast in Linie mit der blauen Kuppel, und Jack fokussierte besonders sorgfältig. Zwar schien das Land kaum vorbeizugleiten, trotzdem öffneten sich allmählich die Arme der Kleinen Reede. Dahinter lag der Innenhafen mit seinem Mastenwald. Alle Schiffe hatten ihre Rahen vierkant gebrasst und waren ständig in Bereitschaft, als wollten sie sogleich zu einem Gefecht auslaufen. Er erkannte die Flagge eines Vizeadmirals, dann die eines Konteradmirals und den breiten Wimpel eines Kommodore: alles unverändert. Dann begannen sich die Arme wieder zu schließen; fast unmerklich glitten die Landspitzen aufeinander zu, und bald war die Kleine Reede erneut seinem Blick entzogen.
Jack schwenkte sein Glas, bis er den Farohügel in Sicht bekam und den Berg dahinter. Er suchte die Landstraße nach dem kleinen Gasthaus ab, wo er, Stephen und Capitaine Christy-Pallière vor nicht allzu langer Zeit so exzellent gespeist und gebechert hatten, zusammen mit einem zweiten französischen Marineoffizier, dessen Name ihm nicht mehr einfiel. Höllisch, die Hitze damals; dagegen diese beißende Kälte jetzt … Ein phänomenales Menü war das gewesen – Gott, hatten sie geschlemmt! –, und jetzt lebten sie von Hungerrationen. Schmerzhaft verkrampfte sich sein Magen in der Erinnerung. Die Lively hielt sich zwar für das reichste Schiff im Geschwader und blickte mit milder Verachtung auf die ärmeren hinab, aber es fehlte ihr genau wie dem Rest der Flotte an Frischproviant, Tabak, Feuerholz und Trinkwasser. Weil unter ihren Schafen die Viehpest und im Schweinestall die Röteln ausgebrochen waren, mussten sich auch die Offiziere mit dem Pökelfleisch ihrer mageren Kadettenjahre begnügen, während die Besatzung nur Zwieback aufgetischt bekam. Noch hatte Jack eine kleine, nicht mehr ganz frische Lammschulter für sein Dinner übrig. Soll ich den Offizier der Wache dazu einladen?, fragte er sich. Es war schon lange her, seit er – außer zum Frühstück – einen Gast gehabt hatte. Auch vermisste er seit Langem ein freimütiges Gespräch von gleich zu gleich. Seine Offiziere – oder vielmehr Kapitän Hamonds Offiziere, denn er war weder an ihrer Auswahl noch an ihrer Ausbildung beteiligt gewesen – luden ihn einmal pro Woche zum Dinner in ihre Messe ein, und er revanchierte sich dafür, indem er den Offizier und den Kadetten der Morgenwache öfter zum Frühstück in die Achterkajüte bat: Doch beides waren keine besonders heiteren Tischrunden. Die höfliche, aber etwas benthamitische Offiziersmesse beachtete strikt die Marine-Etikette, wonach es sich verbot, dass ein Untergebener mit seinem Kommandanten sprach, es sei denn, er wurde von ihm angeredet; außerdem waren sie an Kapitän Hamond gewöhnt, dem diese Rigorosität behagt hatte, und waren ein stolzer Haufen – mit Recht –, der die Schmeichelei und Liebedienerei, die auf so vielen Schiffen grassierte, verabscheute, selbst schon die Ansätze dazu. Vor einiger Zeit hatte man ihnen einen allzu geschmeidigen Dritten Offizier aufgedrückt, aber dem hatten sie nach wenigen Monaten nahegelegt, sich auf die Achilles versetzen zu lassen.
Sie trugen die Nase ziemlich hoch, und obwohl sie ihren Interimskommandanten keineswegs ablehnten – im Gegenteil, sie schätzten ihn ungemein für seine gute Seemannschaft und seinen Kampfgeist –, maßen sie ihm doch unbewusst die Rolle des Olympiers zu. Deshalb fühlte sich Jack in der Isolation, in der er leben musste, manchmal total vereinsamt. Allerdings nur manchmal, denn zur Muße hatte er selten Zeit. Einige Pflichten konnte ihm selbst der tüchtigste Erste Offizier nicht abnehmen, und vormittags beaufsichtigte er stets den Unterricht der Kadetten in seiner Kajüte. Das waren nette Jungen, deren Übermut selbst die gottähnliche Gegenwart des Kommandanten, die Strenge ihres Schulmeisters und das makellose Vorbild ihrer steifleinenen Vorgesetzten nicht ganz unterdrücken konnten. Nicht einmal dem Hunger gelang das, obwohl sie seit gut einem Monat Ratten verspeisten, die ihr Stubenältester in der Bilge fing, sauber häutete und ausnahm und wie winzige Lämmer zum Verkauf auslegte, wobei die Preise von Woche zu Woche stiegen und jetzt bei schockierenden fünf Pence pro Kadaver angelangt waren.
Jack mochte junge Leute und achtete wie viele andere Kommandanten mit großer Sorgfalt auf ihre berufliche und soziale Erziehung, auf ihr Taschengeld und sogar auf ihre Moral. Aber die Beharrlichkeit, mit der er ihrem Unterricht beiwohnte, war nicht ganz selbstlos. Mathematik war ihm als Kind ein Gräuel gewesen und auch später an Bord ein Buch mit sieben Siegeln geblieben. Obwohl er als Seemann ein Naturtalent war, hatte er sein Leutnantsexamen doch nur dank fieberhaften Auswendiglernens und der Hilfe zweier wohlmeinender Prüfer bestanden. Zwar hatte ihm seine gute Freundin Queenie geduldig Tangenten, Sekanten und Sinuswinkel erklärt, trotzdem war er in sphärischer Trigonometrie nie ein großes Licht gewesen. Seine Navigationskunst beruhte auf simplen Faustregeln bei der Bewegung von A nach B, und eine Position berechnete er nur über den Daumen. Zum Glück hatte ihm die