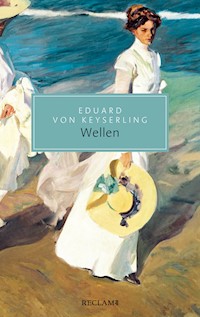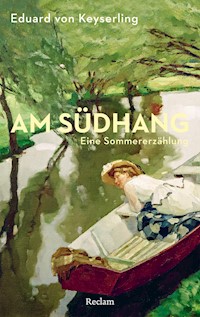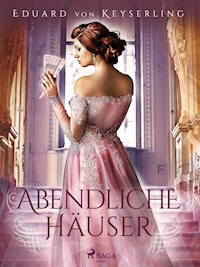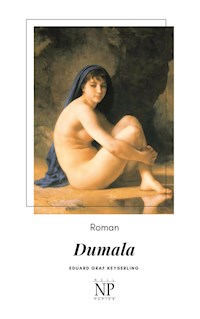
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Keyserling bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Pastor Werner aus Dumala vollzieht seinen Dienst an der Gemeinde pflichtschuldig und mit ganzem Herzen. Somit wird er unfreiwillig auch zum Abnehmer der dörflichen Beichten. Er nennt es »Barmherzigkeitssport«; von der untreuen Ehefrau bis zum betrogenen Ehemann, von der Erbschleicherei bis zum Testamentsbetrug ist alles dabei. Schließlich kommt es, wie es kommen musste: Der Pastor will den Wahrheitsgehalt einer Beichte des notorischen Dorftrinkers überprüfen. Hätte er es lassen sollen? Wie viel kann man am Ende eines Tages wirklich von einem Menschen wissen? Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eduard von Keyserling
Dumala
Roman
Eduard von Keyserling
Dumala
Roman
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: S. Fischer, Berlin, 1915 (190 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962814-46-5
null-papier.de/neu
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Keyserling bei Null Papier
Fräulein Rosa Herz
Wellen
Beate und Mareile
Seine Liebeserfahrung
Dumala
Abendliche Häuser
Schwüle Tage
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Dumala
Der Pastor von Dumala, Erwin Werner, stand an seinem Klavier und sang:
»Der Nebel stieg, das Wasser schwoll, Die Möwe flog hin und wied–e–r«
Er richtete seine mächtige Gestalt auf. Sein schöner Bariton erfüllte ihn selbst ganz mit Kraft und süßem Gefühl. Es war angenehm zu spüren, wie die Brust sich weitete, wie die Töne in ihr schwollen.
»Aus deinen Augen liebevoll Fielen – die Tränen – nie–ie–der.«
Er zog die Töne, ließ sie ausklingen, weich hinschmelzen.
Seine Frau saß am Klavier, sehr hübsch mit dem runden rosa Gesicht unter dem krausen aschblonden Haar, hellbeleuchtet von den zwei Kerzen, die kurzsichtigen blauen Augen mit den blonden Wimpern ganz nah dem Notenblatt. Die kleinen roten Hände stolperten aufgeregt über die Tasten. Dennoch, wenn ein längeres Tremolo ihr einen Augenblick Zeit ließ, wagte sie es, von den Noten fort zu ihrem Mann aufzusehen, mit einem verzückten Blick der Bewunderung.
Es war zu schön, wie der Mann, von der Musik hingerissen, sich wiegte, wie er wuchs, größer und breiter wurde, wie all das Süße und Starke, all die Leidenschaft herausströmten. Das gab ihr einen köstlichen Rausch. Tränen schnürten ihr die Kehle zusammen, und um das Herz wurde es ihr seltsam beklommen.
»Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib, Die Seele stirbt vor Seh–nen –«
Die Stimme füllte das ganze Pastorat mit ihren schwülen Leidenschaftsrufen. Die alte Tija hielt im Esszimmer mit dem Tischdecken inne, faltete ihre Hände über dem Bauch, schloss ihr eines, blindes Auge und schaute mit dem anderen starr vor sich hin. Dabei legte sich ihr blankes, gelbes Gesicht in andächtige Falten.
Das ganze Haus, bis in den Winkel, wo die Katze am Herde schlief, klang wider von den wilden und schmelzenden Liebestönen. Sie drangen durch die Fenster hinaus in die Ebene, wo die Nacht über dem Novemberschnee lag; ja vom nahen Bauernhof antwortete ihnen ein Hund mit langgezogenem, sentimentalem Geheul.
»Mich hat das unglücksel’ge Weib Vergiftet – vergiftet – –«
Die Fenster bebten von dem Verzweiflungsruf. Die Katze erwachte in ihrer Ecke, die alte Tija fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und murmelte:
»Ach – Gottchen!«
»Vergiftet mit ihren Tränen.«
Die kleine Frau lehnte sich in ihren Stuhl zurück, faltete die Hände im Schoß und sah ihren Mann an.
Pastor Werner stand schweigend da und strich sich seinen blonden Vollbart. Er musste sich auch erst wieder zurückfinden.
Jetzt war es ganz still im Pastorate. Nur Tija begann wieder leise mit den Tellern zu klappern.
»Wie Siegfried!« kam es leise über die Lippen der kleinen Frau.
»Wer?« fuhr Pastor Werner auf.
»Du«, sagte seine Frau.
Werner lachte spöttisch, wandte sich ab und begann, die Hände auf dem Rücken, im Zimmer auf und ab zu gehen.
So war es jedes Mal, wenn er sich im Singen hatte gehen lassen, wenn er sich mit Gefühl vollgetrunken hatte. Dann kam der Rückschlag.
Man hatte geglaubt, etwas Großes zu erleben, einen Schmerz, eine Leidenschaft, und dann war es nur ein Lied, etwas, das ein anderer erlebt hat, und die Winde des Zimmers mit ihren Fotografien, die großen schwarz und rot gemusterten Möbel, all das beengte ihn, drückte auf ihn.
Seine Frau saß noch immer am Klavier und starrte in das Licht. Auch bei ihr war der schöne Rausch der Musik vorüber. Nur eine müde Traurigkeit war übriggeblieben. Sie dachte darüber nach, warum er sich geärgert hatte, als sie »Siegfried« sagte. Das kam oft so. Wenn sie ganz voll von Begeisterung für ihn war, dann war ihm etwas nicht recht, und er lachte kalt und spöttisch.
»Lene, essen wir nicht?« fragte Werner.
Da fuhr sie auf.
»Natürlich! Gefüllte Pfannkuchen!«
Und sie lief in die Küche hinaus.
Am Esstisch unter der Hängelampe war alles Fremde und Erregende fort. Wenn es ihm schmeckte, war Pastor Werner gemütlich, das wusste Lene. Dann konnte sie ruhig vor sich hinplaudern, ohne berufen zu werden, dann hatte sie das Gefühl, dass er ihr gehörte.
»Die Baronin aus Dumala fuhr heute hier vorüber«, berichtete sie.
»So«, meinte Werner, und sah über das Schnapsglas, das er zum Munde führen wollte, hinweg seine Frau scharf an: »Nun – und?«
»Nun, ja. Sie hatte eine neue Pelzjacke an. Entzückend!«
Werner trank seinen Schnaps aus und fragte dann:
»Stand sie ihr gut, diese Jacke?«
Lene seufzte: »Natürlich! Diese Frau ist ja so schön!«
»Was ist dabei zu seufzen?« fragte Werner. »Lass sie doch schön sein.«
»Weil ich sie nicht mag«, fuhr Lene fort, »deshalb. Sie will alle Männer in sich verliebt machen. Aber schön ist sie.«
Werner lachte. »Was für Männer? Die arme Frau pflegt ihren gelähmten Mann Tag und Nacht. Die sieht ja keinen. Eine neue Pelzjacke ist da doch eine sehr unschuldige Zerstreuung.«
»Dich sieht sie doch.« Lene nahm einen herausfordernden Ton an, als suche sie Streit.
Werner zuckte nur die Achseln.
»Mich!«
»Ja dich«, fuhr Lene fort. »Und du bist doch auch in sie verliebt, – etwas – nicht?«
Heute ärgerte das Werner nicht.
»Wenn du willst!« meinte er.
Die kleine Frau durfte heute ruhig mit ihm spielen, wie mit einem großen, gutmütigen Neufundländer. Ein wenig schweigsam war er, aber das pflegte er am Sonnabend immer zu sein, wenn die Predigt ihm im Kopfe herumging.
Nach dem Essen saß das Ehepaar am Kaminfeuer. Durch das Fenster, an dem die Läden offen geblieben waren, schaute die bleiche Schneenacht in das Zimmer. Aus der Gesindestube klang Tijas dünne, zitternde Stimme. Sie sang einen Gesangbuchvers.
»So ist’s hübsch«, sagte Lene. »So ist’s gemütlich! Nicht wahr? Alles ist still, und das Feuer, – und man sitzt beisammen.«
»Stell doch der Lebenslage keine Zensur aus«, versetzte Werner, der sinnend in das Feuer starrte.
»Warum?« fragte Lene eigensinnig.
»Weil, weil« – Werners Stimme wurde streng – »weil Zensuren ausgestellt werden, wenn die Schule zu Ende ist.«
»Deshalb!« meinte Lene, die ihn nicht recht verstanden hatte.
»Nun sei aber nicht ungemütlich, Wernerchen.«
Sie stand auf, ging zu ihm, setzte sich auf seine Knie, schmiegte sich an seine Brust, umrankte den großen Mann ganz mit ihrer kleinen, legitimen Sinnlichkeit, die sich schüchtern hervorwagte.
»Wir sind doch glücklich!« sagte sie. »Ich sag’s doch. Ich stell’ gute Zensuren aus.«
Werner saß still da, ließ sich von der Wärme dieses jungen Frauenkörpers durchdringen. Dann plötzlich schob er Lene beiseite und stand auf.
»Wohin?« fragte sie erschrocken.
»Oh – nichts«, erwiderte er, »ich – ich will mir noch was überlegen.«
»Diese ewige Predigt!« seufzte Lene. »Worüber predigst du denn morgen?«
»Über die Versuchung in der Wüste, du weißt’s ja.«
»Ach ja! Sei doch nicht wieder so streng. Wenn du so herunterdonnerst, wird einem ganz bang.«
Er zuckte die Achseln.
»Seit wann willst du denn Einfluss auf meine Predigten nehmen?«
Also nun hatte sie ihn auch noch geärgert. Sie schwieg. Während Werner, die Hände auf dem Rücken, im Zimmer auf und ab ging, kauerte sie auf ihrem Sessel und folgte ihm unverwandt mit den Blicken. Eben noch hatte sie sich glücklich gefühlt, jetzt war wieder etwas über ihn gekommen, das sie nicht verstand. Sie fühlte, wie müde ihre Glieder von der Arbeit des Tages waren, und das Traurige war über sie gekommen, dem sie nicht nachdenken wollte. Sie folgte Werner mit den Blicken, wie er auf und ab ging, sehr aufrecht in seinem schwarzen Rock, auf und ab, bis seine Gestalt undeutlich wurde und ihr die Augen zufielen.
»Herunterdonnern«, hatte Lene gesagt, ja, das liebte er, das Predigen war wie das Singen, da konnte er sich ausgeben, da hatte er das Gefühl, als »ginge eine Kraft von ihm aus«, wie die Bibel sagt. All die großen, schönen Worte, der große Zorn, mit dem er drohen, die ganz großen Seligkeiten, die er versprechen konnte, und all das war unendlich und ewig, das gab auch einen Rausch. Er freute sich schon darauf. Dazu zog die Versuchung in der Wüste, diese wunderbare Geisterunterhaltung, groß wie Dantes Verse, ihn seltsam an. Das Wilde des Kampfes der beiden Wunderkräfte in der Wüste regte ihn auf.
In tiefem Sinnen ging er auf und ab, vergaß seine Umgebung, bis ein verschlafener Laut aus Lenes halbgeöffneten Lippen ihn aufschauen machte.
»Ja so – der Friede des Pastorats« – dachte er nicht ohne Bitterkeit. Weiß es Gott! ihm war wenig friedlich zumute!
Er stellte sich an das Fenster, schaute in die Nacht hinaus.
Oben am Himmel war Aufregung unter den Wolken, zerfetzt und gebläht wie Segel schoben sie sich aneinander vorüber. Der Mond musste irgendwo sein, aber er wurde verdeckt, nur ein schwaches, müdes Dämmerlicht lag über der Ebene.
Frieden! Ja, wenn einer sich beständig mit Wunderdingen abgeben muss, wenn er immer diese Sprüche im Munde führen muss, die so voll Leidenschaft und Zorn und Süßigkeit und Geheimnis sind, wo soll da der Friede herkommen? Das Herz wird so empfindlich und so erregt, dass es auf alles hineinfällt.
Der Wind trieb kleine Schneewirbel wie weiße Rauchwölkchen über die Ebene. Winzige Lichtpünktchen waren in die Nacht gestreut, wie verloren in dem fahlen, weißen Dämmern. Dort die Reihe heller Punkte waren die Fenster des Schlosses Dumala. Werner fiel die neue Pelzjacke der Baronin Werland ein, und dann sah er das große, düstere Zimmer vor sich, die grün verhangene Lampe, am Kamin im Sessel den Herren mit dem wachsgelben, scharfen Gesicht, die Füße in eine rote Decke gewickelt. Bei ihm auf dem niedrigen Stühlchen die schöne Frau mit den schmalen Augen, die unruhig schillerten, und dem seltsam fieberroten Munde. Sie saß da, blinzelte schläfrig in das Kaminfeuer und strich mit ihrer Hand langsam an dem Bein des Kranken auf und ab.
Ein Schmerz, etwas wie ein körperlicher Schmerz, schüttelte Werner bei diesem Bilde, ließ ihn blass werden und das Gesicht leicht verziehen.
Ärgerlich wandte er sich vom Fenster ab. Es war zu dumm! Dieses Predigtmachen ließ jedes Mal alles in ihm toller rumoren denn je!
Er begann wieder auf und ab zu gehen, dann blieb er vor Lene stehen.
Sie hatte die Füße auf den Sessel hinaufgezogen, die Wange an die Stuhllehne gestützt. So schlief sie. Die Lippen halb geöffnet, atmete sie tief, auf dem Gesichte den ernsten, besorgten Ausdruck, den Menschen in schwerem Schlafe annehmen, als sei das Schlafen eine Arbeit.
Werner betrachtete sie eine Weile. Er fühlte plötzlich ein tiefes Erbarmen mit diesem jungen schlafenden Wesen. Auch wieder die Nerven und die unnütze Weichheit! Er konnte ja jetzt nichts mehr ansehen, ohne dass es schmerzte!
Behutsam nahm er Lene auf seine Arme und trug sie in das Schlafzimmer hinüber.
*
Die Sakristei war voller Schneelicht. Zwischen den engen, weißen Wänden, in dem weißen Lichte, sah Pastor Werner, im schwarzen Talare, sehr groß aus. Er saß am Tisch, vor sich das aufgeschlagene Gesangbuch und das Blatt mit den Notizen zu seiner Predigt. Draußen sangen sie schon das Lied, ein Chor harter Frauenstimmen, heiserer Kinderstimmen, dazwischen das Knarren der Bässe. Sie zogen die Töne schläfrig und beruhigt. Gott! spielte der Organist heute tolles Zeug zusammen! Sicherlich hatte der Mann wieder die ganze Nacht durch gesoffen. Die alte Orgel stöhnte und seufzte ordentlich unter seinen rücksichtslosen Fingern.
Werner sang nicht mit. Er schaute zum Fenster hinaus. Es taute und die Sonne schien. Die Bäume hingen ganz voll blanker Tropfen und das beständige Tropfen vom Dache und den Traufen legte um die Kirche ein helles Blitzen und Klingen.
Sonntäglich! Die Sonntagsstimmung war da, die kam immer, aus alter Gewohnheit, anfangs feierlich, später angenehm schläfrig. Er liebte diesen Augenblick in der Sakristei vor der Predigt, wenn er dasaß und sich voll großer Worte, voll lauter, eindringlicher Töne fühlte.
Er horchte hinaus. Er kannte die Schellen der Schlitten, die heranfuhren. Das waren die Schellen von Debschen, das – der Doktor Braun, das die Schellen von Dumala.
Dennoch fragte er, als der Küster eintrat: »Wer ist alles da?«
Der Küster Peterson legte sein großes, schlaues Bauerngesicht in pastorale Falten.
»Die Dumalaschen sind da«, meldete er, »die Baronin und der Sekretär.«
»Wer noch?« fragte Werner ungeduldig. Warum meldete der Kerl gerade nur die Dumalaschen?
Peterson zog ergeben die Augenbrauen empor:
»Der Doktor ist da, die aus Debschen.« –
»Gut – gut.« Werner winkte ab. Es war doch ganz gleichgültig, ob der Doktor da war und die Alte aus Debschen!
Nun war es Zeit, auf die Kanzel zu steigen, sie sangen da drin schon den letzten Vers des Liedes. Werner freute sich, zu finden, dass die Kirche voller Licht war. Wenn die breiten, gelben Lichtbänder durch die hohen Fenster in den Raum fluteten, dann bekam seine Predigt auch anders helle Farben, als wenn die Kirche voll grauer Dämmerung war, und der Regen gegen die Fensterscheiben klopfte.
Es roch nach nassen, schweren Wollkleidern, frischgewaschenen Kattuntüchern und Transtiefeln.
Werner beugte sich über das Pult auf der Kanzel zum Gebet. Dieser Augenblick brachte ihm stets eine sanfte, andächtige Ekstase, so die Stirn auf das Pult zu legen, und unten wurde es still, und sie warteten, warteten auf sein Wort.
Die Predigt begann. Die eigene Beredsamkeit erwärmte ihn heute besonders. Er hörte es, wie die Leute unten aufmerksam wurden, wie das Husten und Sichräuspern schwiegen.
Und Werner gab seiner Stimme vollere Töne, machte große, freie Bewegungen. Er wusste es wohl, die meisten dort unten verstanden ihn nicht, aber heute drängte eine innere Erregung ihn, hinauszusagen, hinauszurufen, was ihn bewegte.
»›Falle vor mir nieder und bete mich an‹, sprach der Böse zum Sohne Gottes. ›Bete mich an!‹ Ja, das ist es, das will er. Er hat nicht genug mit unseren Sünden der Schwäche, der Nachlässigkeit, der Bosheit, des Unglaubens, nein, niederfallen sollen wir vor ihm und ihn anbeten. Er will angebetet, er will verehrt, er will geliebt werden. Danach dürstet er. Er will, dass wir zu ihm sprechen: Um dich geben wir die ewige Seligkeit und die Gotteskindschaft hin, dir opfern wir sie, um dich gehen wir mit offenen Augen in unser Verderben, weil wir dich anbeten, weil du uns groß und liebenswert erscheinst, weil wir zu dir wollen. Der Böse will, dass wir die Sünde lieben, dass wir sie anbeten. Das ist sein Triumph. Das ist das tiefe, furchtbare Geheimnis der Sünde.« Die Stimme des Pastors hatte hier einen tiefen, geheimnisvollen und leidenschaftlichen Tonfall angenommen, wie eine unheimliche Liebeserklärung an die Sünde klang es.
Er hielt inne, selbst erstaunt über das, was er sagte. Es klang fremd in die Kirche hinein, und zugleich schien es ihm, als verriete er etwas, als spräche er etwas aus, das geheim sein sollte und nur von ihm geahnt wurde.
Er schaute hinunter auf die Gemeinde.
Ruhig saßen sie da alle beisammen. Alte Frauen schliefen. Mädchen, mit glattgebürstetem Haar, die Hände im Schoß gefaltet, starrten ausdruckslos vor sich hin, genossen die Ruhe des Augenblicks. Ihm gegenüber im Gestühle der Werlands von Dumala saß die Baronin Karola. Sie hatte den Kopf leicht zurückgelehnt und schaute scharf zu ihm herüber, sie kniff dabei die Augenlider zusammen, sodass die Augen nur wie sehr blanke Striche zwischen den langen Wimpern hervorschimmerten.
Werner ging zum Schluss seiner Predigt über. Seine Stimme nahm wieder ihren ruhig ermahnenden Ton an, in dem erbaulich das Metall seines schönen Baritons mitklang.
Nach dem Gottesdienst fragte Werner den Küster, während er sich in der Sakristei umkleidete:
»Ist die Baronin aus Dumala schon fortgefahren?«
»Nein«, meinte der Küster, »die Frau Baronin wartet auf den Herrn Pastor – wie immer.«
»Wieso – wie immer?« fragte Werner ungeduldig. »Peterson, Sie fangen an, Unsinn zu sprechen.«
Leute kamen zu ihm, die Waldhäuslerin Marri, ihre Mutter, die alte Gehda, konnte nicht sterben, das dauerte nun schon Wochen. Der Herr Pastor soll herüberkommen. Werner fertigte die Leute eilig und mechanisch ab, sagte das nötige »Gott weiß am besten, wenn er uns zu sich ruft. Wir müssen warten«. Die Waldhüterin klagte, dass ihr Mann sie zuschanden schlug, wenn er besoffen war.
Werner zog sich seinen Pelz an. »Ja, ja – ich komme mal an. Gott behüt’ euch lieben Leute – Gott befohlen.« Eilig ging er hinaus.
Die Baronin Karola stand vor ihrem Schlitten, sehr schlank, fest in die blaue Pelzjacke geknöpft, das Gesicht ganz rosa von der scharfen Winterluft, der Mund unnatürlich rot, die Stirnlöckchen voller Tropfen unter der kleinen Fischottermütze. »Ah, Pastor!« rief sie, »ich warte auf Sie. Sie dürfen uns heute nicht verlassen. Ja – er leidet, und es ist abends so traurig bei uns. Also, Sie kommen?« Sie reichte ihm die Hand, schüttelte die seine mit unterstrichener Kameradschaftlichkeit. »Die Verlassenen trösten ist ja doch Ihr Amt.« Sie lächelte, wobei ihre Mundwinkel sich hinaufbogen, was ihr einen leicht durchtriebenen Ausdruck verlieh.
Werner verbeugte sich in seiner feierlichen Art, die etwas Befangenes hatte.
»Oh – gewiss – mit Vergnügen«, und er lächelte auch aus reinem Behagen, diese schöne Frau anzusehn.
»So, danke«, sagte sie. »Jetzt wollen wir fahren, mein Page friert.« Karl Pichwit, der Sekretär und Vorleser des Barons Werland, fror immer. Sein hübsches, kränkliches Knabengesicht war blau von Frost, und er zitterte.
Er half der Baronin in den Schlitten, setzte sich neben sie, und da lächelte auch das kränkliche Knabengesicht und errötete.
Werner stand noch eine Weile da und schaute dem Schlitten, dem Wehen des blauen Schleiers auf dem Fischottermützchen nach, er schützte die Augen mit der Hand vor der Sonne, um länger und besser sehen zu können.
*
»Ich finde es rücksichtslos«, sagte Lene beim Mittagessen zu ihrem Mann, »dass die Werlands dich immerfort hinüber bitten. Ich bin jeden Sonntagabend allein. Der Sonntag gehört doch wenigstens der Familie.«
Werner zuckte die Achseln, ja, daran war nichts zu ändern. Drüben ging es nicht heiter zu, da musste er eben – –
Aber Lene ärgerte sich.
»Ach was! Dieser Baron, der Gottlosigkeiten und Unanständigkeiten spricht, der ist überhaupt kein Umgang für einen Pastor.«
Werner lächelte nur und aß ruhig seinen Sonntagsbraten. Lene erregte sich immer mehr. »Ach was – der Baron! Der ist’s ja gar nicht. Sie ist’s!«
»Sie?« Werner schaute auf.