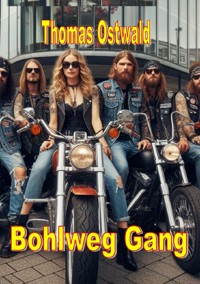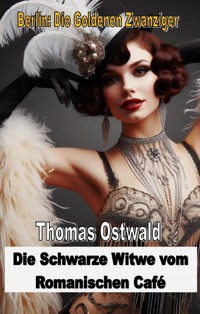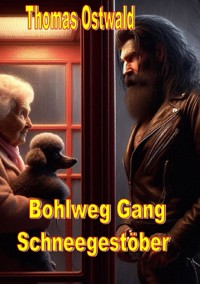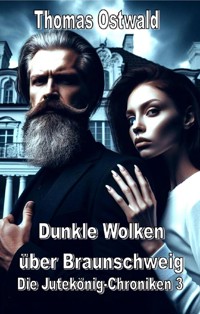
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Familie Spiegelberg nähert sich im dritten Band der Chronik der Jutekönige der verhängnisvollen Zeit von 1930 bis 1933. Der Freistaat Braunschweig erlebt die Auswirkungen der politischen Unruhen, als die NSDAP in den Landtag einzieht und Hitler zum deutschen Staatsbürger gemacht wird. Mitten im Zeitgeschehen stehen die Schicksale der Familien Spiegelberg und Neugebauer. Mit der ersten Jutefabrik Europas sind sie aufgestiegen zu bekannten und geschätzten Unternehmern. Die Textilfabrik fertigt inzwischen eigene Mode an, als sie den Auftrag erhält, Uniformen für die SA zu schneidern. Das aktuelle Geschehen in Deutschland scheint alles zu überrollen und die beiden Familien in einen wilden Strudel der persönlichen Erlebnisse zu ziehen. Es gibt schließlich für alle nur noch einen Weg - sich anpassen oder untergehen. Wie wird diese Entscheidung das Schicksal der Menschen bestimmen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Ostwald
Dunkle Wolken über Braunschweig
Die Jutekönig-Chroniken 3
Thomas Ostwald
Dunkle Wolken über Braunschweig
Die Jutekönig-Chroniken 3
Historischer Roman
Edition Corsar D. u. Th. Ostwald
Braunschweig
Impressum
Texte: © 2023 Copyright by Thomas Ostwald
Umschlag:© 2023 unter Verwendung eines mit Bing Creator erstellten Bildes
Verantwortlich für den Inhalt:Thomas Ostwald
Am Uhlenbusch 17, 38108 Braunschweig
Erstes Kapitel:
Braune Hemden
„Ich habe es euch prophezeit! Ich habe es schon damals gesagt!“
Eliot Spiegelberg stand vor der Familie seines Bruders David mit hochrotem Kopf und einer zusammengeknüllten Zeitung in der Hand. Er war eben zu ungewöhnlich früher Stunde in das Haus am Augusttorwall 3 gekommen und überraschte das Ehepaar noch an der Frühstückstafel. Sowohl Esther wie auch David wussten sofort, worauf der vor Wut zitternde Eliot anspielte. Aber seine Schwägerin war sofort bemüht, Eliot zu beruhigen und wies lächelnd auf einen freien Stuhl an ihrer Tafel. Ihre Kinder Jakob und Noah, sechsundzwanzig und vierundzwanzig Jahre alt, waren bereits in aller Frühe aufgestanden und in die Textilfabrik gegangen, wo beide ihrem Vater in der Geschäftsführung folgten.
„Komm, Eliot, setz dich und trink eine Tasse von dem guten, englischen Tee, das beruhigt die Nerven. Möchtest du noch etwas essen, wir haben Brot und Aufstrich gerade eben erst abräumen lassen.“
„Nein, danke, lass nur. Aber den Tee nehme ich gern!“, erwiderte Eliot und ließ sich schwer auf den Stuhl fallen. „Was für ein Tag! Dabei wollte ich eigentlich nur zur Theaterkasse gehen und mir Karten für die Sonntagsvorstellung holen, als ich diese Zeitung am Kiosk entdeckte!“ Damit schlug Eliot Spiegelberg wütend auf die ohnehin schon zerknitterte Ausgabe der Zeitung Montagsblatt. Unabhängige Zeitung für nationale und soziale Politik, deren Überschrift in dicken Lettern verkündete: Hitler deutscher Staatsbürger!
„Du hast schon 1930 gewarnt, nachdem die NSDAP bei der Wahl 30 Prozent erreichte, und bist wohl einer der ganz wenigen in dieser Stadt, der immer wieder vor diesen braunen Uniformträgern warnte!“, erwiderte David. „Aber du merkst doch auch, wie wenige diese heraufziehende Gefahr erkennen, Eliot. Allein die Farce um die Einbürgerung Hitlers bewegte die Presse, und als schließlich die Geschichte mit seiner Ernennung in Thüringen überall für schallendes Gelächter sorgte, glaubte ich längst nicht mehr an eine solche Möglichkeit. Aber wie glaubwürdig ist denn dieses Montagsblatt?“
Eliot nahm einen Schluck Tee, schluckte und überlegte kurz.
„Nun, es kommen ja für einen solchen Schritt nur zwei Länder in Betracht, weil dort die NSDAP in der Regierung sitzt – Thüringen und der Freistaat Braunschweig. Und nachdem sich Thüringen dermaßen blamiert hatte, wird wohl der Freistaat Braunschweig Vorreiter gewesen sein.“
Der Innenminister und Minister für Volksbildung in Thüringen, Wilhelm Frick, wollte Adolf Hitler zum Gendarmerie-Kommissar in der Kreisstadt Hildburghausen ernennen, um ihm damit die deutsche Staatsangehörigkeit zu geben und den Weg zur Wahl des Reichskanzlers zu ebnen. Dieses Scheingeschäft flog auf und wurde in der deutschen Presse weidlich ausgeschlachtet.
„Meinst du wirklich, Bruderherz, dass der Freistaat sich dazu hergegeben hat?“, erwiderte David.
„Eine andere Möglichkeit sehe ich überhaupt nicht. Wenn nicht Thüringen, dann eben hier. Das trifft uns alle, denn wenn ein Mensch wie Adolf Hitler Reichskanzler wird, dann wird es eng für uns im Staat – denk an meine Worte!“, erwiderte Eliot mit finsterer Miene. „Wir reden darüber schon seit langer Zeit im RjF, durchaus kontrovers.“
David wusste, dass Eliot seit einiger Zeit Mitglied im Reichsbund jüdischer Frontsoldaten war, seitdem man jüdische Mitglieder aus dem „Stahlhelm“, der Vereinigung der Frontsoldaten, gedrängt hatte. Der damalige, antisemitische Vorwurf traf Eliot Spiegelberg hart. Er war im Großen Krieg an der Front, zusammen mit weiteren gut 85.000 deutschen Juden. Dass schon sein Urgroßvater Samuel Spiegelberg zum christlichen Glauben konvertiert war, schien niemanden mehr zu interessieren. Die Spiegelbergs galten in Braunschweig als reiche Juden, die neben der Jutefabrik auch eine Textilfabrik zum Erfolg geführt hatten – gemeinsam mit der Familie Neugebauer. Karl Friedrich Neugebauer, unehelicher Sohn von Julius, wurde von seinem Vater später anerkannt und trat zusammen mit seinen Halbbrüdern in die Führung der Jutefabriken Vechelde und Braunschweig ein.
Gustav und Wilhelm Neugebauer verstanden sich mit den Spiegelberg-Brüdern gut, und auch die nächste Generation mit den Söhnen Karl Gustav und Heinrich Wilhelm verstanden sich mit den etwa gleichaltrigen Jakob und Noah Spiegelberg glänzend und arbeiteten gemeinsam in den Fabriken als Geschäftsführer. Trotz der zahlreichen Streiks der vergangenen Jahre, die immer wieder ganze Industriezweige betrafen und die Produktionen lähmten, nahmen die Fabriken in Braunschweig wieder wirtschaftlichen Aufschwung. Nur die ursprüngliche Flachs- und Jutefabrik in Vechelde kam nicht mit dem Aufschwung Braunschweigs mit und führte eher ein Schattendasein. Die Fabrik musste schon häufiger in die Bemühungen der Direktoren einbezogen werden, Aufträge wurden herbeigeschafft, aber selbst die umliegenden, zahlreichen Bauernhöfe genügten mit ihrer Abnahme von Jutesäcken nicht für einen wirtschaftlichen Betrieb. Das war in Braunschweig durch frühzeitige Kontakte mit dem Hamburger Hafen besser gelaufen – Jute diente als hoch geschätztes Verpackungsmaterial der Waren, die in Ballen nach Übersee verschifft wurden. Auch wenn die Direktoren sich bemühten, einen Teil der Produktion wieder nach Vechelde zu verlagern, so waren die dortigen Maschinen inzwischen technisch überholt und konnten nicht mit dem modernen Maschinenpark in der Stadt mithalten. Für Investitionen war jedoch kein Geld vorhanden, nur durch geschicktes Vorgehen bei den Löhnen der Fabrikarbeiter und die Sanierung der Arbeiterwohnungen wurde es möglich, Streiks abzuwenden und die Arbeiter an die Firma zu binden.
Eliots Blick wanderte durch das Zimmer, streifte die schwere, dunkle Kredenz, auf der zwei Chanukkaleuchter standen, jene jüdischen Leuchter mit acht Armen und einem neunten Dienerlicht, dem Schamasch, wurden nur zum Chanukkafest angezündet. Und an solchen Bräuchen hielt man im Haus Spiegelberg trotz des christlichen Glaubens fest, weil es einfach alte Familientradition war. Die Leuchter wurden 1897 von Hemda Ben-Jehuda geschaffen, der als Erneuerer des Hebräischen galt.
Eliots Blick verharrte kurz auf diesen Leuchtern, dann blieb er auf dem Gemälde seines Vaters Julius Spiegelberg hängen, das ihn etwa im gleichen Alter wie den Großvater Samuel Spiegelberg auf der gegenüber liegenden Wand zeigte. Eliot schien kurz Zwiesprache mit dem Bild zu halten, dann nickte er und erhob sich. „Was hast du jetzt vor, Eliot?“, erkundigte sich Esther besorgt.
„Ich werde von hier zu Fuß in die Fabrik gehen, das wird meine Gedanken ablenken und mir den Kopf freimachen. Wir sehen uns dann später, David!“
Damit reichte er Esther die Hand, nickte seinem Bruder ernst zu und war schon auf dem Flur, wo er sich seinen Hut vom Haken nahm und aus der Tür war, noch ehe David überhaupt reagieren konnte. Der jüngere Spiegelberg war ebenfalls tief in Gedanken versunken, und als seine Frau ihn sanft berührte, schrak er wie aus einem Traum auf und sah sie verwundert an.
„Was denn, Liebes? Eliot hat doch recht, schon nach der letzten Landtagswahl, als die Bürgerliche Einheitsliste und die NSDAP eine Koalition bildeten, warnte er uns vor den möglichen Folgen. Zunächst sah es ja mit dem Dr Anton Franzen noch recht harmlos aus, aber dann kam dieser… Klagges als Innen- und Volksminister, und Eliot hob erneut den Zeigefinger. Er behielt recht, denn seit dieser Zeit sind die Angriffe gegen Juden im Freistaat häufiger geworden und diese ekelhaften Schutztruppen der Partei, die man ja gern als Braunhemden bezeichnet, treten in den Straßen immer unverschämter auf. Da verstehe ich unsere Polizei nicht, die nichts gegen diese Schlägergruppen unternimmt!“
Gedankenverloren hatte sich David noch eine Tasse Tee eingeschenkt, aber als er einen Schluck probierte, stellte er fest, dass der Tee inzwischen kalt war. Mit einem Seufzer erhob er sich und verabschiedete sich von Esther.
„Du willst so früh schon ins Büro, David? Du könntest doch die Jungen ganz beruhigt machen lassen und dafür mir noch Gesellschaft leisten!“, sagte Esther ein wenig schmollend.
„Keine Sorge, Esther – ich gehe erst heute Nachmittag in die Textilfabrik. Aber ich habe jetzt noch einen Termin bei Dr Katzenstein in der Ferdinandstraße, erinnerst du dich?“ - „Ach du liebe Güte, ja, Dr Katzenstein! Hatte ich vollkommen verdrängt! Er wollte dir ja etwas gegen deine ständige Müdigkeit verschreiben und hat wohl jetzt endlich auch die Untersuchungsergebnisse. Wie konnte ich das vergessen! Aber bleibe bitte nicht über das Mittagessen hinaus bei ihm!“
David, der schon an der Esszimmertür stand, drehte sich verwundert um.
„Warum sollte ich denn so lange in der Praxis bleiben?“
Rasch war Esther an seiner Seite, schlang die Arme um seinen Hals und zog ihn zu sich herunter, um ihm einen leidenschaftlichen Kuss zu geben. Dann riss sie sich wieder los und erwiderte lachend: „Als ob ich euch Männer nicht längst kennen würde! Der Doktor ist doch auch Mitglied im RjF und wird sicher ebenfalls diese unangenehmen Mitteilungen erfahren haben. Und wie ich euch beide einschätze, werdet ihr euch darüber die Köpfe heißreden!“
„Keine Sorge, Esther – dazu wird Katzenstein gar keine Zeit haben, und schließlich bin ich ja für ihn nur der jüngere Bruder und zudem ein Ungedienter! Keine Sorge also – bis später!“
Damit war er hinaus und eilte auf den Hof, wo sein Auto stand. Aber die kurze Strecke wollte er zu Fuß zurücklegen, warf nur einen kurzen Blick auf den Rücksitz, wo er am Vorabend seine Aktentasche vergessen hatte und eilte bei ihrem Anblick beruhigt weiter.
Esther wollte zum Wochenmarkt. Zwar wäre der Einkauf dort Sache ihrer Köchin, aber es reizte sie auch immer wieder selbst, die kleineren Dinge zu erledigen. Am kommenden Wochenende erwarteten sie ein befreundetes Paar aus Berlin, und Esther wollte das Gemüse zu ihrem Mittagessen persönlich aussuchen. Sie griff sich einen stabilen Weidenkorb aus der Abstellkammer neben der Küche, setzte sich ein kleines Hütchen keck auf den Kopf und wollte das Haus verlassen, als plötzlich der alte Hausknecht in den Flur trat. „Wollen Sie zum Markt, gnädige Frau?“, erkundigte er sich freundlich.
„Ja, Hartwig, das habe ich vor. Ich möchte gern einmal sehen, was es an Gemüse im frühlingshaften Februar in Braunschweig gibt!“, erwiderte Esther lächelnd.
„Erlauben Sie mir, Sie zu begleiten, Frau Spiegelberg?“
Esther stutzte verwundert.
„Ja, aber warum das, lieber Hartwig? Einen Kohlkopf werde ich noch selbst tragen können!“
Der alte Hausknecht verbeugte sich leicht, und als er sich wieder aufrichtete, sah Esther das Lächeln in seinem faltenreichen Gesicht. Hartwig war zwar ein alter Mann, aber noch immer kräftig und jederzeit hilfsbereit. David hatte ihn angestellt, weil er von seiner früheren Anstellung gute Zeugnisse aufwies und zudem einen freundlichen Eindruck machte. Wo es nur ging, machte sich Hartwig in Haus und Hof nützlich und wusch an jedem Wochenende auch ihre beiden Automobile. Neben dem alten Benz 10/30 war Davids ganzer Stolz der seit 1928 gebaute Typ 27, der mit einem Kompressor ausgestattet war und tatsächlich unglaubliche 200 PS entwickeln konnte. Esther teilte die automobile Leidenschaft ihres Mannes und hatte bereits einige heimliche Fahrversuche an seiner Seite mit dem harmlosen 10/30 hinter sich gebracht.
Als sie David mit ihrem Wunsch überraschte, ein Automobil selbst zu steuern, war der zunächst davon wenig angetan. Aber schließlich wies Esther auf Bertha Benz hin, die schließlich mit dem Motorwagen Nummer 3 eigene Fahrten unternahm und als Pionierin des Kraftwagens neben ihrem Mann Carl wurde. David schwieg dazu und gab damit sein stilles Einverständnis. Zu seiner großen Überraschung erwies sich Esther als sehr talentierte Autofahrerin.
„Also, Hartwig, einverstanden. Dann werden wir allerdings auch Kartoffeln kaufen, und es wird sinnvoll sein, wenn du den Handkarren mitnimmst.“ - „Gern, gnädige Frau, das soll mir ein Leichtes sein!“
Vergnügt leise eine Melodie vor sich hinbrummend, schob der alte Hausknecht in einem Abstand von gut drei Metern den Handkarren hinter seiner Hausherrin. Es wäre ihm nicht in den Sinn gekommen, etwa an ihrer Seite zu gehen, auch wenn ihn Esther dazu nachdrücklich aufforderte.
„Nein, gnädige Frau, das gehört sich nicht. Ich alter Kerl an der Seite einer so hübschen und eleganten Dame – was sollen da die Leute denken!“
Esther lachte zu seiner Bemerkung und gab es auf dem Weg schließlich auf, Hartwig an ihre Seite zu holen. Den Besuch ihres Schwagers hatte sie schon wieder verdrängt, fühlte sich in der milden Frühlingsluft beschwingt und eilte mit einem Korb über dem Arm nun voraus zum Altstadtmarkt, wo bereits zahlreiche bunte Marktstände aufgebaut und dicht von der Kundschaft umlagert waren. Sie wusste, welcher der Bauern aus der näheren Umgebung das beste Gemüse hatte und ging langsam durch die engen Marktreihen bis kurz vor die Martini-Kirche, wo sich eine lange Schlange vor dem Stand gebildet hatte, den sie aufsuchen wollte. Also nutzte sie die Gelegenheit, sich zunächst noch bei den anderen Anbietern ein wenig umzusehen.
Esther Spiegelberg liebte die Gerüche, die sich über dem Markt ausbreiteten. Tatsächlich roch es nach Apfelsinen, und es gab einen Händler, der wohl noch große Bestände der exotischen Früchte anbot, die man für gewöhnlich zur Weihnachtszeit erhielt. Gleich daneben lagen große Walnüsse, und da nun einmal Hartwig mit seinem Karren dabei war, nutzte sie die Gelegenheit, um sowohl Apfelsinen als auch ein Netz voller Walnüsse zu erstehen.
Der nächste Stand hatte Berge von roten und weißen Kohlköpfen kunstvoll zu kleinen Pyramiden aufgetürmt, und es gab zusätzlich einen kleinen Fliegenschrank, in dem der Händler Schaf- und Ziegenkäse hatte. Auch hier kaufte Esther eine größere Menge, denn sie liebte beide Sorten mit ihrem etwas herben Geschmack.Dann aber war sie an dem Marktstand angelangt, bei dem sie Äpfel, Birnen und Weißkohl kaufen würde.
Die Schlange bei ihrem Lieblingsstand war in der Zwischenzeit kaum kürzer geworden. Geduldig wartete Esther ab, bis sie sich langsam heranschieben konnte und gab gerade ihren Wunsch dem rotwangigen Bauernsohn bekannt, als es in der Nähe bei einem anderen Stand laut wurde.
Erschrocken drehten sich die Menschen um, denn dort brüllten mehrere Männer so laut und unflätig, dass Esther unwillkürlich die Hände ballte, als sie die braunen Schaftmützen auf den Köpfen von drei Männern entdeckte, die eben dabei waren, einen Marktstand umzukippen. Mehr war zunächst von den SA-Männern nicht zu erkennen, weil die anderen Marktbesucher dicht um das Geschehen standen, ohne sich zu regen.
Hastig drängte sich Esther durch die Menge, als sie die Stimme eines Mannes vernahm, der vermutlich der Verantwortliche für das Geschehen war.
„Merke dir eines, Itzig – sehe ich dich noch einmal hier zwischen deutschen Bauern, poliere ich dir so gründlich die Fresse, dass du es nicht vergessen wirst!“, schrie er gerade, und als es Esther gelang, die vordere Reihe der Zuschauer zu durchbrechen, erkannte sie einen älteren Mann, der inmitten der Trümmer seines Marktstandes hockte. Blut lief ihm aus der Nase, und die Hände hatte er abwehrend über den Kopf gehoben.
„Aber ich bin… ich bin auch…“
„Halt dein Maul, oder willst du noch etwas drauf haben?“
Esther wollte gerade die umstehenden Marktbesucher anschreien, ob denn niemand dem armen Mann helfen wollte, als sich der Wortführer zu ihr umdrehte. Ein Blick in sein Gesicht ließ sie erschrocken verstummen.
Diesen Mann hatte sie schon einmal gesehen.
Es war der ehemalige Lohndiener Wolfgang Brandes, des Diebstahls bei der Feier im Hause Spiegelberg 1919 überführt und ins Gefängnis gebracht worden. Unverkennbar leuchtete seine rote Narbe, die er nicht im Großen Krieg an der Front, sondern durch den Kampf mit einem Polizisten erhalten hatte. Brandes riss seine Augen weit auf, als er Esther erblickte. Die hatte sich sofort wieder gefasst, machte zwei Schritte nach vorn und bot dem niedergeschlagenen Markthändler ihre Hand.
„Lassen Sie das lieber!“, raunte der Mann, aber Esther packte seine rechte Hand fest und warf einen Blick auf die Männer, die sich noch immer nicht rührten.
„Die Frau Spiegelberg! Sieh mal einer an, was für eine nette Überraschung!“, höhnte Brandes, und auch seine beiden Begleiter in den braunen Uniformen grinsten schadenfroh. Offenbar war das alles für sie ein Riesenspaß.
Esther ignorierte die SA-Männer und sagte zu dem nächsten Mann: „Und Sie sehen einfach zu, wie hier ein Mensch angegriffen, sein Marktstand zerstört wird, die ganzen Hühnereier im Dreck zertreten werden und helfen nicht? Pfui Teufel, was sind das alles für Feiglinge hier! Gaffen und blöd grinsen – mehr könnt ihr wohl nicht?“
Mit ihrer Hilfe war es dem Niedergeschlagenen gelungen, sich wieder aufzurichten. Dabei vermied er es, die Braunhemden anzusehen. Aber Brandes war mit ihm noch nicht fertig.
„So geht das aber nicht, Frau Spiegelberg! Sie mögen es ja gewohnt sein, dass man Ihren Worten folgt, aber da sind Sie bei mir an der falschen Adresse! Es kommen andere Zeiten, und in Zukunft werden wir dafür sorgen, dass das jüdische Pack aus unserer Stadt verschwindet! Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Spiegelberg hört sich eigentlich verdammt jüdisch an!“
Brandes stieß ein dröhnendes Gelächter aus, und wieder stimmten seine beiden Begleiter ein. Das aber schien die starre Haltung der Umstehenden zu brechen. Zwei Männer traten vor und hoben die Bretter des Markstandes auf, lehnten sie an die Mauer des Gewandhauses. Der Niedergeschlagene hatte mehrere Körbe mit Hühnereiern angeboten, die von den SA-Leuten rücksichtslos umgekippt wurden. Mit ihren Stiefeln waren sie darauf herumgetreten, und auch einer der Böcke, auf denen die Bretter lagen, war dabei zerstört worden. Der Stand ließ sich so nicht mehr aufbauen.
„He, was soll das?“, rief Brandes mit seiner lauten Stimme. „Dem Juden wird nicht geholfen, verstanden? Und was Sie angeht, Frau Spiegelberg, so haben wir beide noch eine offene Rechnung, nicht wahr? Glauben Sie nicht, dass ich vergessen habe, was Sie mir 1919 angetan haben!“
Esther lachte laut auf und wandte sich an die Umstehenden.
„Wie kann ich den Dieb meines Tafelsilbers vergessen? Sie haben als Lohndiener in unserem Haus gestohlen, wurden überführt und bestraft! Ich weiß nicht, was das für eine offene Rechnung sein soll!“ - „Frech werden auch noch!“, brüllte Brandes auf und griff nach Esthers Arm. Geschickt wich sie ihm aus und rief dazu: „Fassen Sie mich nicht an, Sie… Sie Unhold!“
Das schien nun die drei SA-Männer herauszufordern. Gerade wollten sie gemeinsam Esther packen, als einer der drei mit einem lauten Schmerzensruf zur Seite sprang. Verwundert starrte er auf einen Handwagen, den ihm ein alter Mann gegen das Schienbein gefahren hatte.
„Pass doch auf, du alter Trottel!“, brüllte der SA-Mann und rieb sich das Bein. „Selber Trottel!“, antwortete Hartwig gelassen und griff nach einem der Handsparren, die man problemlos aus der Halterung herausziehen konnte. „Und Hände weg von der Frau, ihr feigen Kerle! Sonst setzt es etwas!“
„Hört euch den Alten an!“, rief Brandes und wollte nach dem Handsparren greifen, um ihn an sich zu reißen. Aber da hatte er Hartwig unterschätzt, der ihm blitzschnell auf die Knöchel schlug.
Mit einem Wutschrei rieb sich Brandes die Hand und machte Miene, sich jetzt erst recht auf den alten Hausknecht zu stürzen. Aber in diesem Augenblick schoben sich die beiden Männer zwischen ihn und Hartwig. Es waren dieselben, die dem niedergeschlagenen Händler zusammen mit Esther aufgeholfen hatten und seinen Stand zusammenräumten.
„Stopp – es reicht! Hier wird nicht geprügelt, und schon gar nicht werden Frauen und alte Männer geschlagen, haben wir uns verstanden?“
Der Mann wirkte entschlossen, seine Miene drückte jedenfalls aus, dass er bereit war, sich mit den drei Braunhemden anzulegen. Tatsächlich griff einer der drei an seine Schulter, aber das sollte er gleich darauf bereuen. Der Mann fuhr auf dem Absatz herum und gab dem SA-Mann eine derart gewaltige Backpfeife, dass sein Gegner ein paar Schritte zurücktaumelte und um ein Haar gegen einen anderen Marktstand getaumelt wäre.
Sofort machten die beiden anderen gegen den Mann Front, aber der war nun gerade erst warm geworden. Blitzschnell riss er sein Jackett herunter und warf es Esther zu, die es geschickt auffing. Dann stand der Mutige in Boxerstellung vor Brandes und dem zweiten Mann, die Fäuste geballt, das rechte Bein leicht vorgelagert.
„Was ist nun – möchtet Ihr wissen, was es heißt, gegen einen Mann zu kämpfen – oder seid ihr nur stark gegenüber Frauen?“
„Los, Karl, dem zeigen wir es!“, rief Brandes und schlug ohne Vorwarnung nach dem Gegner. Der machte nur eine leichte Bewegung und wich dem Schlag aus. Gleich darauf landete er seinen Treffer direkt auf der Kinnspitze des SA-Mannes. Wolfgang Brandes verdrehte die Augen und schlug der Länge nach rückwärts auf das Pflaster.
„Du auch noch?“, rief der Boxer kampflustig dem dritten Mann zu, der das Geschehen mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen verfolgt hatte. Der aber kniete neben seinem Anführer nieder und versuchte, den Besinnungslosen wieder aufzuwecken. Wolfgang Brandes bot einen hilflosen Anblick. Ein dünner Blutfaden sickerte aus seinem Mundwinkel und lief über den Kragen seines braunen Hemdes. Auch der andere Uniformierte kümmerte sich jetzt um Brandes, und die umstehenden Marktbesucher tuschelten leise untereinander. Als der Boxer lächelnd vor Esther und Hartwig stand, sich leicht verbeugte und sein Jackett wieder in Empfang nahm, bedankte sich Esther herzlich bei ihm.
„Schon gut, gnädige Frau. Leider macht sich dieses Braunhemdengesindel in der letzten Zeit immer häufiger in unserer schönen Stadt breit. Es wird höchste Zeit, ihnen ihre Grenzen aufzuzeigen.“
„Das war sehr mutig von Ihnen, und auch von dir, Hartwig. Bitte, nennen Sie mir doch Ihren Namen, damit ich weiß, wer mein Retter war!“, sagte Esther Spiegelberg lächelnd.
„Friedrich Kurth mein Name. Ich bin eigentlich gar kein Boxer, sondern Schauspieler. Aber ich glaube, ich habe meine Rolle überzeugend dargestellt, oder?“
Esther reichte ihm die Hand.
„Durchaus, Herr Kurth. Ich bin Esther Spiegelberg und möchte Sie herzlich bitten, doch Morgen um halb Vier Nachmittags auf eine Tasse Kaffee oder auch Tee zu uns zu kommen, Augusttorwall 3.“
„Aber, gnädige Frau, ich habe doch nur…“, erwiderte der junge Mann und verbeugte sich.
„Sie haben nur Courage bewiesen, Herr Kurth, und eine unangenehme Situation gemeistert. Dafür möchte ich mich bedanken und Sie meinem Mann David vorstellen.“