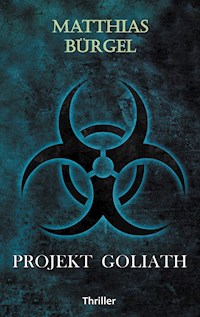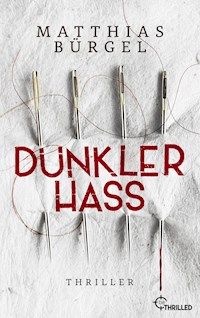
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Fallanalytiker Falk Hagedorn
- Sprache: Deutsch
Ein Serienkiller verschleppt junge Frauen, die er grauenvoll verstümmelt und tötet. Hilfesuchend wendet sich Kommissar Marius Bannert an den bekannten Fallanalytiker Falk Hagedorn, der nach einem Unfall an den Rollstuhl gefesselt ist. Gemeinsam tauchen die beiden Kriminalisten nach und nach in die Psyche des Täters ein. Doch als sie beginnen, seine Motivation zu erahnen, holt der Killer zum Gegenschlag aus - und ein tödlicher Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
"Wieso hast du dich entschieden, mir zu helfen?" - "Ich weiß es nicht genau. Der Fall fasziniert mich. Der Täter fasziniert mich."
LESER-STIMMEN
"Ich war von Anfang bis Ende komplett gefesselt. (...) Der gesamten Story merkt man an, dass der Autor genau weiß, wovon er schreibt. Eigene Erfahrungen und prima Recherchen machen diesen Plot absolut stimmig." (Nellsche, Lesejury)
"Die Spannung begleitet den Leser von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Die Charaktere sind durchwegs authentisch und lebensecht geschildert (...). Ein absolut genialer Thriller, der mich vollends überzeugt hat und ich allen Thriller-Liebhabern wärmstens empfehlen kann (Andrea1978, Lesejury)
"Für jede Person mit guten Nerven und Interesse an Thrillern und Krimis ein absoluter Must-Read. Eine geniale Abwechslung, die Lust auf mehr Bücher dieser Sorte macht." (Vivi_2084, Lesejury)
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Zitat
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
Epilog
Danksagung
Über den Autor
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Am Bodensee verschleppt und tötet ein Serienkiller junge Frauen, die er auch noch grauenvoll verstümmelt. Und die Polizei tappt im Dunkeln. Der leitende Ermittler, Marius Bannert, wendet sich hilfesuchend an den Fallanalytiker Falk Hagedorn, der nach einem Unfall an den Rollstuhl gefesselt ist. Eigentlich will dieser von der Welt nichts mehr wissen – und von der Polizei noch viel weniger. Aber der Fall reizt ihn und er lässt sich von Bannert zur Mithilfe überreden. Über die Opfer gelingt es den beiden Kriminalisten nach und nach, die Psyche des Täters zu analysieren und die Motivation seiner Taten zu erahnen. Doch dann verschwindet plötzlich Hagedorns Tochter …
MATTHIAS BÜRGEL
DUNKLERHASS
»Die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft durch das Herz eines jeden Menschen.«
– Alexander Solschenizyn
Prolog
Zärtlich strichen seine Fingerspitzen über ihre samtene, blasse Haut. Zeichneten unendlich langsam die Konturen ihres weichen Körpers nach. Wie jedes Mal erfüllte ihn freudige Erregung, die seine Hände zittern ließ. Gewiss, sie hatten nicht unbegrenzt Zeit miteinander, dennoch zwang er sich zur Ruhe. Zu rar waren diese Augenblicke, als dass er den Zauber leichtfertig mit ungeduldigen oder ungestümen Handlungen brechen wollte.
Sie war jung und schön, blondes langes Haar umrahmte das engelsgleiche Gesicht. Die Augen geschlossen, die Lippen leicht geöffnet. Zweifellos genoss sie seine Berührungen ebenso wie er. Mit dem kleinen Finger strich er ihr eine Haarsträhne aus der Stirn und ließ seinen Blick über ihren makellosen Köper schweifen. Kleine, feste Brüste mit rosigen Nippeln, die zu liebkosen er kaum erwarten konnte. Er mochte keine großen Brüste. Konnte sie nicht leiden. Noch weniger mochte er große Warzenhöfe, aber ihre waren … perfekt!
Ein Piercing blitzte in ihrem Bauchnabel. Sanft strich er ihr über den Bauch, eine sanfte Wölbung nur, hinab zu dem Dreieck. Noch hatte sie die Beine geschlossen. Sie würde sie ihm bereitwillig öffnen, aber er gemahnte sich zur Geduld.
Regungslos, die Augen geschlossen, sehnte sie sich danach, an den intimsten Stellen berührt und liebkost zu werden.
Nur zu gerne würde er ihr den Gefallen tun. Langsam, sanft, unendlich zärtlich. Seine Erregung schien jedes Maß des Erträglichen überschritten zu haben. Schnell entledigte er sich seiner Kleidung und legte sich behutsam neben sie.
Die Kälte störte ihn nicht, er spürte sie kaum. Er umfing sie mit seinem Arm und küsste sie zärtlich auf die Lippen. So lange hatte er auf sie gewartet und sie auf ihn.
Diese Nacht würde magisch sein.
1. Kapitel
In der Nähe von Konstanz
Die Federung ächzte verdrießlich, als der vierzehn Jahre alte Toyota schaukelnd und quietschend über den Feldweg holperte. Grasnaben streiften schabend den Unterboden, was Marius Bannert unanständige Flüche entlockte. Eine abgerissene Kraftstoffleitung oder eine perforierte Ölwanne hätten ihm gerade noch gefehlt. Warum war er auch nicht zuerst zum Präsidium gefahren, um einen Dienstwagen zu holen? Pure Bequemlichkeit, die sich irgendwann rächen würde.
Raureif lag über dem Ried, und Nebelschwaden waberten über den Wiesen und Feldern. Es hätte ein traumhafter Anblick sein können, wäre es nicht so diesig und wären die Umstände, die ihn hierhertrieben, bessere gewesen.
Der Nebel hielt sich schon seit Tagen hartnäckig, kein Sonnenstrahl vermochte ihn zu durchdringen. Der aktuelle Wetterbericht orakelte, dass sich das in absehbarer Zeit auch nicht wesentlich ändern würde.
Ihm schlug das regelmäßig aufs Gemüt. Zumindest war kein Regen angesagt, was die Spurensicherung wesentlich vereinfachen würde. Obwohl die feuchte, neblige Luft vergänglichen Spuren ebenso zusetzen konnte.
Karsten Kieferle, der leitende Kriminaltechniker der Sonderkommission, hatte ihn gegen sechs Uhr mit einer Hiobsbotschaft geweckt.
Ein weiteres Opfer. Bereits das fünfte innerhalb der letzten sechs Monate, und die Abstände wurden immer kürzer.
Langsam näherte er sich dem Ende des Feldweges. Ein rot-weißes Flatterband mit der Aufschrift Polizei und ein quer zum Weg abgestellter Streifenwagen lieferten die einzigen Hinweise, dass hier irgendetwas vorgefallen war.
Das Flatterband war so dilettantisch an Schilfhalmen befestigt worden, dass es schon wieder komisch anmutete.
Aus seiner Sicht hätte man darauf verzichten können, da er sich beim besten Willen nicht vorstellen konnte, wer sich hier um diese Uhrzeit herumtreiben sollte.
Aber irgendjemand musste ja schon hier gewesen sein, sonst wäre die Leiche vermutlich nie entdeckt worden. Ein Spaziergänger? Ein Vogelkundler? Ein Hundehalter, der seinen Vierbeiner ausführte? Wobei Letzteres nicht gerne gesehen war im Ried, diente das ausgewiesene Naturschutzgebiet doch zahlreichen bedrohten Vogelarten als Brut- und Nistplatz.
Ausgekuppelt ließ Bannert den Wagen noch einige Meter ausrollen, ehe er den Motor abstellte, den Kragen seines Parkas aufschlug und ausstieg. Erst jetzt erkannte er den weißen VW-Bus der Zentralen Kriminaltechnik. Daneben standen zwei Kollegen in Uniform, deren Namen ihm entfallen waren, und Karsten Kieferle in einem weißen Einweg-Overall.
»Guten Morgen«, brummte Bannert und reichte den Uniformierten die Hand. Der säuerlich riechende Atem und der ockerfarbene Fleck auf dem Anorak des jüngeren Beamten waren ihm nicht entgangen.
»So schlimm?«, fragte Bannert an den Jüngeren gewandt. Der nickte verlegen, während Karsten ein abgebrüht gleichgültiges Schulterzucken andeutete.
Bannert wandte sich dem Kriminaltechniker zu. »Morgen, Karsten! Dass dir das nichts ausmacht, ist mir schon klar«, begrüßte er ihn. »Also, lass mal hören!«
Kieferle nickte und schielte verstohlen zum jüngeren der beiden Streifenpolizisten.
»Lass uns ein paar Schritte gehen, Marius.«
Die Hände tief in den Taschen seiner warmen Jacke vergraben, folgte Bannert Kieferle einen mittlerweile schon ausgetretenen Pfad entlang, der beidseitig mit Pflöcken und Trassenband markiert war.
»Ich bin mir sicher«, begann Kieferle, »dass die Tote auf das Konto unseres Killers geht. Es ist haargenau dieselbe Vorgehensweise, derselbe Opfertypus, dieselben Verstümmelungen.«
»Irgendwelche Spuren?«
»Kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber große Hoffnungen brauchen wir uns keine zu machen. Wir arbeiten uns gerade von außen nach innen hin zur Leiche vor. In einem Radius von zehn Metern haben wir begonnen, die oberste Laubschicht abzutragen, einzutüten und zu asservieren. So auf den ersten Blick war noch nichts Brauchbares dabei. Möglicherweise müssen wir die Suche um die Leiche ausweiten. Das Erdreich unmittelbar um die Tote herum ist etwas fester als in den umliegenden Bereichen.
Möglich, dass wir dort Schuhabdrücke finden. Irgendwie muss der Täter die Leiche ja hierhergebracht haben. Sag mal, wo ist eigentlich der Chef?«, fragte Kieferle und blieb abrupt stehen.
»Verhindert«, brummte Bannert.
»Aha, wird wohl seinen Hintern nicht aus dem Bett bekommen haben«, kommentierte Kieferle.
»Keine Ahnung! Ist mir aber auch egal. Dann steht er uns wenigstens nicht im Weg!«
Kieferle grinste.
Bannert roch den Tod, noch bevor er die Leiche erblickte. Der Hauptkommissar wusste, dass nach Eintritt des Todes ein natürlicher biochemischer Prozess in Gang trat. Gase wie Schwefelwasserstoff, Putrescin, Cadaverin und Ammoniak wurden freigesetzt und waren für den bestialischen Gestank verantwortlich. Wer einmal den untrüglichen, süßlichen Gestank in der Nase hatte, vergaß ihn nie wieder. Und doch musste Bannert jedes Mal würgen, wenn er ihn roch.
»Puh, die scheint schon länger hier zu liegen«, murmelte er gedämpft hinter vorgehaltener Hand.
Mit der üblichen Mischung aus Ekel und Faszination ließ er den Blick über den nackten weiblichen Leichnam gleiten, der auf dem Rücken im morastigen Boden des Rieds lag. Arme und Beine waren unnatürlich vom Körper gespreizt. Aufgedunsen, der Kopf schwarz verfärbt, die Körpermitte mit Grünfäule durchzogen, schlug deutlich sichtbar das Venennetz durch. An manchen Stellen warf die Haut eitrig-wässrige Blasen, die zum Bersten prall waren.
Unterleib und Beine bedeckte ein dichter Madenteppich, der sich schmatzend und kauend wie eine kompakte lebende Masse bewegte.
So nah bei der Toten stieg ihm der Gestank noch penetranter in die Nase. Es kostete ihn alle Mühe, sich nicht zu übergeben. Der Würgereiz, gegen den er ankämpfte, trieb ihm die Tränen in die Augen.
»Was ist mit dem Gesicht und den Fingern?«, fragte er an Kieferle gewandt.
»Tierfraß, würde ich vermuten. Kann ich dir aber noch nicht genau sagen, da wir, wie gesagt, noch nicht an der Leiche dran waren. Wir warten noch auf den Gerichtsmediziner.«
»Habt ihr schon eine Ahnung, wer sie war?«
Kieferle schüttelte wortlos den Kopf.
»Leichendaktyloskopie können wir vergessen. Ihre Fingerabdrücke bringen uns hier nicht weiter, weil keine auswertbaren Papillarleisten mehr vorhanden sind. Wir müssen warten, bis wir den Zahnstatus und eine DNA-Auswertung haben.«
»Gibst du mir eine grobe Einschätzung der Liegezeit?«
»Hm …« Kieferle fuhr sich schabend über die Bartstoppeln. »Acht bis zwölf Wochen. Ist aber eine sehr grobe Schätzung.«
»Danke dir. Ich werde zwei Leute die Vermisstenfahndungen der letzten sechs Monate durchgehen lassen.«
Kieferle stimmte brummend zu.
»Ich denke, der Zeitraum sollte weit genug gefasst sein.«
Fröstelnd und mit hochgezogenen Schultern starrte Bannert auf die verfaulenden menschlichen Überreste.
»Und hat er ihr …?«
»Ja, hat er«, unterbrach ihn Kieferle. »Das erklärt die massive Leichenfauna. Ich habe lange keine Leiche mehr gesehen, die derart von Speckkäfern und Käsefliegenlarven übersät war.«
Bannert würgte schwer den säuerlichen Kloß im Hals hinunter.
»Wir müssen den Mörder endlich zur Strecke bringen. Bevor das Schwein ein nächstes Mal zuschlägt!«
2. Kapitel
Vor siebenunddreißig Jahren
Ob sie sie schon vermisst, schießt es ihm durch den Kopf.
Dann hätte sie besser auf sie aufpassen und sie nicht auf der Schaukel liegen lassen sollen. Selbst schuld! Geschieht ihr ganz recht. Jetzt gehört sie ihm. Ihm ganz allein.
Vorsichtig zupft er das Puppenkleidchen zurecht. Nicht, dass er eine Ahnung davon hat, aber das Kleidchen sieht keineswegs gekauft aus. Vielmehr scheint es, dass es jemand in mühevoller Arbeit filigran hergestellt und vernäht hat. Himmelblau mit weißen Rüschen an den Ärmelchen und am Saum, die Taille gerafft und mit einem Gummibund durchwirkt. Ein weißer, feiner Kragen aus Spitze, der nicht mehr ganz sauber ist, ihm aber dennoch gefällt.
Er springt auf und will zur Tür eilen, als er plötzlich innehält, kehrtmacht und die Puppe behutsam unter sein Kopfkissen legt. Irgendwo im Badezimmer, so glaubt er sich zu erinnern, hat er vor einiger Zeit eine kleine grüne Plastikbürste gesehen, die weder er noch seine Eltern je benutzen. Niemand würde sie vermissen.
Er legt das Ohr an seine Zimmertür und lauscht, bevor er es wagt, sie einen Spaltbreit zu öffnen. Auf Zehenspitzen schleicht er ins Badezimmer am Ende des Flurs und beginnt sich darin umzuschauen.
Wo ist sie bloß? Wochenlang hat das blöde Ding doch auf der Waschmaschine gelegen, und jetzt ist es nicht mehr da!
Angespannt kaut er auf der Unterlippe und dreht sich hilflos im Kreis, bis sein Blick an einem Körbchen auf der marmornen Ablage hängen bleibt, in dem seine Mutter Haargummis und Spangen zu horten pflegt.
Wann hat sie sich zuletzt einen Zopf geflochten oder die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden? Er kann sich nicht erinnern.
Vorsichtig, um keine Spuren zu hinterlassen, beginnt er darin zu kramen und findet schließlich, wonach er sucht.
Sie wird die kleine Bürste nicht vermissen! Oder doch? Nein, ganz bestimmt nicht!
Er stopft sie sich in den Hosenbund und legt sorgfältig sein T-Shirt darüber. Obwohl er für sein Alter nicht klein ist, muss er sich auf die Zehenspitzen stellen, um im Spiegel zu überprüfen, ob man auch wirklich nichts sieht.
Er drückt die Toilettenspülung und klappert geräuschvoll mit der Klobürste, ehe er die Badezimmertür öffnet und in sein Zimmer zurückeilt.
Nicht rennen, gemahnt er sich. Papa sitzt im Wohnzimmer, und du willst doch nicht, dass er dich hört?
Die Nachmittagssonne fällt grell und flach in sein Zimmer. Staub tanzt in den Strahlen, die sich in der trüben Fensterscheibe brechen. Wieder und wieder bürstet er verträumt, auf seinem Bett sitzend, ihr langes blondes Haar. Sie ist wunderschön.
Nur ab und zu keimt in ihm ein schlechtes Gewissen auf. Sicherlich würde das Mädchen, dem sie gehörte, traurig sein und weinen, weil ihre Puppe nicht mehr da ist.
Na und, wenn schon. Ist doch nicht meine Schuld, wenn die so blöd ist und ihre Puppe liegen lässt. Wenn ich sie nicht mitgenommen hätte, dann hätte sie ein anderes Kind mitgenommen.
Mit zusammengekniffenen Augen versucht er sich zu erinnern, wann er jemals etwas so Schönes besessen hat. Sein Vater schenkt ihm gelegentlich Fahrzeuge aus Lego-Technik. Lkws, Rennautos oder Geländewagen. Letzte Weihnachten bekam er sogar einen großen Fischer-Technikbaukasten, zu Ostern einen ferngesteuerten Panzer. Es ist ein Modell eines Leopard-Panzers im Maßstab 1:35, mit dem er noch weniger anzufangen weiß als mit dem Fischer-Technikbaukasten, obwohl der, wie sein Vater das Geschenk angepriesen hat, geländegängig ist und solche »Piu-piu-piu-Schießgeräusche« von sich gibt. Da er sich nichts anmerken lassen wollte, hat er Begeisterung geheuchelt und war seinem Vater überschwänglich um den Hals gefallen. Die Batterien des Gefährts sind schnell zur Neige gegangen, und so steht das Teil nun seit Ostermontag im Regal und staubt nutzlos vor sich hin.
Sein Vater ist Berufssoldat und Major in der 10. Panzerdivision in Veitshöchheim. Er ist nur selten zu Hause, deshalb fällt es ihm auch nicht auf, dass er nie mit dem Panzer spielt.
Verstohlen wirft er einen Blick hinüber ins Regal und überlegt, ob er den Panzer zusammen mit einigen seiner Lego-Technik-Modelle auf dem Flohmarkt verhökern soll.
Für das Geld könnte er sich vielleicht ein neues Kleidchen für die Puppe oder sogar eine zweite Puppe leisten. Sogleich empfindet er eine kribbelnde Vorfreude.
Genau! Das mache ich! Nächste Woche ist der große Herbstmarkt, und da werde ich den Kram verkaufen.
»Was machst du denn da?«
Erschrocken fährt er zusammen und hätte beinahe die Puppe fallen lassen.
»Was ist das? Woher hast du die?«, poltert sein Vater.
»Die habe ich …, die habe ich …«, versucht er stotternd zu erklären. Wütend durchquert sein Vater den Raum, entreißt ihm die Puppe und gibt ihm eine schallende Ohrfeige, dass ihm Hören und Sehen vergeht.
Noch Tage später sieht man die Striemen auf seiner Wange, die perfekt die Konturen der großen Hand seines Vaters abbilden.
»Bist du ein Mädchen, oder was? Ein Junge spielt nicht mit Puppen. Das ist Weiberkram«, schimpft er. »Nur Schwuchteln spielen mit Puppen! Bist du etwa eine Schwuchtel? Deine Mutter verhätschelt dich wohl zu sehr.«
Es ist nicht so sehr, was er sagt oder wie er es sagt, sondern die Verachtung in seinem Blick, die ihn so verletzt. Er weiß es nicht recht zu deuten. Hass? Ekel?
Erst als sein Vater mit der Puppe aus dem Zimmer stürmt, brechen sich seine Tränen Bahn. Seine Wange glüht und fühlt sich geschwollen an, aber den körperlichen Schmerz bemerkt er kaum. Irgendetwas scheint sein Vater unten zu brüllen. Wahrscheinlich, so mutmaßt er, würde er seine Mutter für ihr Versagen zur Verantwortung ziehen. Doch obwohl er angestrengt lauscht, kann er nicht verstehen, was er sagt. Was ist denn so schlimm daran, wenn er mit einer Puppe spielt? Ihm liegt halt nichts an den üblichen Jungenspielsachen. Die findet er öde und langweilig.
Als die Haustür krachend ins Schloss fällt, springt er vom Bett auf und schaut durch das Fenster auf den Hof hinunter.
Verächtlich und mit spitzen Fingern, wie etwas Hochansteckendes, lässt sein Vater die Puppe in die Mülltonne fallen, stopft eine Mülltüte hinterher und knallt geräuschvoll den Deckel zu.
In dieser Sekunde fasst er einen Entschluss. Nur welche Konsequenzen der nach sich ziehen wird, ahnt er nicht.
3. Kapitel
Radolfzell
»Wer bitte klaut denn eine Leiche?«, fragte Polizeioberkommissar Wassmeier kopfschüttelnd, während sein jüngerer Kollege die Aufbruchspuren an der Tür zur Aussegnungshalle begutachtete.
»… natürlich glaube ich Ihnen, Herr Diestl. Nur ist mir so etwas in vierzig Dienstjahren noch nie untergekommen.«
»Es ist so, wie ich Ihnen sage, ich schwöre es Ihnen«, beteuerte der Bestatter. Mit einem akkurat gebügelten Stofftaschentuch wischte er sich die Schweißperlen von der Stirn. Panik stand ihm ins Gesicht geschrieben. Wie nur sollte er das den Angehörigen erklären?
»In der sechzigjährigen Geschichte des Bestattungshauses Diestl ist so etwas noch nie passiert. Was soll ich denn den Eltern erzählen?« Die Stimme des feisten Bestatters drohte sich zu überschlagen.
»Jetzt mal eins nach dem anderen. Wer war denn der Verstorbene?«, fragte Wassmeier und gab sich vergeblich Mühe, professionell zu wirken.
»Die Verstorbene! Eine junge Frau. Samantha Zabriĉ. Das arme Ding wurde nur neunzehn Jahre alt. Inoperabler Gehirntumor. Ist am Samstag im Kreise ihrer Lieben verschieden.«
Wassmeier kratzte sich mit dem Kugelschreiber die Stirn unterhalb der Hutkrempe, was eine Reihe blauer Striche hinterließ.
»Das ist ein Fall für die Kripo. Ganz klar! Lassen Sie mich mal eben telefonieren.«
Wassmeier entfernte sich einige Schritte und tippte die Nummer in sein Handy.
»Ja, Wassmeier hier. Aus der Aussegnungshalle des Waldfriedhofs in Radolfzell wurde der Leichnam einer Neunzehnjährigen gestohlen. Ich denke, das ist ein Fall für das K1.«
»Sag mal, tickt ihr noch richtig?«, drang es lautstark an sein Ohr. »Seit wann ist das Morddezernat für Leichendiebstähle verantwortlich? Mensch, Wassmeier, hast du gepennt auf der Polizeischule? Schau mal ins Strafgesetzbuch und lies dir den Paragrafen 168 durch. Dafür sind wir nicht zuständig!«
Mit fast hörbarem, verständnislosem Kopfschütteln beendete der Angerufene das Gespräch.
Betreten kehrte Wassmeier zum Bestatter zurück.
»Die Kripo ist gerade völlig überlastet, weshalb wir den Fall übernehmen. Gerald«, rief er seinem jüngeren Kollegen zu, »mach du ein paar Aufnahmen und die Spurensicherung an der Tür, ich kümmere mich um die Vernehmung des Herrn Diestl.«
»Was für ein Schlamassel!«, stöhnte der Bestatter.
4. Kapitel
Stuttgart
»Gottverdammt!«, fluchte er herzhaft. »Wer diese Tür geplant und eingebaut hat, gehört geteert, gefedert und durch die Stadt getrieben.«
Die Verkäuferinnen hinter der langen Theke schienen seine Tiraden schon gewohnt zu sein, weshalb sie ihm keine weitere Beachtung schenkten. Einige Kunden sahen sich jedoch verwundert nach dem lauthals schimpfenden Kerl um.
Erst im dritten Anlauf gelang es ihm, den Rollstuhl durch die gläserne Schiebetür zu manövrieren. Ein kleines blondes Mädchen hatte sich schutzsuchend hinter die Beine ihrer Mutter verkrochen, als sie ihn erblickt hatte. Er schenkte dem Mädchen ein schiefes Grinsen, was es noch mehr zu verängstigen schien.
Trotz seines Handicaps war er eine imposante Erscheinung und hätte einige der anwesenden Kunden um mehr als einen Kopf überragt. Stehend hätte er fast zwei Meter gemessen. Die streichholzdünnen Beine standen in einem bizarren Widerspruch zu dem breiten Brustkorb und den muskulösen Armen. Als er noch Kraftsport betrieb, hatte er Beine wie steinerne Stelen, die ihm beim Reißen von annähernd zweihundert Kilo einen sicheren Stand verliehen hatten. Auf den breiten Schultern thronte ein gewaltiger Schädel, umrahmt von schulterlangen, schwarz-grau melierten Haaren, die ihm nun nass und strähnig ins unrasierte Gesicht fielen.
Die Beine steckten in einer viel zu weit gewordenen, speckigen grauen Jogginghose, klettbandfixiert und nutzlos in den Beinstützen seines Rollstuhls. Unter dem abgewetzten Bundeswehr-Parka trug er ein rot-blau kariertes Holzfällerhemd aus wärmendem Flanell, das sich über seinem runden Bauch spannte.
Der Anblick des vor Nässe triefenden Rollstuhlfahrers war grotesk. Seine hünenhafte, zerlumpte Erscheinung stand in krassem Kontrast zu dem Hightech-Rollstuhl, in dem er saß. Ohne das elektrisch betriebene Ungetüm hätten ihn die anwesenden Personen zweifellos abschätzig und naserümpfend dem Pennermilieu zugeordnet. Stattdessen erntete er mitleidige Blicke. Und gerade die mochte er leiden wie ein Furunkel am Arsch.
»Was ist?«, blaffte er eine Frau mittleren Alters an, die ihn genau mit jenem Blick bedachte. »Es pisst in Strömen. Leider gibt es kein Hard-Top zu meinem schnittigen Cabrio.«
Betreten wandte sie den Blick von ihm ab.
»Buongiorno!«, trällerte ihm die Stimme einer schwarzhaarigen Verkäuferin entgegen.
»Buongiorno, Francesca. Come stai?«
»Abbastanza bene, grazie!«
»Ach Gott, hervorragend! Die Sonne scheint mir aus dem Hintern. Danke!« Ein kehliges Lachen ertönte.
»Dasselbe wie immer, Herr Hagedorn?«
»Ja bitte, Francesca. Kannst du es mir in die Tüte packen?«
Behände fing sie den Nylonbeutel auf, den er ihr zuwarf, und begann mehrere Körnerbrötchen und Laugengebäcke darin zu verstauen.
»Ach, Francesca, sei doch so gut und mach mir einen Cappuccino und bring mir bitte eine Süddeutsche dazu, ja?«
»Si, certo«, entgegnete sie lächelnd, während der Rollstuhl sich summend in Bewegung setzte und auf einen der drei freien Tische im hinteren Bereich der Bäckerei zuhielt.
Mühelos, als bestünde er nur aus Balsaholz, hob er den schweren Holzstuhl zur Seite, um mit seinem Gefährt am Tisch Platz zu finden. Er drückte einen der unzähligen Knöpfe auf dem Panel seiner Armstütze, und leise zischend senkte sich sein Sitz um wenige Zentimeter, sodass nun auch seine Beine unter dem Tisch verschwanden, als er den Rollstuhl geschickt vorwärtsmanövrierte.
Gedankenverloren rührte er in der Tasse und überflog die Schlagzeilen der Zeitung, die Francesca ihm zusammen mit dem verlangten Cappuccino gebracht hatte.
Erneut Frauenleiche aufgefunden
Kreis Konstanz
Gestern wurde erneut die Leiche einer jungen Frau aufgefunden. Wie das Polizeipräsidium und die Konstanzer Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung verlautbarten, wird der Leichnam zur Klärung der Todesursache und der Identität heute gerichtsmedizinisch untersucht. Laut dem Leitenden Oberstaatsanwalt könne ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen, hieß es. Polizei und Staatsanwaltschaft waren zu einer Stellungnahme, ob der Tod der Frau im Zusammenhang mit den anderen vier Frauenleichen steht, bislang nicht bereit.
Aufmerksam las er den Artikel ein weiteres Mal. Als er zum Ende kam, tippte sein Zeigefinger nervös auf die letzten Lettern der Meldung.
»Natürlich besteht ein Zusammenhang!«, brummte er missmutig. Sorgfältig faltete er die Zeitung zusammen und legte sie auf den Stuhl neben sich, ehe er Zucker in seinen Cappuccino zu schaufeln begann.
»Sei froh, dass du damit nichts mehr zu tun hast«, murmelte er monoton. Er führte die Tasse zum Mund und schlürfte den Milchschaum, den Francesca liebevoll mit einem Kakaopulverherz verziert hatte.
Die Befürchtung, die ihn umtrieb, war nicht, ob sie ihn konsultieren würden, sondern wann, und die Vorstellung behagte ihm gar nicht.
5. Kapitel
Konstanz – Polizeipräsidium
Bannert stand mit verschränkten Armen vor den Tafeln und studierte die Tatortfotos, Spuren und Hinweise, die sie zusammengetragen hatten. Die Obduktion würde klären, ob das jüngste Opfer der Serie zuzuordnen war oder nicht. Bannert hegte jedoch keine Zweifel daran. Alle vier bisherigen Opfer hatten sie identifizieren können. Und obwohl sie Familien hatten, schienen weder Angehörige noch Freunde oder Kollegen sie in den wenigen Tagen und Wochen bis zu ihrem Auffinden wirklich vermisst zu haben. Verdammt! Warum gab es keine Verbindung zwischen den Opfern! Oder konnte er sie einfach nicht erkennen? Die Opfer waren sich nicht einmal sehr ähnlich.
»Und?!«, schreckte ihn eine Stimme auf.
Sein Chef hatte grußlos, still und leise den Soko-Raum betreten. Eine Unart von ihm, die Bannert als sehr störend empfand. Kriminaldirektor Burger schlich oftmals wie ein Geist durch die Flure, bestrebt, Gespräche zu belauschen. Er befürchtete, man würde über ihn tuscheln. Viele Kollegen schienen es ähnlich wie Bannert zu empfinden, da Gespräche, selbst wenn sie banaler Natur waren, schlagartig verstummten, wenn Burger auftauchte. Für seine Position ungewohnt, kleidete sich der schlanke, gut aussehende Mittfünfziger sehr leger.
Auch heute trug er eine Bluejeans, ein auffälliges Hemd von Camp David und schwarze Slipper. Offenbar glaubte er, dadurch mehr Akzeptanz bei seiner Mannschaft zu bekommen. Ein Irrtum!
»Gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse?«
»Guten Morgen, Herr Burger! Nein, leider nicht. Die Obduktion ist noch nicht abgeschlossen. Ein vorläufiges Gutachten sollten wir im Laufe des Morgens bekommen.«
»Wer begleitet die Obduktion?«, erkundigte sich Burger.
»Karsten Kieferle und Nathalia Buday.«
»Wieso wurde die Obduktion gestern nicht mehr durchgeführt?«
Bannert verdrehte im Geiste die Augen.
Weil keine zeitliche Dringlichkeit vorlag, du Kasper, dachte Bannert. Laut sagte er, »Professor Strasser wollte die Leichenöffnung selbst vornehmen.«
Professor Dr. Dr. Stephan Strasser war eine absolute Koryphäe und der führende Gerichtsmediziner in Deutschland. In herausragenden und bedeutsamen oder rätselhaften Fällen ließ er es sich nicht nehmen, die Sektionen selbst durchzuführen oder zu überwachen. In mehr als einem Dutzend Fällen hatte er gerichtsmedizinisch den gewaltsamen Tod eines Menschen nachgewiesen, obwohl gestandene Mediziner bei der Leichenschau einen natürlichen Tod bescheinigt hatten. Strasser hatte das Rentenalter schon lange erreicht. Sehr zum Leidwesen seiner Belegschaft hatte er seinen Dienst um weitere zwei Jahre verlängert.
Das aus Österreich stammende Urgestein der forensischen Medizin pflegte seine Untergebenen nämlich in Gutsherrenmanier zu führen. Entsprechend hoch war die Personalfluktuation am Institut.
»Gut. Wann findet die Frühbesprechung statt?«
»Um neun Uhr. Wollen Sie dazukommen?« Bannert hoffte inständig, dass Burger zu dieser Zeit unabkömmlich sein möge.
»Geht leider nicht.«
»Das ist schade«, log er, »ich halte Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden.«
»Ich bitte darum, Bannert«, antwortete sein Chef und verließ den Raum so geräuschlos, wie er ihn betreten hatte.
Bannert rieb sich über die Stirn und war erleichtert, dass die Besprechung ohne Burger stattfinden konnte. Er hatte nie darum gebeten, die Leitung der Soko zu übernehmen. Burger hatte sie ihm aufgezwungen. Mit einer Stärke von siebenundzwanzig Beamten war die Soko, in Anbetracht eines in Serie mordenden Psychopathen, ein Witz. Mehrfach hatte Bannert ihn darum gebeten, die Soko personell wenigstens auf das Doppelte aufzustocken. Er müsse mit dem Personal vorliebnehmen, was er ihm zuweisen würde, hatte Burger süffisant auf seine Anfrage geantwortet.
Statt ihm das gewünschte Personal und die erfahrenen Leute zuzuteilen, die er angefordert hatte, hatte Burger stattdessen dafür Sorge getragen, dass das LKA ihm einen Beamtennamens Justus Köberschickte. Bannerts Erfahrung nach neigten zumindest einige Kollegen des LKA dazu, großkotzig und besserwisserisch alles infrage zu stellen, was die örtlichen Ermittler taten.
Manches Mal, seit Köber seinem Team zugeordnet worden war, hatte er genau diese Tendenz festgestellt. Köber könnte eine wichtige Schnittstelle zum LKA sein, über die man vieles unkompliziert und ohne große Bürokratie erledigen konnte, weshalb er ihm eine Chance geben wollte.
Nathalia Buday, die junge Kollegin, die Köber im Schlepptau hatte, verhielt sich völlig anders. Sie war interessiert, motiviert, und sie war gelehrig. Aus ihr konnte eine richtig gute Ermittlerin werden. Das war auch der Grund, warum er sie Karsten Kieferle, einem der fähigsten Kriminaltechniker, die er kannte, zugeteilt hatte.
Bannert war in Gedanken mit seiner Tasse den Gang hinuntergegangen, lief unruhig in der Teeküche auf und ab und nuckelte die letzten Reste seine Kaffees daraus. Gerade überlegte er, ob er sich eine weitere Tasse eingießen sollte, da brummte sein Handy nervös in der Hosentasche. »Kieferle«, stand auf dem Display.
»Bannert!«, meldete er sich. »Schieß los, Karsten!«
6. Kapitel
Irgendwo außerhalb von Konstanz
Ihre Zunge fühlte sich taub und pelzig an. Ein fleischiger Klumpen, der fremdartig wirkte und nicht ihrem Körper zu gehören schien. Sie gehorchte ihr genauso wenig wie Finger, Arme und Beine.
Was war geschehen? Wo war sie?
Egal wie sehr sie sich auch bemühte, es gelang ihr nicht einmal, die Augenlider zu öffnen. Sie spürte weder Kälte noch Wärme, sie fühlte gar nichts, und das machte ihr Angst, obwohl es kein unangenehmer Zustand war.
Mit vierzehn hatte man ihren entzündeten Blinddarm operiert. Sie erinnerte sich daran, wie nervös sie war, als man sie in den OP geschoben und die Narkose eingeleitet hatte. So ähnlich fühlte sie sich jetzt. Leicht, dämmerig, beinahe beschwingt.
Ein scharfer, undefinierbarer Geruch stieg ihr in die Nase, und grelles Licht durchdrang ihre geschlossenen Augenlider. War sie in einem Operationssaal? Hatte sie einen Unfall erlitten, an den sie sich nicht erinnern konnte?
»Hallo, hört mich jemand? Was ist passiert? Wo bin ich?«
Die Rufe verhallten ungehört in ihrem Kopf.
»Bin ich im Krankenhaus? Könnte vielleicht mal jemand mit mir reden, verdammt noch mal?!«
Vielleicht bin ich gar nicht mehr am Leben, schoss es ihr schlagartig durch den Kopf.
Nein, Nina. Das ist Quatsch! Warum kannst du sonst das Desinfektionsmittel riechen oder das grelle Licht wahrnehmen? Du bist nicht tot. Du kannst nicht tot sein. Vielleicht liegst du im Koma, aber tot bist du nicht.
Ein metallisches Klappern drang dumpf, wie durch einen dicken Wattepfropf, an ihr Ohr. Es dauerte einen Augenblick bis sie das Geräusch einordnen konnte. Zweifellos das Klappern von OP-Besteck.
Ja, das muss es sein. Operationsbesteck, das in eine Metallschale fällt. Beruhige dich, Nina, alles wird gut! Aber wieso höre ich keine Stimmen?
Aus den unzähligen Arztserien, die sie so sehr liebte, wusste sie, dass während einer Operation ständig geredet wurde, Ärzte Anweisungen gaben, nach dem Skalpell, einer Klammer oder einem anderen medizinischen Gerät verlangten. Und was war mit den Piepgeräuschen, die den Herzschlag markierten?
Ein Ruck ging durch ihren Körper. Sie spürte ein Ziepen auf ihrem Kopf.
»Was war das? Was macht ihr mit mir? Hallo?! Hört mich denn keiner?« Wieder ließ ein Ruck ihren Körper erzittern.
»Verdammt noch mal, was tut ihr mit mir?!«
Die Fingerspitzen ihrer rechten Hand kribbelten, und sie glaubte etwas Kühles, Glattes zu erstasten.
Ich liege auf einem OP-Tisch. Oh Gott, ich muss einen schrecklichen Unfall gehabt haben. Aber wieso kann ich mich nicht erinnern?
Verbissen konzentrierte sie sich auf ihren rechten Zeigefinger.
Yes, triumphierte sie innerlich, als der sich mehrfach auf und ab bewegen ließ.
Oder war es nur ein Reflex? Merkt denn hier niemand, dass ich wach bin?
Nur allmählich glaubte sie, das Gefühl in ihre Finger zurückkehren zu fühlen, aber wenn sie ihnen befahl, sich zu bewegen, blieb es bei einem unkoordinierten Zucken.
Irgendwie musste sie auf sich aufmerksam machen. Ihr schauderte bei der Vorstellung, mitten während der Operation aufzuwachen. Schon öfter hatte sie Berichte gelesen, in denen Patienten plötzlich während der OP erwacht waren und in ihre eigene geöffnete Brust geblickt hatten. Panik ergriff sie.
»Hallo?!«, rief sie, »Ich bin wach, ihr Idioten! Seht ihr das denn nicht?«
Die wohlige Dunkelheit, aus der sie erst vor wenigen Minuten gekrochen war, umfing sie erneut.
Offenbar schien man bemerkt zu haben, dass sie aus der Narkose aufzuwachen drohte, und hatte ihr ein weiteres Narkotikum verabreicht.
Wie lange sie in dem Dämmerzustand lag, wusste sie nicht. Es konnten Sekunden, Minuten oder Stunden gewesen sein. Eine Stimme? Es war eine Stimme, die in ihre Dunkelheit gedrungen war. Eine tiefe Männerstimme. Die Worte konnte sie nicht erfassen, aber sie klang angenehm. Sie begriff allmählich, warum sie ihn nicht verstehen konnte.
Die Stimme sprach nicht, sie summte, summte eine Melodie, die ihr sehr bekannt vorkam, aber sie wusste nicht woher.
Wer sind Sie? Wo bin ich? Sie konnte nicht sprechen, stellte die Fragen nur in Gedanken.
Sagen Sie mir doch einfach, was ich wissen möchte, Sie Scheißkerl.
Ein Ziehen im Unterleib ließ sie zusammenzucken. Das konnte eigentlich nicht sein. Ihre Periode war erst in zwei Wochen fällig.
Oh Gott, ich muss pinkeln. Ich pisse euch gleich auf den OP-Tisch oder ins Bett oder wohin auch immer ihr mich gebracht habt.
Vergeblich versuchte sie dem Drang zu widerstehen. Ihre Blase entleerte sich schwallartig, als wäre sie mehrere Tage nicht mehr auf der Toilette gewesen.
Etwas Feucht-Warmes benetzte ihre rechte Hand, die immer noch seitlich an ihrem Körper ruhte.
Sie hatte nicht erwartet, überhaupt irgendetwas zu spüren. Bildete sie sich das ein? Eine Nebenwirkung der Narkose vielleicht?
Als würden Gewichte sie beschweren, hob sie mühsam die rechte Hand. Ihren Empfindungen mochte sie nicht trauen, weshalb sie sich vergewissern wollte, ob sie sich eingenässt hatte. Einer Spinne gleich krabbelten ihre Finger über die Haut. Die Spinnenbeine ihrer Hand ertasteten die Hüfte und den Bauchnabel, was ihr unsägliche Mühe und Kraft abverlangte.
Was sie jedoch ertastete, fühlte sich warm und seifig an.
Das ist doch kein Urin, schoss es ihr durch den Kopf.
An der Stelle, wo sich ihre Vulva befinden sollte, ertastete sie ein tiefes, glitschiges Loch.
Was zum Teufel hat man mit mir gemacht?
Panisch wand sie sich und versuchte zu strampeln, aber ihr Körper gehorchte ihr nicht.
»Hey, hey, hey, schschsch, du darfst dich nicht bewegen«, sprach die Stimme ruhig. »Du verdirbst sonst alles und ruinierst meine Arbeit.«
»Sie verdammter Mistkerl. Lassen Sie mich in Ruhe! Neiiiiiiiiin!!!!«
7. Kapitel
Konstanz – Polizeipräsidium
Die Stimmung im Soko-Raum war gedrückt, nachdem Bannert mit seinem Bericht über die Obduktion geendet hatte. Es bestanden keine Zweifel, dass auch das fünfte Opfer auf das Konto des Killers ging. Die Vorgehensweise und die Verstümmelungen trugen dieselbe Handschrift. Die Gerichtsmedizin konnte den Todeszeitpunkt nur ungefähr eingrenzen. So lautete die Einschätzung der Liegezeit auf circa sieben bis acht Wochen. Nur über die Todesursache konnte Professor Strasser noch keine definitive Aussage treffen. Äußerlich habe man, abgesehen von den Verstümmelungen, keine Anzeichen von Gewalteinwirkung gefunden, die die Todesursache unmittelbar erklären würde.
Wie die letzten vier Opfer war auch dieses ante mortem verstümmelt worden. Bei den letzten hatte man bei der toxikologischen Untersuchung hohe Dosen eines Barbiturats im Blut nachweisen können. Bannert hoffte inständig, dass auch dieses Opfer sediert gewesen war und die grausame Prozedur nicht bei vollem Bewusstsein ertragen musste. Auch ihr hatte man die Vulva und den Uterus herausgeschnitten. Neben den Brüsten hatte man auch die Haare entfernt. Regelrecht skalpiert. Die gesamte Schädelschwarte war unmittelbar unter dem Haaransatz abgetrennt und entfernt worden.
Bei den anderen Opfern hatte man entweder nur die Brüste, nur die primären Geschlechtsorgane oder nur die Schädelschwarte entfernt. Sie konnten sich darauf einfach keinen Reim machen.
Verschiedene Theorien wurden in der Soko diskutiert, aber die plausibelste schien Bannert ein unbändiger Hass des Killers auf Frauen zu sein.
Beunruhigend war, dass sie an keiner der Leichen und auch an den Leichenfundorten nicht die geringsten Täterspuren gefunden hatten. Weder DNA oder Fingerabdrücke noch Schuhspuren. Nichts, absolut nichts. Obwohl die Spurensicherung extrem auf die Einhaltung der Spurenhygiene geachtet hatte und überaus sauber vorgegangen war.
Bannert war tags zuvor, gleich nachdem er sich am Leichenfundort einen Eindruck verschafft hatte, zur Dienststelle zurückgefahren und hatte die Soko zusammengerufen. Bis auf zwei Kollegen, die sich krankgemeldet hatten, waren sie vollzählig erschienen. Routiniert hatte er die anstehenden Aufgaben verschiedenen Trupps zugeteilt.
Neben den üblichen Maßnahmen, wie die Beantragung der Funkzellendaten, Nachbarschafts- und Anwohnerbefragungen, Absuche der umliegenden Mülleimer, beauftragte er zwei Kollegen, die Vermisstenfahndungen der vergangenen sechs Monate durchzugehen, wenngleich er sich davon nicht viel versprach. So, wie die letzten Opfer, würde auch das jüngste nicht als vermisst gemeldet sein.
Entscheidend würde sein, dass sie das Opfer schnell identifizierten. Aber so stark wie die Leiche verwest war, konnten sie, selbst wenn man sie hergerichtet hätte, nicht an die Öffentlichkeit gehen. Ausgeschlossen!
Würden sich keine anderen Ansätze ergeben, käme er nicht umhin, ein anthropologisches Institut mit einer Gesichtsrekonstruktion zu beauftragen. Bis dahin musste er sich gedulden und den endgültigen Obduktionsbericht abwarten.
Kieferle hatte während der Obduktion unzählige Bilder geschossen. Bannert nahm sich vor, die Fotos in einer ruhigen Minute zu sichten. Als er den holprigen Feldweg zurückgefahren war, hatte er als Erstes telefonisch einen Helikopter der Hubschrauberstaffel angefordert, um großflächig Luftaufnahmen des Leichenfundortes und der näheren Umgebung zu machen. Bannert hoffte, dass die hochauflösenden Bilder, die die Bordkameras lieferten, vielleicht aus der Vogelperspektive mehr zeigten, als man sonst zu sehen imstande war. Reifenspuren, Veränderungen der Vegetation, abgelegte oder verlorene Gegenstände.
Diese Arbeit hätte auch eine Drohne erledigen können. Doch die Polizei hatte es leider noch immer nicht geschafft, sich den technischen Gegebenheiten des einundzwanzigsten Jahrhunderts anzupassen und für sich zu nutzen. Schon vor einem Jahr hatte er, nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft, vorgeschlagen, für Luftaufnahmen Drohnen einzusetzen. Vergeblich hatte er seinem Chef klarzumachen versucht, dass man allein für die Kosten einer einzigen Flugstunde eines Hubschraubers zwei brauchbare Drohnen würde beschaffen können. Das sei alles nicht so einfach, hatte er zu hören bekommen. Ausschreibungen für die Beschaffung der entsprechenden Fluggeräte müssten erfolgen, Genehmigungen der Luftfahrtbehörde eingeholt und Drohnenpiloten ausgebildet werden. Für Bannert waren das Ausreden, zumal er allein zwei Streifenkollegen kannte, die sich im Nebengewerbe mit Drohnenluftaufnahmen etwas dazuverdienten.
In einem zweiten Anruf bat er das Führungs- und Lagezentrum, einen Vertreter des Sachbereichs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu verständigen. Der Hubschrauber im Tiefflug würde den Medien nicht entgehen. Sie würden anfangen, lästige Fragen zu stellen. Und dafür hatte er, weiß Gott, keinen Nerv.
Das Gros seines Teams hatte den Soko-Raum bereits verlassen, während einige wenige still und konzentriert an den PCs arbeiteten.
Sechs Monate war es her, seit sie die erste Leiche gefunden hatten, und sie waren seither keinen Schritt weitergekommen. Die Wut, die Bannert empfand, begann einem Gefühl der Frustration und Verzweiflung zu weichen. Früher hätten das LKA oder das BKA Serienmorde dieser Größenordnung übernommen. Nun ja. In gewisser Weise taten sie das auch noch. Aber die »Fallübernahme« beschränkte sich lediglich darauf, zwei, drei oder vier LKA-Mitarbeiter zu entsenden, die vor Ort die Wichtigen mimten, die Arbeit auf die örtlichen Kollegen abwälzten und sich im Erfolgsfall den Ruhm auf die Fahne schrieben.
Er musste sich eine andere, eine neue Strategie überlegen, wenn er in dem Fall weiterkommen wollte. Und er hatte auch schon eine Idee.
8. Kapitel
Irgendwo in Stuttgart
Zaghaft legte Bannert die letzten Schritte bis zur Haustür zurück.
Raureif hatte die Vegetation erstarren lassen. Vor seinem Gesicht bildeten sich kleine Dampfwölkchen, wenn er ausatmete. Lange hatte er hin und her überlegt, ob er zuerst anrufen sollte, sich dann aber entschieden, alles auf eine Karte zu setzen. Das Reiheneckhaus war nichts Besonderes. Ein schmaler, langweiliger Würfel, in einer lieblos aneinandergereihten Kette von Häusern, wie man sie in den Achtzigerjahren in jeder Reihenhaussiedlung hatte aus dem Boden sprießen sehen. So spießig hatte Bannert das Haus gar nicht in Erinnerung.
HAGEDORN, stand auf dem kleinen, hochglanzpolierten Messingschildchen über dem Klingelknopf. Er betätigte die Klingel, und augenblicklich erklang aus dem Inneren die Tonfolge des Big-Ben-Geläuts.
Gott, geht’s noch spießiger, schoss es Bannert durch den Kopf. Gerade als er erneut klingeln wollte, hörte er Geräusche und bemerkte jenseits des Milchglaseinsatzes in der Haustür einen Schatten, der sich zu bewegen schien.
»Moment!«, brüllte eine Männerstimme, die wenig Begeisterung über unangekündigten Besuch zum Ausdruck brachte. Entsprechend harsch wurde die Tür nur wenige Sekunden später geöffnet.
»Ja!? Was wollen Sie?«
Bannert musste seinen Blickwinkel nach unten korrigieren, da er das Gesicht des Bewohners auf Augenhöhe wähnte.
»Äh, guten Tag, Kollege Hagedorn! Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich …«
Hagedorn fiel ihm barsch ins Wort. »Ich bin kein Kollege. Nicht mehr. Verstanden!?«
Der Mann im Rollstuhl blickte an Bannert vorbei, taxierte die Straße dahinter und richtete seinen durchdringenden Blick wieder auf Bannert.
»Aha, Sie sind also ein Kollege? Von welcher Dienststelle? Aus Konstanz?«
»Mein Name ist Marius Bannert. Ich bin vom K1 des Polizeipräsidiums Konstanz, aber woher …?« Aus reiner Gewohnheit zückte er seinen Dienstausweis und hielt ihn Hagedorn unter die Nase.
»Schon gut, ich glaub’s Ihnen auch so. Hm, da Sie mir wohl kaum einen Höflichkeitsbesuch abstatten, gibt es vermutlich einen dienstlichen Grund.«
»Das ist richtig, Herr Hagedorn. Ich wollte Sie in einer Sache um Rat und um Ihre Mitarbeit bitten.«
Hagedorn stieß ein heiseres Lachen aus. Er hatte es geahnt!
»Ich habe mit eurem Scheißladen nichts mehr zu tun. Und das soll auch so bleiben.«
Hagedorn warf die Haustür krachend ins Schloss.
Bannerts Hoffnung zerplatzte wie eine Seifenblase.
»Kollege Hagedorn, bitte …«
»Verpiss dich und lass mir meine Ruhe«, drang es zornig und dumpf aus dem Hausinneren.
»Herr Hagedorn«, rief Bannert gegen das Türblatt. »Ich bitte Sie inständig, werfen Sie einen Blick auf den Fall, und helfen Sie mir. Wir kommen nicht weiter, wir stecken fest. Und«, Bannert schluckte schwer, »er wird weiter morden, wenn wir ihn nicht schnappen. Kollege, bitte!«
Eine gefühlte Ewigkeit später öffnete sich die Haustür einen Spaltbreit.
»Komm rein!«
Summend setzte sich der Rollstuhl in Bewegung, drehte sich flink auf der Stelle und fuhr den Gang hinunter.
»Kaffee? Tee? Oder etwas Härteres?«, fragte Hagedorn über seine Schulter hinweg. Bannert verblüffte Hagedorns schneller Gesinnungswandel. Er schöpfte neue Hoffnung. Möglicherweise gelang es ihm ja doch, ihn umzustimmen.