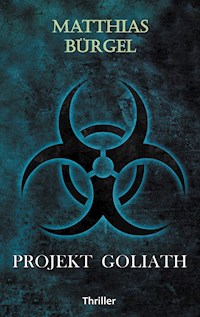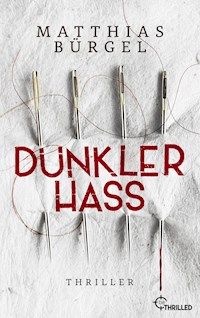7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Fallanalytiker Falk Hagedorn
- Sprache: Deutsch
Vier Städte, vier grauenvoll zugerichtete Leichen - an verschiedenen Flughäfen Deutschlands werden innerhalb kurzer Zeit mehrere Männer ermordet. An den Tatorten gesicherte Spuren deuten auf einen Serientäter hin, doch zwischen den Opfern gibt es keinerlei Gemeinsamkeiten. Die Ermittler beim LKA sind fassungslos, als sie schließlich herausfinden, dass die DNA-Spuren von einer Frau stammen! Das LKA bittet den knorrigen Profiler Falk Hagedorn, ein Psychogramm der Mörderin zu erstellen. Obwohl Hagedorn sich geschworen hatte, nie wieder für die Polizei zu arbeiten, lässt er sich darauf ein - doch dann beschleicht ihn der furchtbare Gedanke, dass er die Täterin kennen könnte ...
eBooks von beThrilled - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Teil 1
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Teil 2
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Teil 3
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Epilog
Anmerkungen und Danksagung
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Vier Städte, vier grauenvoll zugerichtete Leichen – an verschiedenen Flughäfen Deutschlands werden innerhalb kurzer Zeit mehrere Männer ermordet. An den Tatorten gesicherte Spuren deuten auf einen Serientäter hin, doch zwischen den Opfern gibt es keinerlei Gemeinsamkeiten. Die Ermittler beim LKA sind fassungslos, als sie schließlich herausfinden, dass die DNA-Spuren von einer Frau stammen! Das LKA bittet den knorrigen Profiler Falk Hagedorn, ein Psychogramm der Mörderin zu erstellen. Obwohl Hagedorn sich geschworen hatte, nie wieder für die Polizei zu arbeiten, lässt er sich darauf ein – doch dann beschleicht ihn der furchtbare Gedanke, dass er die Täterin kennen könnte …
MATTHIAS BÜRGEL
SCHREINACHRACHE
THRILLER
Teil 1
»Nicht, wer zuerst die Waffen ergreift, ist Anstifter des Unheils, sondern wer dazu nötigt.«
Niccolò Machiavelli
Prolog
21. Mai – Stuttgart
Diffus spiegelte sich sein fahles Gesicht im matt schimmernden Monitor, vor dem er saß. Rot geränderte Augen starrten ihn ausdruckslos an. Eine hässliche daumendicke Schramme zog sich quer über seine Stirn, und seine für gewöhnlich lockige Mähne klebte konturlos am Schädel. Ein grau melierter Sechstagebart vervollständigte das ungepflegte Bild. Er sah aus wie ein Penner.
Trotz des kühlenden Luftstroms, den die leise brummende Klimaanlage kontinuierlich ausblies, klebte ihm das Hemd am Rücken. Aber was noch schlimmer war, er hatte sich eingenässt. Nicht sehr stark, aber ein deutlich sichtbarer Fleck zeichnete sich dunkel im Schritt seiner viel zu weit gewordenen Jeans ab, weshalb er seine Jacke so über dem Schoß drapiert hatte, dass es nicht für jeden offensichtlich war.
Unter normalen Umständen konnte er seinen Harndrang gut kontrollieren. Wenn er zu viel Stress hatte oder zu wenig Schlaf bekam, misslang ihm das zuweilen. Eine Symptomatik seiner partiellen Querschnittslähmung, mit der er seit fünf Jahren leben musste. Und in den letzten Tagen war nichts, aber auch überhaupt nichts normal gelaufen.
Anfangs war ihm das unendlich peinlich gewesen, wenn es passiert war. Egal, was die Therapeuten einem erzählten, das war etwas, woran man sich nie gewöhnte. Man akzeptierte es, lernte zwangsläufig, damit zu leben, und arrangierte sich so gut wie möglich.
Auf dem dunkel hinterlegten Monitorbild vor ihm tanzten grüne Symbole und Zahlenreihen in chaotischer Reihenfolge, deren Bedeutung sich ihm nicht erschloss. Blinkende Punkte, Kreise, Rauten, Pfeile, deren Positionen sich ständig änderten, sich gelegentlich überlagerten und dann sogleich wieder auseinanderdrifteten.
Ein junger Fluglotse, der ihn am Haupteingang zur Flugsicherung empfangen hatte, hatte ihn hierher verfrachtet, weil es der einzig freie Platz im Raum des Towers war. Obwohl alle Anwesenden hoch konzentriert arbeiteten, war die Anspannung beinahe physisch greifbar. Hagedorn fühlte sich, als würde er im Inneren eines Faradaykäfigs sitzen. Umgeben von einem elektrostatischen Feld, das die Härchen seiner Unterarme aufrichtete und sich jederzeit blitzartig zu entladen drohte.
Außer dem Leiter der Flugsicherung befanden sich mit ihm noch fünf weitere Fluglotsen im Tower. Hagedorn musterte die besorgten Gesichter der Männer und Frauen. Gewiss hatten sie alle in ihrer Ausbildung die Abläufe solcher Szenarien wieder und wieder trainiert, doch niemand hatte sicherlich daran glauben wollen, dass es einmal Realität werden könnte.
Seit Flug PinLine 650, von Tampere nach Stuttgart, in den deutschen Luftraum eingetreten war, gab es keinen Kontakt mehr. Der ComLoss, der Verlust der Kommunikationsverbindung zu einem Flugzeug, kam nicht selten vor. Manchmal war er einfach nur auf ein technisches, viel öfter jedoch auf menschliches Versagen zurückzuführen, hatte ihm der junge Fluglotse erklärt. Eine technische Ursache hatte man diesmal ausgeschlossen.
Dennoch gelang es nicht, Funkkontakt zur Cockpitcrew herzustellen.
Zwanzig Minuten nach dem Start in Finnland war der Funkkontakt abgebrochen, und das Renegade-Protokoll war in Kraft gesetzt worden. Eine Konsequenz der Terroranschläge vom 11. September 2001. Sollte der Verdacht oder die Gewissheit bestehen, dass ein Flugzeug als Waffe in ein definiertes Ziel gesteuert werden soll, war auf nationaler Ebene die Möglichkeit geschaffen worden, das Flugzeug abzuschießen.
Das Nationale Lage- und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum mit Sitz in Uedem hatte vor fünfundvierzig Minuten die Kontrolle über den deutschen Luftraum und Flug 650 übernommen. Eine der ersten Anweisungen des NLFZ bestand darin, eine Alarmrotte des Eurofighter-Jagdgeschwaders 71 vom Luftwaffenstützpunkt Wittmund aufsteigen und auf Abfangkurs gehen zu lassen.
Kaum jemand wusste, dass die Alarmrotte im vergangenen Jahr über fünfhundertmal aufgestiegen und auf Abfangkurs gegangen war. Acht davon waren scharfe Einsätze, also solche, bei denen die Piloten die Waffensysteme ihrer Kampfjets aktiviert hatten.
Der erste visuelle Kontakt des führenden Alarmrottenpilots kurz vor Usedom bestätigte, dass die Cockpitcrew nicht reagierte, obwohl er mit dem Abschuss zweier Täuschkörper deren Aufmerksamkeit zu erregen versucht hatte.
Wilde Spekulationen machten die Runde, ob die Crew aufgrund eines plötzlichen Druckabfalls im Cockpit und des daraus resultierenden Sauerstoffmangels die Besinnung verloren haben könnte.
Kurz nach einundzwanzig Uhr hatte zwischen der Flugsicherung Berlin und Flug 650 ein kurzer Funkkontakt bestanden, den man sogleich in den Tower nach Stuttgart weiterleitete. Hagedorn hatte sich den digitalen Mitschnitt angehört und glaubte zu ahnen, wer sich, wenngleich versehentlich, am Funkgerät zu schaffen gemacht hatte.
Hagedorn wischte sich mit dem Rücken der bandagierten Hand eine Schweißperle von der Stirn, als es plötzlich in seinem Headset zu knacken und zu rauschen begann.
»PinLine six-five-zero, melden Sie sich! PinLine six-five-zero, hier ist die Flugkontrolle des NLFZ, antworten Sie!«
Hagedorn hielt die Luft an und lauschte gebannt dem statischen Rauschen in seinem Kopfhörer. Es musste ihm gelingen, irgendwie die Gesprächsführung zu übernehmen, die Verhandlungen, wenn es denn dazu käme, zu dominieren und, was das Wichtigste war, eine persönliche Beziehung herzustellen.
»PinLine six-five-zero! PinLine six-five-zero, hier spricht das Führungszentrum für nationale Flugsicherheit, antworten Sie, verdammt noch mal!«
Nichts! Keine Reaktion.
Hagedorn wischte sich seine schweißnassen Handflächen an der Hose ab und warf einen raschen Blick auf die Digitaluhr in der Konsole vor ihm. Bisher waren Geschwindigkeit und Flughöhe konstant beibehalten worden. Wenn sich daran nichts änderte, würde die Maschine in weniger als fünfundvierzig Minuten Stuttgart erreichen, wenn sie nicht vorher über weniger dicht besiedeltem Gebiet vom Himmel geholt würde. Dann würden Stahl, Aluminium, Glas, aber auch Leiber in Abertausende Fetzen zerrissen werden, ehe sie im Umkreis mehrerer Quadratkilometer brennend der Erde entgegenstürzten.
Hagedorn hatte diesen Albtraum schon einmal erlebt. Als am ersten Juli 2002 zwei Flugzeuge über dem Bodensee in über zehntausend Metern Höhe kollidiert und abgestürzt waren, war er als psychologischer Berater der Einsatzkräfte und einige Tage später als Betreuer für die Angehörigen der Opfer im Einsatz gewesen. Einundsiebzig Menschen, die meisten davon Kinder, hatten bei der Kollision ihr Leben verloren.
Bevor er die ersten Gespräche mit den eingesetzten Polizeikräften führte, hatte er sich am Absturzort einen Überblick verschafft. Viele Monate verfolgten ihn die schrecklich entstellten Leiber in seinen Träumen.
Sein Blick huschte zur Uhr. Es blieb ihm nicht mehr viel Zeit, die Katastrophe zu verhindern. Das Leben von hundertsieben Menschen stand auf dem Spiel. Hagedorn hatte unlängst schon einmal versagt. Das durfte nicht wieder geschehen. Wütend hieb er mit der Faust auf die Armlehne des Rollstuhls.
Seine Niedergeschlagenheit, seine Hoffnungslosigkeit, wich einer verbissenen Entschlossenheit. Sollte der Funkkontakt wieder zustande kommen, würde er alles daransetzen, das unvermeidlich Scheinende abzuwenden.
Und dabei ging es ihm nicht nur allein um die hundertsechs fremden Passagiere, sondern besonders um den einen, der ihm alles bedeutete und der ebenfalls an Bord dieses unglückseligen Flugzeugs saß.
Kapitel 1
2. Mai – Konstanz
Wutschnaubend fegte Hagedorn einen Stapel Papier vom Schreibtisch, das wie welkes Laub raschelnd zu Boden segelte und sich im gesamten Raum verteilte. Egal, wie er es drehte und wendete, es sah nicht gut aus. Dass es nicht einfach sein würde, bis er sich etabliert hatte, war ihm von Anfang an klar gewesen. Nur, dass es sich so schleppend entwickeln könnte, damit hatte er nicht gerechnet. Ein weiterer Monat, in dem er Jasmins Lohn und die Fixkosten von seinem Privatvermögen würde bestreiten müssen.
Mit dem Handballen wischte sich Hagedorn über die Stirn und stellte murmelnd eine überschlägige Berechnung an. Drei, allerhöchstens vier Monate würde er noch überbrücken können. Danach wäre auch seine eiserne Reserve aufgebraucht. Sollte er es überhaupt so weit kommen lassen? Wäre es nicht vernünftiger, gleich die Segel zu streichen?
Er hatte sich in den Kopf gesetzt, Menschen zu therapieren, die wirklich Hilfe benötigten. Opfer schwerer Gewalttaten, schwersttraumatisierte Unfallopfer, Menschen, die, so wie er selbst, einen tödlichen Angriff überlebt hatten. Genau darauf hatte er sich spezialisiert. Die Behandlung depressiver, ängstlicher Menschen, Zwangsneurotiker, Essgestörter oder psychosomatisch Erkrankter lag ihm einfach nicht, obwohl Hagedorn während seiner dreijährigen Praxisausbildung viel mit solchen Patienten gearbeitet hatte.
»Nein«, sagte er entschlossen. Er musste sich und der Praxis einfach Zeit geben.
So leicht gibst du dich nicht geschlagen. Du ziehst das jetzt durch, schwor er sich selbst.
Gleich morgen früh würde er Jasmin anweisen, die Quartalsabrechnungen für die Krankenkassen zügig abzuschließen und bei den selbst zahlenden Patienten, die säumig waren, den Druck zu erhöhen. Außerdem würde er sie bitten, Möglichkeiten und Kosten für eine sinnvolle Werbung in Erfahrung zu bringen.
Jasmin war eine quirlige, aufgeweckte junge Frau, die seine Korrespondenz und was sonst so in der Praxis anfiel, mehr als zufriedenstellend erledigte. Überdies war sie kreativ und sehr versiert, was die sozialen Medien betraf. Hagedorn war sich sicher, dass er die Werbung in Jasmins vertrauensvolle Hände geben konnte.
Wenngleich sie ihm zu Beginn mit ihrer oft überbordenden Vitalität etwas auf die Nerven gegangen war, so hatte er sich doch in den vergangenen sechs Monaten so sehr an sie gewöhnt, dass er sie nicht mehr würde missen wollen. Wenn die Praxis nicht lief, würde er es sehr bedauern, sie nach so kurzer Zeit wieder auf die Straße setzen zu müssen.
Er zog am Joystick in der Konsole seiner Armlehne und stieß sich mit dem Rollstuhl, dessen Elektromotor sich leise summend in Bewegung setzte, von der Schreibtischkante zurück. Ächzend beugte er sich nach vorn, um eines der verstreuten Blätter Papier aufzuheben, ließ es dann aber sein.
Er schüttelte seinen massigen Schädel. Jasmin würde ihm die Unordnung nachsehen, trotzdem würde sie ihn mit einem Grinsen wieder einmal für seine Unbeherrschtheit schelten.
Frustriert schnappte er sich seine Jacke und rollte aus dem Büro hinaus in die nachmittägliche milde Maisonne.
Mit spitzen Fingern zupfte er ein Stofftaschentuch aus der Brusttasche seiner Jacke und rieb damit über das glänzende Messingschild, das neben der Eingangstür mit schwarz eloxierten Schrauben angebracht war.
»F. Hagedorn – Psychotherapeut« war darauf zu lesen.
Das Schild war genauso neu wie der Titel, auf den er drei Jahre lang hingearbeitet hatte. Würde das alles bald schon bedeutungslos sein? Auf gar keinen Fall!
Hagedorn wendete den Rollstuhl um die eigene Achse und fuhr die Marktstätte Richtung Uferpromenade hinab.
»Nicht schon wieder!«, brüllte Hagedorn, begleitet von einigen unflätigen Flüchen und Verwünschungen, als er zwei Stunden später in den Hausflur rollte und das Chaos erblickte.
Er hatte sich im Café Konzil noch ein Kännchen Kaffee und ein Stück Käsekuchen gegönnt.
»Wo steckst du, du Lump!«
Überall lag Füllmaterial aus einem Sofakissen, das wie gewaltige Schneeflocken den Fußboden bedeckte.
Ich bringe ihn um, diesen Hund.
Nur für ein paar Tage, hatte sie gemeint. Er sei auch ganz lieb und pflegeleicht, hatte sie gemeint. Außerdem täte Hagedorn ein wenig Gesellschaft ganz gut, hatte sie gemeint.
Karina, seine Tochter, war mittlerweile eine gefragte Schauspielerin. Und obwohl sie sich gut verstanden, was nicht immer so gewesen war, stand sie kurz davor, seine ohnehin nur ansatzweise vorhandene Gutmütigkeit überzustrapazieren, wenn sie ihren Hund nicht bald wieder abholte.
Murrend setzte er sein Gefährt in Bewegung, wodurch die Riesenschneeflocken auseinanderstoben.
Hoffentlich hat er nirgendwo hingepinkelt oder Schlimmeres, ging es ihm durch den Kopf, als er den Gang bis zur Küche hinunterfuhr.
Der zehnjährige Golden Retriever lag, als könnte er kein Wässerchen trüben, den Kopf zwischen den Vorderläufen auf dem mit Terrakotta gefliesten Küchenboden. Offenbar hielt er es nicht einmal für nötig, den Kopf zu heben.
Nur seine Augen wandten sich Hagedorn zu, als wollte sein vorwurfsvoller Blick sagen: Ach, bist du auch endlich mal zu Hause!
Hagedorn konnte ihm nicht wirklich böse sein. Der Hund musste ja auf dumme Gedanken kommen, sooft wie er ihn allein ließ. Vielleicht würde er Sam morgen mit in die Praxis nehmen.
»Na, komm schon! Hopp! Geh in den Garten«, sagte er und öffnete die Terrassentür.
Träge erhob sich Sam und trottete hinaus, wo er am nächstgelegenen Busch das Bein hob und sich erleichterte.
Seiner Tochter gegenüber würde Hagedorn das niemals zugeben, aber die Gesellschaft dieses Hundes war vielleicht doch nicht so übel.
Sam sah für Hagedorn nicht wie ein Sam aus, abgesehen davon mochte er den Namen nicht besonders. In manchen Momenten sah er einen gewissen Schalk in seinen rehbraunen Augen aufblitzen, weshalb er ihn nur »Lump« nannte. Dem Hund schien das herzlich egal zu sein, da er sowohl auf »Sam« wie auf den Namen »Lump« zu hören schien. Mal mehr, mal weniger.
Sechs Monate waren vergangen, seit er sein Haus in Stuttgart, Bad Cannstatt zu einem unverschämt guten Preis verkauft hatte. Den Erlös hatte er in ein schmuckes Häuschen im Konstanzer Musikerviertel gesteckt. Nur kleinere Umbaumaßnahmen waren nötig gewesen, um es behindertengerecht zu gestalten, dennoch hatte er sich von der Bank noch eine ordentliche Summe leihen müssen.
Unter normalen Umständen wäre er niemals bereit gewesen, mehr als eine Dreiviertelmillion Euro für ein Haus auszugeben, aber er wollte, nachdem er sich vor fast vier Jahren in die Landschaft verliebt hatte, unbedingt an den Bodensee zurück.
Obwohl etwas kleiner als sein altes Haus, bot es wesentlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten und hatte sich leichter für seine Bedürfnisse umbauen lassen. Die Badewanne hatte er demontieren und gegen eine barrierefreie Dusche ersetzen lassen.
Ebenso hatte er einen rollstuhlgeeigneten Treppenlift einbauen lassen, der eine ordentliche Stange Geld gekostet hatte. Der Architekt, der die Umbaumaßnahmen geplant und geleitet hatte, wollte Bad und Schlafzimmer ins Erdgeschoss verlegen, was aber zulasten des großen Wohnzimmers gegangen wäre, und das vorhandene Gäste-WC hätte entsprechend vergrößert werden müssen. Hagedorn hatte sich bewusst dagegen entschieden.
Gerade das Wohnzimmer war eines der Glanzpunkte des Hauses. Versehen mit einer beinahe über die gesamte Länge des Raumes verlaufenden Fensterfront, hatte er hier Sicht auf den Bodensee. Der Raum maß über vierzig Quadratmeter und war während des ganzen Tages lichtdurchflutet. Über eine breite Schiebetür gelangte er mit dem Rollstuhl bequem auf die mit Bangkirai-Holz belegte Terrasse. Außer dass er das Schiffsdielenparkett hatte aufbereiten lassen, hatte er in diesem Raum so gut wie keine Veränderungen vornehmen lassen.
Dass sich das Schlafzimmer, Bad und Büro nun im Dachgeschoss befanden, tat seiner Freude an der neuen Behausung keinen Abbruch.
Den Schritt, sein altes Leben in Stuttgart aufzugeben, hatte er nicht bereut. Schon während der Wintermonate hatte er mit dem Rollstuhl die nähere Umgebung erkundet. Nun genoss er die frühlingshaft milden Nachmittage am Ufer der Konstanzer Bucht.
Kurz überlegte Hagedorn, ob er zum Essen auf die Terrasse des Casino-Restaurants gehen sollte, entschied sich aber dagegen. Sparsamkeit war im Moment angebracht, zumindest so lange, bis die Durststrecke überwunden wäre. Und er zweifelte nicht daran, dass es sehr bald mit der Praxis aufwärtsgehen würde. Aber vielleicht sollte er sich doch einem breiteren Patientenkreis öffnen?
Sam stand mit geneigtem Kopf neben ihm. Aufmerksam sah er ihn an, als könnte er seine Gedanken hören.
Hagedorn schob eine Aufbackpizza in den Backofen, ehe er sich erweichen ließ, Sams Lieblingsspielzeug, einen einäugigen, speicheltriefenden Teddybären, den Sam ihm vor die Füße gelegt hatte, quer durch den Garten zu werfen. Sam jagte hinterher und brachte ihn freudig zurück.
Gerade als Hagedorn das Stofftier mit spitzen Fingern aufgehoben hatte und zu einem neuerlichen Wurf ausholte, erklang die Big-Ben-Tonfolge aus dem Hausflur. Die Klingel war das Einzige, was er aus seinem alten Haus mitgenommen hatte. Kraftvoll schleuderte er den Teddy, so weit es ging, in den Garten hinaus, fest entschlossen, das Läuten zu ignorieren. Weder standen irgendwelche Termine an, noch erwartete er Besuch.
»Herrgott noch mal!«, fluchte er.
Er ärgerte sich, dass er mit den Umbaumaßnahmen keine Gegensprechanlage hatte installieren lassen. Innerlich stellte er sich gerade darauf ein, zum hundertsten Mal einen dieser lästigen Paketzusteller abzuwimmeln, der ihn bitten würde, für seine Nachbarn ein Päckchen anzunehmen, als er das Blaulicht bemerkte, welches trotz des Tageslichts Blitze durch den Glaseinsatz der Haustür warf. Ungehalten riss er die Türe auf.
»Ihr habt mir gerade noch gefehlt«, bellte er den zwei Uniformierten entgegen, die gehetzt und überrascht zugleich auf ihn niederblickten.
Der jüngere der beiden Beamten fing sich schneller als sein Kollege. »Guten Tag, Herr Hagedorn«, begrüßte der ihn sichtlich verunsichert.
»Sie müssen uns begleiten. Ich habe den Auftrag …«
»Müssen muss ich gar nichts«, fiel Hagedorn ihm ins Wort. »Und solange ihr mir nicht sagt, worum es geht, schon zweimal nicht.«
Der ältere trat unruhig von einem Bein auf das andere und ergriff nun das Wort: »Es geht um einen Patienten von Ihnen. Mike Engler.«
Widerwillig war Hagedorn den beiden Beamten zum VW-Bus gefolgt, den ihm das Präsidium geschickt hatte. Nicht ohne Genugtuung hatte er beobachtet, wie sie sich mühten, seinen elektrischen Rollstuhl einzuladen, nachdem er sich auf den Beifahrersitz gehievt und sich angeschnallt hatte.
Schon vor Monaten hatte er sich einen wesentlich leichteren und kompakteren Standardrollstuhl besorgt, den man bequem zusammenklappen und transportieren konnte. Es hätte keinen Aufwand bedeutet, den Rollstuhl zu wechseln, aber irgendwie wollte Hagedorn den beiden Polizisten den Gefallen nicht tun.
Immer noch nach Atem ringend, hatte der ältere der Uniformierten auf einer der mit Kunstleder überzogenen Sitzbänke im hinteren Teil des Fahrgastraumes Platz genommen. Dieser war abgetrennt und nur durch einen schmalen Schiebeglaseinsatz einsehbar. Hagedorn mutmaßte, dass dies eine Art Gefangenentransportbus war, den man vornehmlich für eine sturzbetrunkene oder besonders renitente Klientel einsetzte. Der latente Geruch von Erbrochenem und Urin bestätigte seine Vermutung.
»Mein Name ist Stegner«, brüllte der ältere der beiden Beamten, dessen vor Anstrengung immer noch hochrotes Gesicht in der schmalen Öffnung des Glaseinsatzes erschienen war, gegen den Lärm des Martinshorns an. »Das ist mein Kollege Mang«, fuhr er fort und deutete mit dem Kopf Richtung Fahrer.
Mang nickte Hagedorn knapp, aber freundlich zu und bretterte mit Blaulicht und Martinshorn in halsbrecherischem Tempo weiter unbeirrt durch die Konstanzer Innenstadt. Die Fahrt ging in Richtung des Stadtteils Wollmatingen.
Hagedorn hatte alle Mühe, sich festzuhalten. Mehr als einmal überprüfte er den Sitz seines Sicherheitsgurtes und versuchte, ihn straffer zu ziehen, als er ohnehin schon über seiner breiten Brust spannte.
Verwundert stellte er fest, dass er bei mehr als einer Gelegenheit, bei der Mang in die Bremsen stieg, den Impuls verspürte, sich mit den Beinen in den Sitz zu stemmen. Nur dass seine Beine mit diesem Impuls nichts anzufangen wussten. Stattdessen pendelten sie nutzlos im Fußraum vor ihm, träge der Fliehkraft nach rechts oder links folgend, wenn der Fahrer mit quietschenden Reifen eine Kurve durchfuhr.
»Was ist denn jetzt eigentlich los?«, erkundigte sich Hagedorn bei Stegner.
»Ich weiß nur, dass Engler eine Bank überfallen, Geiseln genommen hat und ich Sie zur Bank bringen soll«, sagte Stegner achselzuckend. »Mehr hat man mir nicht gesagt. Wir werden aber in weniger als zwei Minuten am Einsatzort sein.«
»Arno Vissmann, Leiter der Verhandlungsgruppe«, stellte sich ihm der Mittfünfziger vor. Sein bereits lichter werdendes graues Haar stand in alle Richtungen ab, als hätte er es sich erst vor wenigen Minuten gerauft. Ein penetranter Knoblauchgeruch ging von ihm aus.
Hagedorn verzog angewidert das Gesicht.
»Döner mit Knoblauchsoße«, entschuldigte sich Vissmann beiläufig, dem Hagedorns Grimasse offensichtlich nicht entgangen war.
Hagedorns Blick glitt von der kleinen Bankfiliale, in der sich Mike Engler verschanzt hatte, über die angrenzenden und die gegenüberliegenden Gebäude.
Ihm waren die beiden Scharfschützen des Spezialeinsatzkommandos nicht entgangen. Einer hatte sich auf dem Flachdach eines Bürogebäudes, der andere hinter dem offenen Fenster einer Wohnung in Stellung gebracht. Einem weniger geübten Auge wären die beiden Präzisionsschützen sicherlich nicht aufgefallen.
Hagedorn überkam ein mulmiges Gefühl.
»Können wir?« Vissmanns Stimme riss ihn in die Realität zurück.
»Äh, klar!« Hagedorn folgte Vissmann zu einem etwas abseits abgestellten Einsatzleitwagen.
Ein halbes Dutzend uniformierter und ziviler Beamter stand über mehrere auf einem Klapptisch ausgebreitete Grundrisspläne gebeugt und beratschlagte.
Keine gute Ausgangssituation, wie Hagedorn fand. Anscheinend waren die Bemühungen, Engler zur Aufgabe zu bewegen, gescheitert. Nun diskutierte man die letzte noch verbliebene Option: das Gebäude zu stürmen und den Geiselnehmer zu überwältigen, was in den allermeisten Fällen tödlich für den Geiselnehmer endete.
Rasch stellte Vissmann die anwesenden Personen vor, von denen sich Hagedorn nicht einen Namen merken mochte.
»Sie haben mir immer noch nicht verraten, was ich hier eigentlich soll, Vissmann!«
Verlegen knetete Vissmann seine Hände. »Es ist so …«, druckste er herum. »Wir haben mit Englers Hausarzt gesprochen. Von ihm erfuhren wir, dass er bei Ihnen in Therapie ist.«
»War«, korrigierte Hagedorn barsch.
»Okay, war! Wir haben uns gefragt, ob Sie uns etwas über Engler sagen könnten, was uns hilft, seinen aktuellen psychischen Zustand besser beurteilen zu können.«
»Sie erwarten doch wohl nicht, dass ich gegen meine Schweigepflicht verstoße«, sagte Hagedorn entrüstet.
Vissmann schien mit dieser Antwort gerechnet zu haben, da er Hagedorns Einwand nur mit einem gleichgültigen Achselzucken kommentierte.
»Einen Versuch war es wert! Ich hatte gehofft, Sie wären kooperativer.«
»Wieso? Weil ich ein Ex-Kollege bin? War das so in etwa Ihr Gedankengang?«
Vissmann ging darauf nicht ein, sondern wandte seinen Blick zu der kleinen Bankfiliale, die kaum fünfzig Meter entfernt auf der gegenüberliegenden Straßenseite lag.
»Lassen Sie mich mit ihm reden, Vissmann!«
»Würde ich gerne. Aber Engler hat sein Mobiltelefon ausgeschaltet und die bankinternen Telefonleitungen unterbrochen.«
»Was ist eigentlich genau vorgefallen?«
»Schwer zu sagen. Nach allem, was wir dem wirren Gebrüll Englers entnommen haben, konnte er kein Geld von seinem Konto abheben. Laut einer Zeugin hat er die Filiale wutschnaubend verlassen und ist zwanzig Minuten später zurückgekehrt. Um den Bauch soll er eine Art Sprengstoffgürtel tragen. Zumindest glaubte die Zeugin, einige lose Drähte unter seiner Jacke erkannt zu haben.«
»Pff!«, schnaubte Bannert. »Das glaube ich nicht! Wie und wo soll er sich in der Kürze der Zeit eine Bombe beschafft haben?«
»Ich sagte Ihnen ja. Mehr wissen wir leider auch noch nicht.«
»Hat er Forderungen gestellt?«, erkundigte sich Hagedorn.
»Nein, keine.«
»Hm. Okay.« Hagedorn rieb sich die Nase und dachte einen Augenblick darüber nach, was er Vissmann über Engler sagen konnte, ohne dass ihm jemand daraus einen Strick würde drehen können.
»Trotz seiner Vorgeschichte ist er nicht der Typ, der zu Gewalt neigt. Einmal abgesehen von seinen selbstzerstörerischen Neigungen. Ich muss mit ihm sprechen«, drängte Hagedorn. »Machen Sie das irgendwie möglich!«
»Ich halte das für keine gute Idee. Aber ich will sehen, was ich machen kann«, erwiderte Vissmann und wandte sich dem SEK-Kommandoführer zu, dem er mit einer knappen Handbewegung bedeutete, ihm zu folgen.
Hagedorn beobachtete Vissmann und den leitenden SEK-Mann, als sie sich einige Meter entfernten und miteinander sprachen.
Obwohl es bald dämmern würde, war es immer noch sehr mild für einen Tag Anfang Mai. Er streifte sich die dünne Strickjacke ab, die er sonst nur zu Hause zu tragen pflegte. Wenn Engler die Kommunikation gekappt hatte, würden der Polizei nicht allzu viele Optionen bleiben. Das Spezialeinsatzkommando würde die Bank stürmen. Möglich, dass sie damit bis zum Einbruch der Dunkelheit warten würden.
Das SEK würde sich einen taktischen Vorteil verschaffen und das Gebäude vom Stromnetz trennen, sodass es in völliger Dunkelheit liegen würde, um dann selbst Restlichtverstärker zum Einsatz zu bringen.
Hagedorn wusste nicht, was Englers Verhalten ausgelöst hatte. Während seines klinischen Praktikums hatte er über zwei Jahre mit Mike Engler gearbeitet. In dem jungen Mann schlummerte eine Unmenge Wut und Zorn, welche er bislang immer nur gegen sich selbst gerichtet hatte. Jahrelanger sexueller Missbrauch hatte das sensible Kind, den sensiblen Teenager, regelrecht zerbrochen.
Seit seinem dreizehnten Lebensjahr schluckte, spritzte, schnüffelte, inhalierte und schniefte Engler alles, was er in die Finger bekommen konnte, um der Realität zu entfliehen. Sein Strafregisterauszug war ellenlang, und dennoch war er anderen gegenüber nie gewalttätig geworden.
Hagedorn musste etwas unternehmen, wollte er den jungen Mann retten.
»Hagedorn, wo wollen Sie hin?«
Augenblicklich brach Hektik unter den Einsatzkräften aus. Hagedorn ignorierte das wütende Gebrüll Vissmanns und des SEK-Kommandoführers und beschleunigte sein Gefährt.
»Hagedorn, Sie verdammter Sturkopf! Kommen Sie sofort zurück!«
Er hob den linken Arm und zeigte Vissmann über die Schulter den Mittelfinger, während er mit der maximalen Geschwindigkeit, zu der sein Elektrorollstuhl in der Lage war, auf den Haupteingang der Bankfiliale zuhielt. Hagedorn blieb kaum Zeit, sich darüber zu wundern, dass Engler die automatischen Schiebetüren nicht durch einen Bankangestellten hatte verriegeln lassen, als die Türen viel zu langsam aufglitten und er krachend den rechten Flügel streifte, der bedrohlich hin und her schwang.
Der junge hagere Kerl fuhr erschrocken zusammen und wirbelte um die eigene Achse. Überrascht blickte Engler in Hagedorns Gesicht, der schwer atmend, als hätte er einen Hundert-Meter-Lauf absolviert, seinen Elektrorollstuhl zum Stillstand brachte.
»Was machen Sie denn hier?«, schrie er ihn an. »Machen Sie, dass Sie wegkommen!«
Hagedorn hob beschwichtigend die Arme. »Mike, beruhige dich! Sieh her, ich bin unbewaffnet«, sagte Hagedorn und schwenkte sichtbar seine Hände, während er Engler dabei nicht aus den Augen ließ.
Englers Augen huschten unstet zwischen ihm und dem Eingang, dessen Schiebetüren immer noch leicht vibrierten, hin und her. »Verdammt! Was wollen Sie?«
»In erster Linie will ich dir helfen, Mike.«
Engler stand vor einem der beiden Bankschalter und kaute nervös auf einem Daumennagel. »Helfen?« Er schnaubte verächtlich. »Ich wüsste nicht, wie Sie mir helfen könnten.«
»Mike, hör zu! Noch ist nichts passiert, was sich nicht aus der Welt schaffen ließe.«
»Sie haben doch keine Ahnung, Mann!«, schrie Engler. »Ich habe noch eine Bewährung offen. Glauben Sie, ich kann hier einfach so rausspazieren, und dann lassen die mich laufen? Wie dämlich sind Sie eigentlich?« Engler spähte nervös durch das mit Vertikaljalousien verhängte Schaufenster nach draußen.
Hagedorn ließ seinen Blick in den hinteren Teil des Schalterraums gleiten. Eine kleine Filiale, wie man sie nur noch in einigen Vororten oder auf dem Land fand und wo man Bargeldabhebungen über dreitausend Euro einen Tag vorher anmelden musste. Der Schalterraum war kaum größer als sein Wohnzimmer. Hinter zwei frei stehenden Schaltern hing eine altertümlich aussehende Überwachungskamera an der Decke. Links davon befand sich ein winziges verglastes Kabuff mit einem raumfüllenden Schreibtisch.
An der Wand, unmittelbar unter dem Kameraungetüm, entdeckte Hagedorn eine junge Frau und einen etwas älteren, schon ergrauten Mann – vermutlich der Filialleiter und eine Auszubildende.
Beide saßen mit angezogenen Beinen zusammengekauert an die Wand gelehnt. Blut und Rotz troff aus der dick angeschwollenen Nase des Mannes. Hagedorn mutmaßte, dass Engler ihm ordentlich eine verpasst hatte.
Sein Rollstuhl setzte sich summend in Bewegung, und er näherte sich Engler.
»Was ist eigentlich los?«, hob Hagedorn sanfter an.
»Was los ist? Der Wichser dahinten will mir kein Geld mehr geben.« Englers Zeigefinger stach wütend in die Richtung des Filialleiters. »Ich hatte immer ein Überziehungslimit von fünfhundert Euro. Obwohl ich erst hundertfünfzig Euro in den Miesen bin, will mir der Fettsack kein Geld mehr geben.«
»Hey!«, rief Hagedorn dem Mann zu. »Wie ist Ihr Name?«
»Breyer. Horst Breyer«, näselte der Mann gepresst hervor.
Hagedorn musterte den Mann. »Sind Sie der Filialleiter?«
Sein schütteres und akkurat auf eine Schädelseite gescheiteltes Haar hüpfte auf und ab, als er beflissen nickte. Breyer trug eine schlecht gebügelte graue Bundfaltenhose und ein geschmackloses grünes Hemd, das sich über seinem feisten Wanst spannte. Ausgedehnte Schweißränder hatten sich unter seinen Achselhöhlen gebildet. Hagedorn maß den Mann und kam zu dem Schluss, dass er ihn nicht mochte.
Er kannte die Sorte Mensch. Ein kleiner gescheiterter Bankangestellter, dessen Karriereträume, irgendwann eine eigene Abteilung zu übernehmen, zerplatzt waren, gefangen in einer unbedeutenden Filiale weit weg vom Haupthaus. Ausgestattet mit einem Minimum an Entscheidungsbefugnis und Macht, die er Schwächeren gegenüber nur allzu gern ausspielte.
»Zu Ihnen komme ich noch!«, spie ihm Hagedorn kopfschüttelnd entgegen und wandte sich erneut Engler zu. Hagedorn empfand kein Mitleid mit Breyer. Schließlich war er nicht ganz unschuldig an der Misere. »Mike, sieh mich an!«
Engler lugte erneut nervös durch die Lamellen hindurch, die er mit zwei Finger vorsichtig auseinandergespreizt hatte.
»Mike!«, wiederholte Hagedorn nachdrücklicher.
Engler fuhr zusammen und warf ihm einen wütenden Blick über die Schulter zu.
»Was trägst du unter deiner Jacke?«, wollte Hagedorn wissen.
»Was?«
»Ich möchte sehen, was du unter deiner Jacke hast.«
Engler schien nicht zu verstehen, worauf Hagedorn eigentlich hinauswollte, hob aber den Saum seines Hoodies und drehte sich einmal um die eigene Achse.
»Was soll ich denn unter der Jacke tragen? Sind Sie irre, Mann?«
»Und was sind das für Kabel?«
Erst jetzt schien Engler zu verstehen. »Das sind die Kabel von meinem iPod-Kopfhörer, Sie Spacko! Was dachten Sie denn?«
»Was ich denke, ist völlig egal. Mach dir mal lieber Gedanken, was die da draußen denken«, antwortete Hagedorn und deutete mit dem Daumen hinter sich.
Der geriffelte schwarze Messergriff, der aus Englers vorderem Hosenbund ragte, war Hagedorn nicht entgangen, er vermied es jedoch, allzu auffällig hinzusehen.
»Mike, komm schon. Gib mir das Messer, und lass uns zusammen rausgehen. Ich verspreche, dir wird nichts geschehen.«
»Nicht, bevor mir das Arschloch da hinten meine Kohle gibt.« In Englers weinerlicher Stimme schwang Wut und Frustration mit.
Angstvoll zog der Filialleiter den Kopf zwischen die Schultern und wirkte dadurch noch jämmerlicher.
»Wie soll ich denn über die Runden kommen? Wovon soll ich Essen kaufen? Hm? Sag mir das, du Wichser!«, spie Engler dem ängstlich zitternden Banker entgegen.
Hagedorn musste verhindern, dass er sich weiter in Rage redete. »Wie viel brauchst du denn, um über den Monat zu kommen?«, fragte Hagedorn ruhig.
Engler sah Hagedorn verdutzt an. »Äh, ich weiß nicht. Zweihundertfünfzig sollten reichen. Wieso? Wollen Sie mir das Geld geben?«
»Wenn du mir versprichst, mir das Messer zu geben und mit mir nach draußen zu kommen, geb ich dir das Geld. Natürlich nur geliehen«, fügte Hagedorn gönnerhaft grinsend hinzu.
»Komiker!« Engler schnaubte. Er spähte erneut durch die Jalousien und schien mit sich zu ringen.
Langsam wandte er sich vom Fenster weg und sah unsicher auf Hagedorn hinunter.
»Ich verspreche dir, dass ich dich nicht alleinlasse«, bekräftige Hagedorn. »Ein Freund von mir ist ein ziemlich guter Strafverteidiger. Ich werde ihn bitten, deinen Fall zu übernehmen.« Hagedorn neigte den Kopf, um das Gesicht des jungen Mannes besser zu sehen. »Mike? Haben wir einen Deal?«
Allmählich entspannten sich Englers Gesichtszüge, und Hagedorn sah, wie dessen Widerstand zu bröckeln begann.
Vorsichtig streckte Hagedorn seine Hand nach dem Messer aus, das Engler zögerlich aus seinem Hosenbund zog.
Plötzlich ließ ein ohrenbetäubender Knall die Luft erzittern. Winzige scharfkantige Glaswürfelchen stoben in alle Richtungen, fraßen sich in Hagedorns Stirn und Wangen. Zwei kleinere Explosionen folgten, und beißender Rauch hüllte ihn sogleich ein.
Durch den Tränenschleier hindurch sah Hagedorn nur schemenhaft, wie zwei schwarz gekleidete und schwer bewaffnete Hünen sich durch die gesprengte Schaufensterscheibe zwängten und sich auf Engler warfen.
Sie rissen ihn samt der Jalousienleiste mit sich zu Boden.
Keinerlei Gegenwehr, kein Aufschrei, nicht einmal ein Stöhnen war zu hören, als sich unter dem schmächtigen jungen Mann, der nun seltsam verkrümmt unter den Einsatzbeamten lag, eine dicke, zähe Blutlache auszubreiten begann.
»Ihr Idioten! Ihr verdammten Idioten!«, brüllte Hagedorn.
Kapitel 2
2. Mai – Stuttgart, Flughafen
Mit einer Mischung aus Abscheu und Neugier beugte sich Nadine Adler dicht über den männlichen Leichnam. Der Mann mochte höchstens vierzig Jahre alt geworden sein. Ein teuer aussehender Designeranzug, Lackschuhe und streng nach hinten gestylte Haare erinnerten sie an einen aalglatten Geschäftstypen. Vielleicht ein Banker oder Börsenheini. Der Duft eines teuren Aftershaves haftete dem Toten an.
Eine so gut duftende Leiche ist mir auch noch nie untergekommen, ging ihr durch den Kopf.
Prüfend glitt ihr Blick über das grausam entstellte Gesicht. Häme und Boshaftigkeit lagen darin, was darauf hindeutete, dass die ihm beigebrachten Stichverletzungen Gesichtsnerven durchtrennt hatten, die den Mund widernatürlich entstellten. Wo die Augen sein sollten, klafften zwei dunkle, blutige Krater.
Ohne den Blick von dem Toten abzuwenden, begann sie zu sprechen: »Was denkst du, wie lange ist er schon tot?« Ihre Stimme hallte von den weiß gekachelten Fliesen wider.
»Noch keine drei Stunden«, bekam sie zur Antwort. Ihr Kriminaltechniker steckte in einem weißen Einwegoverall. Die Kapuze hatte er tief ins Gesicht gezogen, und er trug einen Mundschutz. Gerade beschriftete er mehrere Spurentüten.
Adler erhob sich und trat zurück. Sie zog sich die schwarzen Latexhandschuhe von den Händen, die dabei ein schnalzendes Geräusch von sich gaben, und entsorgte sie in einem bereitgestellten Müllsack.
»Todesursache?«
»Lässt sich so nicht genau bestimmen«, antwortete der Kriminaltechniker achselzuckend. »Das muss die Obduktion klären. Ich habe im Oberkörper, im Hals- und Gesichtsbereich insgesamt neunzehn Einstiche gezählt. Jedoch dürften die wenigsten davon unmittelbar tödlich gewesen sein. Nagel mich nicht fest, aber ich würde vermuten, dass mindestens zwei der Einstiche im Brustbereich einen oder beide Lungenflügel kollabieren ließen.«
»Wenig Blut, oder nicht?«, fragte Adler verwundert.
»Richtig. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Sehr wahrscheinlich war inneres Verbluten und/oder Ersticken die Todesursache.«
»Kannst du mir zum Tatwerkzeug was sagen?«, fuhr sie fort, als sie sich die Füßlinge abstreifte und sich aus dem Einwegoverall pellte.
Der KT-Mann rieb sich umständlich mit dem Rücken der behandschuhten Hand die Nase. »Hm, genau weiß ich es nicht. Aber die Stichkanäle sind nicht sehr breit. Maximal elf Millimeter. Die Wundränder sind sauber und glatt. Vielleicht ein beidseitig geschliffenes Stilett. Weiß nicht. Wir müssen warten, bis die Tiefe des Stichkanals bekannt ist. Könnte aber alles Mögliche gewesen sein.«
»Okay. Danke dir. Sorgst du dafür, dass der Tote heute noch in die Obduktion geht?«
»Na klar! Nach der mündlichen Anordnung der Staatsanwaltschaft habe ich uns in der Gerichtsmedizin schon vorangemeldet. Spätestens heute Nachmittag wissen wir mehr.«
»Ah ja …«, hob sie an, als sie sich schon zum Gehen wandte. »Die Zeugin, die die Leiche entdeckt hat – wo ist die?«
»Lindemann ist mit ihr zum Flughafenposten gegangen und vernimmt sie dort.«
»Sehr gut! Also dann, bis später!«, sagte sie zum Abschied und eilte aus der Toilette.
Im Gehen schlüpfte Nadine Adler in ihre Blousonjacke und band den Pferdeschwanz neu, der sich beim Ausziehen des Einwegoveralls gelöst hatte.
Sie orientierte sich an den Hinweisschildern und schlug den Weg zum Polizeiposten der Landespolizei am Flughafen Stuttgart ein. Mehrere Behörden teilten sich die Souveränität am Flughafen. Die Bundespolizei hatte die grenzpolizeilichen Aufgaben wahrzunehmen, die Zollbehörde war für den Warenverkehr zuständig und für die restlichen Belange die Landespolizei.
Nadine Adler wunderte sich, dass Lindemann die Zeugin nicht zur viel näher gelegenen Flughafeninspektion der Bundespolizei verbracht hatte, anstatt mit ihr durch den halben Flughafen zu marschieren. Ihr Praxisausbilder hatte ihr, als sie als junge Kommissarin aufs Innenstadtrevier versetzt worden war, erklärt, dass die Bundespolizisten am Flughafen es nicht so gern sahen, wenn Landesbehörden sich in ihren Büros einnisteten, und sei es nur für ein paar Stunden.
Persönliche Befindlichkeiten, für die Adler keinerlei Verständnis aufbrachte. Natürlich hatten sie unterschiedliche Zuständigkeiten und Kompetenzen. Aber sie alle waren bei der Polizei und dienten ein und demselben Zweck.
Erst nach dem zweiten Versuch war es ihr gelungen, ihre Haare in einem einigermaßen ansehnlichen Pferdeschwanz zu bändigen.
Kritisch betrachtete sie sich im Schaufenster eines verdunkelten Reisebüros. Für die Begutachtung eines Tatorts, an dem ein Mensch niedergemetzelt wurde, und für längere Fußmärsche trug sie heute definitiv das falsche Outfit.
Als der Anruf sie erreicht hatte, dass es einen weiteren Mord gegeben hatte, war sie auf dem Rückweg von einer Besprechung gewesen und nur fünfzehn Minuten vom Flughafen entfernt. Mit Blaulicht und Martinshorn hatte sie sich den Weg nach Filderstadt gebahnt, was ihr eine fast diebische Freude bereitet hatte. Leider kam sie aufgrund ihrer Position kaum mehr in den Genuss einer rasanten Einsatzfahrt.
Als Adler am Polizeiposten angekommen war, musterte der altgediente Polizeihauptmeister ungläubig ihren Dienstausweis, der sie als Kriminalrätin des Landeskriminalamtes auswies, ehe sich die Schleusentür summend entriegelte und er ihr Eintritt gewährte.
»Ich suche meinen Kollegen Lindemann«, antwortete Adler, nachdem er sich nach ihrem Begehr erkundigt hatte.
Er bedeutete ihr zu folgen.
Adler musterte verstohlen das Profil des Kollegen, in dessen buschigem Oberlippenbart sich einige Brotkrumen verirrt hatten. Er trug eine filigrane Brille mit runden Gläsern, die ihm auf die Nasenspitze gerutscht war. Sein Anblick erinnerte sie an eine Kindersendung. Angestrengt überlegte sie, wie sie hieß.
Wortlos und ohne Eile führte er Adler durch ein Gewirr aus Gängen, vorbei an Kopierern, Druckern, altertümlich anmutenden Faxgeräten, einer Arrestzelle und mehreren Büros, in denen emsig auf Tastaturen geklappert wurde, bis zu einem verglasten Raum, vor dem er abrupt hielt.
Meister Eder! Er sah aus wie Meister Eder in Uniform, schoss es Adler plötzlich durch den Kopf. Als Kind hatte sie mehr auf die japanischen Anime-Serien gestanden.
Wenn sie gelegentlich die Wochenenden bei ihrer Oma verbracht hatte, hatte jedoch Oma das Programm festgelegt. Wie der Schauspieler hieß, wusste sie nicht mehr, aber nun kam ihr auch der Titel der Kinderserie wieder ins Gedächtnis. Meister Eder und sein Pumuckl.
Den richtig coolen Serien, wie Kim Possible oder Avatar – Der Herr der Elemente, konnte Oma nichts abgewinnen. Es gab so unglaublich viele Dinge, die sie unauslöschlich mit ihrer Oma assoziierte. Neben Marmorkuchen, Zimtsternen, Maoam-Kaubonbons war Pumuckl eines davon.
Meister Eder tippte sich an eine imaginäre Schildmütze und empfahl sich.
Adler murmelte ihren Dank und wandte sich der Scheibe zu. In dem Raum saß in sich zusammengesunken eine junge Frau auf einem Drehstuhl und schnäuzte sich geräuschvoll in ein Kleenex, von denen sie schon große Mengen verbraucht hatte, dem Berg, der sich vor ihr auftürmte, nach zu urteilen. Es war offenkundig, dass der Fund des Toten sie stark mitnahm. Tränen kullerten über ihre Wangen, und sie zitterte.
Lindemann saß ihr mit überschlagenen Beinen gegenüber und wartete geduldig, bis sie wieder in der Lage war zu sprechen.
Er hatte Adler bemerkt und deutete durch die Scheibe ein Nicken an.
Sie hatte nicht die Absicht, den Raum zu betreten und die Vernehmung zu stören.
Lindemann war seit vielen Jahren am LKA und hatte sich durch sein besonders empathisches Vorgehen und sein Fingerspitzengefühl bei Verhören einen Namen gemacht.