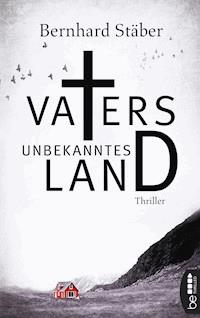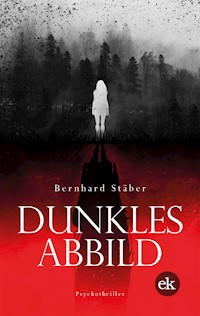
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag edition krimi
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Fotografin und alleinerziehende Mutter Silje Iversen lebt südlich von Oslo in der Kleinstadt Skien. Als sie eines Tages ein Graffiti an einer Hauswand ablichtet, ahnt sie nicht, dass sie selbst im Fokus einer Kamera steht. Katrine Haugen, die Silje zufällig getroffen hat, ist fasziniert, ihr früheres Vorbild aus dem Jugendclub wiedergefunden zu haben. Sie folgt ihr heimlich. Mit wachsender Besessenheit drängt sie sich in Siljes Leben. In ihrer Vorstellung verwandelt Katrine sich zu einem Abbild ihres Idols. Um ihre Phantasie aufrecht zu erhalten, schreckt sie selbst vor Mord nicht zurück. Kann Silje Iversen sich und ihr Kind vor diesem dunklen Abbild ihrer selbst beschützen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Stäber
Dunkles Abbild
On a winter night I hear the Easter bell:I knock on graves and quicken the dead,Until at last in a grave I see — myself.
(Wjatscheslaw Iwanowitsch Iwanow: »Winter Sonnets: XI«)
»Ein hoher Spiegel – so schien es mir zuerst in meiner Verwirrung – stand nunmehr dort, wo vordem keiner sichtbar gewesen war; und als ich, in einem Übermaß von Grausen, darauf zutrat, kam mir mein eigenes Bild entgegen, aber ganz bleich im Gesicht und blutbespritzt …«
(Edgar Allan Poe: »William Wilson«)
»Von allen Prothesen, die die Geschichte des Körpers begleiten, ist der Doppelgänger sicher die älteste. … Wie die Seele, der Schatten und das Bild im Spiegel, die das Subjekt als sein Anderes heimsuchen, bewirkt das Double, dass das Subjekt zugleich es selbst ist und sich doch nie gleicht und von ihm heimgesucht wird wie ein kleiner und ständig heraufbeschworener Tod.«
(Jean Baudrillard: »Transparenz des Bösen. Ein Essay über extreme Phänomene«)
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Hinter dem Vorhang
1
»Nächster Halt: Skien, Ausstieg rechts.«
Es dauert einen Moment, bis die blecherne Stimme aus dem Lautsprecher zu meinem Verstand vordringt. Irgendwann kurz nachdem ich in Oslo eingestiegen bin, muss ich eingeschlafen sein, wahrscheinlich schon recht früh, denn viel habe ich von den zwei Stunden nicht mitbekommen. Der Gin Tonic war gut gewesen, ich hatte den Buzz vermisst, mit dem alles um mich herum gleichzeitig scharfkantiger und doch auch stumpfer an den Rändern wurde. Aber die Drinks hatten mich müde gemacht, so müde. Es war eine lange Woche gewesen.
Ich hatte mich mit Ina in Oslo getroffen, und wir waren gerade mal in zwei Bars gegangen, ins *ism und in die Angst, bis mir unvermittelt im Sitzen die Augen zugefallen waren. Um die Zeit, als ich mich auf die Fahrt nach Hause gemacht hatte, wäre ich noch vor ein paar Jahren erst richtig losgezogen. Aber da hatte es schließlich noch nicht Simon in meinem Leben gegeben.
Der Zug verlangsamt sich und rollt im Bahnhof von Skien ein. Erst als er fast zum Stehen gekommen ist, erhebt sich der junge Mann, der mir gegenübersitzt. Er ist gut zehn Jahre jünger als ich, Anfang zwanzig und so groß, dass er fast den Kopf einziehen muss, als er sich ganz aufgerichtet hat. Er zwängt sich an einer jungen Frau vorbei, die mitten im Gang steht und einen schwarzen Rucksack aus der Gepäckablage zieht. Sie schaut dem Typ kurz genervt hinterher, dann senkt sie den Kopf und folgt ihm. Skien ist die Endstation, weswegen hier alle aussteigen.
Ich erhebe mich als Letzte. Ich bin immer noch benommen von meinem langen Zugnickerchen. Beim Durchqueren des Wagens gleitet mein Blick aus den Fenstern zu meiner Rechten. Das Bahnhofsgebäude ist ein dunkler Kasten vor der jetzt im Juli spät einsetzenden Dunkelheit. Davor gleitet ein Schemen von Fensterscheibe zu Fensterscheibe, mein schwankendes Spiegelbild: leicht vornübergebeugt, das Gesicht ein blasser Fleck unter kurzem blondem Haar, das kaum die Schultern berührt, verschwommen wie meine angetrunkenen Gedanken.
Es war schön gewesen, wirklich schön, mehr als sechs Wochen seit dem Nationalfeiertag endlich mal wieder auszugehen, und das in Oslo, wo es einfacher ist, in Anonymität abzutauchen, nicht in Skien, wo man dauernd auf Leute trifft, die man kennt. Aber ich hatte es gar nicht richtig genießen können. Mein erschöpfter Körper wollte nicht mitspielen und drängt jetzt vor allem auf ein Bett.
Ich atme tief die kühle Nachtluft ein, als ich auf den Bahnsteig trete. In Oslo war es trocken gewesen, aber hier muss es geregnet haben, während ich fort war, denn der Asphalt ist nass, und das Licht der Bahnhofsbeleuchtung spiegelt sich auf der dunklen, rauen Oberfläche. Der Wind trägt noch ein wenig Nässe mit sich, die sich wie feiner Nebel auf meine erhitzten Wangen legt. Endlich verschwindet meine Müdigkeit. Ich sehe mich nach den wartenden Taxis am Rand des Parkplatzes neben dem Bahnhofsgebäude um, aber es ist nur ein Gedankenspiel: Lieber laufe ich die Viertelstunde ins Zentrum, wo ich wohne, als dass ich Geld für ein Taxi ausgebe.
Die Frau mit dem Rucksack steht am Ende des Bahnsteigs außerhalb des Lichtkegels der nächsten Straßenlaterne. Trotz des sommerlich milden Wetters trägt sie eine dunkelbraune Schirmmütze tief ins Gesicht gezogen. Als ich an ihr vorbeigehe, fällt mein Blick auf die Fototasche, die ihr an einem breiten Riemen über der rechten Schulter hängt. Der Behälter sieht wie the real vintage deal aus: abgewetztes schwarzes Leder, mit einem glänzenden Schriftzug aus Metall, »minolta« in kleinen Lettern.
Für einen Moment bin ich versucht, innezuhalten und die Frau auf ihre Kamera anzusprechen. Bestimmt steckt in ihrem Gehäuse noch ein klassischer Rollfilm. Aber meine Müdigkeit, die nur kurz von der frischen Nachtluft vertrieben wurde, meldet sich gerade umso stärker zurück, und ich habe keinen Nerv, noch eine Weile auf dem Bahnhofsgelände herumzustehen, um mit einer fremden Frau über analoge Fotografie ins Gespräch zu kommen. Ich will nur noch ins Bett.
Ich trabe zielstrebig, aber auch immer noch angeschickert an ihr vorbei und auf die Grünanlage zu, die südlich vom Bahnhof liegt. Als ich den Weg zwischen den schattenhaften Umrissen hoher Bäume entlanggehe, fahre ich unwillkürlich mit der Hand in meine Umhängetasche und fühle mit den Fingerspitzen über den Rand der Dose mit dem Pfefferspray. Ich weiß, dass sie an Ort und Stelle ist, ich sehe sie immer, wenn ich etwas hineingebe oder heraushole. Aber in einer dunklen Straße, in der kaum Menschen unterwegs sind, ist das etwas anderes. Da muss ich mich doch kurz versichern, dass ich das Pfefferspray in Griffweite habe.
Ein Gefühl von Sicherheit hebt meine Stimmung. Außerdem kenne ich den Weg, bin ihn oft genug gegangen. Meine Gedanken treiben zurück zu Ina und dem heutigen Abend. Sie wollte ihre Beförderung begießen – nur mit mir. Sie hätte mit der kompletten Führungsetage ihres Verlags feiern gehen können, und vielleicht macht sie das ja auch in ein paar Tagen noch. Aber als heute Mittag die Entscheidung fiel, war ich es, der Inas spontaner Anruf von der Toilette aus galt, in die sie sich vor Aufregung zum Kotzen zurückgezogen hatte. Und diesmal kam mir das Universum tatsächlich mal entgegen: Daliya erklärte sich spontan bereit, auf Simon aufzupassen, damit ich nach Oslo fahren und mich mit Ina treffen konnte. Sie macht das nicht zum ersten Mal, und er mag sie. Eine Nachbarin wie sie ist Gold wert.
Ina wirkt eiskalt, wenn sie einen mit ihren hellblauen Augen ansieht, in denen kaum noch Farbe zu finden ist, Augen wie die zugefrorenen Ufer des Norsjø an einem Wintertag. Aber in Wirklichkeit gibt sie sich nur äußerste Mühe, es sich nicht anmerken zu lassen, wenn sie aufgeregt ist. Und sie war aufgeregt, als sie mich anrief.
Die Frage, ob sie die Programmleitung des Verlags übernehmen wolle, hatte sie völlig unvorbereitet getroffen, und die schnelle, formlose Bestätigung, als sie zugesagt hatte, beinahe noch mehr. Das erzählte sie mir während ihres ersten Cocktails, eines staubtrockenen Martinis. Ina ist so old-school, dass sie ihren Drink allen Ernstes wie Bond, James Bond, geschüttelt, nicht gerührt bestellen kann, ohne dass es albern wirkt. Hat sie sich vielleicht von ihren Autoren abgesehen. Nach allem, was sie erzählt, ist es ein einziger Haufen exzentrischer Nerds.
»Auf die neue Belletristik-Programmleitung des Folkvang Verlags!«, hatte sie laut gerufen, ohne sich um die Blicke von den anderen Tischen zu kümmern, und ihr Martiniglas in die Luft gehoben. »Keine Erfahrung in Teamleitung, aber sie trauen es mir zu, also werde ich es mir erst recht zutrauen. No risk, no fun.«
Es war nicht bei dem einen Glas geblieben, und ich hatte mit Gin Tonic mitgehalten und auf ihren neuen Job angestoßen.
»Wird endlich Zeit, dass du auch mal wieder was riskierst. Du wirst langsam zu einer Einsiedlerin«, hatte sie nach ihrem dritten Cocktail gesagt, den wir in der Nedre Løkka Bar getrunken hatten, einem Caipirinha. Was soll ich sagen, sie ist oldschool. Kaum dass ihr das herausgerutscht war, hatte sie sich die Hand auf den Mund geschlagen. »Fuck! Sorry, Silje. Ich wollte dich nicht drängeln.«
»Hast du nicht«, hatte ich abgewunken und schnell an ihr vorbeigeschaut, als sei mir jemand schräg hinter ihr aufgefallen. Ich hatte ihr nicht in die Augen schauen können, aus Sorge, sie würde sehen, dass sie mich mit ihrer Bemerkung tatsächlich erwischt hatte. Ich war ja nach einer Woche Kellnern schon so erledigt, dass ich mich selbst an meinem freien Tag zeitig auf den Heimweg machte. Nicht einmal ein paar spontane Worte mit einer Frau, die mit einem vermutlich analogen Schmuckstück fotografierte, hatte ich auf die Reihe bekommen. Wahrscheinlich hatte Ina recht. Dieser Tage riskierte ich wirklich nicht viel. Selbst um das kleine Haschpiece an mich zu nehmen, das ich von ihr gekauft hatte, war erst mal ein Drink nötig gewesen.
Sie hatte das Thema, über das wir nicht reden, letztendlich auch nicht angesprochen, zum Glück. Stattdessen hatte sie sich darauf konzentriert, mir die Vorteile von Oslo aufzuzählen, während sie den Rest ihres Caipirinhas durch den Strohhalm saugte. Sie hat es nicht ausgesprochen, aber natürlich hofft sie darauf, dass ich irgendwann wieder in ihre Nähe ziehe.
Rechts und links zu meinem Weg nach Hause stehen die niedrigen, meist weiß gestrichenen Holzhäuser von Skien. Die Spalier stehenden Kleinstadtfassaden scheinen gar kein Ende zu nehmen. Ein paar Stunden in Oslo, und die Provinz schließt sich wieder um mich wie eine Auster. Ich ertappe mich dabei, wie ich schneller gehe, damit die Häuser nicht tatsächlich auf einmal zusammenrücken und mich zerquetschen.
Erst am Liefriedhof nördlich vom Stadtzentrum und ganz bei mir um die Ecke verlangsame ich wieder meinen Gang. Ein großer Teil der weitläufigen Anlage sieht mehr aus wie ein umzäunter Park mit ein paar Ansammlungen von Gräbern. Ich blicke über die Schemen der Grabsteine, schwarze Strukturen, halb versunken in der tieferen Dunkelheit ohne Straßenlaternen. Hier kann ich immer frei atmen, besonders nachts, wenn die Häuser schlafen. Meine Absätze hallen klackend auf dem Gehsteig wider, aber da ist noch ein anderes Geräusch, kein Echo, sondern ein weiteres Paar Schuhe, fast synchron im Einklang mit meinen Schritten.
Ich halte inne und drehe mich um, aber niemand ist hinter mir zu sehen, die Straße ist leer. Schon komisch, wie einem die eigenen Sinne Streiche spielen können. Eigentlich machen sie das ziemlich oft, nur fällt es einem kaum auf, weil es so völlig alltäglich ist, wie die Illusion vorhin beim Anfahren des Zuges in Oslo, als der Bahnsteig für ein paar Augenblicke am stehenden Wagen vorbeizuziehen schien. Aber was, wenn die vielen Augenblicke in ihrer Gesamtheit eine einzige lange Illusion ergeben? Das Leben ein Traum vom Leben.
Langsam wende ich mich wieder um. Mein Blick gleitet über die braune Backsteinmauer der Missionskirche zu meiner Rechten, der man gar nicht ansehen würde, dass sie zu einem religiösen Gebäude gehört, wenn der Name nicht in großen metallenen Lettern an der Seitenwand stehen würde. Ein Fleck an der Mauer fängt meine Aufmerksamkeit ein. Erst denke ich, dass es eine weitere Illusion wie das Echo meiner Schritte ist, der Schatten eines Astes vielleicht. Aber es ist kein Schatten, sondern ein Graffiti. Jemand hat etwas auf die Backsteine gesprüht, das wie eine Mischung aus einem Pfeil und einer Vogelfeder aussieht.
Der Pfeil läuft in einer dreieckigen Spitze aus. Die Vogelfeder befindet sich an dem Ende des Schafts, wo bei einem echten Pfeil die Befiederung wäre. Das Symbol scheint mit einer Schablone aufgesprüht worden zu sein. Einen Schriftzug, wie man ihn oft bei Graffitis dieser Art findet, ist nicht zu sehen.
Etwas an dem nächtlichen Motiv an der Backsteinmauer hält mich davon ab, weiterzugehen. Die Zielgerichtetheit des abgeschossenen Pfeils verwandelt sich in das unbestimmte Dahingleiten einer Vogelfeder. Oder ist es genau andersherum?
Ich ziehe mein Handy hervor. Ich schieße nur selten Fotos mit der Kamera darin. Aber es ist die einzige Kamera, die ich gerade bei mir habe, also benutze ich sie. Ich mache ein Foto von dem Graffiti und stecke das Handy wieder weg, ohne mir das fertige Bild im Galerieordner anzusehen. Das kann ich auch noch morgen früh machen. Wenn ich das Motiv, das ich jetzt gerade vor mir sehe, während der Alkohol durch mein Blut rauscht, dann immer noch interessant finde, komme ich zurück. Mit meiner Hasselblad.
Langsam wende ich mich von dem auf die Backsteine gesprühten Vogelfeder-Pfeil ab und gehe weiter. Ein leichter Wind ist aufgekommen, und mit ihm ist die feine Nässe in der Luft in Regen übergegangen. Er trifft mich auf Stirn und Wangen und treibt mich an. Es wird Zeit, dass ich heimkomme, damit Daliya wieder in ihre eigene Wohnung hinübergehen und sich schlafen legen kann. Für das spontane Babysitten hat sie etwas gut bei mir.
Ina hat ja recht, ich muss es zugeben. Ich habe lange nichts mehr riskiert. Wird Zeit, dass sich das ändert.
2
Ich kann es noch immer kaum glauben. Verdammt, ich bin so aufgeregt, ich kriege keine Luft, ich -
Reiß dich zusammen, beruhig dich. Der Typ auf dem Sitz ihr gegenüber glotzt dich schon an. Du musst ja wirken, als wärst du ein Creep. Oder auf einem schlechten Trip.
Ich zwinge mich, wieder ein neutrales Gesicht aufzusetzen, geradeauszuschauen, den Gang des Bahnwagens entlang, befehle meine Beine zurück an meinen Platz etwas weiter vorne links. Ich war zwar gerade erst auf der Zugtoilette, aber ich könnte schon wieder pinkeln. Sie war es! Keine drei Meter neben mir sitzt sie und döst.
Ob ich sie ansprechen sollte, wenn wir in Skien rausmüssen?
Vielleicht, aber warum? Wahrscheinlich würde sie sich gar nicht mehr an mich erinnern, und wieso sollte sie auch?
Damals haben sie mir oft gesagt, wie ähnlich ich ihr sähe, aber mir war das nie aufgefallen. Jetzt, beim Anblick ihres Gesichts mit den geschlossenen Augen, sehe ich, dass sie recht hatten. Die Ähnlichkeit ist regelrecht unheimlich.
Silje Iversen. Die Silje Iversen, die es vor fünf Jahren mit ihrem ersten und einzigen Bildband zu einem Artikel im Magazin der Aftenposten schaffte, bevor sie wieder aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwand.
Ich hebe leicht den Kopf, taste mit den Fingerspitzen über den metallenen Schriftzug vorne an der Kameratasche, die auf dem Sitz neben mir steht, als würde ich Braille lesen. Mein Blick schweift durch den Bahnwagen, scannt eine Handvoll müder, verschlossener Gesichter auf dem Weg nach Hause. Wem von ihnen würde der Name Silje Iversen etwas sagen? Wer könnte es nachempfinden, dass ich noch immer vor Aufregung zittere, ein begeistertes Fangirl in Gegenwart seines Idols?
Eine Stimme schnarrt aus den Lautsprechern und kündigt Skien an. Ich stehe auf, wobei ich es vermeide, mich noch einmal nach ihr umzudrehen, und hänge mir die Kameratasche um. Als ich meinen Rucksack von der Gepäckablage herunterziehe, knallt mir ein Ellbogen schmerzhaft in die Nieren. Der Typ, der sich an mir vorbeirempelt, entschuldigt sich nicht, schaut sich nicht mal nach mir um.
Dafür bin ich es, die ihm wütend hinterherstarrt. Mein Mund öffnet sich. Ich höre mich sagen, was für ein rücksichtloses Arschloch er ist. Aber nur ich kann meine Worte hören, in meinen Gedanken hallen sie laut und deutlich durch den gesamten Bahnwagen. Fest presse ich meine Lippen wieder aufeinander.
Der Zug hält an, und ich folge ihm aus dem Wagen und auf den Bahnsteig. In meinem Rücken fühle ich Siljes Gegenwart. Ich brauche mich nicht umzudrehen, ich weiß, dass sie hinter mir geht. Es ist, als könnte ich im Geräusch der Schritte um mich herum die ihren heraushören. Ich gehe etwas langsamer, bleibe stehen und kontrolliere den Reißverschluss meines Rucksacks, während ich aus den Augenwinkeln beobachte, wie jemand an mir vorbeigeht. Eine ältere Frau mit eiligen Schritten. Nicht sie.
Da überholt sie mich. Noch einmal sehe ich sie kurz im Profil. Jetzt, wo sie wach ist, fällt die Ähnlichkeit zu mir nicht mehr sofort auf, finde ich. Sie blickt kurz zu mir herüber, ohne mir direkt in die Augen zu sehen, starrt mit diesem benommenen Blick von Leuten, die gerade erst aufgewacht sind, geradeaus. Ich gehe ihr langsam hinterher. Ob sie zu einem geparkten Auto oder zu Fuß weitergehen wird? Vielleicht wohnt sie ja in der Nähe.
Stimmen werden in der Nacht lau. Hey, Øyvind! hallt es im beinahe völligen Dunkel lauter als am hellen Tag über das Bahnhofsgelände, ein Zwei-Mann-Empfangskomitee für den Typen aus dem Zug, der mich angerempelt hat. Er begrüßt sie ebenfalls laut und umarmt beide. Als hätten mich die Rufe der drei aus dem Gleichgewicht gestoßen, knickt mir ausgerechnet jetzt der rechte Fuß beim Gehen weg. Ein heißer Stich fährt mir durch den Knöchel, ich stolpere und mein Rucksack rutscht mir beinahe von der Schulter. Ich strecke seitlich die Arme aus, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, und stoße mit dem Typ aus dem Zug zusammen, der mich angerempelt hat.
»Heh, Vorsicht!«, höre ich ihn sagen.
Ich stehe endlich wieder sicher und fahre zu ihm herum. Neuer Schmerz fährt mir durch den Knöchel, aber ich merke ihn nur am Rande. Die dunkle Welle an Wut, die in mir emporbrandet, ist kälter. Wie zuvor im Zug öffne ich den Mund. Erneut hallt jedes einzelne meiner Worte in meinem Verstand wider wie ein scharfer, heller Glockenschlag, hörbar nur für mich.
Seine Miene verändert sich. Einen Augenblick lang hoffe ich, dass er sich erinnert. Stattdessen runzelt er verwirrt die Stirn.
»Is’ was?«, höre ich ihn fragen. Er klingt ungehalten.
Ich schnappe nach Luft und weiß, dass ich wie ein erstickender Karpfen aussehen muss. Mein Mund schließt sich, und meine Lippen pressen sich hart aufeinander. Der Typ wirft seinen beiden Kumpels einen halb hilfesuchenden, halb belustigten Blick zu. Einer der beiden lacht auf. Es klingt wie ein trockenes Husten.
Ruckartig wende ich mich ab und gehe weiter, vorbei am Parkplatz vor dem Bahnhofsgebäude und über die Straße.
»Alles okay?«, ruft mir der Typ hinterher, aber ich antworte nicht und drehe mich auch nicht um, sondern schreite weiter vorwärts.
»Die ist doch voll!«, meldet sich noch jemand in meinem Rücken zu Wort. Ich versuche, die drei Männer zu ignorieren, aber es will mir nicht gelingen, ganz im Gegenteil: Erst hört sich ihr Stimmengewirr verwundert an, dann mündet es in ein gemeinsames Lachen. Bei jedem Auftreten fährt mir ein stechender Schmerz durch den Knöchel, und mein Gesicht ist heiß vor Wut und Scham.
Denk nicht an die drei Wichser, denk an was Schönes.
Denk an was Schönes, verdammt!
Herrgott, das würde ich ja gerne, wenn mein Kopf nur nicht so leer und gleichzeitig voll wäre!
Was Schönes …
Ich habe die Rektor Ørns gate vor dem Bahnhof überquert und stehe am Rand einer dunklen Grünanlage. Mein Blick fällt auf Silje Iversen gut zwanzig Meter vor mir. Sie überquert die Anlage zu Fuß in Richtung Zentrum. Eigentlich wollte ich mir ganz dekadent ein Taxi nach Hause nehmen, den Abend so besonders beenden, wie er begonnen hatte. Stattdessen setze ich mich trotz der Schmerzen in meinem Knöchel wieder in Bewegung. Ich folge Silje Iversen, und wie ganz von selbst kehren die Eindrücke an den Abend in Oslo in mein Gedächtnis zurück, das Konzert von Highasakite im Rockefeller, den flackernden Dom aus Licht der Lightshow, die Musik so laut in meinen Ohren, dass ich die Erinnerung daran noch während der kompletten Rückfahrt in meinem Körper spüren konnte, als sei er eben erst wie eine Klangschale angeschlagen worden. Ich sehe wieder Ingrid Helene Håvik am Bühnenrand stehen, die langen dunklen Haare aus dem Gesicht gekämmt, ihr Gesicht blass im grellen Scheinwerferlicht, und höre ihre unverkennbare Stimme wie an einem Bungeeseil zwischen tiefen und glasklaren hohen Tönen hinauf- und hinabschwingen.
Lover, where do you live?
Langsam entkrampfen sich meine zu Fäusten geballten Hände, die ich tief in die Taschen meiner Sommerjacke gestopft habe. Die Brandung aus Wut über die Blicke und das Gelächter der drei Männer rollt noch immer gegen mich an, aber als ich Silje hinterhergehe, lässt ihre Wucht nach und weicht mehr und mehr zurück. Nur die Schmerzen bei jedem Auftreten meines rechten Fußes bleiben, aber das ist nicht schlimm. Ich denke an etwas Schönes. Daran, dass mir Silje Iversen wieder über den Weg gelaufen ist, ausgerechnet an dem Abend, an dem ich vom Konzert einer meiner Lieblingsbands zurückgekommen bin.
Ich könnte ihr etwas hinterherrufen. Sie würde stehen bleiben, sich umdrehen. Wir könnten ein paar Worte über die alten Zeiten im Jugendclub wechseln, und ich könnte sie fragen, wie es ihr geht, sie für irgendwann in den nächsten Tagen auf einen Kaffee einladen.
Nein, keine gute Idee. Wahrscheinlich würde ich nur wieder wie eine Idiotin dastehen und nach den richtigen Worten ringen, die mir so schwer über die Lippen kommen, besonders, wenn ich aufgeregt bin. Ich könnte es nicht ertragen, wenn sie mich so ansehen würde wie diese drei Arschlöcher gerade, mit dieser Mischung aus Belustigung und milder Verachtung. Es ist besser, wenn ich Abstand halte. Aber ich will wenigstens wissen, wohin sie geht. Sieht ja ganz so aus, als ob sie in Fußnähe wohnt.
In gehörigem Abstand folge ich ihr durch die karge Grünanlage, die nur einen Rasen und eine Anzahl alter Buchen aufweist. Schließlich geht sie die Amtmand Aalls gate und dann den Dueweg Richtung Zentrum entlang. Ich halte mich so weit hinter ihr, dass ich sie trotz des spärlichen Lichts der Straßenlaternen gerade noch ausmachen kann.
Gegenüber des Liefriedhofs bleibt sie auf einmal stehen, und ich weiß es einfach, dass sie sich umdrehen wird. Tatsächlich – sie wendet sich um. Mit meinem schmerzenden Knöchel bin ich nicht gerade vorsichtig aufgetreten, vielleicht hat das Geräusch meiner Schritte die verlassene Straße bis zu ihr hinüber gehallt. Zum Glück befindet sich genau auf meiner Höhe ein kleiner Parkplatz vor einem Geschäft für Badzubehör. Ich muss nur einen Schritt nach rechts auf den Parkplatz treten und bin in der Deckung des Hauses.
Warum gehe ich nicht einfach weiter? Das könnte ich natürlich, aber dann würde ich Silje auffallen, und es wäre nicht mehr so einfach, ihr zu folgen. Doch vor allem mag ich das Heimliche daran: Sie weiß es nicht, dass ihr jemand hinterhergeht, und so soll es auch bleiben. Ich habe mich noch nicht dazu entschieden, mit ihr zu sprechen, außerdem ist Reden nicht wirklich meine Stärke. Ich war schon immer besser darin, Leute zu beobachten, anstatt mich mit ihnen zu unterhalten.
Vorsichtig blicke ich um die Ecke der Hausmauer. Weiter vorne ist Silje vor einem weiteren Haus stehen geblieben. Sie hat etwas in der Hand, was wohl ein Mobiltelefon sein muss. Jetzt fotografiert sie die Hausmauer ab, oder etwas, das sie in einem Fenster gesehen hat. Mein Herz schlägt schneller. Ob sie an etwas Neuem arbeitet? Nein, dann würde sie doch bestimmt nicht die Kamera ihres Handys verwenden. Andererseits: Sie ist eine freischaffende Künstlerin. Das Material, mit dem sie umgeht, spielt keine Rolle. Silje Iversen könnte auch mit Fingerfarben und ihrer eigenen Pisse arbeiten, und ich würde unglaublich gerne sehen, was daraus entsteht.
Jetzt geht sie weiter. Ich warte noch ein paar Momente, dann setze ich mich ebenfalls in Bewegung. Die Schmerzen beim Gehen sind beinahe verschwunden. Das hätte auch noch gefehlt, dass ich mir so wie Mama neulich einen Knöchel breche und wir ab morgen zu zweit mit Krücken durch die Gärtnerei humpeln!
Die Straße macht keine Biegung, sodass ich Silje auch mit weitem Abstand immer noch erkennen kann. An der Stelle, wo sie stehen geblieben ist, halte ich ebenfalls inne und sehe mir die Hauswand an. Erst fällt mir nichts Besonderes auf, hinter den Fenstern auf Augenhöhe ist alles dunkel, an zwei von ihnen sind Vorhänge vorgezogen. Dann sticht mir ein an die Backsteinmauer gesprühtes Graffiti ins Auge, ein schwarzer Pfeil mit einem Schaft, der in einer geschwungenen Vogelfeder endet. Im schummrigen Licht der nahen Straßenlaterne wirkt das Motiv vor dem Hintergrund der Hauswand wie gemacht für ein Schwarz-Weiß-Foto. Ich werfe einen kurzen Blick auf Silje, die noch immer die Straße entlanggeht. Einen Moment lang zögere ich, unschlüssig, ob ich ihr weiter folgen oder es riskieren soll, sie aus den Augen zu verlieren. Dann hole ich die Minolta aus der Fototasche hervor, um das Graffiti zu fotografieren. Ich bin mir sicher, dass Silje gerade eben an dieser Stelle dasselbe getan hat.
Es hat inzwischen ernsthaft zu regnen begonnen, aber ich habe Routine mit der Kamera, auch im Halbdunkel der Straße. Meine Handbewegungen gehen so schnell vonstatten, dass ich kaum eine Minute brauche, um das Bild zu schießen. Ich setze mich erneut in Bewegung und verstaue die Kamera im Weitergehen. Silje ist eben weiter vorne um eine Ecke gebogen und aus meinem Blick verschwunden, aber das kümmert mich nicht. Ich weiß, dass ich sie finden werde, und ich folge ihr in die Nacht, während meine Gedanken wieder zurück zu dem Konzert von heute Abend treiben. Feine Regentropfen klatschen mir auf die Stirn, und Highasakite spielen wieder Lover, Where Do you Live. Ingrid Helene Håvik singt davon, was sie machen wird, wenn sie die geliebte Person wiedersieht. Sie wird ihr Schauder das Rückgrat hinablaufen lassen.
Schauder, Wirbel für Wirbel.
3
Es ist mir fast nie bewusst, dass ich träume, aber oft ahne ich im Traum, dass irgendetwas merkwürdig und nicht wie sonst ist. Die Erkenntnis, sich in einem Traum zu befinden, ist dann ein blinder Fleck in meinem Hinterkopf: zwar vorhanden, aber ich könnte sie nicht konkret benennen.
So verhält es sich auch jetzt. Ich stehe wieder vor dem Graffiti, das ich auf dem Weg nach Hause mit meinem Handy fotografiert habe. Die wenigen Straßengeräusche in meinem Rücken klingen mir so deutlich in den Ohren wie nachts bei offenem Fenster, wenn sie mir gerade wegen ihrer Spärlichkeit auffallen, gleichzeitig ist es heller Tag. Sonnenschein fällt auf die rotbraunen Ziegel der Hauswand und lässt alle Poren ihrer Oberfläche wie kleine Krater hervorstehen. Der schwarze Pfeil schimmert ölig glänzend im Licht, er scheint auf der Backsteinmauer zu schwimmen.
Ich streiche mit meiner Hand über die Oberfläche der Mauer, fühle die rauen Ziegel unter meinen Fingerspitzen. Auf einmal ist der Pfeil nicht mehr nur schwarze Farbe auf einer Mauer. Ich kann die glatte Erhebung des Schafts mit meinem Zeigefinger nachfahren und über die eng verhakten Federäste an seinem Ende streichen. Meine Hand schließt sich um den Pfeil mit dem Schaft einer Vogelfeder und nimmt ihn an sich.
Als ich auf den Gegenstand in meiner Hand blicke, bemerke ich, dass ich keinen Pfeil mehr halte, sondern einen altertümlichen Schlüssel mit breitem Bart. Seine schwarze Oberfläche glänzt metallisch.
Ich sehe mich nach einem Schloss um, in das er passen könnte, und mir fällt auf, dass sich auch das Gebäude verändert hat. Es ist nun ein mehrere Stockwerke hoher Turm mit breiter Basis, seine glatte, runde Wand weißgekalkt. Es dauert einen Moment, bis ich darauf komme, woran er mich erinnert: Es ist der Turm des alten Tobias aus dem Kinderbuch »Die Räuber von Kardemomme«. Simon liebt die Geschichte. Als er noch in den Kindergarten ging, musste ich sie ihm einen ganzen Sommer lang fast jeden Abend vorlesen. Ich ging sogar mit ihm in den Kardemomme-Freizeitpark im Tiergarten von Kristiansand, wo die komplette Stadt aus Thorbjørn Egners Buch nachgebaut ist.
Ich führe den Schlüssel in das Schloss der Eingangstür von Tobias’ Turm, und tatsächlich passt er. Mit einem ungewöhnlich sanften Klicken für einen so klobigen Gegenstand öffnet sich die Tür.
Im Inneren des Turms verliert sich eine schmiedeeiserne Wendeltreppe nach oben im Dämmerlicht. Vor ihr steht ein hochgewachsener Mann mit Glatze und einem langen schneeweißen Bart, der ihm fast bis zum Gürtel hinab reicht. Es ist Tobias, der alte Mann, der in dem Kinderbuch hoch oben in seinem Turm lebt und von einer runden Plattform aus mit einem Fernrohr das Wetter vorhersagt. Als wir den Freizeitpark in Kristiansand besuchten, stellte ihn ein Schauspieler mit angeklebtem Bart dar. Er füllte seine Rolle so gut aus, dass Simon vor lauter Ehrfurcht kaum ein Wort herausbrachte und sich an meinem Bein festklammerte. Noch lange danach war er völlig davon überzeugt gewesen, den echten Tobias aus dem Kardemommebuch getroffen zu haben.
Der Mann, der im Inneren des Turms vor mir steht, ist kein Schauspieler mit angeklebtem Bart.
»Da bist du ja«, sagt er. Seine Stimme klingt voll und tief, aber leise, als befände er sich weiter weg, als er eigentlich ist. »Wir haben schon auf dich gewartet.«
Ohne mir Zeit für eine Erwiderung zu geben, dreht er sich um und steigt die Wendeltreppe empor. Wie selbstverständlich folge ich ihm.
An der runden Innenwand des Turms sind Bücherregale befestigt, die ebenso wie die Treppe weiter hinaufreichen, als ich sehen kann. Im Vorbeigehen bemerke ich die Vielzahl von Buchrücken. Einige der Titel erkenne ich wieder. Ich sehe Klassiker aus meiner Kindheit: die Märchen von Asbjørnsen und Moe, Karius und Baktus, Harry Potter, Stevensons Schatzinsel und fast alles von Astrid Lindgren. Trotz des Halbdunkels schimmert auf ihnen das Licht längst vergangener Sommer.
Bei der nächsten Umdrehung der Treppe stehen in den Regalen eine Anzahl von schwarz-roten Chinakladden, wie ich sie in meiner Teenagerzeit besessen hatte. Damals hatte ich viel in mein Tagebuch geschrieben, hochdramatisches Zeug voller Wut, Verzweiflung und Rebellion. Ich war ein Einzelkind gewesen, der Liebling meiner Eltern, die mich erst sehr spät bekommen hatten, als sie beide schon über vierzig gewesen waren. Sie hatten ihre Liebe zu mir auf meinem Rücken abgeladen, als wäre ich ihr Packtier, und dieses Gewicht wog schwer. Jahrelang war ich es nicht anders gewohnt gewesen, als mich unter dieser Last zu bewegen. Mit sieben war es noch normal gewesen, kaum Freunde zu haben, weil die eigenen Eltern sich in ihrem Haus am Stadtrand isolierten, als sei Skien ein gefährliches Krisengebiet. Mit dreizehn war es das nicht mehr.
Damals hatte ich einen ständigen Kampf gegen meine Eltern zu führen begonnen, besonders gegen meinen Vater, der einfach nicht begriff, wieso seine Tochter die heile Welt nicht mehr aushielt, die er so mühsam aufrechthielt. Am liebsten hätte ich mit vollem Schwung eine Abrissbirne in das Haus meiner Eltern krachen lassen. Das Mädchen, das diesen Kladden ihre Verzweiflung anvertraut hatte, hätte sich ums Verrecken nicht vorstellen können, irgendwann selbst mal ein Kind in die Welt zu setzen. Das wäre wie ein Ausverkauf gewesen, ein Verrat am eigenen Selbst.
Als ich von zu Hause ausgezogen war, hatte ich die Chinakladden mitgenommen. Aber ich hatte nie wieder in ihnen gelesen. Diese Erinnerungen schlummern in irgendeiner Bananenkiste im Keller vor sich hin. Auch in meinem Traum schreite ich an den Tagebüchern vorbei, ohne eines von ihnen aus dem Regal zu ziehen.
Eine Umdrehung der Wendeltreppe weiter oben passiere ich dicke Fotografiebildbände und Bücher, die ich während meines Kunststudiums in Oslo gelesen habe. Im Vorbeigehen erkenne ich die Namen meiner Helden: Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe, Nan Goldin, Derek Jarman und andere. Mir war immer klar gewesen, dass Vergleiche nichts anderes waren als gedankliches Masturbieren. Im schlimmsten Fall eine sinnlose Selbstquälerei. Dennoch hatte ich nie anders gekonnt. Wann immer ich ein Projekt beendet hatte, stellte ich es in Gedanken neben meine Vorbilder, und es war nie gut genug. Aber gerade gut genug, um weiterzumachen. Um irgendwann einmal etwas zu schaffen, das einem Vergleich standhalten würde. Ich weiß, wie albern sich das anhört. Deshalb rede ich niemals darüber, auch nicht mit Künstlerkollegen. Gerade nicht mit ihnen.
Die letzte Umdrehung, bevor die Wendeltreppe an der Turmspitze endet, gibt einen Blick auf leere Regale frei. Auf einem hölzernen Regalbrett liegen nur ein paar Zeitungsartikel, die Ränder sauber ausgeschnitten, wie dafür bereit, in ein Heft eingeklebt zu werden. Augenblicklich klopft mir mein Herz schmerzhaft hart gegen den Brustkorb. Ich kann gerade noch Tores Namen auf einer fetten schwarzen Schlagzeile erkennen und wende den Kopf ab. Ich gehe schneller und erreiche schließlich die Spitze des Turms. Sie sieht genauso wie in dem Kinderbuch aus, ein runder Raum, umgeben von einer ebenfalls runden, überdachten Plattform, die das komplette Turmzimmer umschließt.
Ich folge dem alten Tobias durch den Raum und hinaus auf den Balkon. Da draußen steht ein Junge auf einer kleinen Trittleiter, damit er besser über die Brüstung hinweg sehen kann. Am Fuß der Leiter sitzt ein kleiner Hund mit braunem Fell und langen, dunklen Ohren. Die beiden sind natürlich Remo und sein Hund Bobby aus dem Kardemomme-Buch, aber in meinem Traum sieht Remo wie Simon aus, selbst für seine sieben Jahre klein, mit strähnigem rotblondem Haar, das er gerne fast schulterlang trägt, weswegen ihn Fremde oft im ersten Moment für ein Mädchen halten. Er sucht mit einem langen, ausgezogenen Fernrohr den Horizont ab. Als er mich bemerkt, wendet er sich mir zu.
»Ein Sturm kommt von Westen«, erklärt er mit der gewichtigen Stimme eines Wettermanns im Fernsehen. »Willst du ihn sehen?«
Er hält mir das Fernrohr entgegen. Ich nehme es und blicke hindurch. Eine schmutziggraue Wolkenwand füllt den runden Bildausschnitt vor meinem Auge. Tief in ihrem Inneren zuckt Wetterleuchten auf. Ich setze das Fernrohr ab. Als ich mich umsehe, sind Simon-Remo und der kleine Hund verschwunden, auch der alte Tobias ist fort. Ich stehe allein auf dem Balkon. Das Unwetter ist noch weit entfernt, aber es füllt bereits den gesamten westlichen Horizont aus, und der Tag wird zusehends dunkler.
Ein kalter Windstoß trifft auf mein Gesicht und lässt mich frösteln. Gleichzeitig überfällt mich die untrügliche Gewissheit, dass ich beobachtet werde. Ich fahre herum.
Tatsächlich: Im Schatten des offenen Eingangs zum Turmzimmer steht eine reglose Gestalt. Wo sie sich befindet, ist es zu dunkel, um ihre Gesichtszüge auszumachen, aber ich glaube, das Glitzern eines Augenpaars wahrzunehmen. Die weißen Skleren schimmern matt im schwindenden Tageslicht. Eine lähmende Bedrohung geht von der Person aus. Obwohl ich mich ihr nähern will, um zu erkennen, wer sie ist, kann ich mich nicht von der Stelle rühren. Stocksteif wie eine Statue stehe ich mit dem Rücken zur Brüstung der Plattform, unfähig, meinen Blick von der schattenhaften Gestalt abzuwenden.
Auch sie bewegt sich nicht. Sie sieht mich nur an, ihre Augen zwei helle Flecken im Dunkel ihres Gesichts. Gleichzeitig werde ich langsam und unaufhaltsam wie von unsichtbaren Händen nach hinten gedrückt. Mein Rücken presst sich hart gegen das Geländer. Jetzt setzt die Gestalt sich in Bewegung, tritt auf die Plattform hinaus und auf mich zu.
Mein Herz steht in einem verrückten Widerspruch zu meiner Reglosigkeit. Es trommelt einen irrsinnig schnellen Rhythmus in meiner Brust, als wollte es mich anfeuern, um mein Leben zu rennen. Ich kann spüren, wie mir Bäche aus Schweiß die Schläfen und Wangen hinablaufen. Aber ich bin einfach nicht dazu in der Lage, auch nur einen Muskel zu bewegen. Nur ein angestrengtes Ächzen entkommt meinem Mund, als der Schatten mit der Form eines Menschen an mich herantritt. Erst war er so groß wie ich selbst, doch auf den letzten Schritten ist er angewachsen. Er überragt mich. Die schimmernden Augen in dem dunklen Gesichtsfleck starren mich unverwandt und ohne zu blinzeln an. Eine regelrecht physisch spürbare Gewalt geht von der Gestalt aus, als würde sie mich mit der Kraft ihres Blicks langsam, aber unerbittlich nach hinten pressen. Ich versuche, den Kopf wegzudrehen, aber vergebens. Ich bin nicht einmal dazu in der Lage, die Augen zu schließen.
Plötzlich kommt die Gestalt wieder auf mich zu. Das Metall einer Messerklinge blitzt in ihrer Hand auf. Noch ehe ich mich zu einer abwehrenden Bewegung zwingen kann, stößt sie mir ruckartig das Messer in den Bauch. Ich spüre den Schmerz, aber er ist eigenartig dumpf, mehr wie von einem Boxschlag als von einem Stich.
Erschrocken keuche ich auf. Ein lang gezogenes Knirschen ertönt in meinem Rücken. Ich kann spüren, wie sich das Geländer aus der Halterung löst. Sein Druck gegen meinen Rücken gibt nach, und ich kippe nach hinten. Eisige Kälte schießt mir das Rückgrat hoch, als ich den Boden unter den Füßen verliere. In Panik will ich meine Arme ausstrecken, mich an irgendetwas festhalten, doch ich bin wie versteinert. Das Augenpaar blickt mir hinterher, als ich von der Plattform hinab in die Tiefe stürze.
4
Ich fahre im Dunkeln hoch, kann mich nicht orientieren, wo oben und unten ist, und rudere wild mit den Armen durch die Luft. Falle ich noch immer? Etwas verhakt sich zwischen meinen Beinen. Dumpfer Schmerz fährt mir durch die rechte Hüfte, als ich hart auf dem Boden vor dem Bett aufschlage.
»Mama?«
Schwacher Lichtschein fällt vom Flur ins Schlafzimmer herein und malt dem dunklen Raum Konturen. Simon steht im Türrahmen, ein kleiner Schatten mit wirr vom Kopf abstehendem Haar. Ich strample meine Füße von der Decke frei, in der sie sich verfangen haben, und setze mich auf. Einen Lidschlag lang fühle ich wieder den eigenartig dumpfen Messerstich, bevor ich hintenüber in die Tiefe kippe, und mein Magen krampft sich zusammen. Unwillkürlich betaste ich meinen Bauch mit den Fingerspitzen, aber natürlich ist da nichts, weder weist mein T-Shirt ein Loch auf noch meine Haut eine Stichwunde. Es war nur ein Traum, nichts weiter.
»Hab … hab ich dich aufgeweckt?«
Meine Stimme klingt mir fremd in den Ohren, belegt, schlaftrunken, als würde sie wie der Rest meines Körpers nicht ganz hierher gehören, sondern mehr an jenen anderen Ort, an dem ich mich eben noch im Traum aufgehalten habe. Auf der Turmplattform, von der ich hinabfiel. In meinem Hinterkopf macht sich der erste Anflug von Katerkopfschmerzen bemerkbar. Ich hatte ganz vergessen, vor dem Schlafengehen noch etwas Wasser zu trinken und eine Kopfschmerztablette zu schlucken.
»Du hast so komische Geräusche gemacht«, sagt Simon. Er tritt ins Zimmer und kommt auf mich zu. Ich sitze immer noch auf dem Boden und schließe meine Arme um ihn. Sein Kopf ruht auf meiner Brust. Ich rieche den Baumwollstoff seines frisch gewaschenen Pyjamas und darunter den unverkennbaren Duft seiner Haut, das exakte Gegenteil des Geruchs von Alter.
»Echt? Hab ich das?«
Er nickt fest. »Hab dich durch die Wand gehört. Klang wie Bauchweh.«
Meine Güte, dann muss ich wirklich laut gewesen sein. Mit meiner freien Hand taste ich nach der Nachttischlampe und knipse sie an. Warmes Licht erhellt den Raum und vertreibt die letzten Schatten des Traums, den dunklen Schemen eines Gesichts und helle Augenflecken darin. Ein Blick, der imstande war, mich zu lähmen.
Unwillkürlich schüttele ich mich wie ein nasser Hund, der die Wassertropfen aus seinem Fell loswerden will. Simon schaut mich verwundert an. Ich lasse ihn los und stehe auf.
»Ich hab schlecht geträumt«, erkläre ich und hebe die Decke vom Boden auf.
»So wie mein Traum von dem Piraten mit dem einen Auge?«, will Simon wissen.
»Jepp, ungefähr so.«
»Aha«, sagt Simon zustimmend, als sei damit alles geklärt. Er hakt nicht weiter nach, wovon ich geträumt habe, wofür ich dankbar bin. Ich will ihm wirklich nicht beschreiben, wie ich vom Turm aus seinem Kardemomme-Buch hinabgestürzt bin.
Ich gehe mit ihm zurück in sein Zimmer. Er legt sich ins Bett, und ich decke ihn zu.
»Wo kommen Träume her?«, will er plötzlich wissen, als ich mich schon zum Gehen gewandt hatte. Sein Gesicht ist halb hinter seiner Spiderman-Bettdecke versunken, aber seine Augen sehen mich wach und fragend an. »Wie kommen die in deinen Kopf? Und in meinen?«
Wenn ich das wüsste, denke ich. Laut sage ich: »Niemand weiß es genau. Die Leute glauben, dass wir dauernd über alles Mögliche nachdenken, auch im Schlaf. Und wenn wir schlafen, werden die Gedanken zu bewegten Bildern, so wie Filme im Fernsehen.«
»Oh«, sagt er. Nach einer Pause fügt er hinzu: »Hast du über was Schlimmes nachgedacht?«
»Keine Ahnung«, sage ich. »Ich hab schon wieder vergessen, worum es in dem Traum ging. Schlaf jetzt, ja? Ich leg mich auch wieder hin, und diesmal träume ich bestimmt von was Schönem.«
Simon scheint mit meiner Antwort zufrieden zu sein. Er brummt eine Zustimmung, schließt die Augen, und sein Kopf sinkt noch etwas tiefer unter die Bettdecke.
Ich knipse das Licht in seinem Zimmer aus und gehe ins Bad, wo ich zwei Pinex mit einem Glas Wasser hinunterspüle, bevor ich mich erneut ins Bett lege. Doch ich kann einfach nicht wieder einschlafen, egal auf welche Seite ich mich wälze. Ich liege wach, aber nicht, weil ich mich fürchte. Das Gefühl von Bedrohung ist mit dem Aufwachen verschwunden. Ich liege wach, weil ich wieder an die Pfeilfeder aus meinem Traum denken muss, an das Bild an der Mauer, das sich in einen Schlüssel verwandelt hat.
Schließlich stehe ich erneut auf. Ein Blick auf den Radiowecker neben dem Bett zeigt mir, dass es kurz nach drei Uhr ist. Ich werfe mir meinen roten Morgenmantel über. So leise wie möglich, um Simon nicht wieder aufzuwecken, gehe ich barfuß durch den dunklen Flur und ins Wohnzimmer, wo mein Mobiltelefon auf dem Schreibtisch liegt. Ich nehme es nie mit ins Schlafzimmer, wenn ich schlafen gehe. Mein Bett ist der eine Ort, an dem ich unerreichbar sein will.
Ich setze mich auf meinen Bürostuhl und entsperre das Handy. Ein paar Sekunden später habe ich das Bild geöffnet, das mich nicht schlafen lässt. Es sieht ganz in Ordnung aus, nichts, was ich ausdrucken und mir an die Wand hängen würde, aber es war mir ja auch erst mal nur darum gegangen, das Graffiti zu dokumentieren.
Doch selbst bei solchen Fotos hatte ich schon immer den Anspruch besessen, sie gut aussehen zu lassen und etwa bei Schnappschüssen ein Verhältnis zwischen Schnelligkeit und Qualität hinzubekommen, das mehr zur Qualität tendiert. Anders als im nächtlichen Kopfkino meines Traums besitzt das Graffiti nicht das tiefe metallische Dunkelgrün einer Elsterfeder, das man von Weitem und in einem unvorteilhafteren Licht mit Schwarz verwechseln könnte. Dennoch … es ist mir schon länger nicht mehr passiert, dass mich ein Motiv so in seinen Bann gezogen hat.
Der Gedanke überfällt mich, dass es sich mit dieser Mischung aus Pfeil und Feder tatsächlich genauso wie in meinem Traum verhält: Manche Motive, die ich fotografiere, schließen Türen auf. Sie gewähren mir Zugang zu Räumen, die ich nie zuvor betreten habe, Bereiche, die zwischen meiner Realität und der anderer Menschen liegen, so wie Risse im Boden, hervorgerufen durch seismische Aktivität. Es ist gefährlich, anderen Wirklichkeiten als der eigenen ins Gesicht zu blicken. Jeder Junkie weiß Geschichten von diesen Erdspalten zu erzählen, in die man hineinstolpern kann, um nie wieder aus ihnen aufzutauchen.
Dennoch suchen Menschen immer wieder die Gegenden auf, die jenseits ihrer eigenen Landkarten liegen – manche mit Zeichenmappen, manche mit Musikinstrumenten, wieder andere mit Kugelschreibern und Notizblöcken. Über die Jahre hinweg haben einige von ihnen meinen eigenen Weg gekreuzt, und egal wie unterschiedlich auch unsere Methoden aussehen, in einem gleichen wir uns alle: Wir haben keine andere Wahl.
Erst jetzt, im nächtlichen Wohnzimmer, nur erhellt vom Licht des Handydisplays, fällt mir auf, wie lange ich es schon nicht mehr empfunden habe, dieses Gefühl, etwas Besonderem auf der Spur zu sein – einer anderen Wirklichkeit, die mich herausfordert, die in der Lage ist, meine eigene Wahrnehmung auf mich selbst und mein Leben infrage zu stellen und zu verändern. Damals hatte es Simon noch nicht in meinem Leben gegeben. Inzwischen haben sich die Türen zu jenen anderen Orten eine nach der anderen geschlossen. Mein kreatives Feuer ist heruntergebrannt, und ich habe es nicht einmal bemerkt.
Nein, das ist nicht die Wahrheit. Ich habe es bemerkt, aber nichts unternommen. Die nächste Miete muss bezahlt werden, die Rahmen für eine mickrige Ausstellung von fünf Tagen im Rathaus von Skien kosten ein Heidengeld, Simon scheint alle paar Monate neue Klamotten zu brauchen, weil er so schnell wächst.
Aber heute Nacht ist das alte Feuer zum ersten Mal seit langer Zeit wieder aufgeflammt. Das Motiv an der Backsteinwand reizt mich. Damit lässt sich etwas anfangen. Morgen will ich es noch einmal aufsuchen, diesmal mit meiner Hasselblad. Ich habe Lust bekommen, es ordentlich abzulichten und das Foto zu bearbeiten.
Das Feuer brennt nicht besonders hell, doch immerhin brennt es.
5
Der feine nächtliche Regen ist am folgenden Tag schon wieder in eine ebenso unwirkliche Ferne gerückt wie der Albtraum, in dem mir jemand ein Messer in den Bauch gerammt hat und ich einen Turm hinabgefallen bin. Als der Frühaufsteher, mit dem ich mir eine Wohnung teile, zu mir ins Bett kriecht und mein schlaftrunkener Blick auf den schmalen Himmelsausschnitt zwischen den halb zugezogenen Fenstervorhängen fällt, sieht es ganz nach einem wolkenlosen Sommertag aus.
»Backen wir heute Pizza?«, will Simon wissen. Seine nackten Füße reiben unter der Decke an meinen Beinen entlang. Ein scharfer Schmerz fährt mir durch die rechte Wade, und ich rücke etwas von ihm ab. »Wird Zeit, dass wir mal wieder deine Zehennägel schneiden, junger Mann!«, sage ich. Sein Gesicht verfinstert sich für einen Moment, ehe er seine Frage wiederholt, um das Gespräch in andere Bahnen als seine überfällige Fußpflege zu lenken.
»Ja, das können wir machen«, erwidere ich, »aber erst, wenn wir von Opa zurück sind.«
Simon zieht einen Flunsch, bei dem sich seine Nasenflügel in Falten legen. »Wir gehen zu Opa?«, fragt er gedehnt. »Ich will aber nicht!«
»Zur Kenntnis genommen, ändert allerdings nichts dran, dass wir heute Mittag zu Opa fahren. Wir haben ihn schon länger nicht mehr besucht, da wird es Zeit, dass wir uns mal wieder bei ihm sehen lassen. Außerdem muss ich heute Nachmittag noch etwas erledigen, und Daliya hat keine Zeit, auf dich aufzupassen.«
»Ich will nicht zu Opa«, murmelt Simon und zieht sich die Bettdecke über den Kopf. Ich gehe nicht darauf ein, sondern stehe auf und ziehe mich an.
Während ich uns Frühstück mache, überlege ich mir, ob ich genug Zeit habe, mit meiner Kamera auf Motivsuche zu gehen, während Simon bei meinem Vater ist. Eigentlich müsste es klappen. Vater wohnt in Porsgrunn, und mit meinem Wagen bin ich schnell wieder zurück in der Innenstadt, denn Skien und Porsgrunn gehen praktisch ineinander über. Ich weiß nur nicht, ob es Vater recht ist, dass er eine Weile alleine auf Simon achtgibt, aber er wohnt nun mal in der Nähe. Mutter dagegen lebt in Trondheim. Sie hat uns verlassen, als ich noch auf die Weiterführende Schule ging. Wegen der Entfernung sieht Simon sie nicht so oft wie seinen Opa.
Irgendwie hatte ich immer geglaubt, alle Großeltern würden ihre Enkel wie selbstverständlich nicht nur lieben, sondern regelrecht vergöttern. Aber mein Vater war schon immer konsequent gegen den Strom geschwommen. Seitdem ich von zu Hause ausgezogen bin und er alleine wohnt, hat seine exzentrische Art noch zugenommen. Frank Iversen lebt in seiner eigenen Welt. Kleine Kinder sind für ihn wie eine fremdartige Spezies, von der er sich nur schwach daran erinnern kann, dass er ihr selbst einmal angehört hat. Und Simon merkt es natürlich, dass sein Großvater nicht viel mit ihm anfangen kann. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, weshalb er ungern Zeit mit Opa verbringt. Er hat Angst vor Halvorsen, dem Labrador meines Vaters.
Halvorsen ist alt, übergewichtig und so harmlos wie ein Stofftier, aber in den Augen meines Sohns ist er ein pechschwarzes Ungeheuer mit riesigem Schädel und sabberndem Maul. Als er noch kleiner war, fing Simon an zu weinen, wenn Halvorsen freudig auf ihn zugesprungen kam, völlig überfordert von zwanzig Kilo Begeisterung auf vier Beinen, und auch heute geht er dem betagten Hund aus dem Weg, sobald dieser in seine Nähe kommt. Trotzdem hoffe ich noch immer, dass er sich eines Tages an ihn gewöhnen wird, und das möglichst nicht erst kurz bevor sich der alte Junge in die ewigen Jagdgründe aufmacht.
Als wir gegen Mittag aus der Wohnung treten, kommt Daliya gerade die Treppe zu uns in den zweiten Stock hochgestiegen. In einer Hand schwingt sie eine Papiertüte, die schwach nach frischem Gebäck duftet.
»Daliyaaa!« Simon springt aus der Deckung des Treppenabsatzes auf sie zu. Sie muss ihn bereits entdeckt haben, denn die Überraschung auf ihrem von einem rosafarbenen Hijab umrahmten Gesicht wirkt doch etwas gespielt. Beinahe lässt sie die Tüte mit den Backwaren fallen, als er sie auf Hüfthöhe umarmt.