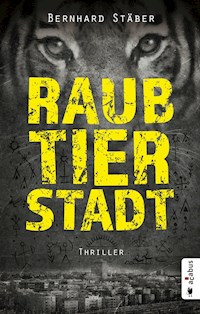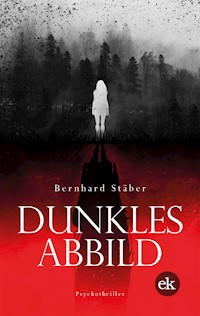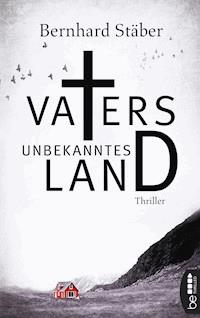4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Arne Eriksen ermittelt
- Sprache: Deutsch
Die alte Akka, die der Psychologe Arne Eriksen in Nordnorwegen kennengelernt hat, ist tot. Zusammen mit seinen Freunden, der Kommissarin Kari Bergland und dem Journalisten Frode Bakklund, reist Arne an den Polarkreis, wo eine Gedenkfeier für die alte Samifrau stattfinden soll. Es ist kurz vor Weihnachten, die Zeit der längsten Dunkelheit. Ein massiver Schneesturm schneidet Akkas Hof von der Außenwelt ab, und die Gruppe aus Angehörigen und Freunden der Toten wird von einem Mörder heimgesucht. In der Kälte des Nordens auf sich allein gestellt, muss Arne in die Mythen der Sami eintauchen, um den Täter zu fassen.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Über dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungZitat12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243Hinter dem VorhangÜber dieses Buch
Der Psychologe Arne Eriksen, zur Hälfte Deutscher, zur Hälfte Norweger, ist in das Land seines verstorbenen Vaters gezogen. Es ist kurz vor Weihnachten, und die Zeit der längsten Dunkelheit ist angebrochen. Da erhält Arne die Nachricht, dass die alte Akka aus dem Volk der Samen, die er in Norwegen kennengelernt hat, verstorben ist. Zusammen mit seinen Freunden, der Kommissarin Kari Bergland und dem Journalisten Frode Bakklund, reist Arne an den Polarkreis. Dort soll eine Gedenkfeier für die verstorbene Samifrau stattfinden. Doch ein heftiger Schneesturm schneidet Akkas Hof von der Außenwelt ab, und ein Mitglied der Trauergesellschaft wird grausam ermordet. In der Kälte des Nordens schließen die Wunden der Vergangenheit nur schlecht. Auf sich allein gestellt, jagen Arne und Kari in den Wäldern des Nordens einen Täter, der davon getrieben ist, seine Vergeltung zu bekommen.
Über den Autor
© Arild Richard Janzon-Eikrem
Bernhard Stäber, geboren 1967 in München, hat unter dem Pseudonym »Robin Gates« mehrere Fantasyromane veröffentlicht. »Kalt wie Nordlicht« ist nach »Vaters unbekanntes Land« sein zweiter Thriller. Er lebt und arbeitet in der Provinz Telemark in Südnorwegen.
BERNHARD STÄBER
Kalt wie Nordlicht
Thriller
beTHRILLED
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Vollständige digitale Ausgabe der bei LYX erschienenen Taschenbuch-Ausgabe.
Textredaktion: Stefanie Zeller
Covergestaltung: www.buerosued.de, München
eBook-Erstellung: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7325-4234-5
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Ann Poulsenin memoriam.
»Aber so unbarmherzig ist das Leben denen gegenüber,die ein Kind getötet haben, dass nachher alles zu spät ist.«
Stig Dagermann
1
Wenn jemand Pastor Svein Fossum am Abend des 9. April 1993 um einundzwanzig Uhr vier mitgeteilt hätte, dass er in genau fünfundzwanzig Minuten sterben würde, dann hätte diese Botschaft ihn nicht vor Angst gelähmt, denn er war ein Fatalist. Er glaubte daran, dass alles in seinem Leben so kommen würde, wie es eben kommen musste, auch wenn er als protestantischer Christ davon überzeugt war, dass Gott dem Menschen immer die Wahl ließ, eigene Entscheidungen zu treffen, gute wie schlechte.
Als er sich in den Lehnstuhl seines Büros zwängte, um seiner Predigt am folgenden Sonntag den letzten Schliff zu geben, ahnte er nicht, dass er sie niemals mehr halten würde. Er hatte sich für seinen Text zwar das Thema ›Schuld und Verantwortung‹ vorgenommen, trotzdem kreisten seine Gedanken momentan nicht um die essenziellen Wegmarkierungen des menschlichen Daseins, sondern um weit profanere Dinge als Leben und Tod. Seine Frau Heidrun hatte sein Lieblingsessen gekocht, selbst gemachte Rinderhackbällchen, dazu ebenfalls selbst gemachtes Kartoffelpüree.
Während er die Schreibtischlampe anknipste, dachte er daran, dass er eben ordentlich zugelangt hatte, obwohl es schon recht spät war. Besonders gesund war das nicht. Das hatte sein Arzt, Dr. Stadheim, ihm wiederholt mit einem Blick auf den Kugelbauch seines Patienten gepredigt, die Stirn in mehrere Reihen tiefer Falten gelegt, die ihn wie einen strengen Dackel aussehen ließen. Was wusste der schon! Sie hatten es sich eben angewöhnt, nach neunzehn Uhr zu Abend zu essen, manchmal noch später. Heute war wieder einmal so ein Tag gewesen.
Gedankenverloren leckte er sich die Lippen. Dabei schmeckte er auf ihnen noch immer eine Ahnung von der fettigen braunen Soße, in der die Klöße geschwommen hatten. Sein Magen war voll, und er fühlte sich träge und ein wenig müde. Trotzdem wollte er nicht ins Bett gehen, bevor er nicht wenigstens noch ein, zwei Stunden über den Text gegangen war.
Er schaltete seinen Computer ein, einen Intel 386, auf dem sein Bruder Torstein das neueste Betriebssystem Windows 3.1. installiert hatte. Noch bis zum letzten Jahr hatte er seine Predigten per Hand geschrieben und erst die letzte Version, ganz zum Schluss, auf der Schreibmaschine verfasst. Aber schließlich hatte er auf Drängen seines Bruders das neue Zeitalter der Computertechnik in sein Haus einziehen lassen.
»Probier es doch einfach mal aus. Du wirst schon sehen, wie dir dieses Ding die Arbeit erleichtert«, hatte Torstein so geduldig auf Svein eingeredet, als wolle er ein nervöses Pferd beruhigen. So war sein Bruder immer gewesen, der Ältere, der sich sein Leben lang wie ein zweiter Vater um ihn gekümmert hatte. Er hatte es zwar nie verstanden, warum Svein Theologie studiert hatte, ihn aber unterstützt, seitdem Svein zurückdenken konnte, und ihm sogar zinslos Geld geliehen, als es im Studium immer wieder mal eng geworden war. Selbst jetzt, da Svein Mitte vierzig und Torstein Anfang fünfzig war, hatte sich an dieser Konstellation nichts geändert – Svein war der Kleine, Torstein der Große.
Und wie so oft hatte Svein Fossum zugeben müssen, dass sein Bruder recht gehabt hatte – auch wenn er sich eher in die Lippen beißen als das ihm gegenüber laut zugeben wollte. Der Computer war ihm so schnell zu einem unersetzlichen Hilfsmittel geworden, dass er sich schon ein paar Wochen nach seiner Anschaffung gefragt hatte, wie er eigentlich jemals ohne ihn zurechtgekommen war.
Er öffnete das Textverarbeitungsprogramm und scrollte langsam von Anfang bis Ende durch seine Predigt. Er hatte jetzt noch etwa zweiundzwanzig Minuten zu leben, aber ihn plagte keinerlei Vorahnung, kein merkwürdiges Gefühl in der Magengrube oder Gänsehaut. Das einzig Bedrückende, das er beim Lesen des Textes verspürte, ging von dessen Inhalt aus. Er hielt kurz vor dem Ende inne und lehnte sich in seinem Sessel zurück, sodass der Kunstlederbezug aufächzte. Sein Blick fiel auf die Zeitungsausschnitte von Dagbladet und Aftenposten auf dem Schreibtisch links neben dem klobigen grauen Monitorgehäuse.
In den letzten Monaten waren in verschiedenen Teilen des Landes Kirchen angezündet worden. Nachdem die ersten beiden Feuer an Ostern in der Røa-Kirche in Oslo und im Mai in der Storetveit-Kirche in Bergen rechtzeitig entdeckt und gelöscht worden waren, hatte es am 6. Juni, ebenfalls in Bergen, eine Katastrophe gegeben: Die historische Fantoft-Stabkirche war völlig niedergebrannt. Damit hatte es nicht aufgehört – ganz im Gegenteil. Im August war es zu zwei weiteren Kirchenbränden gekommen, im September und Oktober ebenfalls. Im Dezember hatte die Serie einen traurigen Höhepunkt erreicht, als ein Feuerwehrmann bei der Bekämpfung eines Brandes in einer Methodistenkirche ums Leben gekommen war.
Pastor Fossum ergriff den Zeitungsausschnitt, der ganz oben auf dem Stapel lag. Er war vom 20. Januar dieses Jahres, stammte aus der Bergens Tidende und trug die Überschrift: ›Wir haben die Kirchen angesteckt.‹ Der Artikel war ein anonymes Interview mit einem jungen Mann, der sich selbst Count Grishnackh nannte und behauptete, dass er und andere aus seinem Umfeld an diesen Bränden beteiligt gewesen seien.
›Unser Ziel ist es, Furcht und Schrecken zu verbreiten, Angst vor der Macht der Finsternis. Nennt uns, wie ihr wollt. Wir verehren den Teufel, aber wir benutzen lieber nicht das Wort Satan. Der Name wird von bescheuerten Quasi-Gruppen lächerlich gemacht.‹
Angewidert warf Pastor Fossum den Artikel auf den Stapel zurück. Aus den Nachrichten hatte er erfahren, dass Count Grishnackh mit bürgerlichem Namen Kristian Vikernes hieß und als Varg Vikernes in der Black-Metal-Musikszene unterwegs war. Er war von der Polizei wegen der Zerstörung der Fantoft-Kirche verhaftet, aber einen Monat später aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen worden.
Was war bloß los mit diesem Land? Leute konnten in Zeitungsberichten mit Straftaten prahlen und spazierten später einfach wieder aus dem Gerichtssaal. Er hatte das Gefühl, dass er, obwohl er noch nicht einmal so alt wie sein Bruder war, dieses ausgehende zwanzigste Jahrhundert einfach nicht mehr begriff, Computer hin oder her.
Umso wichtiger war es, Flagge zu zeigen. Nicht den Kopf einzuziehen, sondern dem Hass, der aus den Zeilen des Interviews in der Bergens Tidende troff, etwas entgegenzusetzen. Er hatte vor, darüber zu sprechen, seinem Stolz auf seine Religion Ausdruck zu verleihen, auch wenn das bei seiner protestantischen Gemeinde möglicherweise etwas zu sentimental ankommen sollte. Diese blutleere Nüchternheit war es doch gerade, die das Christentum von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer unsichtbarer gemacht hatte, und das nicht nur in Norwegen.
Pastor Fossum schob mit der Maus den Cursor zum letzten Satz seines Manuskripts und begann zu tippen. Er war so auf den Schluss seines Textes konzentriert, dass er auf das kaum wahrnehmbare Geräusch aus der Richtung des Hauses erst einige Sekunden, nachdem es an sein Ohr gedrungen war, reagierte. Es klang, als sei etwas umgefallen, vielleicht ein Rechen, der an der Mauer gelehnt hatte.
Er hielt mit den Fingern auf der Tastatur mitten im Satz inne und drehte den Kopf. Sein Büro war ein ehemaliger Geräteschuppen im Garten etwas abseits vom Haus, den er sich als gemütliche Arbeitshöhle eingerichtet hatte. Die meisten Gartengeräte waren jetzt in der Garage verstaut. Manchmal beschwerte Heidrun sich darüber, dass sie die Fahrertür ihres alten Volvos vor lauter Kram kaum aufbekam. Dann erinnerte er sie daran, wessen Idee es gewesen war, das Büro auszulagern, damit er in Ruhe arbeiten konnte – und vor allem ihr nicht auf die Nerven ging, wenn er laut über seine nächste Sonntagspredigt nachgrübelte.
Vom Schuppenfenster an der Wand rechts neben seinem Schreibtisch aus konnte Pastor Fossum den Garten und einen Teil des Hauses sehen. Es war bereits dunkel, aber schwach gelbliches Licht fiel von den erleuchteten Fenstern auf die dunkelgrüne Holzfassade und die darunterliegende weiß gestrichene Grundmauer. Niemand war zu sehen, dennoch glaubte er, gerade in dem Moment, als er den Kopf gedreht hatte, aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrgenommen zu haben. Jemand war aus dem Lichtschein der Fenster in die nächtliche Dunkelheit eingetaucht und um die Ecke des Wohnhauses verschwunden.
Leise schnaufend erhob sich Pastor Fossum aus seinem Bürostuhl. Normalerweise hätte er sich über eine Gestalt, die ums Haus ging, keine Gedanken gemacht. Er hätte angenommen, dass seine Tochter Ina Abfall zum Komposthaufen brachte oder Heidrun etwas aus der Garage holte. Doch heute Abend war er allein zu Hause. Ina übernachtete bei einer Schulfreundin etwas außerhalb von Straumen, und Heidrun hatte nach dem Abendessen den Wagen genommen, um sich in Fauske mit ihren Freundinnen zu treffen, wie alle vierzehn Tage. ›Buchclub‹ nannten sie es. Svein Fossum nannte es den Lästerkreis, denn das schien Heidruns Erzählungen nach ihre Hauptbeschäftigung zu sein, wenn sie sich gemeinsam in einer männerfreien Zone befanden. Und das konnte dauern, meist war Heidrun erst gegen elf zurück. Da er auch den Wagen nicht die Auffahrt hatte heraufkommen hören, war er sich sicher, dass die unbekannte Gestalt, von der er nun felsenfest überzeugt war, dass er sie gesehen hatte, nicht seine Frau war.
Er öffnete die Tür des Schuppens und spähte hinaus.
»Hallo?«, rief er laut.
Keine Antwort ertönte, nur der abendliche Wind wehte kühl durch den Garten.
Er begann, langsam Richtung Haus zu gehen. Seine Pantoffeln machten auf dem schwach erkennbaren Steinplattenweg kaum ein Geräusch. Der Gedanke schoss ihm durch den Kopf, dass er vielleicht nur einen Nachbarn gesehen hatte, der etwas von ihm wollte. Aber er verwarf diese Möglichkeit sofort wieder. Die Leute, mit denen er die kleine Straße am Rand von Straumen teilte, wussten, dass er abends in seinem Büro arbeitete. Sie hätten zuerst an die Schuppentür geklopft. Außerdem … ja, was genau?
Außerdem war die ganze Situation irgendwie merkwürdig. Ein Nachbar hätte auf seinen Ruf geantwortet. Aber es war ganz so, als ob die Gestalt, die er wahrgenommen hatte, es darauf anlegte, nicht gesehen zu werden.
Vorsichtig trat er um die Hausecke. Die dürren Zweige der Kletterrosen vom letzten Jahr waren dunkle Finger vor dem fahlen Weiß der Hauswand. Zwischen ihnen stand das Fenster zum Gästezimmer im Erdgeschoß offen. Eigentlich war das nichts Ungewöhnliches. Es hätte schon die ganze Zeit über offen gewesen sein können, dennoch beunruhigte ihn der Anblick. Mit einem Mal hatte er wieder die Artikel über die brennenden Kirchen auf seinem Schreibtisch vor Augen.
Sie machen nicht mehr bei den Kirchen halt. Jetzt sind wir Pastoren ebenfalls das Ziel.
War das paranoid? Seine Kirche befand sich in Fauske, ein paar Kilometer von hier entfernt. Er hatte sich bisher nie ernsthaft Sorgen darüber gemacht, ob seinem Gotteshaus oder seinem eigenen Zuhause Gefahr von Fanatikern drohen könnte. Dazu waren die Nachrichten trotz ihrer Häufigkeit immer noch verhältnismäßig weit weg gewesen. Die Kirchen, die Ziele von Brandattacken gewesen waren, hatten sich in größeren Städten befunden. Bergen. Oslo.
Warum machte das offen stehende Fenster ihm dann Angst?
Er gab sich einen Ruck, schritt wieder zurück um die Ecke und zur Haustür, die von einer Lampe an der Außenwand über dem Türrahmen hell beleuchtet wurde. So leise wie möglich drückte er die Klinke herunter, öffnete sie und trat in den Flur.
Nichts war zu vernehmen. Alles im Haus war still, aber wie schon beim Anblick des offenen Fensters bekam etwas eigentlich Harmloses unvermittelt einen unheimlichen Beigeschmack. Die Stille war, als ob jemand, der sich ganz in der Nähe versteckte, angestrengt die Luft anhielt, um nur ja kein Geräusch von sich zu geben.
Pfarrer Fossums kurze verbleibende Lebenszeit verrann weiter Sekunde für Sekunde, während er langsam durch den Flur schritt und sich nach allen Seiten umsah. Er ging die schmale Treppe zum ersten Stock hoch. Als er etwa die Hälfte der Stufen zurückgelegt hatte, vernahm er über sich im ersten Stock ein dumpfes Poltern. Er verharrte mitten im Schritt, die Hand auf dem polierten Treppengeländer. Sein Herz begann, heftig zu pochen. Bevor er sich die Frage stellen konnte, wer oder was das Geräusch verursacht hatte, setzte ein Schatten um die Ecke des oberen Treppenabsatzes und fegte blitzschnell an ihm vorbei.
Ollie!
Svein Fossum stöhnte leise auf, schloss die Augen und atmete tief durch. Der verdammte Kater hätte ihm beinahe einen Herzanfall verpasst.
Er war so darauf konzentriert, seinen hämmernden Puls wieder zu beruhigen, dass er das Prasseln, das stetig an Lautstärke zunahm, erst nach wenigen Momenten bemerkte. Er wusste sofort, was es war, und die Erkenntnis trieb seinen Herzschlag, der sich gerade wieder ein wenig verlangsamt hatte, erneut an. Die Starre verließ ihn. So schnell ihn seine Füße trugen, legte er die letzten Treppenstufen zurück und bog im ersten Stock um die Ecke ins Wohnzimmer.
Die Flammen, die das Prasseln verursachten, waren an den Fenstervorhängen emporgeklettert und fraßen sich bereits an der Holzwand entlang. Das Wohnzimmer war in einen flackernden orangeroten Schein gehüllt.
Svein Fossum eilte auf die Brandstelle zu. Hektisch sah er sich nach etwas um, womit er seine Hände umwickeln konnte. Sein erster Gedanke war, die lichterloh brennenden Vorhänge von der Stange herunterzureißen und das Feuer auszutreten, bevor sich der Brand noch mehr ausbreiten konnte. Aber weder auf dem Tisch noch auf dem Sofa lag etwas, womit er seine Hände und Arme hätte schützen können, und von den Flammen ging bereits eine so starke Hitze aus, dass er es nicht wagte, die Vorhänge mit bloßen Händen anzufassen.
Vor seinem inneren Auge blitzte etwas leuchtend Rotes auf. Der Feuerlöscher, der neben der Garderobe im Flur angebracht war! Warum hatte er nicht gleich an das alte Ding gedacht?
Er wirbelte herum und stürmte zum Treppenabsatz. Sein linker Fuß blieb auf der ersten Stufe an etwas hängen. Er hörte Ollie unter sich laut aufkreischen und verlor das Gleichgewicht. Sein rechter Arm streckte sich nach dem Treppengeländer aus, verfehlte es aber, sodass er vornüber und die Treppe hinunter stürzte. Der Lärm, mit dem sein Körper ins Erdgeschoß hinabpolterte, dröhnte ihm laut wie Paukenschläge in den Ohren. Er schlug hart mit dem Brustkorb auf einer der unteren Stufen auf. Stechender Schmerz fuhr ihm durch den Oberkörper. Als er nach Atem rang, stieß er einen dumpfen Schmerzensschrei aus. Ihm war, als ob ihm beim Luftholen Rasierklingen durch die Lunge gezogen würden.
Mühsam zog er sich, immer noch auf dem Bauch liegend, von den letzten Treppenstufen herunter auf den flachen Boden und versuchte aufzustehen. Sein rechtes Schienbein schmerzte höllisch und wollte ihn zunächst kaum tragen. Er war sich nicht sicher, ob es gebrochen oder nur verstaucht war. Auf das linke Knie gestützt kam er hoch und zog sich mit beiden Händen am Treppengeländer auf die Beine. Über ihm war das Prasseln der Flammen im Wohnzimmer zu vernehmen. Obwohl es nicht aus nächster Nähe erklang, füllte es seine Ohren aus, dröhnte lauter als sein rasender Herzschlag. Das Feuer breitete sich aus, fraß sein Zuhause, seinen Besitz. Mit jeder weiteren Sekunde, die verstrich, schwand die Hoffnung, den Brand noch eindämmen zu können. Schlurfend setzte er sich in Bewegung, den Schmerz im rechten Bein ignorierend, die Zähne fest aufeinandergebissen und den Blick starr auf das Ende des Flurs gerichtet, in dessen Schatten er schwach die Umrisse des Feuerlöschers an der Wand erkennen konnte. Er musste ihn schnellstens nach oben bringen!
Der Weg durch den Flur zog sich wie in einem Albtraum in die Länge. Mit jedem keuchenden Atemzug schien er Nadeln zu inhalieren. Endlich hatte er die Garderobe erreicht. Er riss den Feuerlöscher aus der Halterung, mit der er an der Wand befestigt war, und umklammerte ihn. Schritt für Schritt kämpfte er sich zurück durch den Flur und die Treppe hinauf. Sein Herz schien ihm aus dem stechenden Brustkorb herausspringen zu wollen. Er konnte fühlen, wie es hart gegen die rote Metallflasche pochte, die er mit beiden Armen wie ein Baby an sich gepresst hielt.
Endlich war er im oberen Stockwerk angelangt. Dunkler Rauch kam ihm am Treppenabsatz entgegen. Der Brand hatte inzwischen das Sofa erfasst. Dahinter leckten die Flammen an der gesamten Seitenwand empor bis zur Decke. Pastor Fossum musste angestrengt husten. In seiner Lunge entzündete sich eine stachelige Kugel aus Schmerz. Beinahe hätte er den Feuerlöscher fallen lassen. Er taumelte so nah auf die Flammen zu, wie es ihm bei der Hitze, die ihm entgegenströmte, möglich war, und zog mit zittrigen Händen den Sicherheitsstift aus der Halterung am Griff. Mit dem Schlauchende zielte er nach unten in Richtung Sofa und drückte fest den Hebel.
Nichts.
Nur ein leises Zischen entkam dem Schlauch des Feuerlöschers, kaum zu vernehmen vor dem Hintergrund der prasselnden Flammen, und vorbei in wenigen Augenblicken.
Scheiße, das verdammte alte Ding hatte nicht mehr genügend Druck!
Mit einem wütenden Aufschrei schleuderte Pastor Fossum die nutzlose Flasche zu Boden. Ein erneutes Husten stieg in seiner Kehle empor. Der bittere Geschmack von Verzweiflung lag ihm schwer im Mund. Alles, wofür Heidrun und er sich jahrelang abgemüht hatten, war im Begriff, von den Flammen vor ihm vernichtet zu werden. Das Feuer war bereits zu stark angewachsen, um es noch mit ein paar Eimern Wasser aus dem Bad oder der Küche in den Griff zu bekommen, und an das Telefon in der Sofaecke kam er nicht mehr heran. Er musste so schnell wie möglich zu seinem Nachbarn und von dort die Feuerwehr rufen. Vielleicht hatte er Glück und der Feuerschein war Jan Erik Tornes bereits aufgefallen. Vielleicht konnte zumindest die untere Etage des Hauses noch gerettet werden.
Pastor Fossum wandte sich der Treppe zu. In diesem Moment vernahm er über das Brüllen der Flammen hinweg einen schwachen Hilferuf. Für einen Moment glaubte er voll Entsetzen, dass es Ina sei, die er gehört hatte. Dann fiel ihm wieder ein, dass seine Tochter heute gar nicht hier war. Aber wer auch immer gerufen hatte, die Person hielt sich im hinteren Teil der Etage auf, wo das Schlafzimmer und das obere Bad lagen.
Pastor Fossum zögerte nicht mehr länger. Es war Schicksal. Alles würde so kommen, wie es kommen musste. Als sei er im Begriff, wie in seiner Kindheit das Schwimmbecken im Freibad in seiner ganzen Länge unter Wasser zu durchqueren, holte er tief Luft, um keinen weiteren Qualm einzuatmen. Er ignorierte den dumpfen Schmerz in seinem Knöchel und das Stechen in seiner Lunge und humpelte los, so schnell es ihm möglich war, durch das sich immer mehr mit Rauch füllende Wohnzimmer und in den dunklen Flur dahinter. Wer auch immer sich dort aufhielt, durfte nicht in dem brennenden Haus bleiben.
Die letzte Minute seines Lebens hatte begonnen.
2
Sie konnte fühlen, dass es zu Ende ging.
Schon seit ein paar Tagen hatte sie es geahnt. Was als gewöhnliche Erkältung begonnen hatte, war zu einer Lungenentzündung geworden, und sie wusste, was das in ihrem Alter bedeuten konnte. Neue Namen konnte sie sich zwar nicht mehr so gut merken – zum Beispiel hatte der Name der neuen Ministerpräsidentin Erna Solberg anfangs einfach nicht in ihrem Gedächtnis hängen bleiben wollen –, aber ihr Verstand war noch immer scharf. Sie machte sich nichts vor. Es war so weit.
Seltsam. Als sie siebzig wurde, hatte Anja Sofia Turi erwartet, dass sich in ihrem Verhältnis zum Tod etwas ändern würde. Dass sein Schatten häufiger als früher ihren Alltag verdunkeln würde. Stattdessen lebte sie einfach weiter wie zuvor, kümmerte sich sommers wie winters um ihren Hof und ihre Schafe und erlebte die Jahrtausendwende ebenso wie das erste Jahrzehnt des einundzwanzigsten Jahrhunderts, ohne sich von dem Gedanken bedrücken zu lassen, sie könnte die Maisonne, die ihr die alten Knochen wärmte, möglicherweise nie wieder erleben, wenn jener Monat ein weiteres Mal vorüber war. Nicht einmal mit zweiundneunzig hatte sie sich darüber Gedanken gemacht, vielleicht eines Nachts für immer einzuschlafen.
Sie war ein pragmatischer Mensch, war es immer gewesen. Grübeleien gehörten nicht zu ihrem Alltag. Aber wenn sie hin und wieder darüber nachdachte, dann kam sie zu dem Schluss, dass es an ihren Erlebnissen im Krieg liegen musste. Während der deutschen Besatzung hatte sie sich nicht arrangiert, sie hatte sich am Widerstand beteiligt. Der Tod war ihr schon in jungen Jahren, mit noch nicht einmal zwanzig, ein ständiger Begleiter gewesen, der nicht als vage Möglichkeit in der Ferne des Alters auf sie wartete. Sie hatte sich damit abgefunden, dass es jederzeit unvermittelt aus sein konnte. Diese stoische Einstellung zum Sterben hatte sie in all den Jahrzehnten, die dem Ende des schrecklichen Kriegs folgten, nie verloren.
Sie lag in ihrem Bett und starrte an die Deckenbalken. Mit jedem rasselnden Atemzug hob und senkte sich ihre dünne Brust unter der Decke, die Magnus ihr bis ans Kinn hochgezogen hatte. Guter Magnus. Ohne ihn hätte sie in den letzten Jahren niemals alleine leben können. Er hatte ihr die Familie ersetzt. Wenn sie sich konzentrierte, was sie aber nur für ein paar Sekunden durchhalten konnte, weil es sie zu sehr anstrengte, konnte sie ihn in der unteren Etage hören, wie er die Toilettenspülung betätigte und vom Bad ins Wohnzimmer ging. Im Gegensatz zu ihren Augen hatte ihr Gehör auch im Alter nicht nachgelassen. Jetzt stellte er den Fernseher an. NRK, Spätnachrichten. Er meinte es immer viel zu gut mit ihr, dabei bekam sie kaum Luft, denn das violette Wollmonstrum lag wie Blei auf ihr. Wenigstens war es warm. Zuletzt war ihr ständig kalt gewesen, doch nicht, weil ihr Schlafzimmer nicht gut genug geheizt gewesen wäre – ganz im Gegenteil: Sie schwitzte derart, dass Magnus kaum damit nachkam, ihr etwas zu trinken zu bringen, damit sie nicht dehydrierte.
Nein, diese Kälte war anders. Sie schien aus dem Inneren ihrer Knochen herauszusickern und sich um sie zu legen wie ein eisiger Kokon. Es war dieselbe Kälte, die sie manchmal als Kind verspürt hatte, wenn sie im Winter rücklings im tiefen Schnee gelegen hatte und weit über ihr die Nordlichter am Himmel entlanggezogen waren. Ihr unwirkliches Licht, manchmal rötlich, meistens grün, atmete die Kälte des leeren Weltraums. Die Nordlichter besaßen eine schier überirdische Schönheit. Gleichzeitig aber sprach aus ihnen die Unerbittlichkeit der Natur, in der jedes noch so heiß brennende Feuer einmal erlosch.
Die kleine Anja Sofia, die sie vor so langer Zeit einmal gewesen war, hatte diese Wahrheit verstanden, wenn es ihr damals auch unmöglich gewesen war, sie in Worte zu kleiden. Sie war inmitten der brutalen Schönheit der Vesterålen-Inseln aufgewachsen. Das Meer und das Wetter regierten das Leben ihrer Familie und das ihrer Nachbarn, die wie sie auf Langøya zu Hause waren. Dass alles in der Natur belebt war, selbst der steinige Boden und die schroffen Gipfel, die sich in den endlos weiten Himmel bohrten, hatte ihr niemand erklären müssen. Die Erkenntnis hatte ihre jungen Sinne regelrecht überflutet, mit einer Wucht, die sie zu manchen Zeiten alle Kraft gekostet hatte, um nicht von ihr fortgerissen zu werden.
Ihr Großvater hatte sie beobachtet und verstanden. Sein eigener Großvater war ein Noaidi gewesen, ein Sami-Schamane. Opa Sabbe kannte die alten Lieder seines Volkes, und von ihm hatte sie gelernt zu joiken – heimlich natürlich. Joiken galt als unanständig, ja heidnisch sogar und war unter denen, die keine Sami waren, nicht gern gesehen, denn früher waren viele Zaubersprüche in diesem kehligen Singsang ausgesprochen worden. Aber vor allem begehrte das Joiken gegen die Muffigkeit auf, gegen die Bethausstimmung der Sonntagsschule, in der man stillsitzen und sich die Geschichten aus der Bibel anhören musste, während einem das frisch gewaschene und gestärkte Kleid am Hals kratzte.
Für Anja Sofia aber war es hauptsächlich eine Möglichkeit, aus voller Kehle das hinauszurufen, was sie bis zum Platzen ausfüllte, wenn sie sich nach der Schule nach draußen stahl und stundenlang trunken von der sie umgebenden Natur herumlief. Zu joiken gab dem, was in ihr vorging, endlich eine Stimme. Opa Sabbe hatte das begriffen. Er war auch der Erste gewesen, der sie nicht Anja oder Anja Sofia, sondern Akka genannt hatte. Damals hatte sie noch nicht gewusst, warum er sie so genannt hatte oder was dieser Name tatsächlich bedeutete. Das hatte sie erst Jahre später verstanden, als sie zum ersten Mal zu den Klängen einer Rahmentrommel gesungen hatte und in die anderen Welten gereist war. In ihren Kindertagen war es einfach nur ein Geheimnis gewesen, dass Opa Sabbe und sie geteilt hatten.
Dann war sie herangewachsen. Ihr Vater war gestorben, und sie waren von Langøya fortgezogen, um auf dem Festland zu leben. Der Verlust, der mit dem Abschied vom Meer und der rauen Berglandschaft einherging, hatte sie mit so unmittelbarer Härte getroffen, als hätte ihr jemand mit einer Axt eine ihrer Gliedmaßen abgehackt. Die dunkle Zeit war gekommen, die zum Glück nur fünf Jahre gedauert hatte, aber wer hätte das damals wissen können, als die Deutschen ihr Land besetzt hatten?
Wenn sie später an jene Zeit zurückgedacht hatte, dann mit der Gewissheit, dass sie trotz ihrer Jugend an den Menschen verzweifelt wäre, wenn es nicht die Erinnerung an jene ersten Jahre ihres Lebens gegeben hätte. Menschen mochten Ungeheuer sein, aber solange es etwas gab, das größer als sie selbst war – Wald, Berge, Sterne, in deren lebendigen Zyklen sie sich mit derselben Leidenschaft verlieren konnte wie in den Armen eines Menschen –, lohnte es sich, weiterzuleben.
Und dann war tatsächlich jemand aufgetaucht, der in ihr noch eine andere Liebe entzündet hatte als die zu einsamen Wäldern und verlassenen Bergkuppen. Sie konnte sich Frank Schenks Gesicht nicht mehr so gut vorstellen wie früher. Aber das war auch nicht notwendig. Sie musste seine Züge nicht vor sich sehen, um sich daran zu erinnern, welche Leidenschaft seine Berührung in ihr hervorgerufen hatte, selbst Jahre und Jahre nach seinem Tod.
So viele Menschen, die vor ihr gegangen waren, sogar ihre eigene Tochter. Zu viele. Der Fluch des Alters. Dennoch waren auch immer wieder neue Menschen in ihrem Leben aufgetaucht, und Akka hatte sie in ihr Herz gelassen. Menschen wie Magnus Skog Sandmo, der bärbeißige Anthropologe, der sie über die Riten und Gesänge ihrer Vorfahren hatte ausfragen wollen und der am Ende auf ihrem Hof geblieben war, um ihr den Verlust ihres Zuhauses und das Altersheim zu ersparen. Erst im letzten Spätsommer hatte sie einen eigenartigen jungen Mann kennengelernt. Er war halb Deutscher, wie ihre längst verstorbene Liebe, und halb Norweger und war vor den Geistern seiner Vergangenheit aus Deutschland ins Land seines verstorbenen Vaters geflüchtet. Magnus hatte ihm dabei geholfen, seine Angstzustände in den Griff zu bekommen. Am Ende hatte er sich entschlossen, in Norwegen zu bleiben, und den Herbst bei ihnen verbracht.
Wie war noch einmal sein Name gewesen? Er wollte ihr nicht mehr einfallen, aber Namen spielten keine Rolle mehr. Wichtig waren nur Gesichter und die Gefühle, die sie hervorriefen. Und das Gesicht des jungen Halbnorwegers trat so deutlich in ihrer Vorstellung hervor wie das ihres deutschen Mannes, an den sie sich zuletzt vor allem so erinnert hatte, wie sie ihn bei ihrer ersten Begegnung erlebt hatte: jung und faltenlos, mit einem aufmerksamen, wachen Blick, mit Augen, die etwas in sich hineinsahen.
Der Westwind, der von der Nordsee her landeinwärts gezogen war und schon den ganzen Abend über ums Haus strich, heulte unvermittelt auf. Ihr Atem setzte für einen kurzen Moment aus und sie rang röchelnd nach Luft. Ihre Lunge brannte schmerzhaft. Dieses Feuer würde sie nicht mehr löschen können. Es würde sie verzehren, bald schon.
Plötzlich überfiel sie nun doch Angst. Ihr ganzes Leben lang war sie gut allein zurechtgekommen, aber sie wollte nicht allein sterben. Ihre Augenlider begannen zu flattern, als sie sich anstrengte, nach Magnus zu rufen. Doch nur ein heiseres Pfeifen entkam ihrer Kehle. Im unteren Geschoss liefen die Nachrichten weiter.
Aber da … War Magnus ins Zimmer getreten? Stand er jetzt am Bettrand und sah auf sie herab, ohne sich zu regen, ohne etwas zu sagen?
Sie bemühte sich, den Kopf zu drehen. Endlich gelang es ihr. Die Zimmertür stand eine Handbreit offen, aber der Platz vor dem Bett war leer.
Verzweifelt schloss sie die Augen. Besser Finsternis um sie herum als das bedrückend eintönige Bild der Deckenbalken über ihr. Früher hatte sie den romantischen Wunsch gehegt, einmal unter freiem Himmel zu sterben, in der Weite zu verschwinden. Natürlich war es anders gekommen. Wie so viele alte Menschen würde sie allein in einem Bett sterben.
In diesem Moment fühlte sie eine Berührung an ihrer rechten Hand, die während ihrer körperlichen Anstrengung, Magnus zu sich zu rufen, unter der Decke hervorgerutscht war und nun ein wenig über die Bettkante hinaushing. Sie spürte Nässe und wusste sofort, woher sie stammte. Kuling, ihr großer belgischer Schäferhund, hatte sich ins Zimmer geschlichen und leckte ihr den Handrücken. Ihr ganzes Leben lang war sie nicht besonders sentimental gewesen, aber jetzt schossen ihr vor Erleichterung Tränen in die Augen, liefen unter den geschlossenen Lidern hervor und die gefurchten Wangen entlang wie Rinnsale durch ein ausgetrocknetes Flussbett. Sie war nicht allein. Wenigstens Kuling war bei ihr.
Mit letzter verbliebener Kraft hob sie die Hand ein wenig und legte sie um die feuchte Schnauze des Hundes. Sie konnte das dumpfe Geräusch hören, mit dem Kulings Schwanz beim Wedeln gegen den hölzernen Bettpfosten klopfte. Es erinnerte sie an das Geräusch einer Trommel, voll und tief, ein Klang wie geschaffen, um dazu zu joiken. Ein Klang, der den Himmel aufschließen konnte.
Auf einmal blitzten in der Finsternis vor ihren geschlossenen Augen kalte weiße Lichtpunkte auf, mehr und immer mehr. Alle ihre fernen Freunde, die sie schon seit Kindertagen gekannt hatte, waren wieder da, Kassiopeia, Orion, der Plejadenhaufen und der Kleine Bär mit dem Polarstern am Ende seines Schwanzes. Die dunkle Himmelskuppel dehnte sich über Akka aus, wie schon damals, wenn sie als kleines Kind rücklings und blau gefroren im tiefen Schnee gelegen hatte, manchmal stundenlang, und sich in der Endlosigkeit über ihr verloren hatte. Damals, als sie alles verstanden hatte, alles, was sie zu ihr gesungen hatten, auch wenn sie es niemals einem Erwachsenen hätte erklären können.
Mit dem dumpfen Schlag der Rahmentrommel, in den Kulings Klopfen sich verwandelt hatte, flammte in der Finsternis ein geisterhaftes Licht auf, das Band der Nordlichter. Ihr kaltes grünes Schimmern füllte Akkas Verstand aus. Sie zogen die alte Frau mit sich, während ihre letzten rasselnden Atemzüge verklangen.
Kuling hörte auf, die Hand der Toten zu lecken, und setzte sich auf die Hinterpfoten. Ein leises, fragendes Jaulen entkam seiner Kehle. Der große schwarze Hund hielt noch Wache neben dem Bett, als Akkas Leichnam längst kalt geworden war.
3
Eisige Dezemberluft findet ihren Weg durch das angelehnte Schlafzimmerfenster, aber in Arnes Traum herrscht noch immer goldener Herbst. Unter der dicken Wolldecke spürt er die Kälte nicht.
Er sitzt ganz hinten im M49er-Bus, der die Berliner Heerstraße Richtung Spandau entlangfährt. Wenn er aus dem verkratzten Seitenfenster sieht, leuchtet auf der anderen Straßenseite gelbbraun und orange verfärbtes Laub.
Der Bus hält an der Schildhorn-Haltestelle. Die hintere Tür öffnet sich mit einem Zischen, und ein pechschwarzer Hund, groß wie ein Kalb, springt ins Innere. Sein spitz zulaufender Kopf wendet sich neugierig nach links und rechts, dann erkennt er Arne und läuft zielstrebig auf ihn zu.
»Hey, Kuling!«, hört Arne sich sagen. Er wundert sich, dass der struppige belgische Schäferhund mit dem merkwürdigen Namen, der auf Norwegisch so viel wie ›Starkwind‹ bedeutet, plötzlich in Berlin aufgetaucht ist. Er gehört nicht an die Heerstraße, sondern nach Nordnorwegen, an den Polarkreis, zu seinen Freunden Akka und Magnus. Es ist eine Form von halb bewusstem Begreifen, dass dies nicht die Realität sein kann. Die Erkenntnis ist nicht stark genug, um luzide zu werden und den Traum als solchen zu erkennen, aber gerade so stark, um Arne im Schlaf die Stirn runzeln zu lassen.
»Was machst du denn hier, Kumpel?«
Der Bus fährt ruckartig an. Kuling schwankt im Trab gegen die Einkaufstüte eines alten Mannes, der sie mit vorwurfsvollem Blick aus seiner Reichweite zieht. Er legt den Kopf auf Arnes Knie und schließt die Augen, als dieser ihn zwischen den Ohren krault und dabei aus dem Fenster schaut.
Jenseits der Baumreihen erstreckt sich zu beiden Seiten der Stößensee, auf dem die letzten Jollen der Saison hin- und herkreuzen, bevor sie in ihre Winterquartiere gebracht werden. Beim Anblick der hellen Segel auf dem rauchgrauen Wasser fühlt Arne einen schmerzhaften Stich. Hier hat er mit acht Jahren seinen Vater verloren, als der Großbaum seiner Jolle Ingvar Eriksen in einer plötzlichen Windbö bewusstlos geschlagen und über Bord befördert hat. Arne hat es hilflos mit ansehen müssen.
Die Havel verschwindet wieder aus Arnes Blickwinkel, als der Bus weiter die Heerstraße entlangfährt. Die Blätter der Bäume am rechten und linken Straßenrand lösen sich von den Ästen und treiben in einem Schauer aus Gelb und Rot an den Fensterscheiben vorbei. Arne bemerkt, dass das Sonnenlicht abnimmt. Der goldene Schein zwischen den Baumkronen bleicht aus. Mehr und mehr kahle Äste recken sich in einen blassen Himmel empor, der die schmutzig graue Farbe eines mit Eis überzogenen Sees bekommen hat. Kuling öffnet die Augen und sieht sich unruhig um. Ein leises, über die Fahrgeräusche des Busses kaum vernehmbares Knurren entkommt seiner Kehle. Arne fühlt es mehr durch seine Handfläche, die auf dem Kopf des Hundes ruht, als dass er es hört.
Jetzt erst fällt ihm auf, dass alle Passagiere den M49er verlassen haben. Er sitzt ganz alleine mit Kuling zu seinen Füßen auf der hintersten Bank. Wann sind die anderen ausgestiegen? Der Bus hat doch gar nicht gehalten!
Er erhebt sich und drückt an einer der Griffstangen vor der hinteren Tür den Halteknopf. Kuling folgt ihm mit eingezogenem Schwanz und vorsichtigen kleinen Schritten, die so gar nicht zu dem riesigen Hund passen. Arne sieht, dass sie sich einem weißen Schild nähern, das eine weitere Haltestelle ankündigt. Doch der Bus verlangsamt sich nicht. Arne drückt erneut den Signalknopf, ohne dass etwas geschieht. Das Fahrzeug passiert die Haltestelle und lässt sie hinter sich. Ihm bleibt nicht einmal genügend Zeit, ihren Namen zu erkennen. Die Bäume rechts und links von der Straße sind nun völlig kahl wie im Spätherbst. Nebel hängt in ihren Kronen und verhindert die Sicht auf die dahinterliegenden Gebäude. Der Bus fährt durch eine neblige Allee, die keine Ähnlichkeit mehr mit der Berliner Heerstraße besitzt.
Ein Gefühl von Bedrohung steigt in Arne empor. Erst in diesem Moment fällt ihm auf, dass er es verspürt hat, seitdem Kuling zu knurren begann. Es hat ihn begleitet wie ein kalter Windzug. Er wendet sich dem Busfahrer zu.
»Hey, hallo! Können Sie mich rauslassen?«
Der Fahrer am anderen Ende des langen Gelenkbusses, von dem er nur den Rücken sehen kann, reagiert nicht. Arne macht sich auf den Weg zu ihm, gefolgt von Akkas Schäferhund. Sein Herz beginnt, schneller zu schlagen. Seitdem er im letzten Sommer beinahe von einem seiner Klienten im Betreuten Wohnen umgebracht worden wäre, schlägt bei ihm Stress oder Furcht schnell in massive Panikattacken um. Er zwingt sich, ruhig durchzuatmen, während er an den leeren Sitzreihen vorbei in Richtung Busfahrer geht. Gleichzeitig nimmt der Wagen an Geschwindigkeit zu. Das Fahrgeräusch seines Motors wird lauter, und der Bus schwankt deutlich bei jeder Straßenunebenheit, sodass Arne mehrmals nach rechts und links gestoßen wird und sich an den Sitzen festhalten muss. Das Tageslicht draußen hat abgenommen, der Nebel hat etwas von einem schmutzig grauen Tuch.
»He, hören Sie mich?«, ruft Arne. Er hat endlich den Busfahrer erreicht. Hinter ihm beginnt Kuling, so schrill zu bellen, dass es schmerzhaft laut im Wagen widerhallt. Doch der Mann dreht sich immer noch nicht um, sondern sieht stur geradeaus. Arne beugt sich vor, um ihm ins Gesicht zu sehen. Im gleichen Moment reißt der Fahrer das Steuer herum. Der Bus gerät heftig ins Schlingern. Arne taumelt und wird hart gegen die vordere Eingangstür geschleudert. Er hält sich krampfhaft an einer Haltestange links von ihm fest, um nicht zu stürzen. Kuling schlittert auf ihn zu und prallt gegen ihn. Der Hund jault laut auf vor Angst, ein Geräusch, das Arne die Haare im Nacken aufstellt. Aus den Augenwinkeln sieht er den Fahrer und lässt vor Entsetzen beinahe los. Der Mann besitzt überhaupt kein Gesicht – stattdessen schimmert eine grauweiße Masse wie die Oberfläche des Mondes zwischen seinen Schultern: Ein blinder, kalter Fleck.
Mit einem durchdringenden Knirschen, als ob es ihn in zwei Teile reißen würde, schlingert der Bus über den Straßenrand hinaus und rumpelt eine Böschung hinab. Der vordere Teil des Wagens senkt sich. Arne verliert das Gleichgewicht, die Fliehkraft zerrt seine Hände von der Haltestange, und er stürzt zu Boden. Kuling landet schwer auf ihm. Der Fellgeruch des schwarzen Hundes dringt ihm intensiv in die Nase. Arne vernimmt ein markerschütterndes dumpfes Splittern außerhalb des Fahrzeugs. Obwohl er sich nicht erinnern kann, etwas Derartiges jemals vernommen zu haben, weiß er instinktiv sofort, was es ist.
Brechendes Eis.
Kuling schlägt wild mit den Pfoten um sich. Eines seiner Hinterbeine tritt Arne hart ins Gesicht. Die Krallen der Hundepfote schrammen schmerzhaft über seine Stirn. Er hört den Hund vor Angst aufjaulen, dann wälzt Kuling sich von ihm herunter. Der Motor des Busses ist verstummt, aber sie bewegen sich noch immer. Das Fahrzeug kippt langsam weiter nach vorne. Wasser spritzt zwischen den Gummileisten der geschlossenen Fahrzeugtüren hindurch und trifft auf Arne. Es ist so eiskalt, dass ihm der Atem stockt. Mühsam kommt er wieder auf die Beine. Hinter den Fensterscheiben ist es dunkel. Panik packt seine Eingeweide, eisig wie das Wasser, das unaufhaltsam ins Innere des Busses strömt, seine Hose und sein T-Shirt durchdringt. Sie müssen die Oberfläche eines Sees durchbrochen haben!
Eines der Seitenfenster zu seiner Linken splittert, vielleicht war es schon vorher beschädigt worden, als der Bus von der Straße abkam. Das Sicherheitsglas platzt. Splitter fliegen mit der Wucht von Geschossen ins Innere des Busses. Einige regnen schmerzhaft gegen Arnes Kopf. Im nächsten Moment trifft ihn das ins Innere des Fahrzeugs strömende Wasser wie eine Faust. Es reißt ihn von den Füßen und spült ihn hart gegen den Fahrersitz. Unwillkürlich schnappt er nach Luft. Sofort schießt ihm Wasser in die Lunge. Alles in ihm krampft sich zusammen. Gedämpft und wie aus weiter Ferne hört er Kulings verzweifeltes Bellen. Er versucht, den Kopf über Wasser zu halten, aber er kann nicht mehr erkennen, wo oben und unten ist. Die Welt um ihn herum hat sich zu eisiger, schwarzer Nässe zusammengezogen, die ihn lähmt und gleichzeitig von innen zu verbrennen scheint. Er tritt wild um sich, um das offene Fenster zu erreichen und aus dem sinkenden Bus zu entkommen. Es gibt einen harten Schlag, er rollt herum …
… und krachte mit voller Wucht auf den harten Dielenboden. Die Bettdecke, in der sich seine Füße verfangen hatten, rutschte ihm hinterher.
Arne blinzelte heftig. Wie mechanisch setzte er sich auf und blickte benommen um sich. Die Details seines Traums – Kuling, der Berliner Bus, der die Eisdecke eines Sees durchbrochen hatte, das in den Fahrzeugraum eindringende Wasser – standen noch immer gestochen scharf vor seinem inneren Auge und überlagerten die Realität. Das sich panisch überschlagende Kläffen des Schäferhundes gellte Arne auch weiterhin in den Ohren. Vorsichtig betastete er seinen Kopf mit den Fingerspitzen.
Nirgends eine klaffende Wunde, nirgends warmes Blut. Trotzdem glaubte er auch weiterhin Schnitte spüren zu können, ein schattenhafter, aber eigenartig beständiger Phantomschmerz, der nur schwerfällig im Nebel seiner Traumerinnerung versinken wollte.
Noch immer klatschte ihm Wasser unangenehm kalt ins Gesicht. Er hob den Kopf. Als sich seine Pupillen endlich scharf stellten, erkannte er, dass das Schlafzimmerfenster sperrangelweit offen stand. Regen prasselte herein, traf auf den Boden vor dem Bett, wo er saß, und färbte das Bettzeug dunkel. Arne erhob sich ruckartig, wobei er die kleine Stehlampe mit dem grünen Plastikschirm vom Nachttisch stieß. Sie polterte auf den Boden, was ihm aber nur vage auffiel. Draußen war es stockfinster wie mitten in der Nacht, aber in Norwegen zur Winterzeit musste das nichts heißen. Es konnte durchaus schon Morgen sein.
Regen klatschte ihm unangenehm kalt aufs Gesicht und seinen nackten Oberkörper. Er stieß das Fenster zu und ließ sich stöhnend auf der Bettkante nieder. Was für ein beschissener Albtraum!
Der Klingelton seines Mobiltelefons auf dem Nachttisch begann, so laut zu ertönen, dass er zusammenzuckte. Es war die unerträglich dudelige Melodie, mit der er es vor ein paar Wochen geliefert bekommen hatte, als er sich entschieden hatte, sein deutsches Handy erst einmal einzumotten und sich stattdessen ein norwegisches zuzulegen. Eine weitere konkrete Handlung, mit der er sich selbst bestätigt hatte, dass Norwegen seit seinem plötzlichen Fortgang aus Berlin im letzten Sommer inzwischen sein neues Zuhause geworden war. Bisher war Arne zu faul gewesen, den Ton zu ändern. Nun nahm er sich vor, das endlich anzugehen.
Er sah auf das Display. Sechs Uhr dreißig. Wenigstens war es nicht mitten in der Nacht. Der eingespeicherte Name des Anrufers war sichtbar: Magnus Skog Sandmo, der Anthropologe aus Nordland. Was um alles in der Welt wollte Magnus um diese Zeit von ihm?
Der schwarze Hund aus seinem Traum blitzte in seinem schlaftrunkenen Gedächtnis auf. Etwas musste passiert sein. Er nahm das Gespräch an, und das nervtötende Klingeln endete.
»Ja?«
»Arne, bist du es?« Magnus’ vertraute Stimme. Sein voluminöser Opernsängerbariton schaffte es, selbst über das Mikrofon eines Mobiltelefons so zu klingen, als stünde er auf einer Bühne vor Publikum.
»Jepp«, murmelte Arne. »Du hast mich aufgeweckt.«
Das stimmte zwar nicht, aber es war ihm momentan egal. Er hatte es noch nie leiden können, früh am Morgen angerufen zu werden.
»Ich hab schlechte Neuigkeiten«, sagte Magnus am anderen Ende der Leitung, ohne weiter darauf einzugehen, dass er Arne aus dem Schlaf gerissen hatte. Er machte eine kurze Pause, dann fuhr er fort: »Akka ist heute Nacht gestorben.«
Arne verstand Magnus’ Worte, aber sie wollten keinen Sinn ergeben. Gerade hatte er noch mit Akkas Hund in einem versinkenden Bus festgesteckt! War dieser Anruf ebenfalls ein Traum?
Er drückte das Mobiltelefon so fest ans Ohr, dass es wehtat.
»Was?«, hörte er sich selbst sagen. Seine Stimme klang lahm und belegt.
»Es tut mir leid«, antwortete Magnus. »Letzte Woche hatte sie sich eine Erkältung eingefangen. Erst haben wir uns keine großen Sorgen gemacht. Akka war immer gesund wie ein Pferd. Aber dann wurde aus der Erkältung rasend schnell eine Lungenentzündung. Wenigstens hat sie nicht lange gelitten.«
Arnes Kopf fühlte sich leer an. Ihm gegenüber sah er die Spiegelung seines schattenhaften Umrisses in der Fensterscheibe vor der dahinterliegenden Dunkelheit. Die regennasse Bettdecke presste sich unangenehm kalt gegen seinen nackten Hintern, eine spöttische Erinnerung daran, dass er sich das Telefongespräch nicht einbildete.
Es war kein Traum. Akka war tatsächlich tot.
4
Wieder nur Regen statt Schnee. Kari Bergland starrte stirnrunzelnd aus einem der lang gezogenen Fenster der Kantine im fünften Stock des Bergener Polizeipräsidiums. Hinter ihr rauschte das Stimmengewirr der zur Weihnachtsfeier eintrudelnden Kollegen wie Wellen, die sich an Klippen brachen. Es war sieben Uhr abends und längst dunkel, aber in den Lichtkegeln der Straßenlaternen konnte sie sehen, dass es nieselte wie schon den ganzen Tag über. Im Radio warnten sie seit dem Morgen vor Glatteis.
Sie hatte gehofft, dass es noch vor Weihnachten schneien würde, aber es sah ganz so aus, als ob ihr dieser Wunsch nicht erfüllt werden würde. Wenn es um Jahreszeiten ging, dann besaßen Großstädte gespaltene Persönlichkeiten, so wie Dr Jekyll aus der Erzählung von Robert Louis Stevenson, der sich ab und zu in den bösartigen Mr Hyde verwandelte. Während der Sommermonate war es angenehm, sich in Städten aufzuhalten, selbst für Menschen, die auf dem Land groß geworden waren. Die tagsüber herrschende Wärme hielt sich auch nach Sonnenuntergang noch eine Weile zwischen den Häusern, Parks waren eine schnell zu erreichende Alternative zur freien Natur, und wenn man einen offenen Himmel über sich haben wollte, reichte es schon, auf den Balkon hinauszutreten.
Sobald jedoch die dunkle Jahreszeit begann, war dieselbe Stadt auf einmal nicht mehr wiederzuerkennen. An ihre Stelle trat dann ein Gewirr von dunklen, dreckigen Straßen, durch die der Wind vom Meer her pfiff und die man nur durchquerte, um so schnell wie möglich wieder ins Warme und Helle zu kommen. Die Häuser schienen mit dem immer kürzer andauernden Tageslicht dichter zusammenzurücken und sich bedrohlich über einen zu neigen. Das Einzige, das ein wenig aufmunternd wirkte, war die allgegenwärtige Weihnachtsbeleuchtung im Dezember. Was Kari sich herbeiwünschte, war Schnee. Dichter weißer Neuschnee, der die schmutzigen Straßen und die dunklen Hausdächer für eine Weile wie eine Daunendecke überziehen würde. So wie während der Winter, die sie als Teenager weit oben im Norden verbracht hatte, bevor sie wieder zurück nach Haugesund und später nach Bergen gezogen war. Schnee verwandelte auch die hässlichste Stadt in ein Postkartenmotiv. Natürlich würde er bald zu braunem Matsch zertrampelt werden. Mr Hyde ließ sich nicht ewig aufhalten. Aber wenigstens für ein paar Tage, während der dunkelsten Zeit um die Wintersonnenwende …
»Scheißwetter«, fasste eine Stimme hinter ihr in einem Wort zusammen, was ihr durch den Kopf ging. Kari drehte sich nicht um, sondern öffnete wie automatisch das Fenster einen Spalt. Der Dezernatsleiter für Gewaltverbrechen, Holger Nygård, wollte sich bestimmt eine seiner filterlosen Luckys anzünden. Es war nicht erlaubt, in öffentlichen Gebäuden zu rauchen, selbst dann nicht, wenn man den Kopf aus einem Fenster steckte und den Rauch ins Freie blies. Aber Nygård hatte sich nie um dieses Verbot geschert. Er war über fünfzig, hatte sein Leben lang gequalmt wie ein Schlot und sah nicht ein, warum er daran etwas ändern sollte. Dass er überwiegend heimlich in seinem Büro rauchte, wo er es niemandem unter die Nase rieb, auch wenn es so ziemlich jeder wusste, war in seinen Augen bereits ein riesiges Zugeständnis an den Zeitgeist. Und es sagte etwas über das Verhältnis des alten Knochens zu seinen Mitarbeitern aus, dass niemand von ihnen jemals auf die Idee gekommen wäre, sich deswegen über ihn zu beschweren.
Tatsächlich steckte er jetzt erst den Kopf aus dem geöffneten Fenster und dann eine Zigarette zwischen die fleischigen Lippen. Er zündete sie sich an. »Ein Gutes hat der Regen wenigstens«, brummte er. »Es ist so glatt, dass meine Schwester ihren angedrohten Besuch übers Wochenende wieder abgesagt hat. Der Weg aus Notodden über den Haukelipass ist ihr sogar mit Winterreifen zu unsicher.«
Er schnaubte ein trockenes Lachen, inhalierte tief den Rauch und stieß ihn in die kalte Dezembernacht hinaus. Dann drehte er sich zu der Kommissarin um, die in seinem Dezernat arbeitete. Er nickte mit dem Kopf zu einer Traube von Polizeibeamten am anderen Ende des Raums hinüber, die sich um das Buffet der Weihnachtsfeier drängten.
»Schau sie dir an«, sagte er trocken. »Hauen rein, als gäb’s erst wieder nach den Feiertagen was zu essen.«
»Na ja, diesmal ist es ja auch wirklich was Besonderes«, erwiderte Kari. Sie hob das halb volle Glas mit Rotwein, das sie in ihrer Hand gedreht hatte, und nahm einen Schluck. »Nicht nur die typischen Weihnachtsklassiker wie gepökelte Lammrippe, Schweinerücken oder Kabeljau. Ich hab da Saltimbocca gesehen, Rentiersteaks, sogar mehrere Platten Sushi, die bestimmt eine Menge gekostet haben. Wie kommt’s, dass wir dieses Jahr so edel gefüttert werden?«
Nygård drehte den Kopf und blies Rauch durch den Fensterspalt, bevor er antwortete.
»Die grauen Eminenzen im Stadtrat sind wohl der Meinung, dass wir dieses Jahr gute Arbeit geleistet haben. Das Budget für die Feier wurde freundlicherweise etwas aufgestockt.«
Kari ahnte, warum. Aber diesen Weg wollte sie gedanklich gerade nicht weiterverfolgen. Nicht heute. Nicht auf dieser Feier. Es reichte schon, wenn Nygård später seine traditionelle und hoffentlich kurze Rede halten würde.
»Hast du schon was von dem Essen probiert?«, hörte sie Nygård fragen. Er blickte auf sie herab. Ihr Chef war über einen Meter neunzig groß. Neben ihm sah Kari wie ein Schulmädchen aus.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich hab keinen großen Hunger.«
Nygårds Blick wanderte zu dem halb vollen Glas mit Rotwein hinab, das sie in der Hand hielt. »Iss was. Wenn du in dem Tempo weitermachst, hängst du bald über der Kloschüssel.«
Ihre Lippen wurden schmal. »Keine Sorge«, sagte sie kurz angebunden und wandte sich zum Gehen. »Ich weiß schon ganz gut, wie viel ich vertrage. Außerdem bin ich nicht im Dienst.«
Nygård erwiderte nichts, sondern zog nur bedächtig an seiner Zigarette und atmete den Rauch durch die Lücke zwischen Fensterscheibe und Rahmen nach draußen in die Dunkelheit. Kari nahm demonstrativ einen tiefen Schluck aus dem Weinglas und verließ den Platz am Fenster.
Sie hatte sich so ruckartig in Bewegung gesetzt, dass ihr für einen Moment schwindelig wurde und sie beinahe gestolpert wäre. Wie automatisch trank sie den Rest des Glases aus, als sei dessen Inhalt kein Merlot, sondern Wasser, mit dem sie ihren Kopf wieder klar bekommen wollte. Der Abend hatte noch gar nicht richtig angefangen, aber sie hatte schon mit Höchstgeschwindigkeit einen halben Weinkarton geleert. Sogar von dem ekelhaften Julaquavit hatte sie sich mehr als einen Schluck genehmigt. Was wohl ihr alter Freund Frode sagen würde, wenn er sie jetzt sehen könnte? Frode, dem sie in den letzten Jahren wiederholt Vorhaltungen über sein immer stärker werdendes Alkoholproblem gemacht hatte. Frode, der sich an manchen Abenden eine komplette Flasche Whisky genehmigte und der extra Mitglied bei der Fährlinie Color Line geworden war, um bei jeder sich bietenden Gelegenheit eines der preisgünstigen und für Mitglieder manchmal sogar kostenlosen Tickets für eine Einkaufstour nach Dänemark abzugreifen, wo es keine Vinmonopol-Läden gab und man billigen Wodka in jedem Supermarkt bekommen konnte, wie in vernünftigen Ländern.
Aber egal, wie Frodes Kommentar ausgefallen wäre, sie hätte sich nicht mit ihrem alten Freund vergleichen lassen. Heute war Ausnahmezustand. Sie hatte sich im Griff, er nicht.
Sie war stehen geblieben. Ihr Blick suchte den Raum ab. Am anderen Ende in der Nähe des Eingangs standen ihre Kollegen Marius Dahle und Torolf Vangen am Buffet. Die beiden schaufelten sich kleine Sushihäppchen auf die leeren Teller. Sie hatten ihr den Rücken zugewandt, aber Vangens breitschultrige Statur und seine blank geschorene Glatze, in der sich die Deckenbeleuchtung der Kantine spiegelte, waren selbst auf größere Entfernung gut erkennbar. Und wo Vangen sich aufhielt, war der hagere und etwas kleinere Dahle für gewöhnlich nie weit entfernt. Die beiden steckten so unzertrennbar zusammen wie siamesische Zwillinge.
Kari erinnerte sich daran, wie schwer die beiden es ihr anfangs gemacht hatten. Mehr als nur einmal hatten sie ihre junge Kollegin spüren lassen, dass sie nicht aus Bergen kam, sondern weiter südlich aus Haugesund. Dass sie das Revier nicht kannte, in dem Vangen und Dahle aufgewachsen waren. Die beiden Städte an der Westküste waren nicht weit voneinander entfernt. Dennoch waren sie zwei unterschiedliche Welten, schon allein deswegen, weil Bergen größer war. Viele, die vom Dorf stammten, sahen in Bergen sogar eine Großstadt. In einem Land mit nur fünf Millionen Einwohnern wurde dieser Begriff sehr großzügig ausgelegt.
Aber schon nach wenigen Wochen hatten sich Vangens und Dahles abfällige Bemerkungen über Karis provinzielle Herkunft ausgedünnt und stattdessen unverhohlenem Respekt Platz gemacht. Sie stapelte klaglos Überstunden um Überstunden, war sich nicht zu fein für die unangenehmen Jobs wie das Benachrichtigen der Verwandten bei einem Todesfall und arbeitete härter als die meisten ihrer männlichen Kollegen. Und mit einem Mal taten Vangen und Dahle, die mit Mitte dreißig nur gut fünf Jahre älter waren als sie, als wäre sie eine Berufsanfängerin, die sich dank ihrer Einarbeitung zu einer besonders guten Kriminalbeamtin entwickelt hatte, zu einem richtigen Spürhund. Kari musste unwillkürlich schmunzeln, als sie daran zurückdachte. Sie drehte den Stiel des leeren Weinglases zwischen den Fingern.
Die beiden Gockel! Vangen und Dahle waren gute Bullen, aber sie hatte sich ihren Stand im Team allein erarbeitet. Weil sie verdammt noch mal gut war.
So wie Arne Eriksen gut gewesen war. Als sie den Psychologen aus Deutschland vor ein paar Monaten im Mordfall Eivind Tverdal ins Boot geholt hatte, waren Vangen und Dahle anfangs nicht begeistert von ihm gewesen. Die beiden hatten es ihm weiß Gott nicht leicht gemacht. Aber Arne war am Ball geblieben, trotz ihrer abfälligen Sprüche und seiner Panikattacken. Und am Ende war er derjenige gewesen, der den richtigen Riecher gehabt hatte. Ohne ihn hätte es noch ein weiteres Opfer gegeben.
Karis Blick wanderte von dem Buffet, vor dem Vangen und Dahle standen, zu einem Tisch mit mehreren geöffneten Weiß- und Rotweinboxen. Zeit, nachzufüllen. Sie setzte sich in Bewegung, den Blick etwas in die Ferne gerichtet, um von niemandem angesprochen zu werden. Die Rede über das letzte Jahr wollte sie sich auf keinen Fall mit einem leeren Glas in der Hand anhören. Am liebsten wäre es ihr gewesen, wenn nichts in diesem Raum sie an den gemeinsamen Fall erinnern würde, den sie im letzten September gelöst hatten. Kein Vangen, kein Dahle, kein Nygård.
Wenigstens hatten sie Arne Eriksen nicht zu der Feier eingeladen. Dazu wären sie ohnehin nicht verpflichtet gewesen. Streng genommen war er nur ein Mitarbeiter auf Honorarbasis gewesen, für diesen einen Fall. Sie mochte den jungen Mann, der halb Norweger, halb Deutscher war. Und die Sympathie war nicht einseitig gewesen, das hatte sie von Anfang an gespürt. Aber Arnes Anwesenheit würde den Finger darauf legen, was es sie gekostet hatte, diesen Fall aufzuklären. Gerade zurzeit konnte sie das nicht gebrauchen. Sie hatte Arne gemieden, seitdem sie von ihrer Auszeit aus Spanien zurückgekommen war und ihre Arbeit bei der Kriminalpolizei Bergen wieder aufgenommen hatte.
Für einen Moment fragte sie sich, wie es ihm wohl ging und wie er selbst mit dem zurechtkam, was sie erlebt hatten. Dann hatte sie den Tisch mit den Weinboxen erreicht. Sie schob den Gedanken beiseite und zapfte sich ein neues Glas Merlot.
»Hei, Kari!«
Sie drehte sich zu dem Mann um, der sie angesprochen hatte. Wenn man vom Teufel sprach. Wie schon ein paar Mal zuvor fiel ihr die Ähnlichkeit ihres neuen Kollegen mit Arne Eriksen auf. Im Profil erinnerte Morten Linde sie mit seinem kurz geschnittenen blonden Haar und den wachen hellen Augen an den Psychologen, den sie über Frode kennengelernt hatte. Nur dass Arne eine insgesamt ruhigere, introvertiertere Persönlichkeit hatte. Morten dagegen sprühte Funken, gleich vom ersten Tag an, als er sich Mitte November von Oslo nach Bergen hatte versetzen lassen.
»Wie ist der Wein?«, wollte er wissen. Im Gegensatz zu seinem Aussehen war seine Stimme ganz anders als die von Arne, etwas hoch, aber nicht unangenehm.
»Trinkbar«, gab sie knapp zurück und drehte sich um, sodass sie neben ihm am Tisch lehnend das Gewirr der Gäste beobachten konnte. Bekannte und weniger bekannte Gesichter schlenderten mit vollen Tellern zu ihren Tischen, die meisten von ihnen in Gespräche vertieft, die als vielstimmiger Singsang durch die Kantine hallten. Holger Nygård hatte seine Zigarette aufgeraucht, das Fenster geschlossen und war in ein Gespräch mit der Polizeireferentin Anna Johanssen vertieft, einer schlanken rotblonden Frau in Kakihose, deren Gesicht von Sommersprossen übersät war.
»Hast recht«, sagte Morten. »Ist gar nicht so schlecht für Kartonwein.« Er hatte sich ebenfalls etwas von dem Merlot gezapft und einen tiefen Probeschluck genommen. Jetzt lehnte er sich neben Kari an die Tischplatte und hob sein Glas.
»Skål, auf einen guten Abend!«
Sie stieß ihr Glas gegen seines. Das Geräusch ging in dem allgemeinen Stimmengewirr fast unter. Kari fand, dass sich das gedämpfte Pling