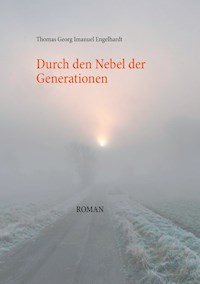
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Begeben Sie sich mit dem Autor und seinem Enkelsohn Maximilian auf eine fast unglaubliche Zeitreise durch die letzten vier Jahrhunderte. Auf der Basis biografischer Daten und zahlloser tradierter Episoden und Legenden wird die Geschichte der Engelhardt-Familie über mehrere Generationen erzählt. Obwohl vieles schon so lange her ist, wird man beim Lesen das Gefühl nicht los, als wäre man mit dabei gewesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Dieses Buch widme ich meinen Enkelkindern,
Marlen Charlotte und Maximilian Liesche
Thomas Georg Imanuel Engelhardt
Großbeeren, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
19. August 2020
Inhaltsverzeichnis
Kapitel: Vorworte: „Dichter Nebel“
Kapitel: Die erste Generation ( 1777 )
Friedrich Johann Wilhelm Engelhardt Friederike Sophie Engelhardt, geb. Hartmann
Kapitel: Rückblick auf die erste Generation
Kapitel: Die zweite Generation ( 1817 )
Alexander Helmuth Friedrich Engelhardt Louise Friederike Christine Engelhardt, geb. Stender
Kapitel: Rückblick auf die zweite Generation
Kapitel: Die dritte Generation ( 1849 )
Alexander Peter August Hermann Theodor Engelhardt Friederike Auguste Dorothea Helene Engelhardt geb. Aken
Kapitel: Rückblick auf die dritte Generation
Kapitel: Die vierte Generation ( 1875 )
Alexander („Lex“) Engelhardt I. Wally Engelhardt, geb. Berne II. Maria Engelhardt, vww. Hardegg, geb. Schmelzle
Kapitel: Rückblick auf die vierte Generation
Kapitel: Die fünfte Generation ( 1907 )
Harald Eduard Wilhelm Engelhardt Elfriede Helene Engelhardt, geb. Röder
Kapitel: Rückblick auf die fünfte Generation
Kapitel: Die sechste Generation ( 1949 )
Thomas Georg Imanuel Engelhardt Veronika Engelhardt, geb. Satzinger
Kapitel: Rückblick auf die sechste Generation
Kapitel: „Schlussworte“
Ahnentafel:
Dokumente und Fotos:
Quellennachweise:
Empfehlungen
1. Kapitel:
Vorworte: „Dichter Nebel“
Dichter Nebel, schlechte Sicht, machen das Fortkommen langsam und weitgehend anstrengend. So ungefähr ergeht es einem, wenn man versucht in die Geschichte seiner Vorfahren einzutauchen. Ein wildes Herumstochern im Nebel bringt einen nicht voran. Wie und woran kann man sich orientieren, um tatsächlich sein Ziel zu erreichen? Oft helfen einem bei der Orientierung die aufgemalten Seitenmarkierungen auf der Fahrbahn oder die dort aufgestellten Baken im Abstand von 25 Metern mit eingebrachten Reflektoren. Mit Nebelscheinwerfern am Fahrzeug hat man das Gefühl, die helfen einem auch nicht wirklich weiter und schaffen nicht die gewünschte Weitsicht, schon gar keinen Durchblick in der Nebelwand.
Im übertragenen Sinne ist Ahnenforschung so, als würde man seinen Weg suchen, „durch den Nebel der Generationen“. Nur bei diesem Weg sind die aufgemalten Linien vielleicht schon vorhandene Stammbäume oder Ahnentafeln, an denen man sich orientieren kann. Die Baken könnten alte Dokumente oder Urkunden sein, die uns auf unserem Weg weiter voran bringen und die Reflektoren, die einem durch unsere Scheinwerfer der Geduld entgegen leuchten, könnten die Freude sein, die man empfindet, wenn man in einem Archiv doch noch ein Dokument seiner Vorfahren entdeckte!
Zusätzlich hatte man eine Fülle von Geschichten und Erzählungen der Familie im Kopf, die man im Laufe seines Lebens gehört hatte. Aber wie und wem konnte man sie richtig zuordnen. Wer war denn bloß der „alte Heidinger“? Ich würde ihm ähnlich sehen, hatte mein Bruder Dieter schon vor vielen Jahren aufgebracht, keiner in der gegenwärtigen Familie hätte so eine Nase wie ich! Wahrscheinlich hatte er das nur so gesagt, um seinen kleinen Bruder etwas zu ärgern. Und damit hatte er auch Erfolg, denn der kleine Thomi zog wütend ab in sein Kinderzimmer.
Heute weiß ich, wie der alte Heidinger in die Geschichte unserer Vorfahren einzuordnen ist. So entwickelte man Schritt für Schritt ein Bild der Familie, gleichsam eines Puzzles, welches immer mehr, durch richtiges Einlegen der einzelnen Teile, sich zu einem Ganzen zusammenfügte. Aber dazu brauchte es fast ein ganzes Leben. Und man ist nie wirklich am Ende, denn hier und da fehlen immer noch verschiedene Puzzleteile. Und dann kam der Zeitpunkt, wo plötzlich deine Enkelkinder über dich herfallen und von dir etwas über die Familiengeschichte erzählt haben wollten! Und das war dann ein Gefühl, als würde die Sonne plötzlich hinter dem Nebel hindurchbrechen!
„War mein Urgroßvater Russe oder Jude? Wieso wurde er in Baku, in Russland geboren? Und ist Baku nicht heute die Hauptstadt von Aserbaidschan? Und wieso ist er dann in Haifa, in Israel aufgewachsen?“ Fragen über Fragen stellte mir mein Enkelsohn, Maximilian. Meine Antwort: „Mein Vater war weder Russe noch Jude.“
Aber das schien ihn nicht wirklich zufrieden zu stellen, ich las es an seinen Augen ab. „Und wieso hatte er dann schließlich in Berlin gelebt? Wie ist er dann hierhergekommen?“
Ja, wie kann man eine lange Geschichte von fast 400 Jahren, der Familie Engelhardt, so erzählen, dass ein junger, heranwachsender Mensch nicht die Lust verliert, überhaupt noch zuzuhören? Können die jungen Leute überhaupt noch zuhören? Heute muss alles schnell gehen, sonst wird es langweilig! Schnell umschalten, wegdrücken; nur höchstens kurze Texte lesen, in Facebook, Twitter oder WhatsApp, das muss reichen!
Wenn sich früher die Familie traf, zu irgendwelchen Geburts- oder Feiertagen, dann hatten wir Kinder am Tisch zu bleiben und still zuzuhören. Das kennt man ja noch: „Kinder haben nur zu reden, wenn sie gefragt werden!“ Es war dann üblich, dass die Alten anfingen ihre Geschichten zu erzählen. Auch wenn es anfänglich noch ganz interessant war und man gespannt zugehört hatte, war man spätestens nach einer Stunde als Kind wohl doch überfordert und rutschte auf seinem Stuhl gelangweilt hin und her. Der gestrenge Blick meines Vaters hatte mich schon getroffen. Wie kam man hier nur raus, schnellstens weg vom Tisch? Was in so einer Situation immer hilft, ist die Aussage: „Ich muss mal zur Toilette!“ Wohlwollendes Kopfnicken signalisierte mir die „Freiheit“, die ich jetzt brauchte. Der Gang zur Toilette war eher Formsache; aber einmal kurz den Keramikgriff an der langen Kette herunterziehen, um die Wasserspülung in Gang zu setzen, musste schon sein, um dann ganz schnell in meinem Kinderzimmer zu verschwinden.
Ich wurde meistens erst wieder gerufen, wenn der Besuch sich verabschieden wollte. Ich hasste dieses Zeremoniell: Da musste man die „schöne“ Hand geben oder irgendwelchen „Tanten“, die man kaum kannte, umarmen oder gar einen Kuss auf die Wange drücken!
Und es kam dann von meinem Vater der „Spruch des Abends“: „Thomas, mach jetzt Kratzfuß und sach jute Nacht“, natürlich mit rollendem R, ganz nach dem baltischen Zungenschlag unserer Großtante Inge.
Ingeborg Lilienblum war im Baltikum, in Kurland, dem heutigen Lettland geboren worden, genau wie ihre Mutter und mein Großvater. Tante Inge lebte damals mit ihrem Sohn Werner und ihrer Mutter, für uns Tante Grete, in Marburg an der Lahn.
Nachdem mein Vater 1957 seinen Führerschein gemacht hatte und sich einen Ford, einen dunkelblauen „Buckeltaunus“ gekauft hatte; noch mit ovalem Heckfenster, mit an der Seite herausklappenden, beleuchteten Winkern und nach vorne öffnenden Türen, waren wir öfter dort in Marburg zu Besuch. Und so sah der Buckeltaunus damals aus:
Und Tante Inge hatte dann diesen Satz geprägt, der von da ab meine Geschwister und mich fast täglich begleitete, wenn es darum ging, dass wir von der „Bildfläche“ und ins Bett zu verschwinden hatten.
(Hintere Reihe, v. links n. rechts: Elfriede Engelhardt, Margarethe Lilienblum, geb. Engelhardt (Tante Grete), Ingrid Engelhardt, Ingeborg Lilienblum (Tante Inge); vordere Reihe: Harald Engelhardt, Thomas Engelhardt, Werner Lilienblum, 1958 am Kaiser-Wilhelm-Turm in Marburg, Lahn)(Foto:TE)
Für mich als Kind damals, selbst in späteren Jahren, war es nicht möglich, die vielen Geschichten und Personen irgendwie richtig einzuordnen. Selbst wenn man es immer wieder hörte, wer mit wem verwandt war und wann und wo sie gelebt hatten. Einen systematischen Überblick habe ich mir erst jetzt im Alter verschaffen können, über die verschiedenen Lebenswege und dazugehörigen Episoden unserer Vorfahren. Eine große Hilfe dabei waren die bereits vorliegenden Stammbäume und Ahnentafeln, die schon vor Jahrzehnten von den Lilienblums in Marburg entwickelt wurden. Mein Groß-Cousin, Dr. Werner Lilienblum, der heute in der Nähe von Hannover wohnt, hat sie mir dankenswerterweise zugänglich gemacht und stand mir auch am Telefon mit Rat und Tat zur Seite. Aber auch von meinem Vater hatte ich nach seinem Tod 1996 eine ganze Menge an Unterlagen zum Thema geerbt. Denn in der Hitlerzeit hatte er Ahnenforschung betreiben müssen, um den Nachweis zu erbringen, dass nirgendwo „unreines Blut“ in die Familie eingeflossen war. Diese dunkelste Zeit der deutschen Geschichte wurde fast gleichzeitig mit der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933 mit dem sogenannten „Arierparagraphen“ eingeleitet. Ziel dieses Gesetzes war es hauptsächlich, jüdische Bürger aus dem Berufsleben zu entfernen. Wer zukünftig einen Beruf ausüben wollte, musste darum einen Abstammungsnachweis erbringen. Spätestens seit 1935 und den Nürnberger Gesetzen galt dieser Paragraph für alle Bürger in Nazideutschland. Mit diesem Gesetz wurden die Juden vom Nazi-Regime zu Bürgern minderen Rechts degradiert. „Zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“, verbot es Eheschließungen zwischen Juden und „Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes“, auf der Grundlage des „Ariernachweises“.
Dieser „Ariernachweis“ bestand aus Heirats-, Geburts- oder Sterbeurkunde, die offiziell beglaubigt werden mussten. Um eine arische Herkunft einwandfrei zu beweisen, mussten die Urkunden mindestens bis zu den Großeltern, besser noch bis 1800 zurückführen.
„Lieber Max, wo diese ganze Geschichte schließlich hinführte, weißt du nur zu genau, denn du hast dich ja mit Hitler in deiner Facharbeit, auf der gymnasialen Oberstufe, lange beschäftigt. Ich habe diesen Teil der Geschichte gleich mal an den Anfang gesetzt, weil wir gegenwärtig wieder konfrontiert werden mit Rufen nach: „Deutschland den Deutschen!“ und nach meinem Geschmack viel zu viele Menschen dazu Beifall klatschen!
Wir können froh und dankbar sein, dass wir hier in Deutschland, seit Ende des zweiten Weltkrieges, mehr als 70 Jahre Frieden hatten. Du Max, genau wie ich, haben bisher nie Verfolgung oder Bombenhagel kennengelernt! Aber die Generationen vor uns haben ständig in der Angst gelebt, dass neue Kriege, Gewalt, Verfolgung, Hunger und Krankheit über sie hereinbrechen.
Nun, unsere Vorfahren, die Engelhardts, haben um 1620 herum im Salzburger Land gelebt. So hat man es jedenfalls von einer Generation zur nächsten weitererzählt. Die Ursachen, warum Menschen damals Salzburg und das Salzburger Land verlassen mussten, lag an den Folgen des Augsburger Religionsfriedens von 1555 und des Westfälischen Friedens von 1648:
„Wes das Land, des die Religion!“
Der Landesherr entschied also, welchen Glauben seine Untertanen führen durften. Hiernach konnten Untertanen, die nicht der Konfession des Landesherren folgen wollten, in Begleitung ihrer Familien und unter Mitnahme ihres Eigentums auswandern. So blieb vielen Menschen damals nur die Flucht aus ihrem Heimatland, um einem erzwungenen Konfessionswechsel auszuweichen.
Unsere Vorfahren waren offensichtlich lutherische Protestanten, die davon gehört hatten, dass man in Hessen und in Preußen protestantische Emigranten aufnehmen würde, denn Salzburg blieb römisch-katholisch. Maximilian, das ist so ein Bereich unserer Familiengeschichte, wo die Ahnenforschung bisher nicht so recht weitergekommen ist; da könntest du mal weiter daran arbeiten, falls du Lust dazu haben solltest. Deshalb befinden wir uns um 1600, also vor rund 400 Jahren, mit unserer Geschichte der Familie Engelhardt, im Bereich der Spekulation! Bisher konnte ich den Namen Engelhardt auf keiner Emigrationsliste von Salzburg oder dem Salzburger Land finden; und doch hat sich durch die Generationen der Familie diese Legende erhalten.
Sie führte die Engelhardts schließlich in das Fürstentum Waldeck-Pyrmont, in ein kleines Dorf, namens Külte, ungefähr sieben Kilometer von Bad Arolsen entfernt, nord-westlich von Kassel gelegen.
Erste Aufzeichnungen des Namens: Engelhardt, findet man im Ortssippenbuch von Külte, erstmals im Jahre 1660, wie mir der Ortschronist, Dirk Wagner, bestätigte. Aber ob dieser Engelhardt oder alle anderen nachfolgenden Engelhardts im Ortssippenbuch sich tatsächlich unserer Familie irgendwie zuordnen lassen, ist leider bisher noch nicht nachgewiesen.
Deshalb beginne ich mit dem ersten „gesicherten“ Vertreter unserer Familie: Friedrich Johann Wilhelm Engelhardt, geboren am 9. Juli 1777, in Arolsen. Von da an sind alle folgenden Generationen der Engelhardts, bis zum heutigen Tage, durch diverse Dokumente abgesichert.
Aber lassen wir Friedrich Engelhardt und alle weiteren männlichen Vertreter unserer Familie, in direkter Linie bis auf mich heute mal „selbst erzählen“, von den Episoden und Legenden, die sich von einer Generation zur nächsten bis jetzt erhalten haben:“
2. Kapitel
Die erste Generation:
Friedrich Johann Wilhelm Engelhardt
Geboren: 9. Juli 1777, in Arolsen, Fürstentum Waldeck-Pyrmont Gestorben: 23. April 1840, auf Schloss Ludwigslust, Mecklenburg
Friedrich Engelhardt (Foto von Radierung/TE)
„Wenn ich uns so anschaue, liebe Friederike, sind wir beide wirklich alt geworden. Und doch sind wir in unseren Herzen noch jung geblieben. Die Begleitung unserer Kinder hat uns in all den Jahren einigermaßen frisch erhalten, zumindest geistig.“
Ich frage mich an der Schwelle meines eigenen Lebens, bin ich wirklich der Ehemann und Vater gewesen, den sich meine geliebte Rieke erhofft und auch verdient hatte? Was mussten wir uns beide erkämpfen damals in Weimar, als wir uns per Zufall kennenlernten?
Die Französische Sprache, die ich schon in meinem Geburtsort Arolsen in frühen Jahren bei meinem alten Lehrer erlernte, war im Grunde der Ausgangspunkt unseres Schicksals. Lehrer Meier, „mit Ei“, sagten wir Kinder untereinander immer; predigte uns regelmäßig: „Französisch sei die Sprache der Gelehrten und des Adels. Es gäbe in Deutschland kein Fürstenhaus, in dem nicht Französisch gesprochen würde! Wer im Leben weiterkommen möchte, der sollte sie gründlich erlernen!“
Dass mir diese Sprache in meinem Leben tatsächlich einmal so nützlich sein würde, konnte ich als Schüler noch nicht erahnen. Sie hatte mein berufliches Vorankommen später ganz wesentlich bestimmt; und nicht ganz unwichtig, auch mein persönliches Glück beflügelt!
Ich hatte mein Elternhaus verlassen und war hinüber gereist ins Thüringische Weimar, hatte am dortigen Hofe eine Anstellung erhalten.
Bei einem Abendspaziergang in Weimar wurde ich plötzlich Zeuge, wie sich einige französische Soldaten über ein junges Mädchen hermachten. Mein Einwand in französischer Sprache, ob sie sich nicht schämen würden, dieses Mädchen so in Angst und Schrecken zu versetzen, verblüffte die Soldaten so sehr, dass sie augenblicklich von ihr abließen und wirklich verschwanden!
Da stand ich nun, als der große Retter, oder sollte ich eher, als der große „Ritter“ sagen, der alle „Feinde“ in die Flucht geschlagen hatte? Wir trafen uns natürlich wieder, an einem der nachfolgenden Tage, und ich freute mich darauf, sie bei einer Tasse Tee wieder zu sehen. Sie kam tatsächlich und ich erfuhr auch bald ihren Namen, Friederike Sophie Hartmann. Eigentlich käme sie ja aus Gotha, aber sie lebe jetzt hier in Weimar und diente bei verschiedenen Herrschaften als Haus- und Kindermädchen. Wohnen würde sie aber im Hause Bertuch, wo ja ihr Onkel und ihre Tante eine erfolgreiche Manufaktur für Kunstblumen führten. Ich erfuhr auch, dass ihre Mutter, eine geborene Bertuch sei.
Ich dagegen wohnte in einem runtergekommenen Palais, unweit des Schlosses in Weimar, teilte mir ein Gesindezimmer mit einem Lakaien. Ich selber hatte eine Anstellung als Schreibgehilfe am herzoglichen Hof erhalten und fristete mein Dasein für ein paar Groschen, in einer recht dunklen Schreibstube, unter der Aufsicht des Oberschreibers, der sich wohl selber für den Herzog höchst persönlich hielt und auch so auftrat. Ich nannte ihn aber heimlich „Napoleon“, zumal er davon ausging, nur er könne ordentlich Französisch sprechen: „Quelle erreur!“ Natürlich war es ausgerechnet „Napoleon“, der mich als erster auf meine amouröse Liaison mit Mademoiselle Friederike Sophie Hartmann ansprach! Ich würde den Ruf meines Dienstherrn und des ganzen Hauses schädigen, wenn ich nicht sofort von ihr abließe; zumal sie zuweilen im Hause Schiller als Kindermädchen verkehre und zudem auch die Tochter des sehr geschätzten herzoglichen Kanzleisekretärs Anton Hartmann am Hofe in Gotha sei!
So blieb mir in dieser heiklen Situation kaum etwas anderes übrig, als entweder auf meine geliebte Rieke zu verzichten oder aber nach Gotha zu reisen und bei ihren Eltern um die Hand ihrer Tochter anzuhalten. Letzteres tat ich schon einige Zeit später. Für mich war es alles andere als einfach, diesen gestandenen Eheleuten in Gotha gegenüber zu treten. Wer war ich denn schon, dieser junge, unerfahrene „Schreiberling“, Friedrich Engelhardt, aus einem kleinen Dorf Külte bei Arolsen? Was hatte ich als zukünftiger Ehemann überhaupt zu bieten?
Ein paar Kreuzer als Ersparnisse und eine Anstellung als Hilfsschreiber, am unterersten Ende meines beruflichen Werdegangs. Meine Eltern in Külte hatten zwar ihr Auskommen. Vater war dort Schmiedemeister, hatte aber immer zu kämpfen, schließlich galt er unter den Einheimischen als Zugereister und somit irgendwie als Außenseiter. Er war ein Nachfahre von protestantischen Flüchtlingen aus dem Salzburger Land; denn mein Urgroßvater hatte nach 1660 im Fürstentum Waldeck Land erworben und sich niedergelassen. Umso mehr war ich überrascht, wie herzlich und zugewandt ich von meinen zukünftigen Schwiegereltern in Gotha empfangen wurde! Rieke hatte offensichtlich ihren Eltern schon ihr Herz ausgeschüttet und ihnen ihre Liebe zu mir ausführlich mitgeteilt; wie sie es mir gegenüber noch nie geäußert hatte! Welche angenehme Überraschung! So wurde ich in Gotha als „großer Held“ gefeiert und eine alsbaldige Eheschließung ins Auge gefasst.
Als ich in der kommenden Woche wieder in meiner Schreibstube saß, unter der strengen Aufsicht von „Napoleon“, kamen mir allerdings Zweifel, ob ich in diesen turbulenten Zeiten in diesem Lande wirklich das Richtige tat. Tausende von französischen Soldaten waren in Weimar untergebracht und mussten versorgt werden; als Folge der Doppelschlacht von 1806, um Jena und Auerstedt. Fortan kämpfte das sächsisch-weimarische Heer von Herzog Carl August nicht mehr für die Preußen, sondern war Teil Napoleon Bonapartes Grande Armee. Wie würde unsere Zukunft in dieser politisch schwierigen Lage aussehen können? Welches Schicksal würde uns zuteilwerden? Weitere Kriegswirren, mit weiterem wirtschaftlichem Niedergang? Wie sollte ich dann meine Frau, meine Familie ernähren und durchbringen können?
Diese düsteren Gedanken verflogen ein wenig, als ich in eine neue Position gelangte. War es ausgerechnet mein Vorgesetzter „Napoleon“, der ein gutes Wort für mich eingelegt hatte, oder war es doch mein Schwiegervater in spe, der seine guten Beziehungen nach Weimar eingesetzt hatte? Ich reucierte jedenfalls zur Dienerschaft der Prinzessin Karoline von Sachsen-Weimar-Eisenach! Was für eine Veränderung, die sich vor allem finanziell und auch wohnungsmäßig auswirkte.
Ich hatte bis dahin eigentlich keine besondere Beziehung zu Kirche und Glauben. Natürlich waren wir getauft und sogar konfirmiert. Aber das sollte sich grundlegend ändern, als ich das erste Mal mit dem Pfarrer der lutherischen Kirche in Weimar in Kontakt kam, um unsere Trauung vorzubereiten. Seine offene und freundliche Art machte uns beiden Mut, genau das in diesen Tagen der Mutlosigkeit zu tun, nach vorne zu schauen im Vertrauen auf Gott; er sei der Inbegriff der Liebe zu uns Menschen! Und so gaben wir uns schließlich glücklich das Jawort, am 1. September 1807, in Weimar.
Wir bekamen auf Grund unserer Eheschließung sogar zwei Zimmer im Schloss und durften die angrenzende Gesindeküche mitbenutzen, was für uns ein besonderer Glücksfall war. Denn in der Küche war stets und ständig Feuer im Herd und das brachte in unser angrenzendes Schlafgemach immer etwas Wärme; besonders wertvoll in den kalten Wintermonaten, als sich schon ein Jahr später Nachwuchs anmeldete, unser Erstgeborener, August Heinrich, der 1808 das Licht der Welt erblickte. Dann kam im Januar 1810 unser zweiter Sohn, Hermann Carl zur Welt, ebenfalls noch in Weimar. Daran kann ich mich noch besonders gut erinnern, denn es war kurz vor der großen Hochzeit von meiner Dienstherrin, Prinzessin Karoline mit dem Erbprinzen Friedrich Ludwig und späteren Erbgroßherzog von Mecklenburg-Schwerin! Zu diesem Zeitpunkt konnten wir noch nicht ahnen, dass diese Verbindung zwischen Karoline und Friedrich Ludwig, auch für uns als kleine Familie, dramatische Veränderungen nach sich zogen.
Natürlich nahm der Erbprinz seine Prinzessin mit hinauf nach Mecklenburg, auf sein Schloss nach Ludwigslust; und wir als untergebene und ergebene Dienerschaft mussten mit. So einfach war das damals! Wir waren ja auch bereit mitzugehen, ohne zu wissen, was dabei auf uns zukommen würde! Unsere Eltern und unsere Familien zu Hause, die würden wir wohl in diesem Leben nicht mehr wiedersehen, das war uns schon klar. Zu weit weg lag Arolsen oder Gotha von Ludwigslust und Schwerin. Dass diese Reise für uns selbst dorthin so anstrengend und so lang werden würde, hätten wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Für das Privileg auf herzoglichen Pferdefuhrwerken reisen zu dürfen, hatte die Dienerschaft dafür zu sorgen, dass die herzogliche Ladung auf denselben auch gut und wohlbehalten nach Schloss Ludwigslust gelangte! Allein wie oft wir stecken geblieben waren, in unwegsamen Gebieten, und uns undurchdringliche Wälder zu langen Umwegen zwangen, oder wir wurden von vagabundierenden, preußischen Soldaten angehalten und ausgefragt, wo wir denn hinwollten? Die Papiere und Passierscheine, die unser oberster Lakai Franz bei sich trug, halfen uns fast jedes Mal weiter. Irgendwo in der Nähe von Stendal hatten wir das Gefühl, jetzt ginge gar nichts mehr. Wir mussten alle fünf Wagen komplett leerräumen, alles hinein in eine Scheune tragen. Sogar die herrschaftlichen Kisten mussten geöffnet und leergeräumt werden. Alles Reden und Vorlegen der entsprechenden Reiseausweise und Passepartouts, vom Herzog selbst unterzeichnet und gesiegelt, beeindruckte die Soldaten diesmal nicht. Erst als Franz darauf bestand, den Vorgesetzten sehen zu wollen, kam Bewegung in die Geschichte. Dennoch verloren wir ganze drei Tage allein an dieser Stelle! Allerdings war es nicht nur für meine Frau und die Kinder eine willkommene Pause und sogar eine rechte Erholung nach den Strapazen der bisherigen Reise, auch ich konnte wieder neue Kräfte sammeln. Wie oft würden wir noch die Fuhrwerke aus morastigem Untergrund heben müssen, um weiter voran zu kommen? Kein Mensch konnte sich vorstellen, wie schlecht Wege und Stege waren in Deutschlands Mitte; und manche redeten vom guten preußischen Pflaster! Aber Berlin und Potsdam waren weit! Ein ewiges auf und ab, ein nach links und nach rechts drehen der Wagen! Eine fast unerträgliche Tortur. Ich lief lieber nebenher, als auf dem Wagen zu sitzen. Dass die Pferde durchgehalten haben, obwohl wir die Pferde auf der gesamten Reise nur zweimal wechseln konnten, grenzte für mich schon an ein Wunder. Nach fast vierzehn Tagen rollten wir in den Hof von Schloss Ludwigslust ein und waren glücklich, endlich wohlbehalten an unserem neuen Wohnort angekommen zu sein. Viele Schlösser hatte ich ja noch nicht gesehen in meinem Leben; nun zu Hause war ja Arolsen ganz schön, dann hatte ich Gotha und natürlich Weimar gesehen und erlebt. Aber jetzt vor diesem imposanten Bauwerk zu stehen, das mein zukünftiger Arbeitsplatz sein sollte, war überwältigend! Man sprach schon vom Versailles des Nordens.
Schloss Ludwigslust / (Foto:TE)
Noch nie hatte ich einen schöneren Spiegelsaal gesehen als hier! Oder was war das für eine Pracht, wenn die Festtafel für die hohen Herrschaften eingedeckt war! Auch wenn solche Tage für die Dienerschaft immer sehr anstrengend waren; allein das zu erleben war schon ein Genuss. Hier war jetzt meine Arbeit, ich hatte hohe Gäste zu bewirten und zu versorgen, sowie ihren Wünschen zu entsprechen, die hier im Hauptflügel des Schlosses, in den Gästezimmern untergebracht waren.
Spiegelsaal, Schloss Ludwigslust (Beide Fotos: TE)





























