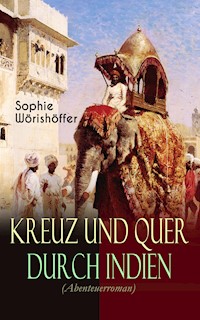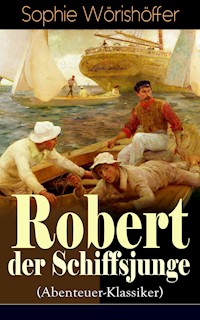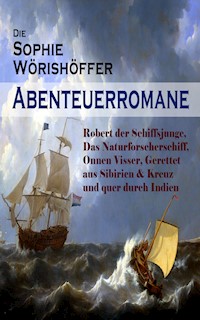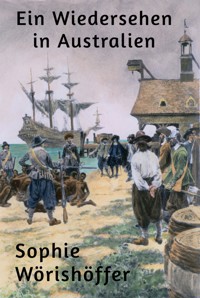2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Durch des 16-jährigen Hans’ Schuld brennt das Haus seiner Eltern nieder, er flüchtet auf See. Sein Schiff sinkt, er gerät mit einem Freund in die Hände von Malaien und Sklavenjägern und dann von Abenteuer zu Abenteuer.
Coverbild: © MSSA / Shutterstock.com
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Durch Urwald und Wüstensand
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenZum Buch + 1. Von Malaien gerettet
Zum Buch
Durch Urwald und Wüstensand
Sophie Wörishöffer
Coverbild: © MSSA / Shutterstock.com
1. Von Maleien gerettet
Auf den Park eines Landhauses an der Alster schienen die letzten Sonnenstrahlen eines Sommerabends. Reichgefüllte Treibhäuser und bunte Beete sprachen für den Wohlstand des Besitzers; alles, bis zu den blauen plätschernden Wellen unten am Gartensaum atmete Schönheit und behagliche Ruhe.
Auf der sorgfältig gemähten Rasenfläche lag ein Junge von etwa sechzehn Jahren mit einer Zigarre zwischen den Lippen und den Händen unter dem Kopf. Sein Gesicht zeigte eine sonderbare Mischung von Ärger und heimlichem Triumph, er sah immer geradeaus und schien an irgendeinen fernliegenden Gegenstand mit besonderem Interesse zu denken.
Hinter ihm befand sich eine Baumgruppe, umgeben von dichtem Gebüsch. Die grüne Wand teilte sich und ein kleiner Junge von etwa neun Jahren kam zum Vorschein. „Hans“, sagte er ängstlich, „du rauchst wieder!“
„Hast du vielleicht Lust, mich zu verraten, Georg?“
„Nein, nein“, versicherte der Kleine. „Ach, Hans, werde nur nicht böse, aber – du musst nicht erschrecken, weißt du –, aber …“
„Der Schuldiener war da“, nickte der ältere Bruder, „ich weiß schon. Er brachte von Studienrat Vogel einen Brief an Papa.“
„Wer hat dir das gesagt?“, rief Georg.
„Mein kleiner Finger“, war die nachlässige Erwiderung.
Hans lachte. „Er ist aber wirklich der reine Vogel, du! Den Namen hat er weg und behält ihn auch, so lange seine Klasse existiert. Wenn er das kleine Gesicht zur Seite legt, den Hals immer in ruckartiger Bewegung, dann gleicht er ums Haar dem Sperling, der eben eine Brotkrume davonträgt. Na, aber – was schreibt er dem Papa?“
„Das weiß ich nicht“, gestand der Kleine. „Ich konnte nur erkennen, dass Tante Lie weinte und dass Papa ein sehr zorniges Gesicht machte. Gewiss hast du wieder einen schlimmen Streich ausgeführt, Hans?“
„Na klar!“
Der kleine Georg rückte näher. „Erzähle doch“, bat er.
„Ja, du“, bekannte Hans, „es war zu köstlich. Ich hatte eine Maus mit in die Klasse gebracht, eingenäht in einen Beutel.“
„Eine lebendige?“, rief Georg.
„Das versteht sich. Während Vogel an den Bänken auf und ab ging, brachte ich ihm geschickt die Maus in die Tasche.“
„Ohne dass er es bemerkte?“
„Im Augenblick, ja. Aber der graue Gefangene sprang und hüpfte, dass des Lehrers Rockschöße schwankten wie ein Schiff auf hoher See; wir grinsten alle, er erkannte bald genug, dass etwas nicht in Ordnung sei, und dann fand er auch den Beutel. Du, es ging ein Lachsturm durch die ganze Klasse!“
„Und es ist herausgekommen, wer die Maus mitgebracht hatte?“
„Ach, weißt du, wir erwarteten, dass er eine lange Rede halten werde. Aber stattdessen kam er gerade auf mich zu und sagte mit dem sanftesten Tone: ,Hans Winkelmann, sieh mich einmal an! Hast du dieses Tier hier in die Klasse gebracht? Antworte offen und ehrlich!‘ – Nun, ich konnte ihm doch nicht ins Gesicht lügen. Das hätte Folgen für die ganze Klasse haben. können. So gab ich alles zu.“
In der Unterhaltung der beiden entstand eine Pause, endlich nahm Georg seinen Roller und wollte sich entfernen. „Gewiss steht die ganze Geschichte in dem Brief“, sagte er. „Papa wird sehr böse sein.“
Der ältere Bruder zuckte die Achseln. „Solch ein Donnerwetter rauscht vorüber“, versetzte er. „Wenn man es Vätern und Lehrern immer recht machen wollte, so müsste man ein wahrer Duckmäuser werden.“
„Aber das verstehst du nicht, Georg“, fügte er dann hinzu, „Weißt du was, ich habe einen Gedanken!“
„Einen neuen Spaß?“, fragte der Kleine.
„Natürlich. Sagtest du nicht, dass Papa und Tante Lie im Garten sind?“
„Ja, unten bei den Schwänen.“
„Nun gut, dann locken wir Tyras, ziehen ihm einen Morgenrock der Tante an, setzen ihm ihre Nachtmütze auf und legen ihn in ihr Bett. Er ist gehorsam; solange ihn niemand ruft, bleibt er ruhig unter der Decke.“
Georg lachte. Er sprang fort und kam schon nach wenigen Minuten in Begleitung eines großen schwarzen Pudels zurück.
„Geh mit, Tyras“, flüsterte Hans, „ganz still, mein Hund.“
Die drei schlichen durch eine Hintertür in das Haus und die Treppen hinauf, bis in ein Zimmer, dessen Fenster weit offen standen. Ein großes Bett nahm die Ecke ein, dicht davor stand ein Schrank, dessen Schlüssel im Schloss steckte. Hans nahm rasch einige Kleidungsstücke der alten Tante heraus, dann ließ er den Pudel sitzen und zog ihn an. Unter Georgs Beihilfe wurde der Hund in das Bett geschafft, bis an die Ohren zugedeckt und leise zur Ruhe gemahnt. „Kusch, Tyras, kusch, mein Bester!“
Nur die glänzenden schwarzen Augen funkelten unter der Nachtmütze hervor, die langen Ohren bewegten sich hin und her, sonst lag der Pudel mäuschenstill und blieb auch regungslos hingestreckt, als sich die Jungen entfernten.
Hans rieb sich die Hände. Er hatte den Brief seines beleidigten Lehrers jetzt schon vollkommen vergessen, ebenso die bevorstehende Strafpredigt des Vaters; ihm ging die Lust an Torheiten, am Lachen über alles. Wie sehr die Tante erschrecken würde, das war es, woran er einzig und allein dachte.
Die beiden jungen Sünder versteckten sich im Garten unter den Fenstern. Nach einer Weile trat Tante Lie in die Haustür und spähte durch das Dunkel des Abends nach allen Seiten. „Tyras! Tyras!“, lockte sie den Pudel.
Ein Fall und der laute Schreckensschrei eines Hundes wurden zugleich gehört, daneben das Klirren zerbrechenden Glases und ein Schlag, der wie ein Kanonenschoß die Stille der Umgebung durchbrach. Aus den offenen Fenstern fuhr eine blaue Flamme, es knisterte und zischte, Rauch wallte auf – das ganze Zimmer brannte lichterloh.
Die Tante schrie, ebenso das Dienstmädchen – mit blassen Gesichtern sahen sich in ihrem Versteck die beiden Knaben einander an.
„Tyras hat die Lampe umgerissen!“ flüsterte Georg. „Ach, Hans, das ganze Haus wird in Flammen aufgehen!“
„Still!“, gebot der ältere Bruder. „Mach, dass du fortkommst, Georg, ich will die Verantwortung allein tragen. Geh! Geh!“
Hans brauchte sich nicht um das brennende Haus zu kümmern, denn von allen Seiten kamen Leute mit Rettungsgeräten herbei; und Herr Winkelmann bemühte sich, zunächst seine angstvoll schreiende Schwester zu beruhigen.
Auch die nebenliegenden Zimmer waren jetzt von den Flammen schon ergriffen, und an einzelnen Stellen begann der Fußboden zu sinken. Wenigstens zwanzig Männer arbeiteten, während der Hausherr durch Rauch und Flammen in das Wohnzimmer eilte, um mehrere Gegenstände selbst in Sicherheit zu bringen.
Aus der Ecke hervor drang ein schwaches Winseln, und als Herr Winkelmann aufhorchend den Namen des Hundes rief, da schleppte sich ein formloses Etwas vor seine Füße und blieb dort leise heulend und klagend auf dem Teppich liegen. Voll Erstaunen bückte sich der Kaufmann, um den seltsamen Gegenstand zu untersuchen, sein schneller Befehl brachte einen Feuerwehrmann mit der Laterne herbei, und nun zeigte sich Tyras in der Nachtmütze und dem Kleide der Tante, aber arg verbrannt, blutend und von versengten Fetzen und Haaren bedeckt. Das arme Tier leckte die Hand seines Herrn, aber es schien dabei vor Schmerz kaum den Kopf erheben zu können; die Ohren waren ziemlich angesengt.
„Schnell, Herr!“, rief der Feuerwehrmann. „Um des Himmels willen, schnell – die Decke stürzt ein!“
Er ergriff den Hund, und beide Männer trugen ihn hinaus auf das kühle Gras, wo Herr Winkelmann vorsichtig die Überreste des Rockes und der Mütze von dem verbrannten Fleisch ablöste. Hans sah alles aus nächster Nähe mit an.
„Lie!“, rief Herr Winkelmann, „komm hierher und sieh den armen Tyras an. Ich kann mir jetzt den ganzen Vorgang erklären – es ist wieder Hans, der das ganze Unglück ins Haus brachte, aber bei Gott, diesmal soll er mich kennen lernen. Ich schicke den Burschen in eine Erziehungsanstalt!“
Hans hatte jedes Wort gehört, er zog sich unwillkürlich tiefer in das Gebüsch zurück, sein Herz schlug schneller, und seine Lippen zuckten. In eine Erziehungsanstalt sollte er gebracht werden?
„Wo steckt überhaupt der Bursche?“, rief Herr Winkelmann. „Hat ihn jemand gesehen?“
Von den Anwesenden konnte keiner Auskunft geben, aber Herr Winkelmann schien darauf nur wenig Gewicht zu legen. „Der Taugenichts wird sich schon melden“, sagte er, „wahrhaftig, diesmal soll ihm der Übermut vergehen.“
„Was hat der Hund?“, fragte jemand. „Es sieht aus, als wolle er in das Gebüsch hineinkriechen – ob vielleicht sein Herr darin steckt?“
„Hans!“, schrie mit lauter Stimme Herr Winkelmann.
Der Knabe hütete sich, zu antworten, er verschwand in dem allgemeinen Getöse und gelangte dann im Dunkel des Abends bald in eine andere Straße, die ihn zum Dammtor führte und von dort in die Stadt hinein. Jetzt war sein Entschluss gefasst – er wollte mit dem nächsten Schiff in die Welt hinausgehen und es versuchen, sich auf eigene Faust durchzuschlagen.
Der Gedanke an die Erziehungsanstalt lief wie Feuer durch alle seine Adern – eher in den Tod als in solche Demütigung, das nahm er sich vor.
Mit wenig Geld in der Tasche und sonst nur mit dem leichten Sommeranzug und einer kleinen goldnen Uhr versehen, lief er in den Hafen und schaute auf das Wasser hinaus. Am Kai neben der Brücke lagerte eine große Schar von Auswanderern, die sämtlich mit ihrem Gepäck an Bord eines Dampfers befördert wurden, etwa um drei Uhr nachts, zur Zeit der eintretenden Flut, sollte das Schiff unter Segel gehen und seine Reise beginnen.
Verschiedene Kajütenpassagiere kamen in Droschken herbei, während die Masse derer, welche im Zwischendeck reisen sollten, familienweise über die Brücke wanderte und im bunten Durcheinander an Bord gelangte. Einer größeren Gruppe schloss sich Hans an, er stand bald auf dem Verdeck und beobachtete das Verpacken der Gepäckstücke, ohne von irgendeinem Menschen bemerkt zu werden. Überall weinten Freunde und Verwandte im Schmerz der Abschiedsstunde, überall hörte man Tröstungen und Versprechungen.
Von seinem letzten Geld hatte Hans unterwegs Brot, Fleisch und eine kleine Flasche Likör gekauft; jetzt galt es nur noch, im Bauche des Schiffes ein Versteck zu finden und bis hinter England darin unbemerkt zu bleiben – dann war er seiner Meinung nach geborgen.
Er drängte sich durch bis zur Leiter, an der verschiedene junge Leute hinab und herauf kletterten.
Noch ein letzter Blick zum Land hinüber, ein letzter tiefer Atemzug in freier Luft, dann stieg er hinab.
Unter dem Zwischendeck lag der Raum. Eine Öllampe schaukelte qualmend an der Decke, bis auf einen schmalen Weg türmten sich, zu beiden Seiten, mit Ketten und Seilen gehalten, die Besitztümer der Passagiere.
Er fand eine Ecke, die durch mehrere umfangreiche Kisten vor neugierigen Blicken hinlänglich geschützt war. Hier lagen Säcke mit weichem Inhalt, auf denen sich’s zur Not ganz gut schlafen ließ; nur Licht gab es natürlich nicht, weil der Raum tief unter der Oberfläche des Wassers lag. Hans rückte und schob sich die Gegenstände, so gut es ging, zurecht.
Über ihm krachten die Bretter unter den Fußtritten der hin und her gehenden Menschen. Noch einige letzte Kolli flogen hinab in den Raum, dann schlossen sich die Luken. „Fremde vorn Bord!“ hieß es; das Schluchzen und Wehklagen wurde lauter, stärker, dann erstarb es allmählich und machte einer beängstigenden Stille Platz. Mehrere Polizisten gingen von Gruppe zu Gruppe und prüften die Reisepässe.
Auch in den Laderaum wurde hineingesehen. „Ist noch jemand da unten?“, rief eine Stimme.
Oben wurden die Landungsbrücken eingezogen, es ertönten Fahrt-Signale, und die Maschinen begannen ihre Arbeit. Leb wohl, Hamburg – leb wohl!
Ein seltsames Gefühl war es doch, so ganz allein da unten in der Finsternis. Wie Blei drückte die heiße Luft, wie ein Hammer schlug das Herz in der Brust. Ein Glück nur, dass die Seekrankheit Hans nichts anhaben konnte – er war bereits zweimal mit dem Vater in England gewesen und hatte keine Übelkeit gespürt, es würde also sicherlich auch jetzt gut abgehen –, nur der Durst fing an, sich fühlbar zu machen.
Hans trank etwas von seinem Likör, dann suchte er zu schlafen. Welche Finsternis, welch drückende Luft.
Lange Stunden vergingen noch, bevor die Sonne wieder am Himmel erschien und auf dem Schiff das Leben des neuen Tages begann. Die Wellen gingen jetzt höher, man hatte Cuxhaven passiert und befand sich in der Nordsee.
Hans aß fast seinen gesamten Vorrat von Brot zum Frühstück. Was für mindestens drei Tage ausreichen sollte, das verschwand schon heute bis auf einen kleinen Rest.
Der Durst war so groß, dass er gegen Mittag den Hunger schon vollständig verdrängt hatte. Hans untersuchte die Säcke und Kisten, er hoffte etwas Genießbares zu finden, aber vergeblich.
Mittags drangen die verlockenden Düfte aus der Küche hinab in sein Gefängnis.
Noch bis zum Abend hielt er es aus, dann hatte ihn eine Art von Fieber ergriffen.
Mitten in der Nacht schleppte er eine Kiste bis unter die Luke, stemmte die Kräfte seiner Schultern gegen das eisenbeschlagene Holz und hob es so ziemlich leicht empor. Noch ein Schwung, dann lag die Luke am Boden, und Hans stand auf der obersten Sprosse der Leiter, um sich den frischen Seewind über die Stirn wehen, zu lassen.
Eine herrliche Kühle – er dachte im Augenblick an nichts anderes. Die Wellen hüpften und tanzten, der Mond schien hell auf das Schiff herab.
Aber der Anblick des Meeres schärfte den Durst; Hans sah umher, ob nicht irgendwo Wasser zu entdecken sei. Drüben in der Küche lagen ein paar Wasserbehälter, die eisernen Schöpfer hingen daran – sollte er es wagen, sich einen Vorrat für die nächsten Tage zu verschaffen? Vielleicht waren auch ein Brot, etwas Fleisch oder einige Früchte aufzutreiben.
Mit einigen Schritten näherte er sich den Fässern, tauchte die Schöpfkelle in das kalte Wasser und trank wie ein Mensch, der länger als vierundzwanzig Stunden gefastet hat.
Als er das Gefäß absetzte, sahen zwei Augen erstaunt in die seinen. „Na“, fragte die Stimme eines jungen Menschen von etwa siebzehn Jahren, „wo kommst denn du her?“
Hans erschrak. „Still!“, flüsterte er, „verrate mich nicht!“
„Gehörst du zu den Zwischendeckpassagieren?“
Hans sah ihn an. „Bist du auch ein Hamburger?“
„Gewiss!“
„Kannst du schweigen?“
Der andere hatte schon die offene Luke gesehen. „Ein blinder Passagier, nicht wahr? – Vor mir bist du sicher.“
Hans reichte ihm plötzlich die Hand. „Kannst du mir so viel Wasser verschaffen, wie ich brauche, bis wir England passiert haben? Und vielleicht auch etwas Brot? – Aber mit dem Wasser halte ich es zur Not schon aus.“
Der andere nickte. „Du kannst zu essen und zu trinken bekommen“, sagte er. „Ich bin Kajütenjunge und habe Gelegenheit genug, dir dies oder das beiseite zu bringen. Willst du denn auf hoher See zum Vorschein kommen?“
Hans lachte. „Nun natürlich“, versetzte er. „Ich kann dir sagen, dass der Aufenthalt da unten seine Schattenseiten hat.“
Der Schiffsjunge wiegte den Kopf. „Unser Kapitän lässt dich bestimmt bestrafen“, sagte er nach einer Pause.
Hans schnippte mit den Fingern. „Ich werde in Amerika schon ebenso glücklich an Land kommen, wie ich in Hamburg an Bord kam“, sagte er leichthin. „Where is a will, there is a way, wie du weißt, mein Lieber.“
Der Kajütenjunge schien sehr erstaunt. „Vorläufig geht das Schiff keineswegs nach Amerika“, versetzte er, „sondern nach Van Diemensland!“
„Australien!“, rief Hans. „Dann wird man Schafhirte!“
In diesem Augenblick erklangen Schritte an Deck, die Wache wurde abgelöst, und Hans musste schleunigst in sein Versteck flüchten, um nicht vom zweiten Steuermann, entdeckt zu werden. Die Hand seines neuen Freundes reichte ihm späterhin ein größeres Gefäß mit Wasser, Schiffszwieback und ein tüchtiges Stück Braten in sein Versteck hinein.
Nun war ihm geholfen, er schlief bis an den hellen Morgen und verbrachte auch den Tag ohne größere Beschwerden; in der nächsten Nacht folgten dann neue Vorräte des Kajütenjungen und zugleich die Mitteilung, dass der Kanal erreicht sei. „Morgen Abend haben wir England im Rücken“, hieß es.
„Und das Schiff legt nicht an?“
„Nein!“
„Wie heißt denn der Hafenplatz, den wir aufsuchen? Ich muss es wissen!“
„Weil du dir ein Märchen ausdenken willst, nicht wahr? Der Ort heißt Georgetown.“
Hans lachte.
Gegen Abend des nächsten Tages belauschte er ein Gespräch zwischen einem der Matrosen und einigen Auswanderern. „Das sind die Scilly-Inseln“, sagte der Seemann.
Hans atmete tiefer. Jetzt war es soweit, nun musste er hervortreten und das Verhör des Kapitäns über sich ergehen lassen – je früher, desto besser.
Er schwang sich aus der Luke hervor und kletterte an Deck.
Unter dem breiten Sonnensegel saßen die Passagiere der ersten und zweiten Klasse, und zwischen ihnen, eine Zigarre rauchend, der Kapitän.
Hans näherte sich langsam wie jemand, der sehr wohl weiß, dass das Recht nicht auf seiner Seite ist.
„Herr Kapitän“, sagte er, „ich komme, Sie um Verzeihung zu bitten.“
Mehrere ältere Damen flüsterten. „Der hübsche Junge“, sagte eine, „wie blass er ist!“
Der Kapitän runzelte die Stirn. „Komm einmal her, Bursche!“, sagte er. „Du bist wohl ein blinder Passagier! Hinter den Scilly-Inseln kommen sie immer zum Vorschein.“
Hans senkte den Blick. „Ja!“, gestand er.
„Das konnte ich mir denken. Und ein Ausreißer natürlich!“
Hans schwieg.
„Sprich, Junge“, rief der Kapitän. „Bist du entlaufen?“
„Ja! – Meine Eltern sind nach Georgetown übergesiedelt und haben mich zur Ausbildung für den Kaufmannsstand in Hamburg zurückgelassen. Das konnte ich nicht ertragen.“
„Armer Junge!“, flüsterten mitleidig die Damen. „Man muss ihm beistehen!“
„Ich will die Sache in die Hand nehmen“, meinte einer der Herren, „will mit dem Vater sprechen und alles ins Reine bringen. Wir haben ja auch in Georgetown Handelshäuser, wo ein junger Mann seine Ausbildung vervollständigen kann!“
„Wie heißt denn dein Vater, Junge?“, fragte schon halbbesänftigt der Kapitän.
„Robert Marquardt“, antwortete Hans mit klopfendem Herzen.
Der Kapitän nickte. „Nun gut“, sagte er, „der Steward soll dir eine Koje anweisen. Da du einmal hier bist, so hilft es nichts, jetzt noch zu schelten, doch werde ich selbst dich deinem Vater überliefern, darauf verlasse dich.“
Hans verbeugte sich dankend und war froh, das Examen glücklich bestanden zu haben.
Die Insel Madeira war passiert, dann das Kap der guten Hoffnung, weiterhin Madagaskar und verschiedene kleine Inseln; unter den Passagieren begann man von dem baldigen Ende der Fahrt zu sprechen.
„Noch vierzehn Tage“, hatte der Kapitän gesagt, „dann landen wir, wenn alles nach Wunsch geht, in Georgetown.“
Hans erschrak, „So schnell schon!“
Zum ersten Mal seit dem Tage seiner Befreiung aus dem Schiffsraum erinnerte er sich wieder des ganz vergessenen Kajütenjungen, er schlich zu ihm und fragte ihn, ob er Georgetown bereits kenne.
Der junge Seemann lächelte. „Du willst heimlich von Bord gehen, nicht wahr? Wenn wir zufällig abends anlegen, wird das vielleicht gelingen, sonst schwerlich.“
„Es muss gelingen!“, rief Hans. „Ich setze alles dran.“
„Sprich doch nicht so unvorsichtig“, warnte der andere. „Noch sind es vierzehn Tage, bis wir landen.“
„Ha, die vergehen auch! Wie heißt du übrigens? Ich habe, glaube ich, noch nicht einmal deinen Namen erfahren.“
„Weil dich die Gesellschaft da drüben so sehr fesselte!“, war die etwas spöttische Antwort. „Ich heiße Otto Berning.“
„Du willst mir also helfen, in Georgetown von Bord zu kommen?“
„Lass uns doch erst einmal das Land in Sicht haben“, rief beinahe ärgerlich der Seemann.
Hans lachte. „Weshalb sollte denn gerade am Ende einer vollkommen glücklichen Reise noch irgendein Schrecknis hereinbrechen?“, rief er. „Bist du abergläubisch, Otto, hast du Vorzeichen gesehen?“
Der andere nickte. „Ich – und noch mehrere von unseren Leuten“, sagte er leise, beinahe scheu.
Hans fühlte sich unwillkürlich gefesselt. „Was denn?“, fragte er.
„Das St. Elmsfeuer. Es brannte in der letzten Nacht auf dem Mittelmast.“
Hans zuckte die Achseln. „Weil wir Gewitterluft haben!“, rief er. „Es ist schwül und beinahe windstill.“
Otto zuckte die Achseln. „Einerlei – die Matrosen sagen, dass solche Zeichen Unglück bedeuten.“
Der Abend sank herab, windstill und dunkel, wie seine Vorgänger. Auf dem ganzen Schiff ruhte die Arbeit, überall im Volkslogis lagen die Seeleute auf Kisten und Bänken mit der Tonpfeife in Mund und dem gefüllten Glas vor sich. Der Kapitän hatte nicht gegeizt: Während seine Passagiere tanzten, ließ er die Leute trinken und den Abend müßig verbringen.
Sie sprachen alle zugleich, die einen von der Zukunft, die andern von der Vergangenheit. Was jeder auf dem Herzen trug, Erhofftes oder Gefürchtetes, das brach sich heute Abend Bahn – seltsam krause, bunte Vorstellungen traten ans Tageslicht.
„Wenn wir sterben, mit einem Glas Alkohol in der Hand und einem Schlager auf den Lippen, kommen wir dann in den Himmel?“
„Wachet und betet“, murmelte der Zimmermann, „hütet euch, dass ihr nicht in Anfechtung fallet!“
„Christus trank auf der Hochzeit von Kana“, fügte er hinzu.
„Lasst den Alten in Ruhe, sage ich euch. Er ist über die Zeit der Torheiten hinaus, nicht wahr, Zimmermann?“
„Ablösung!“, rief eine andere Stimme. „Müssen wir mit?“
Der zweite Steuermann kommandierte einen Matrosen an das Ruder, einen andern auf den Ausguck in den Mittelmast. „Du enterst auf, Lorenz“, befahl er.
Der Matrose schüttelte sich vor Grauen. „Gerade heute Abend?“, raunte er. „Und wenn die blaue Flamme kommt?“
„Dann wird sie dich nicht beißen. Vorwärts!“
Der Zimmermann erhob sich. „Mit Verlaub, Steuermann“, sagte er, „kann ich anstatt des jungen Burschen die Wache beziehen?“
„Wenn Ihr selbst es so wollt. Werdet ja wohl mit Euern fünfzig Jahren das bisschen Elektrizität nicht fürchten.“
Der Zimmermann steckte seine Bibel in die Tasche. „Die Elektrizität?“, wiederholte er in gedehntem Ton. „Nein, die nicht.“
Und dann kletterte er langsam in den Mast bis zum Ausguck.
Aus der Mitte der Tanzgesellschaft herüber erklangen die lustigen Töne eines Walzers, seltsam untermischt mit dem Choral, den der Alte sang. Schwarz und undurchdringlich, bleiern hingen über dem Schiff die Gewitterwolken.
Es war elf Uhr vorbei, die Lust stieg auf den höchsten Gipfel. Mit dem gefüllten Glas in der Hand trat der Kapitän in die Mitte des Saales. „Auf ein glückliches Ende unserer Fahrt!“, rief er. „Stoßen Sie an, meine Herrschaften!“
Die Gläser erklangen, ein allgemeiner Jubel mischte sich in das Tönen der Instrumente. „Auf glückliche Landung! Auf das Wohl des guten Schiffes und seines Führers!“
„Da! Da!“, rief aus dem Logis eine Stimme. „Die Flamme! – Zum dritten Mal ist die Flamme wiedergekommen!“
Von Mund zu Mund flog die Botschaft. Die Kinder jubelten laut, Herren und Damen eilten hinaus auf das Verdeck, nur der Kapitän schwieg. Mit dem Glas in der Hand blieb er allein am Büfett stehen; sein Gesicht hatte alle Farbe verloren.
Draußen herrschte allgemeine Stille. Auf dem Top brannte feierlich die elektrische Flamme, bläulich und weiß schillernd. Niemand sprach – der Bann des Fremden, nur halb Verstandenen lastete auf den Herzen aller.
Und dann geschah etwas Schreckliches.
Unmittelbar neben dem Schiff erklang zur Linken der gellende Ton einer Dampfpfeife, begleitet von dem lauten angstvollen Ausruf des Zimmermanns im Mastkorbe. „Schiff auf Backbord! – Ganz nahe!“
Ein ungeheurer Krach verschlang die letzten Worte. Über den Köpfen der erschreckten Menschen, weiß und gespenstisch in der herrschenden Finsternis, erschien die Takelage eines anderen Schiffes, zerschlagene und zerrissene Fetzen flogen herab auf das Verdeck, rauschend und brausend ergoss sich in die unteren Räume das hereindringende Wasser. Über den Gräueln der Zerstörung, über Trümmern und Splittern stand die blaue Flamme, ruhig wie vorher.
Die Offiziere ließen so schnell wie möglich alle Boote zu Wasser bringen, sie lösten selbst Bänke und Tische aus ihren Verschraubungen, um sie über Bord zu werfen als Rettungsapparate für die vielen, die gleich beim ersten Stoß in das Meer gefallen waren und die, welche kopflos vor Furcht, freiwillig nachsprangen. Rings um das sinkende Schiff riefen Frauen und Kinder in den kläglichsten Tönen, kämpften Männer verzweiflungsvoll mit den Wogen, um zu ihren Lieben zu gelangen; überall erklangen die Laute der Verzweiflung, Beten und Fluchen in schauerlichem Gemisch.
Aus dem Zwischendeck hervor drangen im Strom die Passagiere, zum Teil schon durchnässt, schreiend, flüchtend, wie wahnsinnig vor Angst. Immer tiefer sank das Schiff – noch Hunderte irrten auf dem zertrümmerten Deck umher und baten flehentlich um Rettung.
Das fremde Schiff stoppte, selbst stark beschädigt, in der Nähe der Unglücksstätte und setzte sogleich mehrere Boote aus. Scharenweise stürzten sich die Passagiere über Bord, um in diesen wenigen, zehnfach überbelasteten Kähnen gerettet zu werden.
Nebeneinander, beide an eine lange Planke geklammert, trieben Hans und Otto in den schwarzen Wogen. Sie hatten gleich zu Beginn des Zusammenstoßes sich zusammengefunden und sich mit vereinten Kräften bemüht, zunächst eins der ausgesetzten Boote zu erreichen; aber vergeblich, die Strömung trieb sie in unaufhaltsamer Eile vorwärts, sodass sehr bald die Lichter beider Schiffe, des fremden und des sinkenden, in weiter Ferne zu verglimmen begannen.
Kein Laut drang mehr herüber zu den beiden, auch der Wind schwieg, nur die Wogen fluteten im regelmäßigen Auf- und Ab. Ganz allein in der weiten schaurigen Wasserwüste starrten die Schiffbrüchigen einander an.
„Wenn jetzt ein Hai käme!“, flüsterte Otto.
„Denke nicht an ihn, bis er da ist! Seine Gefräßigkeit findet in dieser Nacht Opfer genug, auch ohne uns.“
Eine Pause verging, dann nahm Otto wieder das Wort. „Ob wir rufen sollten?“
„Immerhin!“, versetzte Hans. „Kannst du übrigens schwimmen?“
„Wie ein Fisch!“
„Nun, ich auch. Vielleicht halten wir es aus, bis der Tag anbricht.“
Sie riefen beide zugleich in die Finsternis hinaus, langgedehnt, mit dem ganzen Aufgebot aller ihrer Kräfte, sie horchten und hielten den Atem an, um keinen Ton zu verlieren, aber umsonst, niemand antwortete.
Sie trieben wieder willenlos mit der Strömung dahin, aber immer mehr und mehr ermatteten ihre Kräfte. Zuweilen drohte die Planke den halberlahmten Händen zu entschlüpfen, dann schlossen sich unwillkürlich die Augen, und in den Ohren entstand ein seltsam musikartiges Singen und Klingen. „Hans“, flüsterte Otto, „bist du noch da?“
„Gewiss! – Eben glaubte ich ein Licht zu sehen.“
„Wo? – Wo?“
„Es ist schon wieder verschwunden. Vielleicht war es ein leuchtendes Seetier.“
„Oder ein Blitz. Ach, wenn nur lieber der Hai erst käme! Wir können noch stundenlang so treiben und müssen schließlich doch zugrunde gehen.“
Hans hob plötzlich den Arm. „Da war es eben wieder! Ich möchte schwören, doch ein Licht gesehen zu haben!“
„Dann lass uns nur rufen! Um Gotteswillen, strenge dich an, so sehr du kannst!“
Ein abermaliges langgedehntes „Ahoi! Schiff ahoi!“ schallte über das Wasser dahin.
Der glänzende Punkt kam jetzt näher, und sie erkannten deutlich das Licht einer Laterne. „Das ist die Rettung!“ rief Otto.
„Das glaube ich auch, aber weshalb fällt kein Schuss? Das ist doch, meine ich, sonst auf hoher See üblich.“
„Es können auch Malaien sein, die da vor uns segeln“, sagte Otto halblaut. „Wir sind in unmittelbarer Nähe der Keelingsinseln.“
„Dann ist vielleicht das brennende Licht am Lande.“
„Nein, nein, es kommt uns ein Schiff entgegen. Ah, jetzt sehe ich den Schiffskörper!“
„Ich nicht“, gestand Hans. „Ach Gott, wenn wir uns irrten!“
Einige Minuten unerhörter Nervenspannung vergingen, dann rief Otto plötzlich mit erschrecktem Ton: „Dachte ich mir’s doch! Das Schiff ist eine malaiische Prau!“
„Und du meinst, dass sie uns die Aufnahme verweigern werden?“
„Nein, aber wir können die Geschichte sehr teuer bezahlen.“
Das Fahrzeug mit seinen unförmlichen Segeln war jetzt nähergekommen und setzte ein Boot aus. Zwei braune Gesellen ruderten kräftig der Planke entgegen und zogen nacheinander die beiden jungen Leute in ihr plumpes Boot hinein.
Der eine Malaie sah finsteren Blickes auf seine Geretteten. „Sprecht ihr Englisch?“, fragte er in barschem Ton.
„Gewiss!“, antwortete Otto. „Wir danken dir herzlichst, Radscha!“
„Wofür? – Habt ihr Geld bei euch?“
„Keinen Pfennig. Unser Schiff ist von einem andern in den Grund gebohrt worden – es war die ,Meta Mathilde‘ aus Hamburg und von dort mit Passagieren nach Georgetown bestimmt. Von dem Schicksal unserer Reisegefährten wissen wir nichts.“
„Ihr könnt euch also auch nicht auslösen?“
„Im Augenblick wenigstens nicht.“
Das Boot flog schnell über die Wogen der Prau entgegen, und schon nach weniger als zehn Minuten befanden sich die beiden Schiffbrüchigen an Bord inmitten einer Anzahl Galgengesichter, deren eines immer noch verschlagener aussah als das andere. Diese Leute beachteten die Weißen nicht im Geringsten, sie boten ihnen weder Speise noch Trank noch eine Schlafstätte an, aber sie hatten auch nichts einzuwenden, als sich Hans und Otto auf einen Haufen alter Stängel streckten, um ein wenig auszuruhen. Drei Stunden später ging die Prau im Hafen von Albion auf einer der Keelingsinseln vor Anker. Es war jetzt Tag geworden, die beiden sahen die Umgebung und empfanden unwillkürlich etwas wie ein geheimes Grauen. Niedere malaiische Hütten standen unter Kokospalmen, eine ganze Flotte von Prauen lag in der Bucht, und braune Gestalten tauchten auf, wohin der Blick sich wandte. Weit und breit war kein europäisches Schiff, kein Mensch mit weißer Haut zu entdecken.
„Jetzt beginnt die Sache ernst zu werden“, flüsterte Hans. „Ich möchte wissen, ob man uns als Gefangene betrachtet.“
Die Beantwortung dieser Frage sollte unerwartet schnell erfolgen. Einer der Malaien berührte Ottos Schulter und deutete dann zum Land hinüber; die Bewegung hieß: „Ihr könnt jetzt gehen!“
„Radscha“, sagte mit höflichem Tone der Kajütenjunge, „willst du uns nicht ein wenig zu essen geben? Mein Freund und ich, wir sind so hungrig wie die Wölfe.“
Der Malaie schüttelte den Kopf. „Nein“, antwortete er. „Seht zu, wo ihr etwas findet.“
„Wir sind also vollkommen frei?“
„Gewiss!“
„Dann nimm unseren besten Dank, Radscha. Lebe wohl!“
Ein kühles Kopfnicken galt als Gruß. Otto bemerkte noch, dass die Malaien einander halblächelnd ansahen, dann bestiegen er und Hans das bereitliegende Boot, um sich von einem der Gelben an Land setzen zu lassen.
„Was tun?“, flüsterte Otto.
„Wir spielen Robinson. Das wird herrlich werden!“
„Auf dieser wüsten Insel?“
Das Boot legte an, und Hans sprang mit einem Satz an das Ufer, Otto folgte ihm kopfschüttelnd. Er kannte aus den ,Erzählungen der Matrosen die Inselbevölkerung viel zu genau, um nicht die schlimmsten Befürchtungen zu hegen …
2. Leoparden bei Nacht
Auf dem Unterbau von Pfahlwerk standen an der Bucht acht bienenkorbartige Hütten dicht nebeneinander, weiter hinein fanden sich keine Wohnungen mehr, es gab auch hier in der unmittelbaren Nähe des Meeres nur wenige und krüppelhafte Bäume, die Aussicht war also nicht eben viel versprechend, namentlich für den hungrigen Magen.
„Was sollen wir essen?“, rief Hans. „Robinson fand wenigstens am Strande Austern und Muscheln!“
Otto seufzte. „Fände sich doch nur ein genießbarer Bissen!“, sagte er traurig.
„Denkst du nicht, dass uns die Malaien einige Lebensmittel geben werden?“
„Auf keinen Fall. Aber da ist wenigstens ein Kokosbaum mit halbreifen Nüssen!“
Ein Jubelschrei antwortete ihm. Hans schüttelte den Stamm mit solcher Gewalt, dass einige Früchte zu Boden fielen. Begierig tranken sie die süßliche Milch. Aber der Saft löschte weder den Durst noch stillte er den Hunger; beide zeigten sich im Gegenteil weit eher verschärft, sodass Hans aus Verzweiflung die Strickleiter der nächsten Hütte erstieg und um etwas Wasser bat.
Der Malaie und sein Weib zuckten die Achseln. „Auf dieser Insel gibt es keinen Quell“, war die mürrische Antwort.
„Aber ihr müsst doch Wasser trinken. Woher nehmt ihr es denn?“
„Vom Regen. Jetzt ist nichts da.“
Ein Versuch im nächsten Haus hatte den gleichen Erfolg; Otto und Hans mussten sich entschließen, weiter zu gehen, um vielleicht irgendwo eine genießbare Frucht aufzutreiben. In der Ferne schimmerten die grünen Laubkronen eines dichten Waldes. Vögel sangen in der Luft, und Insekten krochen am Boden, aber es gab auf dem harten, kalkartigen Gestein keine Blumen und kein Gras; der scharfe salzige Wind mochte die jungen Keime im ersten Entstehen getötet haben.
Die Sonne brannte heiß auf ihre unbedeckten Köpfe herab; sie fühlten in jedem Augenblick den Schwindel, die gänzliche Ermattung stärker werden, besonders Otto, dem alles von der schwärzesten Seite erschien. „Lass uns nur gleich umkehren“, sagte er, „und den Malaien unsere Dienste anbieten; wir müssen es schließlich doch.“
„Nein, erst will ich den Wald sehen, erst will ich wissen, ob nicht vielleicht doch noch ein europäisches Schiff hierher kommt!“
„Ach, da kannst du lange warten!“
„Nur nicht gleich so mutlos!“, rief Hans. „Die Bäume werden hier schon dichter, sieh, da sind welche mit langen schwertförmigen Blättern und spitzen Dornen.“
Es war der Pandanus, den sie entdeckt hatten; die große gelbe, wie eine Ananas gestaltete Frucht kam sogleich zum Vorschein und stillte, obwohl sie sehr schlecht schmeckte, doch den ersten nagenden Hunger.
Otto und Hans setzten sich auf einen gestürzten Baumstamm, um auszuruhen. Jenseits des Gehölzes schimmerte die blaue See.
Die beiden jungen Leute saßen stumm nebeneinander. Die augenblickliche Freude hatte in den Herzen eine umso drückendere Leere zurückgelassen.
Über den Wogen krächzten große Seevögel, die wohl in den terrassenförmig abfallenden Klippen ihre Nester besaßen. Sie eilten schweren Fluges, oft mit Beute beladen, herbei; das Zirpen der Jungen verriet den Weg, den sie nahmen. Tiefer sank der Sonnenball, der Tag neigte sich zum Abend.
„Lass uns eilen“, mahnte Otto. „Hier gibt es keine Höhlen, keine Lamas, keine Früchte – hu, wie schmeckt der Pandanus! Auf dieser Insel kann man nicht Robinson. spielen.“
Hans folgte ihm schweigend. Es war Abend, als sie bei den Hütten der Malaien wieder anlangten, todmüde, hungrig, mit wunden Füßen und schmerzendem Kopf. Otto suchte den Führer der Prau, die ihn und Hans hierher gebracht hatte. „Radscha', sagte er, „du hast uns das Leben gerettet, aber hier auf deiner Insel besitzt es keinen Wert, wir müssen verhungern, wenn es uns unmöglich ist, auf deinem Schiff ein Unterkommen zu finden.“
Der Gelbe wiegte den Kopf. „Ich könnte zwei Burschen, wie ihr seid, brauchen“, versetzte er. „Wollt ihr für Kost und Kleidung arbeiten?“
„Und gegen Bezahlung, Radscha!“
Der Malaie zuckte die Achseln. „Nein“, antwortete er gelassen. „Kapitän Diaz bewilligt euch keinen Lohn; vielleicht gibt er späterhin Anteile vom Gewinn – wenn ihr euch zu seiner Zufriedenheit betätigt. Aber versprechen kann ich nichts.“
Otto und Hans sahen einander an. „Du willst uns also nicht auf deinem eigenen Schiff behalten?“, rief Letzterer.
„Nein; meine Prau betreibt nur Küstenfahrten und braucht sehr wenig Besatzung. Ihr fahrt mit dem Dreimaster ,Lissabon‘ nach Suakin in Ostafrika.“
Otto erschrak. „Eine so weite Reise!“, rief er. „Kommt denn Kapitän Diaz hierher?“
„Ja, er wird in drei oder vier Tagen hier einlaufen, dann will ich sehen, was sich für euch ausrichten lässt – vielleicht macht ihr euer Glück.“
„Sklavenhandel!“, raunte in deutscher Sprache der Kajütenjunge. „Ich weiß jetzt schon alles.“
Laut fragte er: „Was beabsichtigt der Kapitän in Suakin?“
Der Malaie zuckte die Achseln. „Er handelt, er sucht Verdienst, wo er ihn findet, gerade so wie ihr selbst und wie ich.“
„Was hat er denn jetzt geladen?“
Ein verschmitztes Lächeln zuckte über das dunkle Gesicht. „Ballast!“, antwortete der Malaie. „Sand! Ihr könnt euch ja die Sache überlegen, bis er hier ist.“
„Mittlerweile müssen wir aber essen, Radscha.“
Eine Handbewegung deutete auf die am Ufer liegende Prau. „Dort ist geröstete Durrahirse in Fülle“, sagte er. „Nehmt und esst!“
Die beiden gingen eiligst an Bord und aßen das süßliche Negerkorn, als wäre es der herrlichste Braten. Bei der Gelegenheit sahen sie zufällig, dass die Prau bis auf das letzte Plätzchen mit Durra angefüllt war. Otto zog auch daraus seine Schlüsse. „Der Portugiese ist ein Sklavenhändler“, sagte er, „die Mannschaft besteht aus zuchtlosem Gesindel, von dem die Hälfte in den nubischen Wäldern desertiert oder stirbt; er braucht daher immer neuen Nachschub.“
„Aber was kümmert das alles die Malaien?“, rief Hans.
„Sie sind seine Zwischenträger, Vermittler, Spione, Lieferanten, sie verkaufen ihm das Durrakorn für den doppelten Preis, sie liefern ihm die Nilbarken und Arbeitskräfte, wo er sie braucht. Späterhin streichen sie den Löwenanteil des Gewinnes ein.“
Hans lachte. „Ein hübsches Bild, wahrhaftig! Ich gestehe dir, dass es mir lieber wäre, nicht die Bekanntschaft des ‚würdigen‘ Diaz zu machen.“
Otto seufzte.
Am dritten Morgen geriet die Flotte von Prauen und Kähnen in fieberhafte Bewegung; überall öffneten sich, die Decksluken, während aus den Hütten Säcke und Hülsenfrüchte herbeigetragen wurden und wie durch Zauberei ein Branntweinfass nach dem andern aus den tiefen, nur schwer zugänglichen Verstecken in den Uferklippen zum Vorschein kam.
Am äußersten Rande des Horizonts zeigten sich weiße Segel; die ‚Lissabon‘ musste in wenigen Stunden einlaufen.
Hans und Otto sahen klopfenden Herzens das Schiff, auf dem sie diese Insel verlassen sollten, unbekannten Verhältnissen und Gefahren entgegen. Aber es gab für sie keine Wahl; das kleine Koralleneiland glich einem Gefängnis, dem sich nicht entrinnen ließ – sie mussten sich als Kajütenjungen auf der ‚Lissabon‘ anheuern lassen.
Gegen Mittag erschien das Schiff in der Bucht. Zerlumpte, mehr als zweifelhafte Gestalten zeigten sich an Deck, die Malerei und das Takelwerk waren schäbig, das ganze Fahrzeug außen und innen von Schmutz überzogen. Als die Anker fielen, legten sich sogleich mehrere Prauen längs, und nun begann zwischen den Seeleuten und den Malaien ein lebhafter Verkehr.
Dann kam der Kapitän Diaz an Land. Er war groß und kräftig gebaut, ein Mann mit einem Schurkengesicht, bis an die Zähne bewaffnet und in ein zerfetztes prahlerisches Kostüm aus allerlei bunt zusammengewürfelten Uniformstücken gekleidet. Den Branntwein trank er wie Wasser, seine ganze Haltung war die eines Angebers.
Dieser liebenswürdigen Persönlichkeit wurden Hans und Otto als künftige Untergebene vorgestellt; der Kapitän schnitt bei ihrem Anblick eine Grimasse. „So junge Burschen!“, sagte er in wegwerfendem Tone. „Der da ist sogar ein Bürgerssohn, ein Muttersöhnchen, wie mir scheint!“
Hans errötete. „Ich bin bereit zu arbeiten, Kapitän“, antwortete er fest.
Der Portugiese spielte mit der Pistole, deren Lauf aus seiner Brusttasche hervorsah. „Ich kann nur gehorsame und entschlossene Leute brauchen“, sagte er, „nur solche, die meinen Befehl als alleiniges Gesetz anerkennen – diese aber werden auch gut belohnt und führen ein angenehmes Leben. Wollt ihr an Bord der ‚Lissabon‘ Arbeit annehmen, so schlagt ein, aber wisst, dass euch unter Umständen eine Kugel aus diesem Colt so sicher trifft, wie der Tag hell und die Nacht dunkel ist. Ihr dürft nie fragen, sondern habt nur zu gehorchen.“
Hans und Otto sahen einander an. Auf der Keelinginsel mussten sie verhungern, ihnen blieb also keine Wahl, so wenig auch das Arbeitsangebot des Portugiesen sie verlockte.
„Kommt Zeit, kommt Rat“, flüsterte Hans. „Man muss nicht gleich alles von der schwärzesten Seite ansehen! Schlage ein, Otto!“
„Wir nehmen Ihren Vorschlag an, Kapitän“, sagte dieser. „Geben Sie ein Handgeld?“
Der Seemann lachte. „Was wollt ihr hier damit anfangen? Geht an Bord und sagt dem zweiten Steuermann, dass er euch eine Flasche Branntwein gibt. Trinkt euch Mut an und befreundet euch mit euren neuen Kameraden. Vorwärts!“
Eine Viertelstunde später schon meldeten sie sich bei dem Steuermann der ‚Lissabon‘, der ihnen ihre Schlafplätze zuwies. In großen Behältern an Deck fand sich Wasser im Überfluss, auch Schiffszwieback, Durra und getrocknete Fische waren vorhanden, also genügend Lebensmittel, aber dafür auch keine Spur von Ordnung und Sauberkeit. Mehr als einer der Matrosen taumelte am hellen Tage betrunken umher, alle ohne Ausnahme waren zerlumpt wie Strolche.
Jede Sprache der Erde schwirrte und klang hier durcheinander. Da gab es Engländer und Deutsche, Skandinavier und Russen, die Söhne der Tropen und die des fernen Amerika, Franzosen. und Italiener, alles bunt zusammengewürfelt, wie der Zufall den einen oder andern auf das verrufene, von den Kriegsschiffen gehetzte, in Schmutz getauchte Fahrzeug führte.
Nachdem das Schiff den Hafen wieder verlassen hatte und durch den Indischen Ozean dem Roten Meer zusteuerte, wurde nichts mehr gearbeitet. Zerrissene Segel ersetzte man durch neue, der Schmutz blieb liegen, wo er war, und nur an den Branntweinfässern herrschte reges Leben. Der Kapitän kam oft tagelang nicht zum Vorschein; er trank dann in der Kajüte so große Mengen Genever, dass er gar nicht aufzustehen vermochte.
Im Roten Meer änderte sich ganz plötzlich dieses Treiben. Der Portugiese musste eine starke Portion Selbstbeherrschung sein eigen nennen, er stand jetzt Tag und Nacht auf Posten, er brachte Manneszucht unter seine verlotterte Schar und erzwang sich mit der Pistole in der Hand den Gehorsam.
Die lastende tropische Hitze hatte begonnen, an Deck konnten die Bretter nicht mehr mit den nackten Füßen betreten werden, die gedörrten Fische faulten im Raume, das Wasser schmeckte schal, selbst die Nächte brachten keine Kühlung. Unermüdlich, als arbeite und denke er jetzt für zehn andere mit, stand Kapitän Diaz entweder am Ruder oder bei seinen Karten, um die zahllosen unterseeischen Riffe und Felsspitzen zu vermeiden und auf der sicheren Mitte der Fahrstraße den Hafen von Suakin zu erreichen.
Jetzt traten an der fernen Ostküste Afrikas die hohen waldlosen Bergketten aus den Dunstwolken der feuchten Luft erst verschleiert und dann immer deutlicher hervor.
Nach einer Fahrt von vielen Wochen war Suakin glücklich erreicht. Nur Negerhütten, Lehmbauten, die bei jedem Windstoß schwankten, bildeten die Stadt.
Kapitän Diaz ließ gleich am ersten Tage alle seine Leute ausschiffen, und so erhielten Hans und Otto Gelegenheit, die Wunder der fremden tropischen Welt aus nächster Nähe kennenzulernen.
Auf dem Dreimaster blieben nur einige Matrosen und der erste Steuermann zurück, alle übrigen lagerten im Schutze einer verfallenen, von einem schlaublickenden Araber gehaltenen Schenke, die der Sammelplatz des verrufensten Gesindels zu sein schien.
Die Vorbereitungen zu einem Karawanenzug in das Innere wurden im großartigsten Maßstab betrieben. Kapitän Diaz kannte fast jeden einzelnen Besucher der Schenke, er lag während des ganzen Tages auf der Matte und gestattete auch seinen Leuten absolutes Nichtstun; sogar ihre persönliche Freiheit wurde nicht beschränkt; Otto und Hans erkannten allerdings schon sehr bald den Grund dieser scheinbaren Liebenswürdigkeit – aus Suakin ließ sich auf keine Weise entfliehen. Nur zwei oder drei englische Schiffe schaukelten weit draußen vor der Insel auf den Fluten; gegen das Festland hin wurde die Stadt durch einen zwei Kilometer breiten Wasserstreifen von der Küste getrennt und bildete so ein Gefängnis, dem unsere jungen Schiffbrüchigen nicht entrinnen konnten.
„Dürfen wir einmal auf ein paar Stunden mit einem Boot hinüberfahren und die Eingeborenen ansehen?“, fragte Hans den Kapitän.
Der Portugiese lachte. „Immerhin“, antwortete er. „Ihr werdet schon zurückkommen, wenn sich der Hunger einstellt.“
Halbvermummte Araber ruderten sie hinüber, Leute aus der Schenke, in der Kapitän Diaz wohnte, wahrscheinlich sogar seine Kundschafter, denn sie flüsterten mit ihm, ehe das Boot abstieß, und er rief ihnen in englischer Sprache noch nach: „Ich brauche wenigstens vierzig kräftige Tiere und ebenso viele Führer.“
„Es ist gut, Herr, du wirst finden, dass Mehemed Tokar bestens für dich sorgt!“
Der Kapitän winkte, und das Boot stieß ab, um nach einer halben Stunde an der entgegengesetzten Seite zu landen. Bis an den Rand des Wassers hinab standen ganze Straßen von Zelten, während unzählige Kamele, Esel, Rinder, Schafe und Pferde frei umherliefen. Neger, Inder, Araber, Malaien und die Angehörigen der wandernden Mischblutstämme bevölkerten diesen Markt, auf dessen weitem Rund sich Käufer und Verkäufer feilschend drängten.
Hinter einem Zelt sahen schwarze Gesichter hervor, angstvoll und scheu; ein leises Wimmern tönte durch die Luft. Mindestens fünfzig abessinische Sklavinnen, zum Teil noch Kinder, wurden von einer ganzen Reihe bewaffneter Männer mit Argusaugen behütet. Sie waren in den Bergen ihrer Heimat vorn Sklavenjägern geraubt und über Chartum hierher gebracht worden, um in Suakin Käufer zu finden, also Zwischenhändler, welche die lebende Ware nach den türkischen Häfen verschifften.