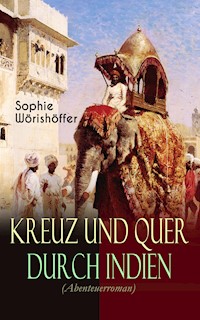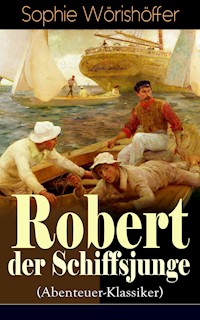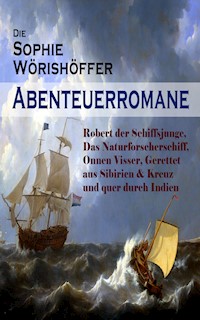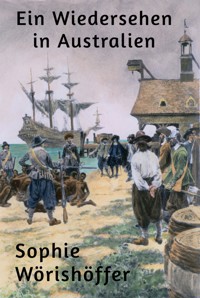3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der 16-jährige Decksjunge Richard Wittenberg rettet in Bombay Oskar Winter von der Gefangenschaft an Bord eines Chinesen. Auf der Flucht quert durch ganz Indien geraten sie in die Hände eines gewissenlosen zwergenhaften Gauklers, der sie einem einheimischen Kult opfern will …
Coverbild: Vectomart / Shutterstock.com
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kreuz und quer durch Indien
Abenteuerroman
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenZUM BUCH
Der 16-jährige Decksjunge Richard Wittenberg rettet in Bombay Oskar Winter von der Gefangenschaft an Bord eines Chinesen. Auf der Flucht geraten sie in die Hände eines gewissenlosen zwergenhaften Gauklers, der sie einem einheimischen Kult opfern will …
Coverbild: Vectomart / Shutterstock.com
EINS
Im Hafen von Bombay lag die Hamburger Brigg ‚Hansa‘ segelfertig zum Auslaufen; nur noch das Eintreten der Flut musste abgewartet werden, dann konnte sie ihre Reise nach dem fernen heimatlichen Strand beginnen.
Es war ziemlich spät abends; die gesamte Mannschaft befand sich an Bord, nur der Kapitän selbst fehlte noch und mit ihm das kleine Boot, das seit Wochen den Verkehr zwischen dem Lande und der Brigg vermittelt hatte. Die beiden größeren Boote hingen an ihren Plätzen in den Wanten.
Neben der Kombüse auf einem Haufen alter Taue und Segel saß einer der Decksjungen, ein kräftiger Bursche von sechzehn Jahren mit offenem, sonnenbraunem Gesicht. Schon seit geraumer Zeit hatte er hinausgespäht auf das stille, fast in Finsternis gehüllte Meer und die zahllosen Schiffe, die dort vor Anker lagen; irgendein Gedanke schien seine Seele lebhaft zu beschäftigen, endlich sagte er: „Steuermann, ist’s erlaubt, eine Bitte auszusprechen?“
Der Angeredete blieb stehen. „Na, Junge, was wolltest du denn?“, fragte er.
„Eins der Boote losbinden, vier Mann mitnehmen – und vielleicht eine Stunde oder zwei ausbleiben, das ist alles, Steuermann.“
„Aber nichts Geringes“, lachte dieser. „Schlag dir’s aus dem Sinn, Richard, der Kapitän hat strenge Befehle gegeben, heute Abend darf keine Katze mehr von Bord.“
Der Knabe schüttelte den Kopf. „Das weiß ich ja, Steuermann. Sie könnten mir die Sache aber unter der Hand gestatten; ich muss hinaus.“
„Aber wozu denn, Junge? Ich tue es auf keinen Fall, das lass dir gesagt sein. Könnte da so ohne Weiteres meine ganze Stellung verscherzen, irgendeiner Torheit wegen – du kennst ja den Alten, er schießt mit der Pistole dazwischen, wenn sich jemand widersetzt.“
Richard schwieg; nach einer Pause nahm der Steuermann das Gespräch wieder auf. „Was hast du denn am Lande noch zu suchen, Junge, he?“
„Ans Land will ich überhaupt nicht gehen. Steuermann, lassen Sie mich allein auf eine einzige Stunde hinaus, ganz allein – Sie helfen damit vielleicht ein gutes Werk fördern.“
Der brave Hamburger vergaß vor Erstaunen, den Mund zu schließen. „Ein gutes Werk, Junge? Potz Kringel und Krummbrot, bei dir rappelt es!“
Richard stand auf, er trat hart an seinen Vorgesetzten heran. „Darf ich Ihnen eine Geschichte erzählen, Steuermann? Etwas, das ich erlebt habe?“
Der andere nickte. „Schieß los!“, sagte er.
„Gut. Ich will’s kurz machen, Steuermann. Sie wissen, dass ich in letzter Zeit mehrere Male auf Urlaub an Land gewesen bin, nicht wahr? Ich bummelte im Hafen zwischen den Schiffen ein wenig herum, hauptsächlich da hinten, wo die chinesischen Dschunken liegen; es machte mir Spaß, ihre verrückten Segel und Taue aus Binsen zu betrachten. Ganz in der vordersten Reihe befindet sich ein großes altes Schiff, starrend von Schmutz, mit allerlei schauderhaften Fratzenbildern bemalt und voll von gelben Gesichtern, die nichts Gutes zu weissagen scheinen – mehrere Male, wenn ich am Abend hart unter dem Bug des unheimlichen Fahrzeuges dahinstreifte, hörte ich deutlich das Wimmern einer Menschenstimme, zuweilen sogar das Geräusch von Schlägen, alles im Innern der Dschunke.“
Steuermann Peters runzelte die Stirn. „Der verdammte Heide prügelt seine Frau oder seine Leute“, sagte er, „es ist Dewitschand, der alte Fuchs, von dem behauptet wird, dass er mit allem, was Seeräuberei treibt, heimlich befreundet sei. Lass du ihn laufen, Junge, dich kümmert’s ja nicht, wessen Rücken er mit dem Bambus traktiert.“
Die Augen des Knaben blitzten. „Doch vielleicht“, rief er, „doch vielleicht, Steuermann. Gestern Abend war ich wieder da, eins der Fenster stand ein wenig offen, sodass ich die Stimmen des Chinesen und dessen, den er misshandelte, deutlich unterscheiden konnte, und dieser ist jedenfalls ein Deutscher.“
„Unmöglich!“, rief entschieden der Steuermann. „Deutsche Seeleute fahren auf diesen schmutzigen, berüchtigten Dschunken niemals.“
„Es ist aber doch, wie ich sage, Steuermann. Die Stimme rief ganz vernehmlich ein: ,Ich tue es nicht, und wenn er mich auf dem Fleck tötet!‘ Dazwischen erklang mehr als ein halberstickter Schmerzensschrei.“
Der Steuermann sah auf das dunkle Meer hinaus. „Schlimm genug, wenn sich die Sache so verhalten sollte“, sagte er sehr ernst. „Wir können uns aber durchaus nicht hineinmischen, zumal unser Alter den Dewitschand ganz genau kennt und schon viele Handelsgeschäfte mit ihm abgeschlossen hat. Vergiss, was du entdecktest, Richard; man muss oft im Leben weder hören noch sehen, um nur sich selber durchzuschlagen.“ Er zuckte die Achseln: „Vorläufig können wir dem armen Schelm, wer er auch sein möge, nicht helfen.“
Damit war die Unterredung beendet; der Steuermann ging in seine Kajüte, und Richard blieb allein auf dem Taubündel sitzen. Eintönig plätscherten die leichten Wellen gegen den Kiel, von fern drang das Geräusch der großen Stadt herüber, eine milde, kühle Luft fächelte nach dem heißen Tage die Stirn des Jungen. Ob es denn so ganz unmöglich war, auch ohne die Erlaubnis des Steuermannes vom Bord zu kommen? Allerdings, das Boot konnte er nicht lösen, aber es wimmelte ja im Hafen von Fahrzeugen aller Art; für wenige Pence fand sich ein Hindu, der ihm seinen Kahn überließ, ohne lange nach dem Woher und Wohin zu fragen. Richards Herz schlug schneller, er horchte.
Alles still. Die Matrosen saßen im Logis und spielten Karten, den Kajütsjungen hatte der Kapitän mit sich in die Stadt genommen – auf dem Verdeck war im Augenblick keine lebende Seele.
Richard schlich leisen Fußes zum Fallreep, den zur Besteigung des Schiffes herabhängenden Tauen. Die Flut kam erst um vier Uhr morgens, der Kapitän vielleicht auch nicht früher, da blieb also Zeit in Fülle, um heimlich wieder in die Koje zu kriechen, und wenn es Gottes Wille war, mit dem geretteten Fremden.
Er kletterte am Fallreep bis zum Wasserspiegel und spähte umher. Aus dem Schatten der nächsten Schiffe löste sich sofort ein kleines Boot, und die Stimme eines Eingeborenen fragte in schlechtem Englisch, ob der Sahib fahren wolle.
„Pst! Komm hierher!“
Der Hindu brachte lautlos das Boot bis dicht unter den Bug der ‚Hansa‘. „Sahib befiehlt?“, flüsterte er.
„Kannst du mir deinen Kahn auf ein paar Stunden leihen, Freund? Hier ist Geld, aber ich muss allein fahren. Bei der Landungstreppe findest du morgen den alten Kasten unversehrt wieder.“
Der Hindu ergriff begierig die Münzen. „Well, Sahib. Brahmas Augen sollen die Leuchte deines Weges sein.“
„Danke schön, mein Bester. Und jetzt lass mich allein!“
Der Hindu sprang gewandt auf den nächsten, an einem Pfahl schaukelnden Kahn und war schon nach Sekunden in der Finsternis verloren gegangen – mit langen Ruderschlägen schoss sein Fahrzeug, von den kräftigen Armen des jungen Hamburgers getrieben, über die Wellen dahin und links um den Ankerplatz der deutschen Schiffe herum bis zur Stelle, wo die Dschunken lagen. Dunkle schmale Wasserstraßen führten nach allen Richtungen durch das Gewirr der schwimmenden Kolosse, Boote schossen vorüber, Lichter glänzten und Menschenstimmen sangen, nur von den chinesischen Schiffen erklangen wenige oder gar keine Laute. Dieser Teil des Hafens war verlassen und öde, Richard gelangte bis unter den Bug des schwarzen, alten Fahrzeuges, ohne etwas Verdächtiges wahrgenommen zu haben.
Eine Schlange mit offenem Rachen, um ein vierfüßiges Fabeltier gewunden, ein unentwirrbarer Knäuel gelb- und rotbemalter Glieder, schmückte als Wappentier die plumpe Wand der Dschunke – Richards Herz klopfte heftig; das war das Schiff, welches er suchte. Seine Augen, längst an die herrschende Dunkelheit gewöhnt, sandten musternde Blicke über das Deck dahin – vier menschliche Gestalten ließen sich deutlich erkennen. Drei davon kehrten der Seite, an der er sich befand, den Rücken, der vierte Mann aber stand an den Mast gelehnt und schien zu schlafen oder in Gedanken versenkt, wenigstens bewegte er kein Glied und der Kopf hing auf die Brust herab.
Die drei anderen aßen und waren damit so eifrig beschäftigt, dass sie sich um nichts anderes bekümmerten. Richard wollte eben die im Abendwind schaukelnde Fallreepstreppe erklettern und unter einem Vorwand das Deck des Chinesenschiffes betreten, als ihn ein Laut von den Lippen des am Mast lehnenden Mannes aufhorchen ließ. Dem tiefen schmerzvollen Seufzer war ein Wort hinzugefügt, ein einziges, aber – ein deutsches.
„Wasser!“
Richard fuhr zusammen. Das war der Unglückliche, den Dewitschand in seiner Kajüte zu peitschen pflegte. Ob er laut schreien, ob er die Umgebung alarmieren sollte, um den bedrohten Landsmann aus der Mörderfaust des chinesischen Gauners zu befreien?
Im ersten Augenblick wollte er es, aber seine Besonnenheit kehrte doch bald zurück. Es waren mindestens zwanzig Dschunken zur Stelle; ehe daher die Hafenpolizei erschien, hatten befreundete Hände den Gefangenen so sicher verborgen, dass ihn kein menschliches Auge wiederfand; wenn es sein musste, sogar auf dem Grunde des Meeres. Nur List konnte zum Ziel führen.
Die drei Chinesen aßen noch immer, Richard hob daher behutsam das eine seiner beiden Ruder aus dem Wasser und hielt es hoch in der Luft – der Deutsche musste unbedingt das Zeichen sehen.
Augenblicke vergingen so, dann kam der erste Erfolg – Richard war wenigstens bemerkt, obwohl er im gleichen Augenblick, eine neue erschreckende Entdeckung machen musste. Anstatt am Mast der Dschunke zu lehnen, war der Deutsche an ihn gefesselt; Hanfschnüre umwanden alle seine Glieder, er konnte nicht einmal eine Hand bewegen.
Richards Empörung stieg; er legte den Finger auf die Lippen: „Keinen Laut!“
Dann erkletterte er geräuschlos das Fallreep, zog sein Messer aus der Tasche und begann, nachdem er es zwischen die Zähne genommen, auf Händen und Füßen über das Deck der Dschunke zu kriechen. Drüben an der andern Seite des Schiffes hatten die Chinesen ihr Abendessen beendet; sie schwatzten jetzt durcheinander und einer sang mit rauer, eintöniger Stimme ein Lied – Richard sandte für dies Konzert ein Dankgebet zum Himmel, es war vielleicht für ihn und seinen unbekannten Schützling das Mittel zur Rettung.
Schritt um Schritt, wie der Indianer auf dem Kriegspfade, kroch Richard vorwärts.
Deutlicher und immer deutlicher trat aus der Finsternis die Gestalt des jungen Mannes am Mittelmast hervor; er konnte nur wenig älter sein als Richard selbst, aber Aussehen und Kleidung zeugten von den erlittenen Misshandlungen. Der leinene Anzug hing in Fetzen von einem abgemagerten Körper herab, das Gesicht war blass und das Haar verworren, die Augen unnatürlich groß. Eine Gebärde zeigte Richard die Schnüre, die an Hals und Händen das Fleisch zerschnitten.
Statt aller Antwort nahm Richard das Messer aus dem Munde und begann zuerst die Arme des Gefangenen zu befreien, dann den Kopf, alles langsam und leise, um nicht etwa den Verdacht der Wache haltenden Chinesen zu erwecken.
„O – ich danke dir!“, flüsterte der Fremde.
„Still – ich bitte dich!“
Unablässig sägte und trennte das scharfe Messer. An einem einzigen Haar hing Tod und Leben, ein zufälliger Blick schon konnte den Chinesen zeigen, was sich hinter ihrem Rücken zutrug, kein Augenblick durfte versäumt werden.
Jetzt fiel die letzte Fessel; nahe, ganz nahe beugte sich Richard über den Befreiten. „Mache es wie ich, Freund, krieche hinter mir her bis zum Fallreep.“
Aber der andere schüttelte den Kopf. „Ich kann es nicht, meine Glieder sind wie abgestorben. Was fangen wir nur an?“
Richard überlegte nicht lange. „Wollt’ ich dich tragen, so würden uns die Chinesen hören“, sagte er, „es bleibt uns nichts übrig, als Folgendes: Wenn ich mein Boot glücklich erreicht habe, lässt du dich über Bord ins Meer fallen. Ich ziehe dich schon wieder heraus.“
„Und wir sollten die Dschunke verlassen, ohne den schurkischen Kerlen einen Denkzettel zu geben? Drei sind nur an Bord!“
„Mit denen ich es doch allein nicht aufnehmen könnte, und du zählst ja nicht mit. Mache es, wie ich dir sage.“
Der andere ballte die Faust. „Ja, ja“, stammelte er, „aber ich hätte gern das verfluchte Schiff in Brand gesteckt.“
Richards Blicke warnten ihn. „Ich gebe dir ein Zeichen“, flüsterte er, „bis dahin rege kein Glied.“
Sie trennten sich, und der junge Deutsche legte den gefahrvollen Weg über das offene Deck ebenso rasch und sicher wieder zurück, wie er gekommen war. Im Boote angelangt, gab er das Zeichen mit dem Ruder.
Mit schneller Bewegung, lautlos wie eine Schlange, rollte sich der Befreite bis zur Schanzkleidung; mit einem entschlossenen Ruck ließ er sich ins Meer fallen.
Richard hatte das Ruder schon bereit, er zog kaum einige Sekunden später den Geretteten aus dem Wasser und hob ihn ins Boot.
Die Wellen bewegten sich, wie eine Möwe schoss der schlanke Kiel hindurch, in unbestimmten Umrissen verschwand die Dschunke den Blicken. Die Chinesen hatten sich um nichts bekümmert.
„Hurra!“, rief Richard. „Wir haben gesiegt!“
Der andere fiel ihm mit beiden Armen um den Hals. „Ich will dir danken, so lange ich lebe!“, rief er leidenschaftlich. „Bist du auch ein Hamburger?“
„Also du auch?“
„Na klar! Ich heiße Oskar Winter!“
„Und ich Richard Wittenberg. Aber sage mir, wie kamst du als deutscher Seemann auf die Chinesendschunke? Und weshalb hat man dich wie einen Gefangenen behandelt?“
„Ach – das erzähle ich dir alles später. Es wird doch in Bombay eine Hafenpolizei geben, oder besser noch, ein deutsches Konsulat? Ich will den Spitzbuben Dewitschand ans Messer liefern!“
Richard schüttelte den Kopf. „Werde erst ruhiger“, versetzte er. „Vor allen Dingen müssen wir sehen, unbemerkt ans Land und in eine geschlossene Sänfte zu kommen. Bedenke, wenn uns Dewitschand zufällig in den Weg laufen sollte. Stehst du in den Listen als sein Untergebener?“
„Als Decksjunge, ja!“
„Dann hat er das Recht, dich verhaften zu lassen, wo du ihm begegnest. Wir müssen auf unserer Hut sein!“
Das Boot näherte sich der Hafenmauer; man sah einzelne Gestalten auftauchen und dann mehrere und immer mehrere; Herren und Damen zu Pferde, Kutscher nach europäischem Muster, dazwischen Hindus im weißen Gewande mit rotem Turban, Türken mit grüngoldenem Turban, eingeborene Frauen mit dem Nasenring, Parsi, Chinesen und Europäer aller Länder. Durch die Straßen trugen geschäftige Hindu den goldgeschmückten Palankin, eine bunte Menge drängte sich an den Dämmen und Spazierwegen, Geräusch und reges Durcheinander der Stimmen erfüllte rings die abendliche Luft, in der alles Lebende nach der erdrückenden Hitze des Tages neu aufatmete.
„Hier müssen wir anlegen“, meinte Richard. „Es ist die Bootstreppe. Soll ich nach dem Polizeigebäude fragen?“
Statt aller Antwort berührte Oskar den Arm seines neuen Freundes, er sah starr auf eine Gruppe von Männern, die sich eben der Treppe näherte und zum Wasser hinabzusteigen begann, sein Gesicht war blass vor Schreck.
„Dewitschand!“, flüsterte er.
„Wo?“
„Der kleine alte Chinese da. Er hat uns bemerkt.“
Es war wirklich so. Die Schlitzaugen des Gelben bohrten sich aus nächster Nähe in die des jungen Deutschen, der Zopf geriet in schwingende Bewegung, die Hand ballte sich zur Faust.
„Hölle und Teufel“, rief er in englischer Sprache, „das ist mein Decksjunge. Er hatte Bordarrest, er will entlaufen – wo ist die Polizei?“
Ein paar uniformierte Gestalten näherten sich raschen Schrittes, ihnen voran stürzte der Chinese die Stufen hinab und in das nächstbeste Boot, dessen Führer an den Stufen auf Fahrgäste wartete. „Vorwärts!“, schrie er, „vorwärts, ich bezahle, was ihr verlangt!“
Aber der Hindu musste sein Fahrzeug erst von der Kette lösen; es vergingen einige Minuten, bevor er die Riemen ins Wasser tauchte, und diese kurze Frist hatte Richard benutzt, um mit allen Kräften das Boot aus dem Bereich der Gefahr zu bringen. Einen Silberstreif hinter sich lassend, glitt es hinaus in das Dunkel, verfolgt von den Flüchen und Verwünschungen des Chinesen, der sich vergebens bemühte, den Führer seines eigenen Kahnes zu größerer Eile anzuspornen.
„Ich bezahle doppelt“, schrie er, „dreifach, zehnfach! Lasst mir den Burschen nicht entkommen, er ist ein Dieb, er bestiehlt mich!“
Aber stattdessen wurde er plötzlich aufgehalten. Hinter dem Hinduboot, das ihn trug, schoss das der beiden Polizisten durch die Fluten, vor ihm versperrten zahlreiche Kähne den Weg. Vornehme Europäer mit ihren Damen, die der allgemeinen Sitte abendlicher Wasserfahrten huldigten, junge Mädchen und Kinder, alles nahm Partei für die Flüchtlinge.
„Ein paar arme weiße Jungen“, ging es von Mund zu Mund, „was mag der alte Chinese mit ihnen vorhaben?“
„Einer blutete an Hals und Händen?“
„Lasst uns ihnen einen Vorsprung schaffen!“
Und die Boote schoben sich zusammen; wo das des Chinesen durchschlüpfen wollte, da mussten erst zwei andere ausweichen, und das kostete viel Zeit. Halb aus Mitleid für die beiden Bedrohten, halb zum Spaß hielten die Gondelfahrer den Chinesen so lange in ihrer Mitte zurück, bis die herrschende Finsternis den Weg zum Boote der beiden jungen Deutschen verlegte. Es war unmöglich, zwischen Hunderten von Fahrzeugen gerade das eine herauszufinden.
Ehe eine Viertelstunde verging, musste Dewitschand die Verfolgung aufgeben. Er tobte und fluchte, er ballte die Faust, aber seine ohnmächtige Wut konnte den beiden nicht mehr schaden.
Oskar berührte Richards Arm. „Er nannte mich einen Dieb, der Schurke! Er sagte, ich habe ihn bestohlen – hörtest du es nicht?“
„Leider“, versetzte der Angeredete. „Wir sind in eine böse Lage geraten. Sahst du neben dem Chinesen den großen Mann mit dem Vollbart? Das war mein Kapitän. Wir sind nun beide als Flüchtlinge und Gott weiß was sonst noch angemeldet.“
Oskar schüttelte den Kopf. „Du nicht, Freund. Überlasse mich meinem Schicksal, setze irgendwo den Kahn an Land und begib dich zu deinem Schiffe zurück.“
„Damit mich der Chinese für an Bord seines Schiffes begangene Gewalttätigkeit vor Gericht stellt, nicht wahr? Ich bleibe bei dir, namentlich, wo du schwach und krank bist – irgendwo finden wir wieder ein Schiff, das uns in
den Schutz deutscher Behörden zurückbringt. Mein Steuermann ist ein ehrlicher Kerl, er wird für mich zeugen, wenn später das ganze Abenteuer bei den Behörden in Hamburg zur Sprache kommt.“
Oskar seufzte. „In Hamburg!“, wiederholte er.
„Gewiss. Ober kurz oder lang werden wir ja doch dort im Hafen wieder Anker werfen. All mein bisschen Geld habe ich in der Tasche, meine Papiere auch – lass dann die paar Stücke Zeug nehmen, wer sie mag. Vorwärts – und den Kopf oben!“
Oskar nickte. „Dich hat niemand beleidigt, niemand misshandelt“, sagte er. „Aber mir ist die Haut von den Knochen geschunden, mich hat der Chinese bis aufs Blut gepeinigt – und das alles soll ungerächt bleiben?“, rief er leidenschaftlich. „Es ist nicht allein meinetwegen, wenn ich den Seeräuber an den Galgen bringen möchte, er hat eine Untat begangen, die zum Himmel schreit, er ist ein Mörder!“
„Aber sage mir“, fuhr er tiefatmend fort, „wohin fährst du? Es drängt mich, dir meine Geschichte zu erzählen.“
„Nach Elephanta“, antwortete Richard, „nach der Höhlenstadt. Wir müssen bis an den Morgen rudern, aber dafür wird uns in den Felsentempeln auch so leicht niemand finden. Ich war schon dort, die unterirdischen, zerklüfteten Wege sind mir nicht mehr unbekannt, die Bettler vor den Toren haben Lebensmittel in Fülle. Das ist fürs Erste alles, was wir brauchen.“
Oskar seufzte. „Ich glaube, dir verursacht das Abenteuer nur sehr wenig Kummer“, sagte er.
Richard ruderte emsig; auf seiner Stirn sammelten sich Tropfen. „Zu Hause sorgt sich niemand um mich“, versetzte er, „ich bin frei wie der Vogel in der Luft. Mir kann’s nicht leicht zu bunt werden.“
„Du hast also keine Eltern, keine Geschwister mehr?“
Ein Kopfschütteln war die Antwort.
„Aber doch noch Onkel und Tanten, Vettern und Basen – davon besitzt jeder Mensch eine große Anzahl.“
„Ich nicht, Oskar. Mein Daheim, alles was ich von Familie und Freundschaft kennen lernte, umschließen die grauen Mauern in der Admiralitätsstraße!“
„Ach – du bist ein Waisenkind?“
„Ja. Ich wurde drei Jahre nacheinander Klassenbester; das gab allemal aus einer Stiftung eine hübsche Summe – die verwendete ich, um mir eine Ausrüstung für die See zu kaufen. Die Heuer der ersten Reise liegt in Hamburg bei der Sparkasse – die erste Planke für das Schiff, das ich einmal besitzen werde.“
Er lachte. „Man muss dem Leben immer die gute Seite abgewinnen, du; bei dem Kopfhängen kommt nichts heraus. Jetzt lass mich deine Wunden sehen!“
Er fand die Quetschungen und Schrammen an dem Körper seines Genossen zwar sehr zahlreich, aber doch nicht gefährlich. Das Ärgste verband er mit dem Taschentuch, dann wurde die Fahrt kräftig fortgesetzt.
„So, Oskar, jetzt erzähle mir von deinem Schicksal!“
„Ach – das ist eine Geschichte, wie sie nicht oft vorkommt, wenigstens was meine Erlebnisse zur See betrifft, das Übrige ist einfach genug. Ich bin in der Steinstraße als Sohn eines armen Schreibers geboren; mein Vater ist von guter Herkunft, aber das Elend hat ihn gebrochen. Sieben Kinder – das war zu viel für ihn, ob auch die Mutter vom Morgen bis zum Abend nähte und stickte, um ein paar Pfennige mitzuverdienen. Als ich konfirmiert war, blieb mir nur der Schiffsdienst übrig; der Vater hatte kein Geld, um mich etwas anderes lernen zu lassen, und so ging ich denn zur See, obwohl nicht besonders gern. Ich gäbe noch heute Jahre vom Leben dahin, könnte ich ein Baumeister werden! Aber das sind alte Geschichten“, unterbrach er sich, „die Hauptsache kommt erst. Zwei Reisen nach Singapur und Kapstadt gingen glücklich vonstatten; ich hatte mich halb und halb mit meinem Schicksal versöhnt, da, auf dieser letzten Reise geschah etwas, das plötzlich eine vollkommene Umwälzung aller Verhältnisse zu bringen versprach. Das Glück suchte mich, ich hielt es schon in der Hand, es war mein – und Dewitschand hat mir’s gestohlen.“
Er seufzte. „Dewitschand hat mir’s gestohlen!“, wiederholte er.
„So wird er früher oder später den Raub wieder herausgeben müssen!“, rief Richard. „Das Unrechte siegt immer nur für kurze Zeit.“
„Hier nicht. Hier ist alles verloren!“ Oskar suchte sich gewaltsam zu fassen. „Mein Schiff ging nach Ceylon“, fuhr er fort, „die Reise war glücklich, aber vor Point de Galle packte uns ein Taifun und warf den Schoner in die Tiefe des Meeres, während von der Mannschaft einige gerettet wurden, darunter ich selbst. Der Kapitän war ertrunken, mein Hab und Gut dahin; es blieb mir, da im Augenblick auf deutschen oder englischen Schiffen keine Stellung zu erlangen war, nichts anderes übrig, als nach einem belebteren Hafen unter Segel zu gehen, und so geriet ich in Dewitschands Hände. Seine Mannschaft war an den Blattern zur Hälfte gestorben und ein Ersatz, wenigstens Chinesen, in Point de Galle nicht zu haben, er musste daher, so ungern es geschah, weiße Leute an Bord nehmen. Ich dachte, dass ja die kurze Fahrt von Ceylon hierher wohl zu ertragen sei, und so ließ ich mich als Decksjunge einschreiben, obgleich ich auf dem Schoner schon Leichtmatrose gewesen war. Aber der geldgierige Schurke kam ja billiger davon, wenn er dem, der Matrosendienste verrichtete, nur die Löhnung des Jungen bezahlte!
Außer mir war in Point de Galle noch ein Mann an Bord gekommen, den ich gleich von Anfang an für einen Deutschen hielt, obwohl er nur englisch sprach und mir auch von seiner Lebensgeschichte wenig oder nichts erzählte, ein älterer Mann mit gütigem Wesen, vielleicht ein hoher Vierziger, dessen Haar in dem heißen Klima vor der Zeit ergraute. Mr Gould hatte in Point de Galle erfahren, dass ich bei dem Schiffbruch des Hamburger Schoners mein bisschen Hab und Gut eingebüßt, er fragte mich nach den Verhältnissen meiner Eltern, nach diesem und dem aus Hamburg und sagte zuletzt, er beabsichtige von Bombay aus dorthin zu gehen.
‚Dir will ich eine gute Stellung verschaffen, Kind‘, sagte er mir einmal unter vier Augen, ‚ich kenne viele deutsche Kapitäne. Aber lass es den Chinesen nicht hören, er hat ein Fuchsgesicht und wird dich gutwillig kaum von Bord lassen.‘
,Aber ich habe nur bis Bombay geheuert!‘, rief ich erschrocken.
,Das leugnet er, wenn es ihm besser passt. Die Söhne des himmlischen Reiches sind, soweit sie das Meer befahren, alle Schurken. Hätte sich nur eine andere Gelegenheit geboten, so wäre ich gar nicht auf ein chinesisches Fahrzeug gegangen, aber in dieser Jahreszeit kann man monatelang warten, bis deutsche oder englische Schiffe nach Point de Galle kommen. Verlass dich nur ganz auf mich, Junge!‘
Er sprach in dieser Weise viel mit mir, ich lernte ihn immer näher kennen und mehr und mehr hochschätzen. ,Ich bin reich‘, sagte er einmal, ‚über siebzehn lange, schwere Jahre habe ich in den Sandfeldern des inneren Ceylon Diamanten gesucht, zuerst mit sehr geringem Erfolg, dann Schlag auf Schlag vom Glücke begünstigt. Wenn du so gern ein Baumeister werden möchtest, Junge, dann helfe ich dir dazu – und für deinen alten Vater wird sich ja wohl auch noch ein Plätzchen auftreiben lassen, das ihn besser ernährt als die Lohnschreiberei. Es ist immer ein schlimmes Ding‘, setzte er seufzend hinzu, ein gar schlimmes Ding, einen Knaben in eine Laufbahn hineinzutreiben, die seinen Wünschen nicht entspricht. Dir helfe ich!‘, versprach er nochmals. ,Lass uns nur erst einmal den Boden von Hamburg unter den Füßen haben.‘
Mir schwebte die Frage ob er dort geboren sei, schon auf den Lippen, aber ich wagte doch nicht, sie auszusprechen. Gewiss war Mr Gould ein sehr unglücklicher Mann trotz seines Reichtums, er litt auch an Kopfschmerzen und starker Schlaflosigkeit; ich sah ihn oft des Nachts an Deck auf und ab gehen, wobei er dann immer seine Kajüte verschloss. War er nicht drinnen, so trug er den Schlüssel in der Tasche.
Gewiss befanden sich in einem schmalen, eisernen Kasten, der ihm gehörte, Diamanten von großem Werte; er behütete den Schatz wie eine Mutter ihren Säugling.
Für mich war diese Zeit die denkbar glücklichste. Mr Gould wollte mir zur Erreichung meines Lieblingswunsches die Hand bieten, er wollte meinen armen alten Vater aus seiner bedrängten Lage herausheben – ach, wie freute ich mich. Es lag in dem Plane des gütigen Mannes, ein großes überseeisches Handelshaus zu gründen, so viel hatte ich schon erfahren – da würde es ja gar nicht schwer werden, einen gewandten und gut besoldeten Schreiber anzustellen. Das Glück schien endlich für uns aufgegangen, ich konnte kaum erwarten, das kleine Haus in der Steinstraße wiederzusehen und Mr Gould dort einzuführen. Welch ein Freudentag sollte das sein!
Und dann trat Dewitschands Verbrechen zwischen mich und die Erfüllung meiner liebsten Hoffnungen, dann hat mir der Verfluchte alles, alles geraubt.
Es war während einer heißen Nacht. Plötzliche Nebel huschten über die See, ein Gewitter grollte in der Ferne, und das Wasser lag totenstill um den Bug der Dschunke, wie Blei drückte die Luft auf jedes Gehirn. Meine Kameraden im Logis schliefen, die Tür stand halb offen, der unerträglichen Schwüle wegen, auf dem Verdeck befand sich keiner der Chinesen, nur hinter der Kajüte saß einer am Steuerrad, aber natürlich ohne das, was auf dem Schiffe vorging, beobachten zu können. Mr Gould wanderte wie gewöhnlich zwischen den Masten und all den unsauberen Bauten am Deck auf und ab, mitunter beugte er sich auch über die Schanzkleidung, stützte den Kopf in die Hand und sah unbeweglich hinab auf den Wasserspiegel.
Dichte Nebel umlagerten das Schiff; wie durch einen Schleier erkannte ich, dass sich die Tür der Kapitänskajüte öffnete, dass Dewitschand spitzes Gesicht hervorlugte, gleich dem des Fuchses, der auf Raub ausgeht – seine Bewegungen setzten mich in Erstaunen, nicht sein Kommen selbst. Kein tüchtiger Kapitän lässt die Nacht verstreichen, ohne mehrere Male nach dem Rechten zu sehen; auch dann nicht, wenn er eine vollkommen zuverlässige Mannschaft besitzt.
Dewitschand öffnete Zoll um Zoll die Tür – an den Wanten stand Mr Gould – plötzlich, mit einem einzigen Sprunge, katzengleich stürzte der Chinese hervor, packte den ahnungslosen Mann und warf ihn über Bord, alles in einem einzigen Augenblick, alles unter dem wallenden dichten Nebelschleier, der die Gestalten verzerrte und verlängerte, bis sie nichts Menschliches mehr hatten. In der nächsten Sekunde schloss Dewitschand die Tür seiner Kajüte und war verschwunden.
Ich hatte alles gesehen; wie der Blitz sprang ich auf und schlug mit geballten Fäusten gegen die Tür. ,Hilfe, Hilfe!‘, rief ich. ,Mr Gould ist ermordet worden! Ein Boot! Um Gottes willen, ein Boot!‘
Nichts regte sich. Dewitschand ließ absichtlich mehrere Minuten verstreichen, ehe er an Deck erschien. Seine Leute sollten glauben, dass ihn erst mein Geschrei aus dem Schlafe erweckt habe – nach längerer Frist kam er hervor und sah sehr erstaunt von einer Seite zur andern. ,Du bist es, Junge? Was treibst du hier, Taugenichts?'
,Mörder!‘, rief ich außer mir, ‚Mörder! Sie haben den armen Mr Gould über Bord gestürzt!‘
Sein gelbes Gesicht wurde fahl. ,Der Junge hat den Teufel im Leibe!‘, schrie er, ‚ihn plagen böse Träume und dann nennt er andere Leute Mörder. Hinunter mit ihm in den Raum, legt ihn in Ketten!‘
Die gelben Schurkengesichter umringten mich von allen Seiten. Vielleicht wusste mehr als einer aus diesem Gezücht, dass ich die Wahrheit sprach, aber sie nahmen doch sämtlich Partei für ihren Anführer, sie schienen taub zu sein, so oft ich flehentlich bat, ein Boot auszusetzen – fünf Minuten später lag, ich, an Händen und Füßen gefesselt, in einem dunkeln Behälter, aus dem man die Schweine entfernt hatte, weil sie ohne Luft und Licht gestorben sein würden. Obwohl aber meine eigene Lage entsetzlich war, dachte ich im Augenblick doch nur an den armen Mr Gould. Wie schändlich hatte ihn Dewitschand ermordet!
Das Schiff glitt in langsamer Fahrt durch die Wellen, auf dem Verdeck regte sich nichts – die Elenden hatten den vortrefflichen Mann im Wasser umkommen lassen, er musste, obgleich ein tüchtiger Schwimmer, doch schon längst ertrunken sein.
Bei dem Gedanken habe ich das Bewusstsein verloren. In der verpesteten, mit den schrecklichsten Dünsten erfüllten Luft ließ sich ohnehin kaum atmen – es waren Folterstunden, die ich da unten verbrachte.
Am Morgen kam Dewitschand. In einer Hand trug er einen Wasserkrug, in der andern einen vielfach geknoteten Strick aus Binsen. Voll Bosheit und Tücke beobachteten mich die kleinen Augen, er murmelte als einzigen Gruß ein paar Worte in seiner Sprache, die ich natürlich nicht verstand, die aber genau wie eine Verwünschung klangen.
Dann trat er mir näher. ,Ich bin gekommen, um dich etwas zu fragen‘, sagte er. ,Bist du durstig?‘
Ich antwortete ihm nicht, aber meine trockenen Lippen, meine heiße Stirn mochten ihm alles sagen; er hielt mir mit satanischem Vergnügen den Krug dicht vor das Gesicht. ,Du willst trinken, nicht wahr, Bursche? Sieh hier das klare schöne Wasser, es ist dein, wenn du eingestehst, dass in dieser Nacht ein Traum deine Sinne verwirrte. Du sahst, wie der weiße Mann über Bord fiel – er ist nicht in seiner Kajüte, also muss ein Unglück geschehen sein! –, und im Erschrecken darüber bildetest du dir ein, man habe ihn ermordet. Nicht wahr, so ist es? Soll ich die Mannschaft rufen, Weiße und Chinesen, willst du ihnen allen bestätigen, was ich soeben sagte?‘
Seine Augen funkelten, ich sah, wie sehr er das Eingeständnis von meinen Lippen ersehnte, und aus Hass schwieg ich.
,Sprich!‘, zischte er. ,Du hast einen Traum gehabt, Bursche!‘
Ich sah ihn an, aber über meine Lippen kam keine Silbe.
Da schlug er mich, bis das Blut herabfloss. ,Wirst du sprechen, Hund!‘, rief er. Ich lachte.
Und so wiederholte sich derselbe Auftritt an jedem Morgen; Dewitschand begann, je mehr wir uns dem Hafen von Bombay näherten, desto entschiedener von seiner Forderung abzulassen. Die Haltung der weißen Matrosen mochte ihm Furcht einflößen, er schien sehr unruhig.
,Du brauchst nur eins zu tun‘, sagte er mir, ‚dann ist‘s genug. Schwöre bei dem Christengotte, dass du von dem, was du gesehen zu haben glaubst, keinem Menschen ein Wort sagen wirst, und es ist alles gut.‘
Wieder lauerte er. ,Schwöre, schwöre – oder du stirbst aus Mangel an Luft und Licht.‘
Aber ich blieb standhaft. Das Verlangen nach Rache, nach Genugtuung für meinen armen gemordeten Freund war stärker als alle Körperqualen. Dewitschand ging bis zur Bitte, bis zu Schmeichelworten, er wand sich wie ein Wurm – ich lachte nur.
Inzwischen kamen wir hierher nach Bombay, die Dschunke warf Anker, und die beiden weißen Matrosen, welche mit mir an Bord gekommen waren, wurden abgemustert. Sie schienen äußerlich von meinem Schicksal nichts bemerkt zu haben, aber schon vorher hatte sich der eine des Nachts zu mir geschlichen und im Dunkel meine Hand gedrückt. ,Du kennst die Gesetze, Oskar, weißt, wie Meuterei und Gewalttätigkeit zur See bestraft werden! Solange wir in den Schiffslisten stehen, ist es uns unmöglich, dir zu helfen, aber vom Lande aus befreien wir dich und an Deck sollst du wenigstens jetzt schon kommen, dafür lass mich sorgen.‘
Wie er die Sache angefangen hat, weiß ich nicht, genug, Dewitschand holte mich heute aus dem abscheulichen Käfig hervor, ließ mein Gesicht und meine Hände waschen und mich an den Mast binden. ,Da du wahnsinnig bist‘, sagte er, ‚so muss man sich deiner versichern. Ich werde übrigens einen Arzt an Bord bringen.‘
Diese letzte Drohung erschreckte mich sehr. Ich mochte wohl einem Geisteskranken gleichen, nach einer so schweren Prüfungszeit konnte es kaum anders sein – was würde dann mein Los werden? Mir graute und ich sah während des ganzen Tages voll Sehnsucht auf das Meer hinaus, ohne jedoch von meinen Kameraden irgendein Lebenszeichen zu erhalten; sie sind sicher in eine Branntweinschenke geraten und betrunken liegen geblieben.
Was weiter geschah, weißt du – deine Tat hat mich erlöst.“
Richard nickte zufrieden. „Lass alles fahren dahin“, sagte er, „ein Menschenleben ist mehr wert als Hab und Gut. Wir bleiben beieinander, bis uns der Weg zu einem deutschen Schiff führt – sei es früher oder später.“
„Nur eins beklage ich für dich“, setzte er hinzu, „dass dein Wohltäter sterben musste. Dewitschand wird seine Strafe erhalten, aber dadurch lässt sich Mr Gould nicht wieder von den Toten erwecken.“
Oskar hob die Hand. „Zuweilen denke ich, dass er doch noch leben könnte“, sagte er. „Weißt du, in dem Augenblick als ich so wie außer mir über das Deck stürzte und mit beiden Fäusten an Dewitschands Tür schlug, da glitt im dichten Nebel ein Schiff hart an der Seite der Dschunke vorüber, soviel sich im Fluge erkennen ließ, ein englisches Kriegsschiff – ich habe Stimmen und ein Rasseln von Ketten gehört; erst später, nachdem sich die furchtbare Aufregung legte, fiel mir das alles wieder ein. Vielleicht ist ein Boot ausgesetzt worden! Die See war spiegelglatt und Mr Gould konnte schwimmen wie ein Fisch. Freilich, den eisernen Kasten hat Dewitschand auf jeden Fall erbeutet.“
Sie hatten sich während dieser Unterhaltung der Insel Elephanta genähert und endlich im ersten Schimmer des Tages die Landungsstelle erreicht. Das ungeheure, mehr als lebensgroße, aber im Zerfall begriffene Steinbild eines Elefanten lag hart am Ufer, mehrere Boote schaukelten sich an Pflöcken, und lungernde Bettler und Hindu richteten sofort ihre Blicke auf die beiden.
„Der weiße Sahib will den Tempel des Schiwa besuchen – soll sein Diener ihn auf dem Rücken an das Land tragen?“
„Der Sahib blutet – sein Diener kennt heilkräftige Kräuter. Soll er Wasser herbeiholen und Brot – und Früchte?“
„Bringe uns nur erst einmal ans Ufer, Freund!“
Zwei Hindu stiegen bis an den Gürtel ins Wasser und trugen die beiden Deutschen auf den Strand, dann erkundigte sich Richard nach den Verhältnissen der Insel. „Liegen hier immer Boote?“, fragte er.
„Immer, Sahib. Mögen dich die Götter hundert Jahre alt werden lassen.“
„Hm, das ist ein zweifelhafter Wunsch. Sage mir lieber, ob du einige Schillinge verdienen möchtest?“
Der Hindu schnalzte mit der Zunge. „Die dunkeläugige Göttin begleite dich auf allen deinen Wegen, Sahib. Gebiete über deinen Diener!“
„Gut. So nimm ein Boot, binde das, in dem wir hierher kamen, daran und bringe es bis zur Landungstreppe in Bombay. Es gehört nicht mir, daher muss ich es rechtzeitig wieder abliefern. Wenn du zurückkommst, bezahle ich dich!“
„Dein Diener wird alles ausrichten, Sahib. Hast du sonst noch Befehle?“
„Hm, kennst du dich im Hafen einigermaßen aus?“
„Wie in der Hütte meiner Mutter, Sahib. Auf welches Schiff soll ich gehen?“
„Auf keines, aber sage mir, ob die ,Hanna‘, eine hamburgische Brigg, noch an ihrem früheren Platze vor Anker liegt.“
„Brahma segne dich; dein Diener wird gehorchen.“
Er knüpfte gewandt die beiden Fahrzeuge zusammen und ruderte davon, während sein Kamerad die jungen Leute in eine nahe am Ufer gelegene Hütte führte und dort zunächst Oskars Wunden mit gequetschten Blättern und sauberen Leinenstreifen regelrecht verband. Die beiden frühstückten stehend, da sich keine Sitzgelegenheit vorfand, und nahmen dann das Mattenlager gemeinschaftlich in Besitz. Die Natur machte ihre Rechte geltend – schon nach wenigen Minuten schliefen sie fest.
ZWEI
Es war fast Mittag, als der Inder aus Bombay zurückkehrte. Sein Bruder, sein Weib und die nackten braunen Kinder hatten unterdessen ihre Zeit im Freien verbracht, um den Schlaf der beiden Weißen nicht zu stören; als diese aber gegen zwei Uhr nachmittags neu gestärkt hervorkamen, da begann das Mahl, bei dem der Bambus als Napf und die Finger als Gabel dienten. Richard erkundigte sich zunächst nach seinem Schiffe, vielleicht in der stillen Hoffnung, aus sicherem Versteck dem Kapitän schreiben zu können, aber was er gefürchtet hatte, das traf ein — die ‚Hansa‘ war unter Segel gegangen.
Äußerlich ließ er sich, seinem Genossen zuliebe, nichts merken, sondern fing an, Land und Leute einer eingehenden Beobachtung zu unterziehen. „Ganz Indien duftet wie ein Kuhstall!“, sagte er in deutscher Sprache. „Begreifst du das, Oskar?“
„Sieh dir einmal den Türpfosten an und das Herdfeuer und die Stirnen unserer würdigen Gastfreunde, bis herab zu der des Säuglings, dann wird dir das Rätsel schon klar werden.“
Richard lachte. „Überall ein grün-bräunlicher Fleck, etwa wie gekochter Sauerampfer aussehend! Die heilige Kuh wird eigentümlich verehrt, das muss ich sagen.“
„Und dieser Reis ohne Fleisch oder Milch schmeckt abscheulich. Wir wollen uns an die Bananen halten.“
Noch während des Mahles, das auf Matten vor der Hütte eingenommen wurde, näherte sich eines der Kinder seiner Mutter und flüsterte ihr ein paar Worte ins Ohr. Die Frau sprang auf, unruhig, wie es schien; sie scheuchte die Kleinen eilends zurück und warf sich am Eingang der Hütte mit gefalteten Händen auf die Knie, während die beiden Männer so ruhig sitzen blieben, als sei nichts Besonderes vorgefallen.
„Was hat sie nur?“, rief Oskar.
„Ich will es jedenfalls mit ansehen!“
Und dem auf den Knien liegenden Weibe näher tretend, überblickte Richard das Innere der Hütte. „Eine Schlange!“, rief er, „so wahr ich lebe, eine Kobra Capella, eine Brillenschlange von der größten Sorte!“
Und einen Stein ergreifend, wollte er das gefährliche Tier mit geschicktem Wurfe zerschmettern, aber ebenso schnell waren die beiden Männer aufgesprungen und ihm in den Arm gefallen. „Die Kobra ist heilig, Sahib, du darfst sie nicht berühren. Alle ihre Freunde und Brüder würden kommen, um die Kinder des armen Hindu zu töten, wenn er ihr ein Leid geschehen ließe. Das Weib Anar-Rambos betet zur Schlange, der Sahib wird gleich sehen, dass sie antwortet.“
„Wer – die Kobra?“
„Ja. Verkriecht sie sich unter dem Lager deines Dieners, so kündigt sie dadurch ein Unglück an, hebt sie aber den Kopf und geht hinaus, denn bedeutet das dem Hause des armen Hindu viel Geld, Gesundheit und Freude!“
Richard ließ den Stein fallen. „Wie ihr wollt“, sagte er, „aber werden denn diese Bestien niemals getötet?“
Von den Hindu nicht.“
Die Schlange war während dieses kurzen Zwiegesprächs in der Hütte umhergekrochen und das Weib ihr, auf den Knien liegend, betend und seufzend von Stelle zu Stelle nachgerutscht; jetzt aber änderte sich die Szene. Das Tier rollte den Schweif tellerförmig zusammen, hob den Oberkörper auf und drehte den spitzen Kopf nach allen Seiten, dann schoss es, wie der Pfeil vom Bogen, urplötzlich zur Tür hinaus und verschwand zwischen den Gebüschen.
Ein Freudenschrei brach über die Lippen der Hindu.
„Die dunkeläugige Göttin will dem Hause Anar-Rambos das Glück schenken!“, riefen sie.
Die Kinder tanzten laut jubelnd, das Weib lief mit schnellen Schritten zu einem windschiefen Schuppen in der Nähe und kam bald darauf wieder zum Vorschein, in beiden Händen einen Korb tragend, dessen Inhalt die Geruchsnerven der beiden jungen Leute beleidigte.
„Heilige Kuh“, rief Richard, „du bist fürchterlich!“
Das Hinduweib fügte mit gewandter Hand dem braunen Klecks auf den Stirnen sämtlicher Familienmitglieder noch einen kleinen Nachschub hinzu, während der Türpfosten förmlich eingesalbt wurde und die vier Ecken des steinernen Feuerherdes je eine Verzierung aus dem seltsamen Baustoffe erhielten, den man unbekümmert um seine Heiligkeit von heute, sobald er getrocknet war, morgen als Brennmaterial verwandte.
Die Brillenschlange war abgezogen, ohne jemand gebissen zu haben, dafür mussten alle Hausgötter ihr Opfer erhalten.
„Über Nacht bleiben wir in dem großen Schiwa-Tempel“, entschied Richard. „Hier unter den Gebüschen ist mir’s unheimlich.“
„Mir auch. Wüssten wir nur erst einmal, was aus uns werden soll!“
„Wir müssen einen anderen Hafen erreichen, das ist alles. Schlimmstenfalls als Lastträger oder Elefantentreiber. Morgen wird in Bombay das große Schlangenfest gefeiert, dazu kommen die frommen Hindu aus der ganzen Umgegend; wir werden leicht irgendeine Gruppe von Leuten finden, denen wir uns anschließen können.“
„Wie weit ist es denn bis zum Schiwa-Tempel?“
„Zwei Stunden höchstens. Jetzt werde ich mit Anar-Rambo abrechnen und dann machen wir uns auf den Weg. In dem alten Gemäuer gibt es Spinnen von Riesengröße, Eidechsen und Vögel, aber doch keine Giftschlangen oder heilige Kühe – was mir ein großer Gewinn zu sein scheint.“
Der Hausherr wurde herbeigerufen, und nun zeigte sich’s, wie viel seine reichlichen Segenswünsche im Grunde wert waren; er stellte unverschämte Forderungen und feilschte um jeden Penny. Richards schmaler Geldbeutel hatte die Hälfte seines Inhalts herausgegeben, als man sich endlich trennte und die beiden jungen Freunde allein in das Innere der Insel vordrangen.
Mehr und mehr verdichtete sich das Gebüsch am Wege zum tropischen Wald, in dem Palmen und Bananen vorherrschten. Der Pfau, der Fasan und eine große Anzahl besonders schön gefärbter Hühnerarten, Papageien und zahllose kleinere Vögel wiegten sich auf den Zweigen, aber auch Schlangen und Käfer schossen häufig durch das Gebüsch, Insekten aller Art, Bienen und Fliegen von stahlblauer Farbe.
Scharlachfarbige, große Blumenglocken der Bignonia hingen von allen Zweigen herab, reife Tamarinden schaukelten im Wind, der ganze Wellen eines beinahe betäubenden Duftes mit sich führte. Die Sonne sandte ihre glühenden Strahlen durch das Laubdach, Moskitos schwärmten um die Stirnen der Weißen herum – jede Bewegung kostete Ströme von Schweiß.
„In den Felsenhöhlen ist es kühl“, tröstete Richard seinen ermatteten Gefährten, „aber wir können ja auch hier erst ein wenig ausruhen.“
Sie streckten sich in das Gras. Überall schien in jeder Blattfalte, auf jedem Halm und jeder Rinde ein kleines Tier zu leben; es kroch und flog, es summte und schwirrte, während Ingwer- und Zimtbäume, Cardenia und Pfeffersträucher ihre starken Wohlgerüche der heißen Luft mitteilten.
„Sieh das Tier da!“, flüsterte Richard. „Wie mag es heißen?“
Oskar folgte der angedeuteten Richtung. „Ein Chamäleon“, versetzte er, „hier Anoly genannt. Du wirst gleich sehen, wie es in der Erregung die Farben verändert.“
An einer dichten Ranke schaukelte sich ein Geschöpf von etwa sechs Zoll Länge, mit stark ausgebildetem Wickelschwanz und hohen dünnen Kletterbeinen. Der Körper schien einem Katzenbuckel zu gleichen, die Beine waren mit Füßen wie die eines Menschen versehen, aber sämtliche Farben, die diesen hässlichen Körper schmückten, außerordentlich schön.
Große goldglänzende, raublustige Augen sahen aus dem plumpen Kopfe hervor, der Rücken war smaragdgrün, der Bauch weiß und der Kopf scharlachrot; am Halse hing ein Lappen wie beim Hahn. So beobachtete die große Anoly gespannten Blickes einen Gegenstand, den die beiden jungen Leute bis jetzt nicht sehen konnten, der aber bald zum Vorschein kam.
In den Blättern am Boden raschelte es, die Halme bogen sich, ein halb- erstickter Schrei aus der Kehle eines Vogels durchzitterte die Luft, dann wurde alles still, und am unteren Ende der Ranke, auf der die Anoly saß, erschien eine der braunen scheußlichen Vogelspinnen, die sich nur langsam fortbewegte, In ihren vorderen Fangarmen trug sie einen kleinen Vogel, aus dessen durchbissener rosenroter Kehle das Blut in Tropfen hervorsickerte; Zoll um Zoll schleppte die Räuberin das noch zitternde Opfer mit sich, höchstwahrscheinlich, um es in einem Astloch des Tamarindenbaumes zu verstecken und mit Muße auszusaugen.
Aber sie hatte ohne die Anoly gerechnet. Das hässliche Tier saß regungslos in scheinbar träger Ruhe, sobald aber die Spinne bis auf etwa einen Fuß Entfernung von ihm herangekommen war, öffnete es das große Maul und schnellte blitzartig die seltsame, dünne, unten mit einem Wulst versehene Zunge hervor.
Der Wurf war sehr geschickt ausgeführt, einige der langen behaarten Spinnenbeine umgarnt. Die Vogelspinne wand sich unter dem Griff der Eidechse, sie ließ den getöteten Vogel fallen und wollte gewaltsam ihre Glieder befreien, aber während dieses verzweifelten Ringens war das Chamäleon näher gerückt und zog nun im selben Maß, wie es an den scheußlichen Körper seiner Gefangenen herankam, die lange Zunge ein, um endlich mit einem schnellen Ruck die umgarnten Beine abzubeißen. Jetzt war die Spinne hilflos; sie hielt sich mittels der Hinterbeine krampfhaft an der Ranke fest, aber ohne vom Fleck kommen zu können. Die Anoly biss ihr sämtliche Glieder eines nach dem andern in aller Ruhe ab.
„Hast du die Farbenspiele bemerkt?“, flüsterte Oskar.
„Alle, alle. Zuerst, während ich das Tier beobachtete, ging das Scharlachrot der Kehle in grau über, dann wurde es weiß und endlich braun, wie die Ranke, worauf es saß. Nach erfochtenem Siege kehrten Goldgrün und Rot langsam zurück.“
„Sieh dorthin“, rief Oskar. „Schon wieder ein neues Bild!“
Am Stamm der Tamarinde erschien ein zweiter roter Kopf, aber größer als der des Chamäleons; boshafte Augen lugten nach allen Seiten, braune, derbe Schultern schoben sich langsam vorwärts.
„Ein Skorpion!“, rief Richard. „Möglicherweise ist auch er heilig, aber hier soll mich niemand hindern, ihn zu töten.“
Er ergriff einen Stein und wollte eben das giftige Gewürm zerschmettern, als ihn Oskars leise Stimme davon zurückhielt. „Wir können einen neuen Zweikampf beobachten, da – aus den Zweigen der Tamarinde wickelt sich eine Schlange hervor.“
„Wieder eine Kobra?“
„Nein, die rote Schlange der Dschungeln. Siehst du sie noch nicht?“
Unmittelbar über dem Kopfe des Skorpions hing an einem Ast ein dunkelroter, schuppiger Schlangenleib, der sich immer tiefer herabsenkte und eben das Chamäleon ergreifen zu wollen schien, als dieses die Gefahr bemerkte und vor Schreck ins Gras fiel. Blitzschnell schoss die Schlange herab, glitt mit erhobenem Kopfe züngelnd über den Boden und packte den Skorpion, ehe Sekunden vergingen. Ein einziger Biss tötete ihn vollständig.
Dann öffnete die Schlange den Rachen so weit als möglich und sog unzerkleinert, ohne es zu zerkauen, ihr Opfer ein. Je mehr vom Körper des Gewürms verschwand, desto stärker dehnte sich der des roten Würgers aus; als der Skorpion verzehrt war, streckte sich die Schlange zusammengerollt ins Gras, um zu verdauen.
Richards Stein erreichte sie jetzt ungehindert. Ein einziger geschickter Wurf machte ihrem Dasein ein Ende.
Hoch oben im Blau schwebte der weiße Falke, Affen lugten aus den Baumwipfeln hervor, und vom Fluss her stiegen in ganzen Scharen langschnäbelige schwarze Reiher in die Luft empor; Richard mahnte zum Aufbruch.
„Wir müssen die Felsenhöhlen erreichen“, sagte er. „So unter dem Raubgesindel ohne Waffen oder Feuer im offenen Walde die Nacht zu verbringen, wäre doch wohl bedenklich.“
Langsam wanderten sie weiter. Seltsam geformte Blumen hingen ohne Stängel oder Blatt in der Luft, Tiergestalten, Vogelköpfe, Schmetterlinge, meist aus dürrem, blitzgespaltenem Stamme hervorsehend, glühend in den sattesten Farben Indiens – das Geschlecht der Orchideen, denen aus blattloser gewundener Ranke die purpurne, weiße oder farbige Blume sprießt, geheimnisvoll wie ein Märchen, prächtig, keiner anderen Blüte gleich. Ein leiser Hauch kräuselte die sonderbaren Kelche, Insekten saßen darin wie dunkle, glänzende Augen.
Von fern lichtete sich der Wald; graues, verwittertes Gestein, zerklüftet und uralt, schwoll zu einem Berg, dessen oberer Rand die höchsten Bäume um das Dreifache überragte. Als die jungen Leute näher traten, sahen sie eine wohlerhaltene Reihe niedriger Steinsäulen, von einem durchbrochenen, mit vieler Bildhauerarbeit geschmückten Gitter umgeben, dahinter ein undurchdringliches Dunkel, das den Zugang zum Innern des Felsentempels verhüllte.
Wie ein grünes ragendes Tor aus Tausenden und Abertausenden von Zweigen, wölbten sich vor dem Steingitter die Baumkronen mit ihrer Blütenlast. Was Kunst und frommer Wahn erschaffen, das schmückte hier die Natur mit ihrer ganzen verschwenderischen Fülle.
„Da hinein?“, fragte Oskar. „Und ohne Licht?“
„Du wirst gleich sehen, dass wir Fackeln bekommen können. Ich sagte dir ja, die Bettler haben und verkaufen alles.“
Einsam schien die Umgebung, still und feierlich unter dem blauen wolkenlosen Himmel, kein Geräusch störte den Frieden ringsumher, langsamen Schrittes gingen die beiden durch das Säulentor. Rechts und links waren Nischen in den Stein gehauen – und in diesen wurde es urplötzlich lebendig.