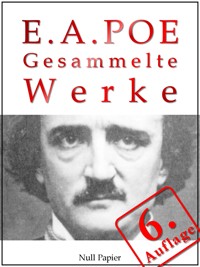
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gesammelte Werke bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Fünfte, überarbeitete Auflage mit zusätzlichen Texten Über 1000 Seiten Edgar Allan Poe ist einer der wichtigsten und einflussreichsten Schriftsteller, der auch weit nach seinem Tod großen Einfluss auf Autoren, Filmemacher und Künstler unserer Zeit hat. Dieses Buch wird Sie ein Stück begleiten bei der Entdeckung dieses großartigen Künstlers. Lesen Sie eine spannende Auswahl aus seinem Werk. Darunter die bekanntesten Gedichte wie "Leonore", "Der Rabe", "Annabel Lee" und Geschichten wie "Der Untergang des Hauses Usher", "Der Doppelmord in der Rue Morgue", "Die schwarze Katze" und viele mehr. Insgesamt erwarten sie auf 1217 Seiten 38 Gedichte, 45 Geschichten, 4 Novellen, Poes einziger Romen "Die denkwürdigen Erlebnisse des Artur Gordon Pym" und ein einführender Aufsatz zu Leben und Werk. Viel Vergnügen bei diesem frühen Meister seines Fachs, der leider viel zu früh verstorben ist. Ausschnitt aus "Der Rabe" Hastig stieß ich auf die Schalter - flatternd kam herein ein alter, Stattlich großer, schwarzer Rabe, wie aus heiliger Zeit hervor, Machte keinerlei Verbeugung, nicht die kleinste Dankbezeigung, Flog mit edelmännischer Neigung zu dem Pallaskopf empor, Grade über meiner Türe auf den Pallaskopf empor - Saß - und still war's wie zuvor. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1489
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edgar Allan Poe
Gesammelte Werke
Edgar Allan Poe
Gesammelte Werke
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 6. Auflage, ISBN 978-3-943466-95-9
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Edgar Allan Poe
Gedichte
Der Rabe
Gebet
Ulalume
Die Glocken
Annabel Lee
An meine Mutter
Das Kolosseum
Das Geisterschloß
Lenore
Israfel
An Marie Louise Shew
An Helene
Eroberer Wurm
An Frances S. Osgood
An Eine im Paradies
Das Tal der Unrast
Die Stadt im Meer
Die Schlafende
Schweigen
Ein Traum in einem Traum
Traumland
An Zante
Eulalie
El Dorado
Für Annie
An --
Braut-Ballade
An F --
An den Fluß
Ein Traum
Romanze
An M. L. S.
An --
Sonett an die Wissenschaft
Hymne
Lied
Märchenland
Der See
Geschichten
Der Untergang des Hauses Usher
Der Mann der Menge
Hinab in den Maelström
Die Maske des roten Todes
Wassergrube und Pendel
Das schwatzende Herz
Der entwendete Brief
Bericht über den Fall Valdemar
Der alte Mann mit dem Geierauge
Die Rache des Zwerges
Eine Geschichte aus dem Felsengebirge
Schweigen
Schatten
Morella
Metzengerstein
Eleonora
Eine Erzählung aus den Ragged Mountains
Du bist der Mann
Die längliche Kiste
Die Insel der Fee
Der Teufel der Verkehrtheit
Der Herrschaftssitz Arnheim
Das ovale Porträt
Berenice
Eine Geschichte aus Jerusalem
Bon-Bon
Das Manuskript in der Flasche
König Pest
Das Stelldichein
Vier Tiere in einem
Ligeia
Der Teufel im Glockenstuhl
William Wilson
Die schwarze Katze
Die Brille
Der Duc de l’Omelette
Lebendig begraben
Des wohlachtbaren Herrn Thingum Bob
Das System des Dr. Teer und Prof. Feder
Die Tatsachen im Falle Waldemar
Die Sphinx
Das Faß Amontillado
Hopp-Frosch
Von Kempelen und seine Entdeckung
Landors Landhaus
Roman & Novellen
Die denkwürdigen Erlebnisse des Artur Gordon Pym
Der Doppelmord in der Rue Morgue
Der Goldkäfer
Das unvergleichliche Abenteuer eines gewissen Hans Pfaall
Das Geheimnis der Marie Rogêt
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Gesammelte Werke bei Null Papier
Edgar Allan Poe - Gesammelte Werke
Franz Kafka - Gesammelte Werke
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
E. T. A. Hoffmann - Gesammelte Werke
Georg Büchner - Gesammelte Werke
Joseph Roth - Gesammelte Werke
Mark Twain - Gesammelte Werke
Kurt Tucholsky - Gesammelte Werke
Rudyard Kipling - Gesammelte Werke
Rilke - Gesammelte Werke
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe (* 19. Januar 1809 in Boston, Massachusetts, USA; † 7. Oktober 1849 in Baltimore, Maryland) prägte entscheidend die Genres der Kriminalliteratur, der Science Fiction und der Horrorgeschichte. Seine Poesie bildete die Basis des aufkeimenden Symbolismus und damit der modernen Dichtung.
Edgar Allan Poe wurde als Sohn der in England geborenen Schauspielerin Elizabeth Arnold Poe und des aus Baltimore stammenden Schauspielers David Poe in Boston geboren. Der Vater verließ die Familie früh, die Mutter starb jung mit 23 Jahren an der Tuberkulose. Der zweijährige Poe, sein zwei Jahre älterer Bruder William Henry Leonard und seine ein Jahr jüngere Schwester Rosalie blieben mittellos zurück.
Edgar Allan Poe und seine Geschwister wurden von verschiedenen Familien aufgenommen. Und obwohl er sich nicht immer in seiner Pflegefamilie akzeptiert fühlte, nahm er deren Familienname Allan als Zweitname an.
1815 zog die ganze Familie wegen geschäftlicher Verpflichtungen nach England, wo Poe von 1816 bis 1817 ein Internat besuchte. Die Wirtschaftskrise von 1819 belastete die Familie sehr, so dass man sich gezwungen fühlte, 1820 wieder in die Vereinigten Staaten zurückzukehren.
Daheim in Richmond genoss Poe weiterhin eine gute Erziehung, zeigte eine hohe Begabung für Sprachen und entwickelte sich zu einem hervorragenden Sportler, insbesondere Schwimmer.
Im Alter von 14 Jahren verliebte sich Poe in Jane Stanard, die 30-jährige Mutter eines Schulfreundes. Jane Stanard starb ein Jahr später, und Poe besuchte wiederholt ihr Grab. 1825 entwickelte sich eine Beziehung zwischen Poe und der etwa gleichaltrigen Sarah Elmira Royster. Diese endete jedoch, als Poe die Universität besuchte und Elmiras Vater, der die Beziehung ablehnte, Poes Briefe an sie abfing. Als Poe von der Universität zurückkehrte, war Elmira mit einem Anderen verlobt.
Im Februar 1826 immatrikulierte sich Poe im Alter von 17 Jahren an der kurz zuvor von Thomas Jefferson gegründeten Universität von Virginia in Charlottesville. Dort studierte er alte und neue Sprachen. In dieser Zeit vertiefte Poe sein Französisch und lernte vermutlich auch etwas Italienisch und Spanisch.
An der Universität verschuldete sich Poe, begann zu spielen und zu trinken. Die genauen Hintergründe sind nicht klar. Nach nur acht Monaten Studium hatte Poe Schulden von 2000 US-Dollar. Als Resultat verschärften sich die Spannungen zwischen ihm und seinem Ziehvater. Was schließlich dazu führte, dass Poe die Familie verließ und nach Boston ging -- wahrscheinlich auch, um Gläubigern zu entgehen. Mitte des Jahres 1827 veröffentlichte er seinen ersten Gedichtband »Tamerlane and Other Poems« -- allerdings auf eigene Kosten. Kurz darauf verpflichtete sich Poe 5 Jahre zur Armee.
Poe wurde mehrmals befördert, 1829 zum Sergeant Major, dem höchstmöglichen Rang für einen einfachen Soldaten. Nach zwei Jahren kaufte sich Poe vorzeitig aus der Armee frei. Das Geld dazu hatte ihm sein Ziehvater nach anfänglichem Widerstand gegeben.
Poe wollte später jedoch seine Karriere als Offizier bei der Armee fortsetzen. Er musste ein Jahr warten, um auf Empfehlung seines Ziehvaters auf der Akademie West Point aufgenommen zu werden. 1830, in den ersten Monaten dort zeichnete er sich durch hervorragende Leistungen aus. Es flammte jedoch der alte Konflikt zwischen ihm und seinen Ziehvater erneut auf, worauf Poe seinen unehrenhaften Rauswurf aus der Akademie provozierte, um seinen Ziehvater zu demütigen.
Am 1. August 1831 im Alter von 24 Jahren starb Poes Bruder William Henry an den Folgen seiner Alkoholkrankheit.
Über Edgar Allan Poes Leben in Baltimore zwischen 1831 und Anfang 1835 ist nur sehr wenig bekannt. Sicher ist, dass er in dieser Zeit begann, Erzählungen zu schreiben, um so ein Einkommen zu erzielen.
Am 16. März 1836 heiratete Poe offiziell seine Kusine Virginia. Auf der Urkunde wird ihr Alter mit 21 angegeben. Tatsächlich war Virginia zu dieser Zeit 13 Jahre alt, Poe 27.
In Richmond, wohin die kleine Familie mittlerweile gezogen war, entstand 1836 Poes Essay »Maelzel’s Chess-Player« über den auch als Schachtürken bekannten Automaten. Zwar war Poe nicht der Erste, der nachwies, dass sich in dem vermeintlichen Roboter ein kleinwüchsiger Mensch verbergen musste, aber die detaillierte Technik seiner Beweisführung bereitete seine späteren Detektivgeschichten vor.
Im Februar 1837 zog Poe für etwa 15 Monate nach New York. Seine Hoffnungen, in New York eine Anstellung bei einer Zeitschrift zu finden, vielleicht sogar ein eigenes Magazin zu gründen, erfüllten sich nicht.
1838 schlug Poe sich mit Arbeiten für verschiedene Zeitschriften durch. In Philadelphia wurde Poe im Juni 1839 Redakteur und später Mitherausgeber von »Burton’s Gentleman’s Magazine«, für das er Artikel über die verschiedensten Themen schrieb.
Im Dezember 1839 erschien die erste Erzählsammlung Poes unter dem Titel »Tales of the Grotesque and Arabesque«. Das Buch wurde überwiegend positiv besprochen.
Anfang 1841 erschien Poes erste Detektivgeschichte »The Murders in the Rue Morgue« (»Der Doppelmord in der Rue Morgue«), für die er den Pariser Detektiv C. Auguste Dupin erfand. Das Wort »detective« kam durch Poe in die englische Sprache.
Im März 1842 lernte Poe in Philadelphia Charles Dickens kennen, dessen Werke er schätzte und wiederholt positiv besprach.
Im April 1844 verließ Poe Philadelphia wieder in Richtung New York -- in der Hoffnung, auf dem dortigen Zeitschriftenmarkt ein besseres Einkommen erzielen zu können.
In New York arbeitete Poe für den Evening Mirror, wo er vor allem journalistische Kurztexte unterschiedlichster Art veröffentlichte und Artikel anderer Journalisten redigierte. Während dieser Zeit entstanden u.a. die Geschichte »The Purloined Letter« (»Der entwendete Brief«) und sein wohl bekanntestes Gedicht »The Raven« (»Der Rabe«).
In seiner New Yorker Zeit betrieb Poe weiterhin Literaturkritik und versteigerte sich in teils polemische Briefwechseln mit anderen erfolgreicheren Autoren. Diese Fehden ließen Poe bei Verlegern und Kollegen in Ungnade fallen. Ein Umstand, der noch lange nach seinem Tode drohte seine literarischen Fähigkeiten und Schöpfungen in Vergessenheit geraten zu lassen.
1847 starb Virginia, deren Gesundheit schon seit Jahren angegriffen war, im Alter von 24 Jahren. Poe brachte seine Trauer unter anderem in dem Gedicht »Annabel Lee« zum Ausdruck.
1849 traf Poe in Richmond seine Jugendliebe Elmira Royster wieder. Sie war mittlerweile verwitwet. Nach kurzer Werbung akzeptierte sie Poes Antrag, und die beiden verlobten sich.
Poe starb am 7. Oktober 1849 in Baltimore. Die Umstände seines Todes sind unklar, die Todesursache ist unbekannt. Es gibt hierzu zahlreiche Theorien, bewiesen ist jedoch keine. Nachgewiesen ist nur, dass er auf dem Weg zu Hochzeitsvorbereitungen für mehrere Tage verschollen ging. Bereits stark geschwächt tauchte er am 03. Oktober 1849 in Baltimore wieder auf, wo er vier Tage später trotz ärztlicher Fürsorge verstarb.
In seinem Heimatland lange Zeit als trunksüchtiger Streitsucher verschrieen, wurde er für die europäische Literaturszene durch seine Übersetzer Charles Baudelaire und Stéphane Mallarmé entdeckt. Schließlich fand er auf diesem Umwege auch die späte, aber verdiente Anerkennung in den USA.
Im deutschsprachigen Raum wurde er Anfang des 20. Jahrhunderts populär, als eine zehnbändige Ausgabe der Werke Poes zwischen 1901 und 1904 herausgegeben wurde.
Poe hatte großen Einfluss auf die Werke von Jules Verne, Arthur Conan Doyle und H. G. Wells. Ebenfalls von großer Bedeutung ist sein lyrisches Werk. Poes Lieblingsthema, das in vielen Geschichten immer wieder auftaucht, ist der Tod einer schönen Frau. Nicht selten Verfallen seine zurückgelassenen, männlichen Protagonisten daraufhin dem Wahn.
Poe verfasste Satiren, Essays, Lyrik und Erzählungen, literaturwissenschaftliche und auch komplexe naturwissenschaftliche Abhandlungen. Es ist schwer, ein Oberbegriff für sein Werk zu finden.
Seit 1922 erinnert das Edgar Allan Poe Museum in Richmond, Virginia an Leben und Werk des Autors.
Gedichte
Der Rabe
Einst in dunkler Mittnachtstunde, als ich in entschwundner Kunde Wunderlicher Bücher forschte, bis mein Geist die Kraft verlor Und mir’s trübe ward im Kopfe, kam mir’s plötzlich vor, als klopfe Jemand zag ans Tor, als klopfe -- klopfe jemand sacht ans Tor. Irgendein Besucher, dacht ich, pocht zur Nachtzeit noch ans Tor -- Weiter nichts. -- So kam mir’s vor. Oh, ich weiß, es war in grimmer Winternacht, gespenstischen Schimmer Jagte jedes Scheit durchs Zimmer, eh es kalt zu Asche fror. Tief ersehnte ich den Morgen, denn umsonst war’s, Trost zu borgen Aus den Büchern für das Sorgen um die einzige Lenor, Um die wunderbar Geliebte -- Engel nannten sie Lenor --, Die für immer ich verlor. Die Gardinen rauschten traurig, und ihr Rascheln klang so schaurig, Füllte mich mit Schreck und Grausen, wie ich nie erschrak zuvor. Um zu stillen Herzens Schlagen, sein Erzittern und sein Zagen, Mußt ich murmelnd nochmals sagen: Ein Besucher klopft ans Tor. -- Ein verspäteter Besucher klopft um Einlaß noch ans Tor, Sprach ich meinem Herzen vor. Alsobald ward meine Seele stark und folgte dem Befehle. »Herr«, so sprach ich, »oder Dame, ach, verzeihen Sie, mein Ohr Hat Ihr Pochen kaum vernommen, denn ich war schon schlafbenommen, Und Sie sind so sanft gekommen -- sanft gekommen an mein Tor; Wußte kaum den Ton zu deuten...« Und ich machte auf das Tor: Nichts als Dunkel stand davor. Starr in dieses Dunkel spähend, stand ich lange, nicht verstehend, Träume träumend, die kein irdischer Träumer je gewagt zuvor; Doch es herrschte ungebrochen Schweigen, aus dem Dunkel krochen Keine Zeichen, und gesprochen ward nur zart das Wort »Lenor«, Zart von mir gehaucht -- wie Echo flog zurück das Wort »Lenor«. Nichts als dies vernahm mein Ohr. Wandte mich zurück ins Zimmer, und mein Herz erschrak noch schlimmer, Da ich wieder klopfen hörte, etwas lauter als zuvor. »Sollt ich«, sprach ich, »mich nicht irren, hörte ich’s am Fenster klirren; Oh, ich werde bald entwirren dieses Rätsels dunklen Flor -- Herz, sei still, ich will entwirren dieses Rätsels dunklen Flor. Tanzt ums Haus der Winde Chor?« Hastig stieß ich auf die Schalter -- flatternd kam herein ein alter, Stattlich großer, schwarzer Rabe, wie aus heiliger Zeit hervor, Machte keinerlei Verbeugung, nicht die kleinste Dankbezeigung, Flog mit edelmännischer Neigung zu dem Pallaskopf empor, Grade über meiner Türe auf den Pallaskopf empor -- Saß -- und still war’s wie zuvor. Doch das wichtige Gebaren dieses schwarzen Sonderbaren Löste meines Geistes Trauer, und ich schalt ihn mit Humor: »Alter, schäbig und geschoren, sprich, was hast du hier verloren? Niemand hat dich herbeschworen aus dem Land der Nacht hervor. Tu mir kund, wie heißt du, Stolzer aus Plutonischem Land hervor?« Sprach der Rabe: »Nie du Tor.« Daß er sprach so klar verständlich -- ich erstaunte drob unendlich, Kam die Antwort mir auch wenig sinnvoll und erklärend vor. Denn noch nie war dies geschehen: über seiner Türe stehen Hat wohl keiner noch gesehen solchen Vogel je zuvor -- Über seiner Stubentüre auf der Büste je zuvor, Mit dem Namen »Nie du Tor«. Doch ich hört in seinem Krächzen seine ganze Seele ächzen, War auch kurz sein Wort, und brachte er auch nichts als dieses vor. Unbeweglich sah er nieder, rührte Kopf nicht noch Gefieder, Und ich murrte, murmelnd wieder: »Wie ich Freund und Trost verlor, Werd ich morgen ihn verlieren -- wie ich alles schon verlor.« Sprach der Rabe: »Nie du Tor.« Seine schroff gesprochnen Laute klangen passend, daß mir graute. »Aber«, sprach ich, »nein, er plappert nur sein einzig Können vor, Das er seinem Herrn entlauschte, dessen Pfad ein Unstern rauschte, Bis er letzten Mut vertauschte gegen trüber Lieder Chor -- Bis er trostlos trauerklagte in verstörter Lieder Chor Mit dem Kehrreim: ›Nie du Tor.‹« Da der Rabe das bedrückte Herz zu Lächeln mir berückte, Rollte ich den Polsterstuhl zu Büste, Tür und Vogel vor, Sank in Samtsitz, nachzusinnen, Traum mit Träumen zu verspinnen Über solchen Tiers Beginnen: was es wohl gewollt zuvor -- Was der alte ungestalte Vogel wohl gewollt zuvor Mit dem Krächzen: »Nie du Tor.« Saß, der Seele Brand beschwichtend, keine Silbe an ihn richtend, Seine Feueraugen wühlten mir das Innerste empor. Saß und kam zu keinem Wissen, Herz und Hirn schien fortgerissen, Lehnte meinen Kopf aufs Kissen lichtbegossen -- das Lenor Pressen sollte -- lila Kissen, das nun nimmermehr Lenor Pressen sollte wie zuvor! Dann durchrann, so schien’s, die schale Luft ein Duft aus Weihrauchschale Edler Engel, deren Schreiten rings vom Teppich klang empor. »Narr!« so schrie ich, »Gott bescherte dir durch Engel das begehrte Glück Vergessen: das entbehrte Ruhen, Ruhen vor Lenor! Trink, o trink das Glück: Vergessen der verlorenen Lenor!« Sprach der Rabe: »Nie du Tor.« »Weiser!« rief ich, »sonder Zweifel Weiser! -- ob nun Tier, ob Teufel -- Ob dich Höllending die Hölle oder Wetter warf hervor, Wer dich nun auch trostlos sandte oder trieb durch leere Lande Hier in dies der Höll verwandte Haus -- sag, eh ich dich verlor: Gibt’s -- o gibt’s in Gilead Balsam? -- Sag mir’s, eh ich dich verlor!« Sprach der Rabe: »Nie du Tor.« »Weiser!« rief ich, »sonder Zweifel Weiser! -- ob nun Tier, ob Teufel -- Schwör’s beim Himmel uns zu Häupten -- schwör’s beim Gott, den ich erkor -- Schwör’s der Seele so voll Grauen: soll dort fern in Edens Gauen Ich ein strahlend Mädchen schauen, die bei Engeln heißt Lenor? -- Sie, die Himmlische, umarmen, die bei Engeln heißt Lenor?« Sprach der Rabe: »Nie du Tor.« »Sei dies Wort dein letztes, Rabe oder Feind! Zurück zum Grabe! Fort! zurück in Plutons Nächte!« schrie ich auf und fuhr empor. »Laß mein Schweigen ungebrochen! Deine Lüge, frech gesprochen, Hat mir weh das Herz durchstochen. -- Fort, von deinem Thron hervor! Heb dein Wort aus meinem Herzen -- heb dich fort, vom Thron hervor!« Sprach der Rabe: »Nie du Tor.« Und der Rabe rührt sich nimmer, sitzt noch immer, sitzt noch immer Auf der blassen Pallasbüste, die er sich zum Thron erkor. Seine Augen träumen trunken wie Dämonen traumversunken; Mir zu Füßen hingesunken droht sein Schatten tot empor. Hebt aus Schatten meine Seele je sich wieder frei empor? -- Nimmermehr -- oh, nie du Tor!
Gebet
Am Morgen -- am Mittag -- im Abendlicht Vernahmst Du, Maria, mein Lobgedicht. In Lust und Leid -- in Wonne und Weh, Gott-Mutter, auch fernerhin mit mir geh! Als strahlende Stunden heiter entwichen Und keine Wolken den Himmel durchstrichen, Führtest Du gnädig die Seele mir Hin zu den Deinen, hin zu Dir. Nun, da Schicksalsstürme schrecken, Dunkel mein Heute, mein Gestern bedecken, Laß mein Morgen strahlend scheinen Im holden Hoffen auf Dich und die Deinen!
Ulalume
Der Himmel war düster umwoben; Verflammt war der Bäume Zier -- Verdorrt war der Bäume Zier; Es war Nacht im entlegnen Oktober Eines Jahrs, das vermodert in mir; War beim düsteren See von Auber, In den nebligen Gründen von Weir -- War beim dunstigen Sumpf von Auber, In dem spukhaften Waldland von Weir. Durch Zypressenallee, die titanisch, Bin ich mit meiner Seele gegangen -- Bin hier einst mit Psyche gegangen -- Zur Zeit, da mein Herz war vulkanisch Wie die schlackigen Ströme, die langen, Wie die Lavabäche, die langen, Die rastlos und schweflig den Yaanek Hinab bis zum Pole gelangen -- Die rollend hinab den Berg Yaanek Zum nördlichen Pole gelangen. Unser Wort war von Dunkel umwoben, Der Gedanke verdorrt und stier -- Das Gedenken verdorrt und stier; Denn wir wußten nicht, daß es Oktober, Und der Jahrnacht vergaßen wir -- Der Nacht aller Jahrnächte wir! Wir vergaßen des Sees von Auber (Obgleich wir gewandert einst hier), Des dunstigen Sumpfs von Auber Und des spukhaften Waldlands von Weir. Und nun, da in alternder Nacht Die Sternuhr gen Morgen sich schob -- Da die Sternuhr gen Morgen sich schob -- Ward am End unsres Pfades entfacht Ein Schimmern, das Nebel umwob, Aus dem mit wachsender Pracht Ein Halbmond sein Doppelhorn hob -- Astartes demantene Pracht Deutlich ihr Doppelhorn hob. »Sie ist wärmer«, so sagte ich, »Als Diana: sie schwärmt durch ein Meer Von Seufzern -- ein Seufzermeer; Sie sah es: die Träne wich Von diesen Wangen nicht mehr, Und vorbei am Löwenbild strich Als Lenker zum Himmel sie her, Als Leiter zu Lethe sie her; Trotz des Löwen getraute sie sich, Uns zu leuchten so hell und so hehr -- Durch sein Lager hindurch wagte sich Ihre Liebe, so licht und so hehr.« Doch Psyche hob warnend die Hand: »Fürwahr, ich mißtraue dem Schein Dieses Sterns -- seinem bleichen Schein. O fliehe! o halte nicht stand! Laß uns fliegen -- denn oh! es muß sein!« Sprach’s entsetzt, und es sanken gebannt Ihre Schwingen in schluchzender Pein -- Ihre Schwingen schleiften gebannt Die Federn in Staub und Stein -- Voll Kummer in Staub und Stein. Ich erwiderte: »Traum ist dies Grauen! Laß uns weiter in Lichtes Pracht -- Laß uns baden in seiner Pracht! Es läßt mich die Hoffnung erschauen In kristallener Schönheit heut nacht -- Sieh! es flackert gen Himmel durch Nacht! Oh! man darf seinem Schimmern vertrauen, Es führt uns mit weisem Bedacht -- Oh! man muß seinem Schimmern vertrauen, Es lenkt uns mit treuem Bedacht, Da es flackert gen Himmel durch Nacht!« Ich beruhigte Psyche und gab Ihr Küsse und lockte sie vor -- Aus Bedenken und Dunkel hervor; Und wir schritten den Baumgang hinab, Bis am Ende uns anhielt das Tor Einer Gruft -- ein märchenhaft Grab. »Schwester«, sprach ich, »was schrieb man aufs Grab -- An das Tor von dem Wundertume?« »Ulalume!« sprach sie; »in dem Grab Ruht verloren für dich Ulalume!« Und mein Herz wurde düster umwoben, Wurde dürr wie der Bäume Zier -- Wurde welk wie der Bäume Zier; Und ich schrie: »Es war sicher Oktober In der nämlichen Nacht, da ich hier Im Vorjahr gewandert -- und hier Eine Last hertrug, fürchterlich mir! Diese Nacht aller Jahrnächte mir, Welcher Dämon verführte mich hier? Gut kenn ich den See jetzt von Auber -- Diese nebligen Gründe von Weir -- Gut kenn ich den Dunstsumpf von Auber -- Dieses spukhafte Waldland von Weir.«
Die Glocken
I.
Hört der Schlittenglocken Klang -- Silberklang! Welche Welt von Lustigkeit verheißt ihr heller Sang! Wie sie klingen, klingen, klingen In die Nacht voll Schnee und Eis, Während sprüh die Sterne springen, Zwinkernd sich zum Reigen schlingen Im kristallnen Himmelskreis: Halten Schritt, Schritt, Schritt, Tanzen Runenrhythmen mit Zu der kleinen klaren Glocken süßem Singesang, Zu dem Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang -- Zu dem Singen und dem Schwingen in dem Klang.
II.
Hört der Hochzeitsglocken Klang -- Goldnen Klang! Welche Welt von Seligkeit verheißt ihr voller Sang! Wie ihr Läuten lauter lacht Durch den Balsamduft der Nacht! Aus dem holden goldnen Schwall, Wie altgewohnt, Fliegen leicht die Töne all Hin zur Turteltaube, die beim frohen Schall Schaut zum Mond. O wie schwillt im Überschwang Ein Guß von hohem Feierklang so voll die Nacht entlang! Hochgesang -- Hoffnungssang Auf der Zukunft heitern Gang! Freude treibt zu schnellerm Drang Dieses Ringen und das Schwingen In dem Klang, Klang, Klang -- In dem Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang -- Dieses Quellen und das Schwellen in dem Klang.
III.
Hört der Feuerglocken Klang -- Bronznen Klang! Welch ein Aufruhr stürmt daraus so schreckenvoll und bang! Wie ihr Schreien Schreck entfacht In durchbebter Luft der Nacht! Zu entsetzt, um klar zu sein, Können sie nur schrein, nur schrein, Ohne Takt Rufen sie in lautem Lärmen um Erbarmen an das Feuer, Zanken in verrücktem Toben mit dem tollen tauben Feuer. Höher, höher, ungeheuer Springt verlangend auf das Feuer; In verzweifeltem Bemühn, Bis zum Mond emporzusprühn, Sind die Flammen steilgezackt. Oh, der Klang, Klang, Klang! Wie er grauenvoll und bang Alles schreckt! Wie er schauert, schallt und braust, Daß den Lüften bangt und graust, Wie er aller Orten lähmendes Entsetzen weckt! Dennoch hört das Ohr sie gut Durch das Schallen Und das Hallen: Ebbe der Gefahr und Flut; Dennoch nimmt das Ohr es wahr Durch das Zanken Und das Schwanken: Flutet oder ebbt Gefahr -- Durch das Stocken und das Schwellen in dem schnellen Glockenklang, In dem Klang -- In dem Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang -- Durch das Härmen und das Lärmen in dem Klang.
IV.
Hört der Eisenglocken Klang -- Eisenklang! Welche Welt von Trauer trägt ihr monotoner Sang! In der Grabesruh der Nacht Wie er uns erschauern macht Durch das Trauern und das Drohen in dem Ton! Denn die Klänge, die entrollen Rostigen Glockenkehlen, tollen Grollend fort. Oh, die Wesen, die dort oben In dem Glockenturme toben -- Einsam dort Mit den monotonen Glocken -- Die da tollen, tollen, tollen, Voll verschleiertem Frohlocken Einen Stein aufs Herz uns rollen -- Leichenfressende Dämonen Sind’s, die in den Glocken wohnen, All im Sold Ihres Königs, der da tollt, Der da rollt, rollt, rollt, Rollt Triumph aus Glockenklang! Und sein Busen schwillt im Drang Des Triumphs aus Glockenklang. Johlend tanzt er zu dem Sang: Haltend Schritt, Schritt, Schritt, Tanzt er Runenrhythmen mit Zum Triumph aus Glockenklang, Glockenklang. Haltend Schritt, Schritt, Schritt, Tanzt er Runenrhythmen mit Zu dem Dröhnen in dem Klang, In dem Klang, Klang, Klang -- Zu dem Stöhnen in dem Klang. Haltend Schritt, Schritt, Schritt, An der Totenglocke Strang Tanzt er Runenrhythmen mit Zu dem Tollen in dem Klang, In dem Klang, Klang, Klang, Zu dem Rollen in dem Klang, In dem Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang -- Zu dem Trauern und dem Schauern in dem Klang.
Annabel Lee
Ist ein Königreich an des Meeres Strand, Da war es, da lebte sie -- Lang, lang ist es her -- und sie sei euch genannt Mit dem Namen Annabel Lee. Und ihr Leben und Denken war ganz gebannt In Liebe -- und mich liebte sie. In dem Königreich an des Meeres Strand Ein Kind noch war ich und war sie, Doch wir liebten mit Liebe, die mehr war denn dies -- Ich und meine Annabel Lee -- Mit Liebe, daß strahlende Seraphim Begehrten mich und sie. Und das war der Grund, daß vor Jahren und Jahr Eine Wolke Winde spie, Die frostig durchfuhren am Meeresstrand Meine schöne Annabel Lee; Und ihre hochedele Sippe kam, Und ach! man entführte mir sie, Um sie einzuschließen in Gruft und Grab, Meine schöne Annabel Lee. Die Engel, nicht halb so glücklich als wir, Waren neidisch auf mich und auf sie -- Ja! das war der Grund (und alle im Land Sie wissen, vergessen es nie), Daß der Nachtwind so rauh aus der Wolke fuhr Und mordete Annabel Lee. Weit stärker doch war unsre Liebe als die All derer, die älter als wir -- Und mancher, die weiser als wir -- Und die Engel in Höhen vermögen es nie Und die Teufel in Tiefen nie, Nie können sie trennen die Seelen von mir Und der schönen Annabel Lee. Kein Mondenlicht blinkt, das nicht Träume mir bringt Von der schönen Annabel Lee, Jedes Sternlein das steigt, hell die Augen mir zeigt Meiner schönen Annabel Lee; Und so jede Nacht lieg zur Seite ich sacht Meinem Lieb, meinem Leben in bräutlicher Pracht: Im Grabe da küsse ich sie -- Im Grabe da küsse ich sie.
An meine Mutter
Weil tief ich fühle, daß in Himmeln dort Die Engel, wenn sie Liebe-Worte nennen, Kein heilig-heißer und kein inniger Wort Als »Mutter« zueinander flüstern können, Drum gab ich diesen liebsten Namen dir -- Die -- mehr denn Mutter mir in meinen Schmerzen -- Der Tod, als er Virginias Geist von hier Befreit, zum Horte setzte meinem Herzen. Die eigne Mutter, die schon früh mir starb, War mir nur Mutter, du hingegen bist Von ihr die Mutter, die mein Lieben warb; Und so viel mehr, als meiner Seele ist Mein Weib denn meiner Seele eignes Leben, Muß ich auch dir denn eigner Mutter geben.
Das Kolosseum
Urbild des alten Rom! Reliquienschrein Für Schaun und hohen Traum, den in die Zeit Jahrhunderte von Pracht und Macht gestellt! Nun endlich -- endlich -- nach so vielen Tagen Von Wandermüdigkeit und gierem Durst (Von Durst zum Quell des Wissens, den du birgst) Ein andrer und demütiger kniee ich In deinem Schatten nun und trinke ein Dein ragend Düster, deinen Glanz und Ruhm. Unendlichkeit und Öde! Schwermut, Schweigen! Uralter Zeit Erinnern -- düstere Nacht! Ich fühl euch jetzt -- fühl eure ganze Wucht -- O Zauber, stärker als Judäas König Voreinst gelehrt im Berg Gethsemane! O Wunder, machtvoller als der Chaldäer Jemals verzückt aus stillen Sternen zog! Hier, wo ein Held einst stürzte, stürzt die Säule. Hier, wo ein goldner toter Adler glänzte, Hält mitternächtig Wacht die Fledermaus. Hier, wo der Damen Roms vergoldet Haar Im Winde wehte, wogt nun Ried und Distel. Hier, wo auf goldnem Thron der Herrscher lehnte, Schlüpft geisterhaft aus ihrem Marmorhaus, Vom Schein des zwiegehörnten Monds beleuchtet, Die flinke Echse schweigend über Steine. Doch halt! Die Mauern -- diese Bogengänge, Hochauf von altem Efeu eingekleidet, Die schwarzen bröckeligen Säulensockel Und düstern Schäfte, dunklen Kapitelle, Zerfallenden und fast verblaßten Friese, Zersprungnen Kranzgebälke -- dieses Wrack -- All diese Steine -- ach, die grauen Steine -- Sind sie denn alles, was der Zahn der Zeit Von all dem Ruhm und ungeheuren Glanz Für mich und für das Schicksal übrigließ? »Nicht alles«, geben mir die Echos Antwort, »Nicht alles, nein! Prophetische Klänge steigen -- Und laute Klänge -- ewig von uns auf, Von allen Trümmern zu den Weisen auf, Wie Melodie von Memnon steigt zur Sonne. Wir leiten alle riesenhaften Geister. In unumschränkter Macht beherrschen wir Mit unserm Schwung die Herzen aller Großen. Wir sind nicht leblos -- wir erblichnen Steine. Nicht alle Macht ist hin -- nicht aller Ruhm -- Nicht aller Zauber unsres hohen Rufes -- Nicht all das Wunder, das uns rund umfaßt -- Nicht all Geheimnis, das in uns verborgen -- Nicht all Erinnern, das wie ein Gewand Uns rund umhängt und überall bedeckt, Und das uns hüllt in mehr als Herrlichkeit.«
Das Geisterschloß
In der Täler grünstem Tale Hat, von Engeln einst bewohnt, Gleich des Himmels Kathedrale Golddurchstrahlt ein Schloß gethront. Rings auf Erden diesem Schlosse Keines glich; Herrschte dort mit reichem Trosse Der Gedanke -- königlich. Gelber Fahnen Faltenschlagen Floß wie Sonnengold im Wind -- Ach, es war in alten Tagen, Die nun längst vergangen sind! -- Damals kosten süße Lüfte Lind den Ort, Zogen als beschwingte Düfte Von des Schlosses Wällen fort. Wandrer in dem Tale schauten Durch der Fenster lichten Glanz Genien, die zum Sang der Lauten Schritten in gemeßnem Tanz Um den Thron, auf dem erhaben, Marmorschön, Würdig solcher Weihegaben, War des Reiches Herr zu sehn. Perlen- und rubinenglutend War des stolzen Schlosses Tor, Ihm entschwebten flutend, flutend Süße Echos, die im Chor, Weithinklingend, froh besangen - - Süße Pflicht! -- Ihres Königs hehres Prangen In der Weisheit Himmelslicht. Doch Dämonen, schwarze Sorgen, Stürzten roh des Königs Thron. -- Trauert, Freunde, denn kein Morgen Wird ein Schloß wie dies umlohn! Was da blühte, was da glühte - - Herrlichkeit! -- Eine welke Märchenblüte Ist’s aus längst begrabner Zeit. Und durch glutenrote Fenster Werden heute Wandrer sehn Ungeheure Wahngespenster Grauenhaft im Tanz sich drehn; Aus dem Tor in wildem Wellen, Wie ein Meer, Lachend ekle Geister quellen -- Weh! sie lächeln niemals mehr!
Lenore
Zerschellt die goldne Schale, ach! Der Geist so fern entflogen! Schickt Glockenschall der Seele nach, die fort zum Styx gezogen! Und Guy de Vere, weinst du nicht mehr? Jetzt oder nie sei trübe! Da liegt, sieh her, und liebt nie mehr Lenore, deine Liebe. Komm! laß vollziehn mit frommem Wort des Grabes Heiligung -- Nichts Königlichres stirbt hinfort als sie, die starb so jung -- Man singe, bete immerfort für sie, die starb zu jung. »Wichte! ihr Reichtum war euch lieb, ihr Stolz war euch verhaßt, Und da die Zarte fiel und blieb, das Grab ihr segnen laßt! Das Ritual und Requiem, wie frommt’s der Heiligung? Durch euch -- durch euch: den bösen Blick? Durch euch: die Lästerung, Die diese Unschuld totgehetzt, die starb -- und starb so jung?« Peccavimus; doch laß Verdruß! Sing wie am Feiertag Ein Lied zu Gott, daß keine Qual die Tote fühlen mag. Lenore schritt voran, und mit ihr flog die Hoffnung traut - - Die unbedacht und toll dich macht -- auf die erkorene Braut: So sanft sie war und wunderbar, erlag sie dem Geschick -- Das Leben noch im gelben Haar, doch nicht in ihrem Blick -- Noch immerdar im gelben Haar, doch Tod in ihrem Blick. »Hinweg! Leicht wacht mein Herz heut nacht: Kein Schmerzlied will ich klagen, Triumph soll meinen Engel sacht im heiligen Fluge tragen. Kein Glockenschlag! daß nicht noch zag die süße Seele werde Bei solchem Ton, aufgleitend schon von der verfluchten Erde: Zu Freunden hin, von Feinden hier, laßt frei die Tote gehen -- Aus Hölle auf zu hohem Rang hoch oben in den Höhen -- Aus Gram und Groll auf goldnen Thron zum Herrn der Himmelshöhen.«
Israfel1
Ein Geist wohnt in den Höhn, »Dessen Herz einer Laute gleicht«; Wie Israfel so schön Singt keiner in den Höhn; Die Sterne, die sich kreisend drehn, Verstummen im Vorübergehn, Wenn der Klang sie erreicht. Und wenn im Weltgetriebe Der wechselnde Mond Am höchsten thront, Erglüht er von Liebe; Und horchend verharren der rote Blitz Und die sieben Plejaden stockenden Schritts Auf ihrem Himmelssitz. Und sie sagen (der sternige Rat Und alle Lauscher in seinem Geleite), Daß Israfel sein Feuer Verdanke jener Leier, Die seine Stimme weihte -- Dem bebenden lebenden Draht Jener ungewöhnlichen Saite. Doch die Höhn, wo der Engel wohnt, Wo hohe Gedanken, Pflicht und Zoll, Wo, erwachsene Gottheit, die Liebe thront, Wo die Huri blickt, sind nah und fern Von all der Schönheit voll, Die wir schätzen an einem Stern. Drum gehst du recht in deinem Drang, O Israfel, du weiser Barde! Verachtend glutenlosen Sang Gab dir der Ruhm den höchsten Rang, Dein ist der Lorbeer, bester Barde! Heiter lebe und lang! Und die Verzückungen drüben, Sie passen zu deinem feurigen Reigen, Deinem Gram, deiner Lust, deinem Haß, deinem Lieben, Sind ganz deiner Inbrunst zu eigen -- Wohl mögen die Sterne schweigen! Ja, der Himmel ist dein! Doch dieser Welt Ist Süß und Sauer gemein; Unsre Blumen können nur -- Blumen sein; Der Schatten deiner Wonne fällt Auf uns als Sonnenschein. O wär ich schnell, Wo Israfel Gewohnt, und er wär ich -- Er säng wohl nicht so flammend hell Ein sterblich Lied; doch ich, Ich säng aus solcher Leier Quell Ein Lied, dem keines glich!
Und der Engel Israfel, dessen Herz eine Laute ist und der die süßeste Stimme hat von allen Gotteskreaturen. -- Koran. <<<
An Marie Louise Shew
Noch unlängst pries der Schreiber dieser Zeilen, Sich brüstend mit besonderem Verstand, »Die Schöpferkraft der Worte« und bestritt, Daß je Gedanken jenseits des Gebiets Der Menschenzunge Menschenhirn entsprängen; Und jetzt gesteht er, seinen Stolz verhöhnend: Zwei Worte sind, zwei seltsam fremde Silben, Italiens Töne, die von Engeln nur In Mondlichttraum sich flüstern lassen, »Tau, Der perlengleich auf Hermons Hügel hängt«, Aus seines Herzens tiefstem Grund bewegte Gedanken, die, wie ungedacht, die Seele Nur von Gedanken sind, weit reicher, wilder Und göttlich-visionärer, als sie selbst Der Seraphharfner Israfel (der doch »Die süßeste der Stimmen hat von allen Geschöpfen Gottes«) jemals äußern könnte. Und ich! Ach, meine Zauber sind gebrochen. Kraftlos entsinkt die Feder meiner Hand. Ob du auch batest drum, ich kann es nicht, Mit deinem teuren Namen etwas schreiben. Ich kann nicht sprechen oder denken, ach, Nicht fühlen mehr; denn das ist kein Gefühl, Dies starre Stehen auf der goldnen Schwelle Weitoffnen Traumtors, da ich regungslos, Entzückt vom prächtigen Ausblick und durchschauert So auf dem rechten wie dem linken Weg, Weithin den ganzen Weg, in Purpurdunst Bis fern ans Ende sehe -- dich allein.
An Helene
Ich sah dich einmal -- einmal nur -- vor Jahren: Ich sage nicht wie vielen -- doch nicht vielen. Es war in Julinacht, und aus dem vollen Kreisrunden Mond, der gleich wie deine Seele Den steilsten Weg hinauf zum Himmel suchte, Fiel sanft ein silberseidner Schleier Licht -- Fiel still und schwül und schlummerselig nieder Auf tausend Rosen, die nach oben schauten Und die in einem Zaubergarten wuchsen, Wo Wind auf Zehen nur sich rühren durfte -- Auf Rosen fiel er, die nach oben schauten, Die ihre Seelen in verzücktem Sterben Als Duft aushauchten in das Liebe-Licht -- Auf Rosen fiel er, die nach oben schauten, Die lächelten und starben, wie verzaubert Von dir und deines Wesens Poesie. Ich sah dich ganz in Weiß, auf Veilchenbeet; Auf offne Rosen, die nach oben schauten, Fiel hell der Mond -- und auch auf dein Gesicht, Das aufwärts schaute -- schaute, ach, in Leid. War das nicht Schicksal, das in dieser Nacht -- War das nicht Schicksal (das auch Leiden heißt), Das mir vorm Gartentore Halt gebot, Den Schlummerduft der Rosen einzuatmen? Kein Schritt: in Schlaf lag die verhaßte Welt; Nur du und ich -- (o Gott, wie schlägt mein Herz, Da ich zusammen die zwei Worte nenne!) -- Nur wachend du und ich. Ich stand, ich blickte -- Und plötzlich loschen alle Dinge aus. (Bedenkt es wohl, es war ein Zaubergarten!) Der Perlenglanz des Monds erlosch, die Beete, Die moosigen Beete und gewundnen Pfade, Die frohen Blumen, säftevollen Bäume -- Nichts sah man mehr; und selbst der Duft den Rosen Erstarb im Arm anbetend stiller Lüfte. All alles außer dir verschied, verhauchte, Nichts blieb als du -- als weniger denn du: Als nur das Himmelslicht in deinen Augen -- Als deine Seele nur in deinen Augen. Ich sah nur sie -- sie waren mir die Welt. Ich sah nur sie -- sah stundenlang nur sie -- Sah nichts als sie, bis daß der Mond sich senkte. Welch wundersame Herzgeschichten sprachen Aus jenen himmlischen kristallnen Kugeln! Welch dunkles Weh! Und doch welch hehres Hoffen! Welch heiter schweigend Meer erhabnen Stolzes! Welch kühne Ehrbegier! Und doch welch tiefe -- Unfaßbar tiefe Liebe-Fähigkeit! Doch jetzt, doch endlich sank Diana hin In westliches Gewitterwolken-Pfühl; Und du entglittst wie Geist dem Grabesschatten Der Bäume dort. Nur deine Augen blieben! Sie gingen nicht -- sie sind nie mehr gegangen! In jener Nacht mir sorgsam heimwärts leuchtend Verlaß’nen Pfad, verließen sie mich nie -- Nie mehr (wie all mein Hoffen doch getan). Sie folgen mir -- sie leiten mich durchs Jahr. Sie sind mir Diener -- dennoch ich ihr Sklave. Ihr Amt ist: zu beleuchten, zu entflammen -- Mein Dienst: beseligt sein durch ihren Glanz, Gereinigt sein durch ihr elektrisch Feuer, Geheiligt sein in ihrem Himmelsfeuer. Sie füllen mir mein Herz mit Schönheit an (Die Hoffen ist) und sind im Himmel droben Das Sternenpaar, vor dem ich kniend liege Im traurigstummen Wachen meiner Nacht; Indes sogar im Mittagsglanz des Tages Ist noch sie sehe -- holde Zwillingsschwestern, Venusse, die kein Sonnenlicht verlöscht!
Eroberer Wurm
O schaut, es ist festliche Nacht Inmitten einsam letzter Tage! Ein Engelchor, schluchzend, in Flügelpracht Und Schleierflor sieht zage Im Schauspielhaus ein Schauspiel an Von Hoffnung, Angst und Plage, Derweil das Orchester dann und wann Musik haucht: Sphärenklage. Schauspieler, Gottes Ebenbilder, Murmeln und brummeln dumpf Und hasten planlos, immer wilder, Sind Puppen nur und folgen stumpf Gewaltigen düsteren Dingen, Die umziehn ohne Form und Rumpf Und dunkles Weh aus Kondorschwingen Schlagen voll Triumph. Dies närrische Drama! -- O fürwahr, Nie wird’s vergessen werden, Nie sein Phantom, verfolgt für immerdar Von wilder Rotte rasenden Gebärden, Verfolgt umsonst -- zum alten Fleck Kehrt stets der Kreislauf neu zurück -- Und nie die Tollheit, die Sünde, der Schreck Und das Grausen: die Seele vom Stück. Doch sieh, in die mimende Runde Drängt schleichend ein blutrot Ding Hervor aus ödem Hintergrunde Der Bühne -- ein blutrot Ding. Es windet sich! -- windet sich in die Bahn Der Mimen, die Angst schon tötet; Die Engel schluchzen, da Wurmes Zahn In Menschenblut sich rötet. Aus -- aus sind die Lichter -- alle aus! Vor jede zuckende Gestalt Der Vorhang fällt mit Wetterbraus: Ein Leichentuch finster und kalt. Die Engel schlagen die Schleier zurück, Sind erbleicht und entschweben in Sturm, »Mensch« nennen sich sie das tragische Stück, Seinen Helden »Eroberer Wurm«.
An Frances S. Osgood
Dein Herz sucht Liebe? -- So möge es nie Vom jetzigen Pfade weichen, Sei, was du bist, und wolle nie Dem, was du nicht bist, gleichen -- So wird die Welt deinem sanften Sein, Deiner Anmut ein unendlich Und freudevolles Preislied weihn, Und Liebe wird selbstverständlich.
An Eine im Paradies
Du warst für mich all dieses, Lieb, Was Seele füllt und Sein, Warst Inselgrün im Meere, Lieb, Springbrunn und Altarstein Voll Frucht- und Blumenwunder, Lieb, Und all das Blühn war mein! O Traum, dem Sterben kam! O Sternenhoffen, dessen Licht Sturmwolke mir benahm! Ein Rufen aus der Zukunft spricht: »Voran! Voran!« -- Doch Gram Um das, was war, nimmt Zuversicht, Macht müd und flügellahm. Denn weh! des Lebens warmer Glanz Erstrahlt für mich nicht mehr! Die Woge raunt im Brandungstanz Zum Sand: nie mehr -- nie mehr Wird wundgeschossne Schwinge ganz, Dürr bleibt der Baum und blätterleer, Dem jäh ein Blitz zerschlug den Kranz. Und Tag ist Traum, der zu dir wacht, Und Nacht ist Traum und leitet Hin, wo dein dunkles Auge lacht Und wo dein Fuß hinschreitet, Der in ätherischen Tänzen sacht -- Auf welchen Strahlen gleitet?
Das Tal der Unrast
Einstmals war ein stilles Tal, Unbewohnt; mit Schild und Stahl Zog das Volk in Kriege fort; Hielten milde Sterne dort Vom arzurnen Turm zur Nacht Über all die Blumen Wacht, Über denen jeden Tag Rot und faul die Sonne lag. Jetzt wird jeder Wandrer sehen Unrast dieses Tal durchwehen, Nichts ist da, das nicht sich regt, Luft nur brütet unbewegt Ob der Zauber-Einsamkeit. Ach, kein Lüftchen weit und breit Rührt der Bäume Blätterkleid, Die da pulsen ohne Frieden Gleich dem Eismeer der Hebriden. Ach, kein Lüftchen jagt und bauscht Das Gewölk, das ruhlos rauscht, Rastlos rauscht von früh bis spät Über Myriadenbeet Blauer Veilchen, sorgenreich, Myriaden Augen gleich, Über Lilien, die so weich Wehend, weinend schaun herab Auf ein namenloses Grab! Wehend: aus dem Duft heraus Kommen Tropfen ewigen Taus. Weinend: von den zarten Zweigen Ewig Tränen niedersteigen, Die gleich Edelsteinen schweigen.
Die Stadt im Meer
Weh! wunderliche, einsame Stadt, Drin Tod seinen Thron errichtet hat, Tief unter des Westens düsterer Glut, Wo Sünde bei Güte, wo Schlecht bei Gut In letzter ewiger Ruhe ruht. An Schlössern, Altären und Türmen hat (Zerfreßnen Türmen, die nicht beben!) Nichts Gleiches eine unsrige Stadt. Von Winden vergessen, die wühlen und heben, Stehn unterm Himmel die Wasser ringsum, Schwermütige Wasser, ergeben und stumm. Kein Strahlen vom Himmel kommt herab Auf jener Stadt langnächtiges Grab. Doch steigt ein Licht aus dem Meere herauf, Strömt schweigend an kühnen Zinnen hinauf, Hinauf an Türmen bis zum Knauf, Hinauf an Palästen, an Zitadellen, An Tempeln hinauf und an Babylonwällen, Hinauf an vergessenen Laubengängen Mit eingemeißelten Fruchtgehängen, Hinauf an manchem Opferstein, Auf dessen Friesen zu engem Verein Verflochten Viola, Violen und Wein. Stehn unterm Himmel die Wasser ringsum, Schwermütige Wasser, ergeben und stumm. Die Mauern und Schatten wie Nebelduft -- Es scheint, als hänge alles in Luft. Vom Turm, der herrschend ragt und droht, Schaut riesenhaft herab der Tod. Geöffnete Tempel und Totengrüfte Gähnen auf leuchtende Meeresschlüfte. Doch nicht die blitzenden Juwelen In goldner Götzen Augenhöhlen Und nicht der reiche Tod verführen Die starren Wasser, sich zu rühren: Kein kleinstes Wellchen kommt in Gang Die gläserne Einöde entlang; Kein Kräuseln erinnert, daß weniger leer Von Wind ist irgendein anderes Meer, Nichts sagt, daß je ein Wehen war Auf Meeren, die weniger grauenhaft klar. Doch, oh -- es regt sich leis wie Wind! Ein Wellen durch das Wasser rinnt -- Als ob die Türme im sachten Sinken Die Flut verschöben zur Rechten und Linken -- Als ob schon die Spitzen inmitten des blassen Himmels Lücken zurückgelassen. Ein roteres Glimmen steigt heran -- Die Stunden halten den Atem an -- Und wenn die Stadt hinab, hinab Von hinnen sinkt mit unirdischem Stöhnen, Wird ihr von eintausend Thronen herab Der Gruß der Hölle tönen.
Die Schlafende
In tiefe Junimitternacht Der mystische Mond herniederwacht. Einschläfernde Nebel dunsten leise Heraus aus seinem goldnen Kreise Und triefen sanft wie Schlummerlieder Tropfen um Tropfen sachte nieder Auf Höhen, schimmernd wie Opal, Und in das allumfassende Tal. Auf einem Grab nickt Rosmarin, Träg lehnt die Lilie drüber hin. Von leerem Nebel überdacht Fault die Ruine hinein in Nacht. Wie Lethe sieh den Weiher ruhn, Scheint tiefen, tiefen Schlaf zu tun, Nicht um die Welt erwachte er nun. Alle Schönheit schläft! -- und ach! wo liegt (Ihr Fenster den Himmeln geöffnet) -- wo liegt Irene, vom Schicksal eingewiegt! O Schönste! -- ach! ich steh’ betroffen: Das Fenster weit dem Nachtwind offen? Die Lüfte fallen im Mondenschein Vom Baum herab durchs Gitter ein -- Sie flüchten flüsternd wie Geisterschar Durch dein Gemach und stoßen gar Am Bett den bunten Baldachin So schaurig her, so schaurig hin Über des Auges geschlossene Glut, Darunter die schlummernde Seele ruht, Daß Schatten gleich Gespenstern weben Und Wand und Boden irr beleben. O liebe Dame, banget dir? Warum und was nur träumst du hier? Gewiß, du kamst von fernstem Meer, Ein Wunder, in diesen Garten her! Seltsam deine Blässe! Seltsam dein Kleid! Die Locken länger als jederzeit! Seltsam die düstere Feierlichkeit! Sie schläft! Und wie sie dauernd ruht, So ruhe sie auch tief! Und gut Hab Himmel sie in heiliger Hut! Heiliger sie jetzt und der Raum, Schwermütiger sie als je ihr Traum. O Gott! laß nie ihren Schlaf vergehn, Ihr Auge nie sich öffnen und sehn, Indes die Gespenster vorüberwehn! Meine Liebe, sie schläft! Wie dauernd sie ruht, So ruhe sie auch tief und gut; Leis krieche um sie die Würmerbrut! Mög fern im Forst, in Düster und Duft, Für sie sich auftun eine Gruft -- Eine Gruft, die oft das schwarze Tor Aufwarf vor bangem Trauerchor, Triumphierend über den Wappenflor Der Toten aus ihrem erhabenen Hause -- Eine Gruft, entlegen wie Einsiedlerklause, Deren Tor ihr einst beim kindlichen Spiel Für manchen Stein gedient als Ziel -- Ein Grab, aus dessen tönendem Tor Sie nimmermehr zwingt ein Echo hervor, Das dröhnend dem Kind in die Ohren rollte, Als sei es der Tod, der da drinnen grollte.
Schweigen
In Eins verleibt, in engster Innigkeit Sind Kräfte: doppellebig -- so geschweißt Ein Bild von jener Zwillings-Wesenheit Aus Stoff und Licht, die Körper ist und Geist. Da ist ein zweifach Schweigen -- Strand und Meer -- Körper und Seele. Einer wohnt am Ort, Jüngst übergrünt; ein tränenvolles Wort, Gedenken und Ehrzeichen, ernst und hehr, Verhüllen alles Graun -- er heißt: Nie mehr! Er ist vereinigt Schweigen; fürcht ihn nicht, Da ihm zum Bösen alle Macht gebricht. Doch solltest du begegnen (traurig Los!) Seinem Gespenst (dem Kobold Namenlos, Der spukt auf nie vom Mensch betretnen Pfaden Der Einsamkeit), befiehl dich Gottes Gnaden.
Ein Traum in einem Traum
Auf die Stirn nimm diesen Kuß! Und da ich nun scheiden muß, So bekenne ich zum Schluß Dies noch: Unrecht habt ihr kaum, Die ihr meint, ich lebte Traum; Doch, wenn Hoffnung jäh enflohn In Tag, in Nacht, in Vision Oder anderm Sinn und Wort -- Ist sie darum weniger fort? Schaun und Scheinen ist nur Schaum, Nichts als Traum in einem Traum! Mitten in dem Wogenbrand Steh’ ich an gequältem Strand, Und ich halte in der Hand Körner von dem goldnen Sand -- Wenig, dennoch ach, sie rinnen Durch die Finger mir von hinnen -- Weinen muß ich, weinend sinnen! Ach, kann ich nicht fester fassen, Um sie nicht hinwegzulassen? Ach, kann ich nicht eins in Hut Halten vor der Woge Wut? Ist all Schaun und Schein nur Schaum -- Nichts als Traum in einem Traum?
Traumland
Auf Pfaden, dunkel, voller Grausen, Wo nur böse Engel hausen, Wo ein Dämon, Nacht genannt, Auf schwarzem Thron die Flügel spannt, Aus letztem düsterm Thule fand Ich jüngst erst her in dieses Land -- Aus Zauberreich, so wild und weit, Fern von Raum, fern von Zeit. Ewig bodenlose Schlünde, Klüfte, Schlüfte ohne Gründe, Unbegrenzte Wassermassen, Die sich nie in Ufer fassen, Wälder, die kein Ende nehmen, Die -- titanenhafte Schemen -- Tropfend stehn in Nebeltau, Endlos wuchtend, endlos grau! Berge, endlos niederfallend, Meere, in kein Ufer wallend, Meere, die urewig fluten, Himmel, die urewig gluten, Weiher, die unendlich breiten Stummer Wasser Einsamkeiten, Die in Tod und Stille liegen Und den Schnee der Lilie wiegen. Bei den Weihern, die da breiten Stummer Wasser Einsamkeiten, Die in Tod und Trauer liegen Und den Schnee der Lilie wiegen; Bei den Bergen, bei den Flüssen, Die so ruhlos murmeln müssen; Bei den Wäldern, bei den Sümpfen, Wo bei schwarzverfaulten Stümpfen Molch und Kröte lauernd schleichen; Bei den Pfuhlen und den Teichen, Wo gefräßige Dämonen Gierig bei den Leichen wohnen; Bei den trüben Sündenquellen, Die in giftigen Dünsten schwellen -- Trifft der Wandrer voller Bangen Alles, was schon lang vergangen: Totenhemden, die sich blähen, Schemen, die aus Schatten spähen, Freunde, lang schon aus dem Leben, Erd -- und Himmel übergeben. Für das Herz voll tausend Wehen Ist es hier ein friedvoll Gehen -- Für den Geist, den Schatten bannt, Ist’s ein paradiesisch Land! Doch wer wandert durch dies Grauen, Wage niemals aufzuschauen, Nie den schwachen Blick zu heben In das Weben und das Beben, Senke das bewimpert Lid, Daß es kein Geheimnis sieht. So des Königs Machtbefehle. Und so darf die trübe Seele Hier nur im Vorübergehen Durch getrübte Gläser sehen. Auf Pfaden, dunkel, voller Grausen, Wo nur böse Engel hausen, Wo ein Dämon, Nacht genannt, Auf schwarzem Thron die Flügel spannt -- Aus jenem letzten Thule fand Ich jüngst erst heim in dieses Land.
An Zante
O schöne Insel, die den schönen Namen Sich von der süßesten der Blumen nimmt, Ach, daß bei deinem Schaun mich überkamen All jene Stunden, die einst froh gestimmt! Wie viele Szenen lang versunkner Wonne! Wie viel Gedenken an begrabnen Traum -- Ach, an ein Mädchen, das in deiner Sonne Nie mehr hinschreitet durch den Bradungsschaum! Nie mehr! Das ist der zaubrisch trübe Klang, Der alles wandelt! Nie soll dein Gedenken Mehr meiner Seele eine Freude schenken! Verflucht erscheint mir nun dein blumiger Hang, O hyazinthne Insel! purpurn Zante! »Isol d’oro! Fior di Levante!«
Eulalie
Ich weilte allein In der Welt voll Pein, Und mein Herz war wie Sumpf so seicht, Bis die schöne und sanfte Eulalie mir errötend die Hand gereicht -- Bis die blonde und junge Eulalie mir lächelnd die Hand gereicht. Ach, weniger klar Die Sternennacht war Als die Augen der strahlenden Maid! Und nimmer ist Hauch Vom zartesten Rauch, Dem Mond seinen Sternenglanz leiht, So schön wie der Locke Eulalies bescheidene Lieblichkeit -- So schön wie der Locke Eulalies gleichgültige Lieblichkeit. Nun Zweifel -- nun Pein Kehr nimmermehr ein, Denn Seufzer um Seufzer strebt Ihre Seele mir zu, Und all Tag in Ruh Astarte am Himmel schwebt, Indessen zu ihr lieb Eulalie ihr mütterlich Auge hebt -- Indessen zu ihr jung Eulalie ihr Veilchenauge hebt.
El Dorado
Ein Ritter, hehr Von Art und Ehr’, Durch Sonnenschein zog und Schatten. Er ritt gar lang Durchs Land und sang Und suchte El Dorado. Doch wurde alt Die Reckengestalt, Ihm sank ins Herz ein Schatten, Denn nirgends er fand Ein Fleckchen Land, Das aussah wie El Dorado. Und als er gar Entkräftet war, Da traf er Pilger Schatten -- Den sprach er an: »Schatten, wo kann Es liegen: El Dorado?« »Reit immerzu Über Mondberge du Hinab ins Tal des Schattens, Reit fort und fort« -- War Schattens Wort -- »Dort findest du El Dorado.«
Für Annie
Gottlob! die Gefahr Ist nun endlich vorbei, Von schleppender Krankheit Ward endlich ich frei -- Ward sieghaft vom Fieber, Dem »Leben«, nun frei. Ich weiß es, ich kann Keine Taten mehr tun, Keinen Muskel mehr regen, Nur langgestreckt ruhn -- Was tut es! Jetzt fühl’ ich Mich besser im Ruhn. Und ich liege so friedlich, Errettet von Not, Daß wer an mein Bett tritt, Vermeint, ich sei tot -- Erschrickt bei dem Anblick Und meint, ich sei tot. Das Ächzen und Krächzen, Die seufzende Plag’ Ist nun endlich vorbei Mit dem schrecklichen Schlag, Mit des Herzens entsetzlichem Schrecklichem Schlag! Das Übel -- der Ekel -- Die ruhlose Not -- Hörte auf mit dem Fieber, Das im Hirn mir geloht -- Mit dem Fieber, dem »Leben«, Das wahnvoll geloht. Und von allen Foltern Ich jener genas, Die am schrecklichsten quälte, Am furchtbarsten fraß: Des Durstes nach Liebe, Nach Lieb ohne Maß -- Nun trank ich ein Wasser, An dem ich genas. Ein Wasser, das flutet Mit schläferndem Klang, Das nah unterm Boden Sich gräbt seinen Gang -- Wenig Fuß in dem Grunde Sich gräbt seinen Gang. Und ach, daß doch nimmer Die Dummheit es spricht, Daß enge mein Bette, Ohne Luft, ohne Licht -- Denn in anderen Betten Da ruht es sich nicht, Und zum Schlafen bedarfst du Solch Bett ohne Licht. Die gemarterte Seele, Hier ruht sie sich aus, Vergißt, und vermißt nicht Den duftenden Strauß Von Myrten, von Freude -- Den Rotrosenstrauß. Denn drunten da ruht sie In heiligerm Hauch, In süßestem Duften Von Rosmarinstrauch -- In Blauveilchenduften Und Rosmarinhauch -- In Trauer und Treue Von Rosmarinstrauch. Und da liegt sie nun heiter In Träume gebannt Von Treue und Schönheit Von Annie, gebannt In Träume von Annie, Von Locken umspannt. Sie küßte mich innig, So zärtlich bewußt, Dann fiel ich in Schlummer Dort an ihrer Brust -- In traumtiefen Schlummer An himmlischer Brust. Als das Licht dann erloschen, Da deckt’ sie mich warm, Und sie bat zu den Engeln, Mich zu hüten vor Harm -- Zu der Herrin der Engel, Mich zu schirmen vor Harm. Und ich liege so friedlich, Errettet von Not (Denn ich weiß ihre Liebe), Daß ihr meint, ich sei tot -- Und ich ruh’ so gelassen, Errettet von Not (Ihre Liebe im Busen), Daß ihr meint, ich sei tot -- Nur schaudernd mich anschaut Und denkt, ich sei tot. Doch mein Herz das strahlt heller, Als am Himmelsthron sprüht Der Sterne Gewimmel, Da von Annie es glüht -- In der Liebe von Annie Erstrahlet und glüht, Im Gedanken an Annies Lichtaugen erglüht.
An --
Ich sorge nicht, daß mein Erdenlos Wenig von Erde trägt, Daß Haß in Minute erbarmungslos Jahre der Liebe schlägt. Ich klage nicht, daß mehr an Glück Der Einsame hat denn ich -- Doch daß Du sorgst um mein Geschick -- Um diesen Wandrer -- mich!
Braut-Ballade
Der Ring an meiner Hand, Der Kranz aufs Haar gesetzt -- Mein ist nun Prunk und Tand Und wunderbar Gewand, Und ich bin glücklich jetzt. Und mein Herr, er liebt mich sehr; Doch sein Schwur hat mich entsetzt -- Sein Wort klang dumpf und schwer Wie Grabgeläute her Und klang, als spräche er, Der kämpfend fiel im Heer -- Und der wohl glücklich jetzt. Doch er beruhigte mich Mit sanftem Kuß zuletzt, Indes ein Träumen mich Zum Kirchhof trug und ich D’Elormie, dem Toten, mich Vermählte innerlich. »O ich bin glücklich jetzt!« Und so war das Wort gesprochen Und der Schwur, der Pflichten setzt; Und sei auch die Treu’ gebrochen, Und sei auch mein Herz gebrochen -- Der Ring, er hat gesprochen, Er zeigt mich glücklich jetzt. Wollt’ Gott, ich könnte lassen Den Traum, der so mich hetzt! Meine Seele kann’s nicht fassen, Ich muß in Reu erblassen, Daß der Tote, so verlassen, Nicht glücklich sein mag jetzt.
An F --
Geliebte! mitten in der Qual, Die meinen Erdenpfad umdrängt (Ach, trüber Pfad, den nicht einmal Einsam erhellt einer Rose Strahl), Meine Seel’ an einem Troste hängt: An Traum von dir -- der allemal Mir Frieden bringt aus Edens Tal. So ist das Deingedenken mir Wie fern verwunschnes Inselland Inmitten aufgewühlter Gier Des Ozeans: ein Meer-Revier In Sturm -- indes doch unverwandt Ein heitrer Himmel blauste Zier Grad über jenes Eiland spannt.
An den Fluß
Du schöner Fluß mit deiner Flut, Die niemals stille hält. Du bist ein Bild von Jugendmut, Von einem Herzen unverstellt. Doch wenn in dein kristallnes Blau, Das trübe Augen scheuen, Die Liebste blickt, gleichst du genau Mir selbst, ihrem Getreuen. Denn dies Herz birgt wie du so rein Ihr Bild und strahlt bewegt, Wenn es den teuren Widerschein In seinen Tiefen hegt.
Ein Traum
Oft fand ich mein entschwundnes Glück In einem nächtlichen Gesicht, Doch ließ mich hoffnungslos zurück Ein wacher Traum im Tageslicht. Ach, was ist nicht ein solcher Traum Für ihn, der mitten in der Flucht Der Dinge über Zeit und Raum Der Seele einen Stützpunkt sucht! O dieser Traum -- dieweil in Qual Und Wirrnis um mich lag die Welt -- Hat wie ein Schutzgeist manches Mal Sich zu mir Einsamen gesellt. Was durch der Täuschung Dämmerlicht So tröstend schimmerte von fern -- War es dem Herzen teurer nicht, Als selbst der Wahrheit Tagesstern?
Romanze
Romanze, die am Nachmittag Gern traumhaft nickt und singt im Hag, Wo überm schattendunklen Teich Die Zweige säuseln sacht und weich -- Einst warst du, da ich wild und frei, Ein Kind, doch wissend, Tag für Tag Dir lauschend unterm Baume lag, Ein seltner bunter Papagei Aus einem fremden Wunderland, Den ich doch Laut für Laut verstand. Doch nun umkreist den Weltenbau Der Kondorflug der Zeit so rauh, Daß in der tosenden Gefahr Ich aller seligen Muße bar. Und wenn mit sanfterem Flügelschlag Den unruhvollen Geist ein Tag Auch wohl entführt in Träumerei’n -- Dann litte meine Seele Pein, Wenn sie bei Leier und Gesang Nicht bebte mit dem Saitenstrang.
An M. L. S.
Von allen, die dich preisen wie den Morgen, Die, wenn du fern bist, wähnen, es sei Nacht, Am Himmel erloschen sei die Sonne -- Von allen, die dich unter Tränen segnen, Daß du die Hoffnung ihnen wiedergabst, Ja, mehr noch, ihren tief begrabenen Glauben An Wahrheit -- Tugend -- Menschlichkeit; Von allen, die vom Bette der Verzweiflung, Wo hingestreckt sie lagen, sich erhoben Bei deinem sanftgesprochnen Wort: »Es werde Licht!« Dem sanftgesproch’nen Wort, das sich erfüllte Im engelreinen Schimmer deiner Augen; Von allen, die dir danken, deren Dank Anbetung gleichkommt -- o gedenke Des Wahrsten, innigst dir Ergebenen, Der, während er dies niederschreibt, erbebt zu denken, Daß er mit einem Engel Zwiesprach halte.
An --
Die Kelche, oft im Traum erschaut, Wo Singvögel sich wiegen, Sind deine Lippen -- und der Laut Melodisch draus entstiegen -- Dein Augenstrahl, mir sanft erglüht, Fällt mitten in dem Dunkel Auf mein undüstertes Gemüt Wie eines Sterns Gefunkel. Dein Herz -- dein Herz, seufz’ ich gepreßt Und träume bis zum Tage Vom Glück, das sich nicht greifen läßt. Doch will, daß man es wage.
Sonett an die Wissenschaft
O Wissenschaft! Du Sproß der Greisin Zeit, Vor dessen Späherblick nichts sicher ist! Du Geier, fluglahm vor der Wirklichkeit, Was spürst du nach dem Dichter so voll List? Wie sollte er -- wenn schon du weise bist -- Dich lieben, die ihm seine Wanderung, Mit der er Sternengegenden durchmißt, Mißgönnt und seinen adlergleichen Schwung? Vertriebst du nicht die Götterliebespaare? Aus Fluß und Hain die Nymphen und Najaden, Daß sie sich flüchteten ins Unsichtbare? Verscheuchtest du nicht von den Wiesenpfaden Die Elfen -- und von mir den Sommertraum Des Mittags unterm Tamarindenbaum?
Hymne
Wenn ich des Morgens mich erhob, Maria! hörtest du mein Lob. Legte ich mich zum Schlummer hin. Pries ich dich, Himmelskönigin. Als noch die Stunde hell entflog, Den Himmel kein Gewölk umzog, Nahmst du, wie eine Mutter tut, Mein schwaches Herz in deine Hut. Nun, da die Tage freudlos fliehn, Mein Leben Stürme überziehn, Mach meine Zukunft wieder licht Durch Hoffnung und durch Zuversicht.
Lied
Ich sah dich unterm Myrtenkranz Erröten tief und zag, Da noch die Welt in eitel Glanz Und Liebe vor dir lag. Von allem Prunk und Flackerlicht In deinem Brautgeleit Sah mein geblendetes Gesicht Nur deine Lieblichkeit. Mag sein, daß jene scheue Glut Nur flüchtig dich berührt, Mir aber ward davon das Blut Zur Flamme angeschürt. Da ich dich unterm Myrtenkranz Erröten sah so zag, Obwohl die Welt in eitel Glanz Und Liebe vor dir lag.
Märchenland
Ströme und dunkle Täler und Tiefen, In wolkengleichen Wäldern versteckt, Deren Formen uns ganz verdeckt, Weil sie von bleiernen Nebeln triefen. Riesige Monde, die wachsen und schwinden Des Nachts drüber her ohne Unterlaß, Von deren Atem, frostig und naß, Die Sterne erlöschen oder erblinden. Ihr Kern sinkt auf die Bergesspitzen, Doch ihre Lichtkreise wogen schwer Über dem großen Wäldermeer Und dringen in alle Schlünde und Ritzen, Bis alle Irrgänge weit und breit Umsponnen sind von Müdigkeit Und sie des Schlafes Leidenschaft Umfängt mit zaubertiefer Haft. Des Morgens aber entschweben Die Mondeshüllen, wirr zerflossen Zugleich mit den Stürmen, und erheben Sich gleich riesigen Albatrossen, Die in den Lüften als getrennte Atome wieder herniederfallen, Und so (nie ruhende Elemente) In einem ewigen Zirkel wallen Und auf ihren zitternden Schwingen Zur Erde Himmelsspuren bringen.
Der See
In meinen jungen Jahren trieb Mich Sehnsucht oft an einen Ort, Der mich gebannt hielt wie ein Hort. So war die Einsamkeit mir lieb Von einem See, um dessen Rand Ein schwarzes Felsgemäuer stand. Doch wenn die Nacht ihr Bahrtuch warf Auf diese Stelle und auf mich, Und mystisch durch die Wellen strich Der Wind, bald klagend und bald scharf, Dann -- ja -- erschreckte mich oft jäh Die Einsamkeit am dunklen See. Doch dieser Schrecken war nicht Grau’n; Nein, eine Lust, die Schauer barg, So zitternd und dämonisch stark, Wie sie in unterirdischen Gau’n Der spüren mag, der einen Schein Erhascht von flimmerndem Gestein. Tod war um jenen giftigen Strand -- Und in der Flut ein Grab für ihn, Der dort für seine Phantasien Besänftigende Tröstung fand Und den sein Träumen wandeln hieß Das finstre Reich zum Paradies.
Geschichten
Der Untergang des Hauses Usher
Son cœur est un luth suspendu; Sitôt qu’on le touche il résonne.
De Beranger
Ich war den ganzen Tag lang geritten, einen grauen und lautlosen melancholischen Herbsttag lang -- durch eine eigentümlich öde und traurige Gegend, auf die erdrückend schwer die Wolken herabhingen. Da endlich, als die Schatten des Abends herniedersanken, sah ich das Stammschloß der Usher vor mir. Ich weiß nicht, wie es kam -- aber ich wurde gleich beim ersten Anblick dieser Mauern von einem unerträglich trüben Gefühl befallen. Ich sage unerträglich,





























