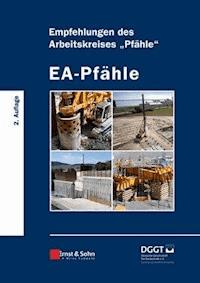Contents
Vorwort und Benutzerhinweise
1: Einleitung und Anwendungsgrundlagen der Empfehlungen
1.1 Nationale und internationale Vorschriften für Pfähle
1.2 Nachweisformen und Grenzzustände nach dem Teilsicherheitskonzept
1.3 Planung und Prüfung von Pfahlgründungen
2: Pfahlsysteme
2.1 Übersicht und Zuordnung zu den Pfahlsystemen
2.2 Pfahlherstellung
2.3 Pfahlähnliche Elemente
3: Grundsätze zu Entwurf und Berechnung von Pfahlgründungen
3.1 Pfahlgründungssysteme
3.2 Baugrunderkundung bei Pfahlgrändungen
3.3 Zuordnung der Böden bei Pfahlgründungen
3.4 Pfahlkonstruktionen zur Baugrubenherstellung und Sicherung von Geländesprüngen
3.5 Pfahlkonstruktionen zur Böschungssicherung
3.6 Anordung von Hülsen
4: Einwirkungen und Beanspruchungen
4.1 Allgemeines
4.2 Pfahlgründungslasten aus dem Bauwerk
4.3 Herstellungsbedingte Beanspruchungen von Pfählen
4.4 Negative Mantelreibung
4.5 Seitendruck
4.6 Zusatzbeanspruchung von Schrägpfählen aus Baugrundverformungen
4.7 Gründungspfähle in Böschungen und an Geländesprüngen
5: Tragverhalten und Widerstände von Einzelpfählen
5.1 Allgemeines
5.2 Ermittlung von Pfahlwiderständen aus statischen Pfahlprobebelastungen
5.3 Ermittlung von Pfahlwiderständen aus dynamischen Pfahlprobebelastungen
5.4 Axiale Pfahlwiderstände aus Erfahrungswerten
5.5 Bohrpfähle mit Fußaufweitung
5.6 Weitere Verfahren nach Handbuch EC 7-1 und Handbuch EC 7-2
5.7 Pfahlwiderstände bei Mantelund Fußverpressung
5.8 Pfahlwiderstände quer beanspruchter Pfähle
5.9 Pfahlwiderstände bei nicht ruhenden Einwirkungen
5.10 Innere Tragfähigkeit von Pfählen
5.11 Numerische Berechnungen zur Tragfähigkeitvon Einzelpfählen
6: Standsicherheitsnachweise
6.1 Allgemeines
6.2 Grenzzustandsgleichungen
6.3 Nachweis der Tragfähigkeit
6.4 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
6.5 Pfahlgruppen und Pfahlroste
6.6 Kombinierte Pfahl-Plattengründungen
7: Berechnung von Pfahlrosten
7.1 Berechnungsmodelle und Verfahren
7.2 Nichtlineares Pfahltragverhalten in der Pfahlrostberechnung
8: Berechnung und Nachweise von Pfahlgruppen
8.1 Einwirkungen und Beanspruchungen
8.2 Tragverhalten und Widerstände von Pfahlgruppen
8.3 Nachweis der Tragfähigkeit
8.4 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
8.5 Genauere Nachweise bei Pfahlgruppen
9: Statische Pfahlprobebelastungen
9.1 Allgemeines
9.2 Statische axiale Pfahlprobebelastungen
9.3 Statische Pfahlprobebelastungen quer zur Pfahlachse
9.4 Statische axiale Probebelastungen an Mikropfählen (Verbundpfählen)
10: Dynamische Pfahlprobebelastungen
10.1 Allgemeines
10.2 Anwendungsbereich und allgemeine Anforderungen
10.3 Theoretische Grundlagen
10.4 Beschreibung der Prüfverfahren, Versuchsplanung und Durchführung
10.5 Auswertung und Interpretation der dynamischen Probebelastungen
10.6 Kalibrierung der dynamischen Pfahlprobebelastungen
10.7 Qualifikation der Prüfinstitute und des Personals
10.8 Dokumentation und Bericht
10.9 Prüfung der Rammgeräteeignung
11: Qualitätssicherung bei der Bauausführung
11.1 Allgemeines
11.2 Bohrpfähle
11.3 Verdrängungspfähle
11.4 Verpresste Mikropfähle (Verbundpfähle)
12: Pfahl-Integritätsprüfungen
12.1 Zweck und Verfahren
12.2 „Low-Strain“-Integritätsprüfung
12.3 Ultraschall-Integritätsprüfung
12.4 Pfahlprüfungen durch Kernbohrungen
12.5 Weitere Prüfmethoden
13: Tragverhalten und Nachweise für Pfähle unter zyklischen, dynamischen und stoßartigen Einwirkungen
13.1 Allgemeines
13.2 Zyklische, dynamische und stoßartige Einwirkungen
13.3 Ergänzende geotechnische Untersuchungen
13.4 Tragverhalten und Widerstände bei zyklischer Belastung
13.5 Tragverhalten und Widerstände bei dynamischer Belastung
13.6 Tragverhalten und Widerstände bei stoßartiger Belastung
13.7 Standsicherheitsnachweise zyklisch axial belasteter Pfähle
13.8 Standsicherheitsnachweise zyklisch querbelasteter Pfähle
13.9 Standsicherheitsnachweise dynamisch oder stoßartig belasteter Pfähle
Anhang A: Begriffe, Teilsicherheitsbeiwerte und Berechnungsgrundlagen
A1 Begriffe und Formelzeichen
A2 Teilsicherheitsbeiwerte YF1) bzw.YE2) für Einwirkungen und Beanspruchungen aus Handbuch EC 7-1 [44], Tabelle A 2.1
A3 Teilsicherheitsbeiwerte für geotechnische Kenngrößen und Widerstände aus Handbuch EC 7-1 [44], Tabelle A 2.2 und A2.3
A4 Streuungsfaktoren ξi zur Ermittlung der charakteristischen Pfahlwiderstände für den Grenzzustand der Tragfähigkeit aus den Versuchs- bzw. Messwerten von statischen und dynamischen Pfahlprobebelastungen nach Handbuch EC 7-1
A5 Verfahren zur Ermittlung des Widerstandes von Pfählen gegen Knickversagen in Bodenschichten mit geringer seitlicher Stützung (informativ)
A6 Verbundspannung von verpressten Verdrängungspfählen (informativ)
Anhang B: Berechnungsbeispiele Pfahlwiderstände und Nachweise
B1 Ermittlung der axialen Pfahlwiderstände aus statischen Pfahlprobebelastungen sowie Nachweise der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit
B2 Charakteristische axiale Pfahlwiderstände aus dynamischen Probebelastungen
B3 Ermittlung der axialen charakteristischen Pfahlwiderstände aus Erfahrungswerten für einen Bohrpfahl
B4 Ermittlung der axialen charakteristischen Pfahlwiderstände aus Erfahrungswerten für einen Fertigrammpfahl
B5 Ermittlung der axialen charakteristischen Pfahlwiderstände aus Erfahrungswerten für einen Fundexpfahl
B6 Grundlage der Auswertung einer statischen Pfahlprobebelastung am Beispiel eines Fertigrammpfahls und Vergleich mit Erfahrungswerten nach 5.4.4.2
B7 Vorbemessung und Nachweis des Grenzzustandes der Tragfähigkeit von Frankipfählen auf der Grundlage von Erfahrungswerten und Vergleich mit einem Probebelastungsergebnis
B8 Negative Mantelreibung bei einem Verdrängungspfahl infolge Geländeaufschüttung
B9 Ermittlung der Beanspruchung eines quer zur Pfahlachse belasteten Pfahls und Nachweis gegen Materialversagen
B10 Auf Seitendruck beanspruchte Pfähle
B11 Pfeilergründung auf 9 Pfählen – Nachweise der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit unter Berücksichtigung von Gruppenwirkung
B12 Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit einer Zugpfahlgruppe
B13 Quer zur Pfahlachse belastete Pfahlgruppen: Ermittlung der Verteilung der horizontalen Bettungsmoduln
Anhang C: Beispiele zur dynamischen fahlprobebelastung und Integritätsprüfung
C1 Auswertungsbeispiel dynamische Pfahlprobebelastungen nach dem direkten Verfahren
C2 Auswertungsbeispiel für dynamische Pfahlprobe-belastungen nach dem erweiterten Verfahren mit vollständiger Modellbildung
C3 Auswertungsbeispiel eines Rapid-Load-Tests nach der Unloading-Point Methode
C4 Fallbeispiele „Low-Strain“-Integritätsprüfung
C5 Rammbegleitende und/oder „High-Strain“-Integritätsprüfung
C6 Fallbeispiel einer Ultraschallprüfung
Anhang D: Berechnungsverfahren und -beispiele für zyklisch belastete Pfähle (informativ)
D1 Anwendungshinweise
D2 Zyklisch axial belastete Pfähle
D3 Zyklisch quer zur Pfahlachse belastete Pfähle
D4 Verfahren zur Ermittlung eines äquivalenten Ein-Stufen-Lastkollektivs
Literatur
Arbeitskreis AK 2.1 „Pfähle“ der
Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V.
Obmann: Univ.-Prof.(em) Dr.-Ing. Hans-Georg Kempfert
Potosistraße 27
D-22587 Hamburg
[email protected]
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2012 Wilhelm Ernst & Sohn, Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Rotherstr. 21, 10245 Berlin, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publisher.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie als solche nicht eigens markiert sind.
2. ergänzte und erweiterte Auflage
Print ISBN: 978-3-433-03005-9
ePDF ISBN: 978-3-433-60156-3
ePub ISBN: 978-3-433-60155-6
mobi ISBN: 978-3-433-60154-9
oBook ISBN: 978-3-433-60111-2
Mitglieder des Arbeitskreises AK 2.1 „Pfähle“
Zum Zeitpunkt der Herausgabe der vorliegenden Sammelveröffentlichung setzte sich der Arbeitskreis „Pfähle“ wie folgt zusammen:
Univ.-Prof. (em) Dr.-Ing. H.-G. Kempfert, Hamburg (Obmann)
Dr.-Ing. W.-R. Linder, Essen (stellvertr. Obmann)
Dipl.-Ing. B. Böhle, Essen
Dipl.-Ing. W. Brieke, Düsseldorf
Dipl.-Ing. G. Dausch, Mannheim
Dipl.-Ing. E. Dornecker, Karlsruhe
Dipl.-Ing. A. Ellner, Nürnberg
Dipl.-Ing. M. Glimm, Hamburg
Dipl.-Ing. R. Jörger, Wiesbaden
Dr.-Ing. O. Klingmüller, Mannheim
Dipl.-Ing. O. Krist, München
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Chr. Moormann, Stuttgart
Dr.-Ing. K. Morgen, Hamburg
Prof. Dr.-Ing. D. Placzek, Essen
Prof. Dr.-Ing. B. Plaßmann, Mainz
Dipl.-Ing. U. Plohmann, Eggenstein
Dr.-Ing. habil. K. Röder, Leipzig
Dr.-Ing. P. Schwarz, München
Dr.-Ing. W. Schwarz, Schrobenhausen
Dr.-Ing. S. Weihrauch, Hamburg
Dipl.-Ing. J. Voth, Hamburg
Weitere Mitglieder des Arbeitskreises „Pfähle“ seit Herausgabe der 1. Auflage (2007) waren:
Dipl.-Ing. W. Körner, Hamburg
Dr.-Ing. H.G. Schmidt, Ladenburg
Bei der Bearbeitung der EA-Pfähle haben folgende Unterausschüsse mitgearbeitet bzw. mitgewirkt:
Unterausschuss „Dynamische Pfahlprüfungen“: Bearbeitung Kapitel 10, 12 und Anhang C
Dr.-Ing. O. Klingmüller, Mannheim (Obmann)
Dipl.-Ing. A. Beneke, Achim
Dr.-Ing. U. Ernst, Nürnberg
Dipl.-Ing. J. Fischer, Braunschweig
Dr.-Ing. M. Fritsch, Braunschweig
Dipl.-Ing. P. Grud, Dänemark
Dipl.-Ing. G. Kainrath, Österreich
Dr.-Ing. F. Kirsch, Berlin
P. Middendorp, MSc, Holland
Dr. rer.nat. E. Niederleithinger, Berlin
Dr. F. Rausche, USA
Prof. Dr.-Ing. W. Rücker, Berlin
Dr.-Ing. M. Schallert, Mannheim
D. Schau, Büdelsdorf
Dr.-Ing. W. Schwarz, Schrobenhausen
Univ.-Prof. Dr.-Ing. J. Stahlmann, Braunschweig
R. Skov, MSc, Dänemark
Dr.-Ing. G. Ulrich, Leutkirch
Dr.-Ing. B. Wienholz, Oldenburg
Unterausschuss „KPP- und Pfahlgruppen-Gründungen“: Mitwirkung zu Abschnitt 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1 und 8.4.1 (bis 2007)
Prof. Dr.-Ing. Th. Richter, Berlin (Obmann)
Dipl.-Ing. U. Barth, Mannheim
Univ.-Prof. Dr.-Ing. R. Katzenbach, Darmstadt
Univ.-Prof. Dr.-Ing. H.-G. Kempfert, Kassel
Prof. Dr.-Ing. B. Lutz, Berlin
Dr.-Ing. Y. El-Mossallamy, Darmstadt
Dr.-Ing. H. Wahrmund, Köln
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Chr. Moormann, Stuttgart
Gemeinsamer Unterausschuss AK 1.4 „Baugrunddynamik“ und AK 2.1 „Pfähle“: Bearbeitung Kapitel 13 und Anhang D
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. S. Savidis, Berlin (Obmann Ak 1.4)
Univ.-Prof. (em) Dr.-Ing. H.-G. Kempfert, Hamburg (Obmann Ak 2.1)
Dr.-Ing. J. Dührkop, Hamburg
Dr.-Ing. H.-G. Hartmann, Frankfurt
Dr.-Ing. U. Hartwig, Stuttgart
Dr.-Ing. F. Kirsch, Berlin
PD Dr.-Ing. habil. K. Lesny, Essen
Dr.-Ing. F. Rackwitz, Berlin
Prof. Dr.-Ing. Th. Richter, Berlin
Dr.-Ing. E. Tasan, Berlin
Dr.-Ing. S. Thomas, Kassel
Dr.-Ing. S. Weihrauch, Hamburg
Dr.-Ing. J. Wiemann, Hamburg
Vorwort und Benutzerhinweise
Die Normung über die Ausführung und Bemessung von Pfahlgründungen und einzelnen Pfahlsystemen hat in Deutschland eine lange Tradition. Dabei arbeitet der Normenausschuss „Pfähle“ (NA 005-05-07 AA) und der Arbeitskreis AK 2.1 „Pfähle“ der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e. V. (DGGT) langjährig in Personalunion zusammen. Dieser gemeinsame Ausschuss hat in den vergangenen Jahrzehnten die im letzten Jahrhundert in der Praxis bekannten und eingeführten Pfahlnormen DIN 4026 (Rammpfähle), DIN 4014 (Bohrpfähle) und DIN 4128 (Verpresspfähle) sowie den Pfahlteil der DIN 1054 (Abschnitt 5) bearbeitet und in den einzelnen Ausgaben dem Stand der Technik angepasst.
Seit Beginn der europäischen Normung Ende der 1980iger Jahre hat der Ausschuss die Aufgabe, die europäischen Ausführungsnormen DIN EN 1536 (Bohrpfähle), DIN EN 12699 (Verdrängungspfähle) und DIN EN 14199 (Mikropfähle) als nationaler Spiegelausschuss zu begleiten. Bezüglich der Berechnung und Bemessung von Pfählen lag sein Aufgabenschwerpunkt bei der Bearbeitung der Pfahlabschnitte der DIN 1054:2005-01 und DIN 1054:2010-12 unter Berücksichtigung des Teilsicherheitskonzeptes. In Ergänzung dazu hatte sich der AK 2.1 entschlossen, eine zusammenfassende Empfehlung zur Berechnung und Bemessung von Pfählen national herauszugeben, die 2007 in 1. Auflage als „EA-Pfähle“ veröffentlicht wurde und nun als 2. Auflage vorliegt. Die „EA-Pfähle“ sieht sich damit in der Tradition vergleichbarer Empfehlungen der DGGT, wie z. B. EAB, EBGEO, usw., die sich als Regeln der Technik etabliert haben.
Mit der Herausgabe der Normenhandbücher der Eurocodes für den konstruktiven Ingenieurbau und für die Geotechnik des Handbuchs Eurocode 7, Geotechnische Bemessung – Band 1: Allgemeine Regeln (1. Auflage 2011), ist die europäische Normung für diesen Bereich zunächst zu einem Abschluss gekommen. Es ist geplant, die Normen mit einer Stichtagslösung voraussichtlich noch in 2012 bauaufsichtlich einzuführen. Das Handbuch Eurocode 7, Geotechnische Bemessung – Band 1: Allgemeine Regeln, enthält zusammengefasst die DIN EN 1997-1:2009-09 (Eurocode EC 7-1: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil1: Allgemeine Regeln). Zusätzlich die DIN 1054:2010-12 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau – Ergänzende Regeln zu DIN EN 1997-1) und die DIN EN 1997-1/NA: 2010-12 (Nationaler Anhang).
Für die Berechnung und Bemessung von Pfählen wird in der DIN 1054:2010-12 an verschiedenen Stellen auf die „EA-Pfähle“ verwiesen, z. B. auf die Tabellenwerte der Pfahltragfähigkeiten aus Erfahrungswerten. Aus formalen Gründen verweist die DIN 1054:2010-12 zwar auf die 1. Auflage der „EA-Pfähle“, aber erst mit der nunmehr vorliegenden 2. Auflage ist die technische Verbindung zum Handbuch EC 7-1 [44] auch inhaltlich verbessert vorgenommen worden. Dies gilt besonders für die Nachweisformen und für die Schreibweisen mit Bezug auf das Handbuch EC 7-1 [44], sodass für den Anwender bei der Berechnung und Bemessung von Pfahlgründungen in sich geschlossene und untereinander abgestimmte Regelungen vorliegen.
In Ergänzung dazu finden sich in der „EA-Pfähle“ auch ausführungstechnische Belange mit Bezug auf die europäischen Pfahlausführungsnormen DIN EN 1536, DIN EN 12699 und DIN 14199. Eine vergleichende Einordnung der in der Praxis vorhandenen Pfahlsysteme (Kapitel 2) erleichtert die Zuordnung zu diesen Normen. Detaillierte Regelungen zu statischen und dynamischen Pfahlprobebelastungen (Kapitel 9 und 10) sowie qualitätssichernde Hinweise und Verfahren (Kapitel 11 und 12) sollen helfen, eine hochwertigen technische Ausführung von Pfählen sicherzustellen.
Ein gegenüber der 1. Auflage neues Kapitel 13 behandelt das Pfahltragverhalten und die Nachweisformen von Pfählen unter veränderlichen Einwirkungen. Dabei wurde ein besonderer Schwerpunkt auf das Tragverhalten von Pfählen unter zyklischen Belastungen gelegt, die insbesondere für Windenergieanlagen (offshore, onshore), aber auch im Verkehrswegebau, usw., häufig angewendet werden.
Nachdem die 1. Auflage der EA-Pfähle zunächst als Entwurf zu verstehen war, die seinerzeit zur probeweisen Anwendung empfohlen wurde, entfällt ab der 2. Auflage der Entwurfscharakter, da zwischenzeitlich die Fachöffentlichkeit Gelegenheit hatte, die Regelungen zu erproben und Hinweise und Änderungsvorschläge an den Ausschuss zu geben. Dies gilt auch für das neue Kapitel 13, welches auf verschiedenen Wegen vorveröffentlicht wurde. Alle Einsprüche zur 1. Auflage wurden bei der Bearbeitung der 2. Auflage vom Ausschuss diskutiert und, wenn berechtigt, in die 2. Auflag mit eingearbeitet. Die Anhänge A5, A6 und Anhang D enthalten „informative“ technische Hinweise, die noch nicht als Stand der Technik einzustufen sind, sondern eher den Stand der Wissenschaft darstellen.
Der Anwender wird bezüglich der Verbindlichkeit der vorliegenden Empfehlungen „EA-Pfähle“, 2. Auflage, auf die Benutzerhinweise der EAB (2006), 4. Auflage, Verlag Ernst & Sohn, verwiesen, die hier in vergleichbarer Weise anzuwenden sind.
Der Arbeitskreis AK 2.1 „Pfähle“ der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e. V. (DGGT) bittet für die Weiterentwicklung der vorliegenden Empfehlungen um Hinweise und Zuschriften an den Obmann des AK 2.1 (Adresse siehe Impressum).
Hamburg, 2012
Hans-Georg Kempfert
1
Einleitung und Anwendungsgrundlagen der Empfehlungen
1.1 Nationale und internationale Vorschriften für Pfähle
(1) Mit DIN EN 1997-1:2009-09: Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln wird in Deutschland die Berechnung und Bemessung von Pfählen im Kapitel 7 dieses Eurocodes EC 7-1 in Verbindung mit DIN 1054:2010-12: Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau – Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1 und dem nationalen Anhang zum EC 7-1 DIN EN 1997-1/ NA:2010-12: Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln geregelt. Diese drei aufeinander abgestimmten Normen sind textlich zusammengefasst im Handbuch Eurocode 7, Band 1 [44].
Anmerkung: Sofern in den im Handbuch Eurocode 7, Band 1 [44] enthaltenen Normen Änderungen oder Berichtigungen vorgenommen werden, sind diese zugrunde zu legen, auch wenn sie noch nicht in [44] Eingang gefunden haben.
(2) Weiterhin sind für die einzelnen Pfahlsysteme folgende Herstellungsnormen vorhanden:
DIN EN 1536:
Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) – Bohrpfähle,
DIN SPEC 18140:
Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 1536
DIN EN 12699:
Ausführung spezieller geotechnischer Arbeiten (Spezialtiefbau) – Verdrängungspfähle,
DIN SPEC 18538:
Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 12699,
DIN EN 14199:
Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) – Pfähle mit kleinen Durchmessern (Mikropfähle),
DIN SPEC 18539:
Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 14199,
DIN EN 12794:
Betonfertigteile – Gründungspfähle,
DIN EN 1993-5:
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 5: Pfähle und Spundwände.
(3) Da auch Schlitzwandelemente oftmals im Sinne von Pfahlgründungen angewendet werden, ist als Herstellungsnorm
DIN EN 1538:
Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) – Schlitzwände,
in Verbindung mit
DIN 4126:
Nachweis der Standsicherheit von Schlitzwänden
zu beachten.
(4) Weiterhin werden auch für einige spezielle Themen zu Pfählen ISO Normen erarbeitet, die in Deutschland voraussichtlich aber nicht bauaufsichtlich eingeführt werden. Derzeit liegt vor
DIN EN ISO 22477-1:
Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Prüfung von geotechnischen Bauwerken und Bauwerksteilen – Teil 1: Pfahlprobebelastungen durch statische axiale Belastungen.
Für die Durchführung von statischen Pfahlprobebelastungen sollten national die Regelungen nach Kapitel 9 angewendet werden.
1.2 Nachweisformen und Grenzzustände nach dem Teilsicherheitskonzept
1.2.1 Neue Normengeneration und Anwendung auf Pfahlgründungen
(1) Laut Beschluss der Europäischen Kommission sind bzw. werden die maßgeblichen nationalen Bemessungs- und Ausführungsnormen im Bauwesen durch Europäische Normen ersetzt. Dazu liegen zwischenzeitlich zahlreiche europäische Bemessungs- und Ausführungsnormen für die Geotechnik und den Spezialtiefbau vor.
(2) Die für die Herstellung von Pfählen maßgeblichen europäischen Ausführungsnormen sind in 1.1 aufgeführt.
(3) Die Berechnung und Bemessung von Pfahlgründungen ist europäisch in DIN EN 1997-1: „Entwurf, Bemessung und Berechnung in der Geotechnik“ (Eurocode EC 7-1) in Verbindung mit DIN 1054 und DIN EN 1997-1/NA behandelt, siehe 1.1
(4) Als Übergangslösung bis zur bauaufsichtlichen Einführung der Eurocodes diente eine neue nationale Normengeneration nach dem Teilsicherheitskonzept für alle Gebiete des konstruktiven Ingenieurbaus. Für Pfahlgründungen sind dazu insbesondere folgende Normen maßgebend:
DIN 1055-100:2001-03:
Grundlagen der Tragwerksplanung,
DIN 1054:2005-01:
Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau,
DIN 18800:1990-11:
Stahlbauten und
DIN 1045:2001-07:
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton.
(5) Die bauaufsichtliche Einführung von Eurocode EC 7-1 in Verbindung mit DIN 1054:2010-12 ist in 2012 voraussichtlich als Stichtagslösung zu erwarten. Eine vorgezogene Anwendung kann in Abstimmung mit den Prüfinstanzen vorgenommen werden.
(6) Die vorliegende Fassung der 2. Auflage der EA-Pfähle beruht auf den vorstehend aufgelisteten Normen nach 1.1 und für die Bemessung besonders Eurocode EC 7-1 in Verbindung mit DIN 1054 und NA nach 1.1 (1).
1.2.2 Einwirkungen, Beanspruchungen und Widerstände
(1) Das ursprüngliche Teilsicherheitskonzept ging aus von der Wahrscheinlichkeitstheorie zur Festlegung der einzuhaltenden Sicherheiten auf probabilistischer Grundlage. Demgegenüber folgt die neue Normengeneration in der Geotechnik ab Einführung der DIN 1054:2005-01 einer pragmatischen Aufspaltung der bisher gebräuchlichen Globalsicherheiten in Teilsicherheitsbeiwerte für Einwirkungen bzw. Beanspruchungen und Teilsicherheitsbeiwerte für Widerstände.
(2) Grundlage für Standsicherheitsberechnungen sind die charakteristischen Werte für Einwirkungen und Widerstände. Der charakteristische Wert, gekennzeichnet durch den Index „k“, ist ein Wert, von dem angenommen wird, dass er mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit im Bezugszeitraum unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Bauwerks oder der entsprechenden Bemessungssituation nicht über- oder unterschritten wird. In der Regel werden charakteristische Werte aufgrund von Versuchen, Messungen, Rechnungen oder Erfahrungen festgelegt.
(3) Wenn die „innere“ oder „äußere“ Tragfähigkeit von Pfählen nachgewiesen werden muss, werden die Beanspruchungen am Pfahlkopf oder in Schnitten benötigt:
– als Schnittgrößen, z. B. Normalkraft, Querkraft, Biegemoment,
– als Spannungen, z. B. Druck-, Zug-, Biegespannung, Schub- oder Vergleichsspannung.
Darüber hinaus können weitere Auswirkungen von Einwirkungen auftreten:
– als dynamische oder zyklische Beanspruchung,
– als Veränderung am Bauteil, z. B. Dehnung, Verformung oder Rissbreite,
– als Lageveränderung der Einzelpfähle oder der Pfahlgruppe, z. B. Verschiebung, Setzung, Verdrehung.
(4) Bei der Bemessung von Einzelteilen sind der Querschnitt und der innere Widerstand des Materials maßgebend. Dafür sind die einzelnen Bauartnormen zuständig.
(5) Die charakteristischen Werte der Beanspruchungen werden mit Teilsicherheitsbeiwerten multipliziert, die charakteristischen Werte der Widerstände durch Teilsicherheitsbeiwerte dividiert. Die so erhaltenen Größen werden als Bemessungswerte der Beanspruchungen bzw. der Widerstände bezeichnet und durch den Index „d“ gekennzeichnet. Beim Nachweis der Standsicherheit werden unterschiedliche Grenzzustände unterschieden, siehe auch 1.2.3, 1.2.4 und 3.1.1 (4).
(6) Neben den Einwirkungen sind für die Pfahlnachweise, wie bei anderen Bauteilen auch, Bemessungssituationen zu berücksichtigen. Dazu sind die bisherigen Lastfälle LF 1, LF 2 und LF 3 für die Nachweise nach DIN 1054:2005-01, für die Nachweise nach DIN EN 1997 (EC 7-1) und DIN 1054:2010-12 bzw. DIN EN 1990 in die Bemessungssituationen
– BS-P (Persistent situation),
– BS-T (Transient situation) und,
– BS-A (Accidental situation)
umgewandelt worden. Zusätzlich gibt es die Bemessungssituation infolge Erdbeben BS-E. Weitergehende Hinweise finden sich im Handbuch EC 7-1 [44] und in [133].
1.2.3 Grenzzustände und nationale Anwendung des Handbuchs EC 7-1
(1) Der Begriff „Grenzzustand“ wird in zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet:
a) Als „Grenzzustand des plastischen Fließens“ wird in der Bodenmechanik der Zustand im Boden bezeichnet, in dem in einer ganzen Bodenmasse oder zumindest im Bereich einer Bruchfuge die Verschiebungen der einzelnen Bodenteilchen gegeneinander so groß sind, dass die mögliche Scherfestigkeit ihren Größtwert erreicht, der auch bei einer weiteren Bewegung nicht mehr größer, gegebenenfalls aber kleiner werden kann. Der Grenzzustand des plastischen Fließens kennzeichnet den aktiven Erddruck, den Erdwiderstand, den Grundbruch, das „äußere“ Pfahlversagen sowie den Böschungs- und Geländebruch.
b) Ein zweiter Grenzzustand im Sinne des neuen Sicherheitskonzeptes ist ein Zustand des Tragwerks, bei dessen Überschreitung die der Tragwerksplanung zugrunde gelegten Anforderungen nicht mehr erfüllt sind.
(2) Im Sinne des Teilsicherheitskonzeptes werden folgende Grenzzustände unterschieden:
a) Der Grenzzustand der Tragfähigkeit ist ein Zustand des Tragwerks, dessen Überschreitung unmittelbar zu einem rechnerischen Einsturz oder einer anderen Form des Versagens führt. Er wird in EC 7-1 und DIN 1054 als ultimate limit state ULS bezeichnet. Dabei wird eine weitere Unterteilung nach (5) vorgenommen.
b) Der Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist ein Zustand des Tragwerks, bei dessen Überschreitung die für die Nutzung festgelegten Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. Er wird in EC 7-1 und DIN 1054 als serviceability limit state (SLS) bezeichnet.
(3) Im Hinblick auf die Nachweise der Sicherheit im Grenzzustand der Tragfähigkeit (ULS) bietet der Eurocode EC 7-1 drei Möglichkeiten an. Die für die Anwendung in Deutschland geltenden ergänzenden Regelungen der DIN 1054 stützen sich bis auf eine Ausnahme (siehe (6) und (9)) auf das Nachweisverfahren 2 nach EC 7-1 in der Form, dass die Teilsicherheitsbeiwerte auf die Beanspruchungen und auf die Widerstände angewendet werden. Zur Unterscheidung zu der ebenfalls zugelassenen Variante, bei der die Teilsicherheitsbeiwerte nicht auf die Beanspruchungen, sondern auf die Einwirkungen angewendet werden, wird dieses Verfahren in [133] als Nachweisverfahren 2* bezeichnet, siehe auch Handbuch EC 7-1 [44].
(4) Der Nationale Anhang zu EC 7-1 und die DIN 1054 sind ein formales Bindeglied zwischen dem EC 7-1 und dem nationalen Normenwerk, siehe Handbuch EC 7-1 [44]. In DIN 1054 und dem Nationalen Anhang wird angegeben, welches der zur Auswahl gestellten Nachweisverfahren und welche Teilsicherheitsbeiwerte im nationalen Bereich maßgebend sind. Weiterhin darf angegeben werden, welche nationalen Regelwerke ergänzend anzuwenden sind. Die ergänzenden nationalen Regelungen dürfen dem EC 7-1 nicht widersprechen. Darüber hinaus soll der Nationale Anhang und DIN 1054 keine Angaben wiederholen, die bereits im EC 7-1 enthalten sind.
(5) Eurocode EC 7-1 gliedert den Grenzzustand der Tragfähigkeit (ULS) auf in folgende Grenzzustände:
a) EQU: Gleichgewichtsverlust des als starrer Körper angesehenen Tragwerks oder des Baugrundes. Die Bezeichnung ist abgeleitet von „equilibrium“.
b) STR: Inneres Versagen oder sehr große Verformungen des Tragwerks oder seiner Bauteile, wobei die Festigkeit der Baustoffe für den Widerstand entscheidend ist. Die Bezeichnung ist abgeleitet von „structure failure“.
c) GEO: Versagen oder sehr große Verformung des Tragwerks oder des Baugrundes, wobei die Festigkeit von Boden oder Fels für den Widerstand entscheidend ist. Die Bezeichnung ist abgeleitet von „geotechnic failure“.
d) UPL: Gleichgewichtsverlust des Bauwerks oder Baugrundes infolge von Auftrieb oder Wasserdruck. Die Bezeichnung ist abgeleitet von „uplift“.
e) HYD: Hydraulischer Grundbruch, innere Erosion oder „Piping“ im Boden, verursacht durch Strömungsgradienten. Die Bezeichnung ist abgeleitet von „hydraulic failure“.
(6) In der Terminologie des Handbuchs EC 7-1 [44] wird der Grenzzustand GEO aufgeteilt in GEO-2 und GEO-3:
a) GEO-2: Versagen oder sehr große Verformung des Baugrundes im Zusammenhang mit der Ermittlung der Schnittgrößen und der Abmessungen, d. h. bei der Inanspruchnahme der Scherfestigkeit beim Erdwiderstand, beim Gleitwiderstand, beim Grundbruchwiderstand und beim Nachweis der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge sowie bei Spitzendruck und Mantelreibung bei Pfahlgründungen. Der Grenzzustand GEO-2 beinhaltet das Nachweisverfahren 2*, siehe (3), nach Handbuch EC 7-1 [44].
b) GEO-3: Versagen oder sehr große Verformung des Baugrundes im Zusammenhang mit dem Nachweis der Gesamtstandsicherheit, d. h. bei der Inanspruchnahme der Scherfestigkeit beim Nachweis der Sicherheit gegen Böschungsbruch und Geländebruch sowie in der Regel beim Nachweis der Standsicherheit von konstruktiven Böschungssicherungen, auch unter Berücksichtigung konstruktiver Elemente, z. B. Anker, Pfähle. Der Grenzzustand GEO-3 beinhaltet das Nachweisverfahren 3 nach Handbuch EC 7-1 [44].
(7) Die Grenzzustände EQU, UPL und HYD beschreiben den Verlust der Lagesicherheit. Dazu gehören:
a) der Nachweis der Sicherheit gegen Umkippen (EQU),
b) der Nachweis der Sicherheit gegen Aufschwimmen oder Abheben, z. B. bei einer Zugpfahlgruppe (UPL),
c) der Nachweis der Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch (HYD).
(8) Bei den Grenzzuständen EQU, UPL und HYD gibt es nur Einwirkungen, keine Widerstände.
Maßgebend ist die Grenzzustandsbedingung
(1.1)
d. h. die destabilisierenden Einwirkungen Fk multipliziert mit dem Teilsicherheitsbeiwert γdst ≥ 1,0 dürfen höchstens so groß werden wie die stabilisierende Einwirkung Gk multipliziert mit dem Teilsicherheitsbeiwert γstb < 1,0.
(9) Der Grenzzustand GEO-2 beschreibt das Versagen von Bauwerken und Bauteilen bzw. das Versagen des Baugrundes. Dazu gehören:
a) der Nachweis der Tragfähigkeit von Bauwerken und von Bauteilen, die durch den Baugrund belastet bzw. durch den Baugrund gestützt werden,
b) der Nachweis, dass die Tragfähigkeit des Baugrundes, z. B. in Form von Erdwiderstand, Grundbruchwiderstand, Pfahlwiderstand oder Gleitwiderstand, nicht überschritten wird.
Dabei wird der Nachweis, dass die Tragfähigkeit des Baugrundes nicht überschritten wird, genau so geführt wie bei jedem anderen Baumaterial. Maßgebend ist immer die Grenzzustandsbedingung
(1.2)
d. h. die charakteristische Beanspruchung Ek, multipliziert mit dem Teilsicherheitsbeiwert γF für Einwirkungen bzw. Beanspruchungen, darf höchstens so groß werden wie der charakteristische Widerstand Rk dividiert durch den Teilsicherheitsbeiwert γR.
(10) Der Grenzzustand GEO-3 ist eine Besonderheit des Erd- und Grundbaus. Er beschreibt den Verlust der Gesamtstandsicherheit. Dazu gehören:
a) der Nachweis der Sicherheit gegen Böschungsbruch,
b) der Nachweis der Sicherheit gegen Geländebruch.
Maßgebend ist immer die Grenzzustandsbedingung
(1.3)
d. h. der Bemessungswert Ed der Beanspruchungen darf höchstens so groß werden wie der Bemessungswert Rd des Widerstandes. Hierbei werden die geotechnischen Einwirkungen und Widerstände mit den Bemessungswerten
(1.4a)
(1.4b)
der Scherfestigkeiten ermittelt, d. h. die Reibung tan ϕ und die Kohäsion c werden von vornherein mit den Teilsicherheitsbeiwerten γϕ und γc abgemindert.
(11) Der Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (SLS) beschreibt den Zustand des Bauwerks oder Bauteils, bei dem die für die Nutzung festgelegten Bedingungen nicht mehr erfüllt sind, ohne dass seine Tragfähigkeit verloren geht. Dem Nachweis liegt zugrunde, dass die zu erwartenden Verschiebungen und Verformungen mit dem Zweck des Bauwerks vereinbar sind.
1.2.4 Übergangsregelungen zur Anwendung der EA-Pfähle im Zusammenhang mit dem Handbuch EC 7-1
(1) Die vorliegende 2. Auflage der EA-Pfähle beruht auf den Festlegungen des Handbuchs EC 7-1 [44].
(2) Eine maßgeblich andere Festlegung im Handbuch EC 7-1 [44] gegenüber DIN 1054:2005-01 für Pfahlgründungen sind andere Teilsicherheitsbeiwerte γP (niedriger) und Streuungsfaktoren ξ (höher). In der Summe ergeben sich aber aus γP und ξ vergleichbare Größenordnungen auf der widerstehenden Seite wie nach DIN 1054:2005-01, siehe [59].
(3) Die bisherigen Grenzzustände nach DIN 1054:2005-01 werden im Handbuch EC 7-1 [44] wie folgt ersetzt:
a) Dem bisherigen Grenzzustand GZ 1A nach DIN 1054:2005-01 entsprechen ohne Einschränkung die Grenzzustände EQU, UPL und HYD nach Handbuch EC 7-1 [44].
b) Dem bisherigen Grenzzustand GZ 1B nach DIN 1054:2005-01 entspricht ohne Einschränkung der Grenzzustand STR nach Handbuch EC 7-1 [44] als „innere“ Pfahltragfähigkeit (Materialfestigkeit). Hinzu kommt der Grenzzustand GEO-2 nach Handbuch EC 7-1 [44] im Zusammenhang mit der „äußeren“ Bemessung der Gründungselemente, z. B. „äußere“ Pfahltragfähigkeit.
c) Dem bisherigen Grenzzustand GZ 1C nach DIN 1054:2005-01 entspricht der Grenzzustand GEO-3 nach Handbuch EC 7-1 [44] im Zusammenhang mit dem Nachweis der Gesamtstandsicherheit, d. h. bei Inanspruchnahme der Scherfestigkeit beim Nachweis der Sicherheit gegen Böschungsbruch und Geländebruch.
1.3 Planung und Prüfung von Pfahlgründungen
(1) In der EA-Pfähle werden in Anlehnung an Handbuch EC 7-1 [44] und Handbuch EC 7-2 [45] die Begriffe „Entwurfsverfasser“ (Planverfasser) verwendet.
(2) Der Entwurfsverfasser sollte einen Fachplaner für Pfahlgründungen hinzuziehen, wenn er nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung für die Planung der Pfahlgründung besitzt.
(3) Für Pfahlgründungen ist gemäß Handbuch EC 7-1 [44] ein Geotechnischer Entwurfsbericht zu verfassen, in dem auf den Geotechnischen Untersuchungsbericht nach Handbuch EC 7-2 [45] Bezug zu nehmen ist.
(4) Pfahlgründungen sind entweder in die Geotechnische Kategorie GK 2 oder GK 3 einzustufen. Einstufungskriterien siehe 3.2 und Handbuch EC 7-1 [44].
(5) Bei Pfahlgründungen, die in die Geotechnische Kategorie GK3 einzustufen sind, ist ein Sachverständiger für Geotechnik mit entsprechenden Erfahrungen in die bautechnische Prüfung des Geotechnischen Untersuchungsberichtes und des Geotechnischen Entwurfsberichtes einzubinden. Der Sachverständige für Geotechnik sollte insbesondere das Baugrundmodell, die Bodenkenngrößen und das Bemessungskonzept überprüfen sowie in Abstimmung mit dem Prüfingenieur Vergleichsrechnungen durchführen.
(6) Die Ausführung von Pfahlgründungen sollte durch einen Fachplaner bzw. Sachverständigen für Geotechnik überwacht werden, der über entsprechende Erfahrungen und Sachkunde mit Pfahlgründungsarbeiten verfügt. Bei Pfahlgründungen, die in die Geotechnische Kategorie GK3 einzustufen sind, ist der in (5) genannte Sachverständige auch zur Prüfung der Ausführungsplanung und bei der Überwachung der Pfahlausführungsarbeiten hinzuzuziehen.
2
Pfahlsysteme
2.1 Übersicht und Zuordnung zu den Pfahlsystemen
(1) Die in ihrer Bauart und ihren Anwendungsmöglichkeiten sehr unterschiedlichen Pfahlsysteme werden entsprechend der Herstellungsnormen, in denen sie beschrieben sind, in drei Gruppen zusammengefasst, s. Bild 2.1. Diese sind:
a) Bohrpfähle nach DIN EN 1536 und DIN SPEC 18140:
Bohrpfähle sind dadurch gekennzeichnet, dass bei ihrer Herstellung Boden gelöst und gefördert wird. Das geförderte Bodenvolumen kann dem gesamten Pfahlvolumen oder nur einem Teil davon entsprechen.
Die DIN EN 1536 gilt für vertikale und bis 4:1 geneigte Bohrpfähle (bei bleibender Verrohrung bis 3:1) mit Durchmessern zwischen 0,3 m und 3,0 m und einem Verhältnis Tiefe zu Durchmesser oder Breite ≥ 5.
Die Systematik der Norm unterscheidet Bohrpfähle nach der Art der Stützung des Bohrlochs und nach den Verfahren für Aushub, Betonierung und Einbau der Bewehrung. In Tabelle 2.1 sind die Verfahrenskombinationen zusammengestellt.
– Ungestütztes Bohren ist bei der Herstellung von Pfählen in (für die Dauer der Pfahlherstellung) standfesten Böden geeignet. Diese Pfähle werden in der Regel mit diskontinuierlichen Aushubverfahren (mit Kellystangen geführten Bohrschnecken oder Bohreimern, mit Seilgreifern oder Schappen) gebohrt und im Trockenen betoniert. Die Bewehrung kann vor oder nach dem Betonieren eingebaut werden. Die Pfähle können Fußaufweitungen oder in Sonderfällen auch Schaftaufweitungen erhalten.
– Verrohrtes Bohren ist bei der Herstellung von Pfählen in nicht standfesten Böden und bei Bohrungen unter dem Grundwasserspiegel geeignet. Der Aushub erfolgt diskontinuierlich wie oben beschrieben oder kontinuierlich, z. B. mit durchgehender Bohrschnecke oder im Spülbohrverfahren (letzteres ist in Deutschland bei der Pfahlherstellung weniger gebräuchlich). Die Pfähle können mit Fußaufweitung und bei großen Bohrtiefen teleskopiert, d. h. mit der Tiefe abgestuft verringertem Durchmesser, hergestellt werden. Der Beton wird im Kontraktorverfahren eingebracht. Nur wenn Grundwasserzutritt zum Bohrloch ausgeschlossen ist, darf der Betoneinbau nach den Bedingungen für das Betonieren im Trockenen erfolgen. Die Bewehrung kann vor oder nach dem Betonieren eingebaut werden. Die Verrohrung ist entweder temporär und wird während des Betonierens wieder ausgebaut oder kann permanent erforderlich sein, z. B. in freiem Wasser, bei starker Grundwasserströmung oder starker Betonaggressivität des Grundwassers.
– Der Aushub unter Stützflüssigkeit ist bei den gleichen Baugrundverhältnissen wie beim verrohrten Bohren und grundsätzlich mit den gleichen Aushubwerkzeugen möglich. Die Pfähle können außer mit kreisförmigen auch mit Rechteck-, T-, L oder Kreuzquerschnitten hergestellt werden. Die nicht-kreisförmigen Pfähle (sog. Barette) werden im Schlitzwandverfahren hergestellt. Für die flüssigkeitsgestützten Pfähle sind dem Schlitzwandverfahren entsprechende Standsicherheits- und Qualitätsnachweise zu erbringen.
– Erdgestützt, d. h. mit durchgehender Bohrschnecke hergestellte Pfähle. Es werden Bohrschnecken mit kleinem und solche mit großem Seelenrohrdurchmesser unterschieden, siehe auch 2.2.1.4. Während des Bohrens füllt sich der Wendelgang der Schnecke mit aufgelockertem Bohrgut. Dies stützt die Bohrlochwandung und wird auf der Wendel nach oben gefördert. Bei Verwendung von Bohrschnecken mit kleinem Seelenrohr wird der Beton beim Ziehen der Schnecke durch das Seelenrohr gepumpt. Der Bewehrungskorb wird nach Fertigstellung des Pfahls in den Frischbeton eingebracht. Während des Ziehens der Schnecke wird das auf der Wendel verbliebene Bohrgut abgeworfen. Beim Einsatz von Schnecken mit großem Seelenrohr wird in der Regel der Bewehrungskorb im Schutze des Seelenrohres vor dem Betonieren eingebaut. Mit großem Seelenrohr hergestellte Pfähle werden auch als „Teilverdrängungsbohrpfähle“ bezeichnet, da nur ein Teil des Bodenvolumens gefördert und der übrige Teil in die Pfahlumgebung verdrängt wird. Zur Untergruppe der Teilverdrängungsbohrpfähle gehören auch solche Systeme, deren Bohrwerkzeug nur auf einer Teillänge im Fußbereich eine durchgehende Schnecke aufweist. Beim Einbohren in den tragfähigen Boden kann dieser zumindest teilweise in darüberliegende Schichten umgelagert werden. Beim Herausziehen der Bohrschnecke wird das im Schneckengang liegende Bodenmaterial zur Geländeoberfläche gefördert.
b) Verdrängungspfähle nach DIN EN 12699 und DIN SPEC 18538:
Verdrängungspfähle sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ohne Aushub oder Entfernen von Bodenmaterial eingebracht werden – außer zur Begrenzung von Hebungen, Erschütterungen, zum Entfernen von Hindernissen oder als Einbringhilfe.
Der bei der Herstellung von Verdrängungspfählen an der Geländeoberfläche entstehende Bodenaufwurf ist auf den Verdrängungseffekt und die oberflächennah fehlende Bodenauflast zurückzuführen. Er stellt keine relevante Bodenförderung dar.
Der Mindestpfahldurchmesser bzw. die entsprechende Querschnittsabmessung ist in DIN EN 12699 derzeit auf 150 mm festgelegt.
Anmerkung:
Bei der z. Zt. laufenden Überarbeitung der Norm wird diese Grenze zukünftig entfallen.
Innerhalb der Gruppe der Verdrängungspfähle werden unterschieden
– Fertigrammpfähle aus Stahlbeton, Spannbeton, Stahl, Gusseisen oder Holz,
– Ortbetonrammpfähle,
– verpresste Verdrängungspfähle,
– Schraubpfähle (Vollverdrängungsbohrpfähle). Dies sind Pfahlsysteme, bei deren Herstellung das Vortreibrohr mit einem am unteren Ende angeordneten Verdrängungsbohrkopf durch Drehen und Drücken in den Boden eingebracht wird, ohne dass es zu einer relevanten Bodenförderung oder einer Bodenumlagerung aus dem Einbindebereich im tragfähigen Boden in darüberliegende Schichten kommt.
Anmerkung:
Bei Verdrängungspfahlsystemen, deren Bohrwerkzeug im Fußbereich mehr als einen Schneckengang besitzt, kann es beim Abteufen des Bohrwerkzeugs zu einer Umlagerung des Bodens aus der tragfähigen Bodenschicht heraus in die darüber liegende Schicht kommen. Das in dem Schneckengang liegenden Bodenmaterial wird beim Herausziehen des Bohrwerkzeugs gefördert. Diese Effekte sind bei der Bemessung zu berücksichtigen, sie können zu einer Abminderung der Tragfähigkeit gegenüber den „Vollverdrängungspfählen“ führen. Für diese Pfahlsysteme sind in Kap. 5 keine Erfahrungswerte der Pfahlwiderstände angegeben.
c) Mikropfähle nach DIN EN 14199 und DIN SPEC 18539:
Der Durchmesserbereich der Mikropfähle liegt nach dem derzeitigen Stand der Normung bei gebohrten Pfählen unter 0,30 m und bei Verdrängungspfählen bis 0,15 m. Die Kraftübertragung zum umgebenden Baugrund erfolgt bei Mikropfählen überwiegend durch Mantelreibung.
Innerhalb der Gruppe werden unterschieden:
– Ortbetonpfähle mit kleinformatigen Bewehrungskörben und feinkörnigen Betonen oder Mörteln, für die im Wesentlichen die Verfahren der verrohrten oder suspensionsgestützten Pfahlherstellung angewendet werden,
– Verbundpfähle, die ein stab- oder rohrförmiges Tragglied aus Stahl mit einer Zementmörtelumhüllung besitzen und
– Fertigpfähle (< 0,15 m) mit oder ohne Nachverpressung.
Anmerkung
Bei der laufenden Überarbeitung der Normen EN 12699 und EN 14199 ist geplant, die Durchmesserbegrenzung aufzuheben und alle Verdrängungspfähle der Norm EN 12699 zuzuordnen.
Bild 2.1 Übersicht über die nach den Herstellungsnormen DIN EN 1536, DIN EN 12 699 und DIN EN 14 199 genormten Pfahlsysteme
2.2 Pfahlherstellung
2.2.1 Bohrpfähle
2.2.1.1 Verrohrt hergestellte Bohrpfähle
(1) Bei verrohrt hergestellten Bohrpfählen wird der Boden im Schutz einer Verrohrung gelöst und gefördert. Anschließend wird in den temporär hergestellten verrohrten Hohlraum ggf. Bewehrung eingestellt und Beton eingebracht. Die Herstellung erfolgt nach DIN EN 1536, s. a. [80] und [136].
(2) Das Einbringen der Bohrrohre kann auf verschiedene Arten erfolgen:
– durch Hin- und Herdrehen (Oszillation) oder einsinniges Durchdrehen (Rotation) und axialem Vorschub mit einer Verrohrungsanlage oder Rohrdrehmaschine,
– mit dem Kraftdrehkopf eines Bohrgerätes für das Drehbohrverfahren,
– durch Einbringen mittels Ramm- oder Vibrationsbär.
(3) Bei großen Bohrtiefen und hoher Mantelreibung kann die Verrohrung teleskopartig ausgebildet werden. Dabei wird die Bohrung mit dem größten Durchmesser begonnen. Vor Erreichen der Leistungsgrenze der Verrohrungsmaschine wird das Bohrrohr abgefangen und mit einer Rohrtour mit kleinerem Durchmesser weitergebohrt.
(4) In nicht standfesten Böden ist die Verrohrung dem Aushub voreilend einzubringen. Nur in festen oder zumindest temporär standfesten Böden darf die Verrohrung dem Aushub nacheilend eingebracht werden. Die Verrohrung besitzt am unteren Ende einen Schneidschuh mit gehärteten Spezialzähnen, die zur Reibungsverminderung auch einen geringen Freischnitt zur Rohrwandung herstellen.
(5) Das Lösen und Fördern des Bodens kann auf verschiedene Arten erfolgen:
– diskontinuierlich im Drehbohrverfahren mit Drehbohrgeräten und Kellystangen-geführten Schneckenwerkzeugen, Bohreimern (Kastenbohrern) und Kernbohrern,
– diskontinuierlich im Greiferbohrverfahren mit Seilbagger und Bohrgreifer, Kiespumpe oder Meißel,
– kontinuierlich mit durchgehender Bohrschnecke (Doppelkopf-Bohrverfahren),
– kontinuierlich mit Flügel- oder Rollenmeißel im Spülbohrverfahren.
(6) Beim Doppelkopfbohrverfahren wird das Bohrwerkzeug mit der Verrohrung unter ständiger Rotation in den Baugrund vorgeschoben, wobei der Boden mit dem Schneckenwerkzeug gelöst und auf dem Wendelgang gefördert wird.
(7) Bei Spülbohrungen wird der Boden durch Rollen- oder Flügelmeißel fortlaufend gelöst. Der Materialtransport erfolgt durch Luft- und/oder Wasserspülung. Diese Bohrverfahren sind in Deutschland zur Herstellung von tiefen Brunnenbohrungen oder Bohrungen zur Erdwärmegewinnung verbreitet, kommen zur Pfahlherstellung aber nur in Ausnahmefällen zur Anwendung.
(8) Um Auflockerungen im umgebenden Boden so gering wie möglich zu halten, sind die Grundsätze nach 11.2.1 einzuhalten. Nach Erreichen der Endtiefe wird im Regelfall ein Bewehrungskorb eingesetzt und der Pfahl im Kontraktorverfahren bei gleichzeitigem Ziehen der Verrohrung betoniert. Der Bewehrungskorb kann aber auch nachträglich in die Frischbetonsäule eingebracht werden (z. B. beim Doppelkopf-Bohrverfahren).
(9) Zur Herstellung von Fußaufweitungen werden spezielle Aufschneid- Werkzeuge verwendet. Da diese nicht innerhalb der Verrohrung eingesetzt werden können, ist der Einsatz nur in standfesten Böden oder unter besonderer Stützung des Aufweitungsbereichs möglich.
(10) Verrohrte Bohrpfähle werden mit Schaftdurchmessern bis zu 2,5 m, in Sonderfällen auch größer, hergestellt. Der Hauptanwendungsbereich liegt zwischen 0,6 und 1,8 m. In Abhängigkeit vom Baugrund und Durchmesser können Tiefen bis ca. 60 m ausgeführt werden. Für größere Tiefen können Maßnahmen nach (3) erforderlich sein.
(11) Die charakteristischen Pfahlwiderstände im Gebrauchszustand liegen, je nach Durchmesser und Untergrundverhältnissen, in einer Größenordnung zwischen etwa 1 und 10 MN. Sie können bei großem Durchmesser und günstigen Untergrundverhältnissen auch höher sein.
(12) Insbesondere Pfähle mit größeren Pfahldurchmessern können bei geeignetem Baugrund aufgrund ihrer hohen Biegesteifigkeit auch beträchtliche Horizontallasten abtragen.
(13) Verrohrte Bohrpfähle können in allen Böden sowie (mit Einschränkungen) in Fels hergestellt werden. Hindernisse können mit speziellen Werkzeugen durchörtert werden (Meißel, Felsbohrschnecken und -eimer, Kernrohre).
2.2.1.2 Ungestützt hergestellte Bohrpfähle
(1) In ausreichend standfesten Böden können Bohrpfähle auch ohne Verrohrung oder andere Stützung des Bohrloches hergestellt werden.
(2) In solchen Fällen ist lediglich im Bereich des Bohrlochmundes ein Schutzrohr zur Stabilisierung des Bohrloches und zur Führung des Bohrwerkzeuges erforderlich.
(3) Werden nicht-standfeste Bodenschichten durchfahren, ist dieser Bereich des Bohrlochs zu stützen.
(4) Das Herstellungsverfahren sollte nur für Lotpfähle und Schrägpfähle bis zu einer Neigung von 15:1 eingesetzt werden.
2.2.1.3 Flüssigkeitsgestützt hergestellte Bohrpfähle
(1) Flüssigkeitsgestützt hergestellte Bohrpfähle können sowohl kreisförmige als auch rechteckige oder aus Rechtecken zusammengesetzte Querschnitte besitzen. Letztere werden auch Barette genannt. Als Stützflüssigkeit zur Stabilisierung der Bohrlochwandungen wird üblicherweise eine Bentonitsuspension eingesetzt.
(2) Zu Beginn der Arbeiten wird ein Anfängerrohr (kreisförmig) gesetzt oder eine Leitwand (Barette) gebaut. Danach erfolgt der Bodenaushub im Schutz der Stützflüssigkeit. Der Flüssigkeitsspiegel im Bohrloch muss ständig innerhalb des Anfängerrohres oder der Leitwand so hoch gehalten werden, dass ein ausreichender Überdruck auf die Bohrlochwandung vorhanden ist. Die Standsicherheit des flüssigkeitsgestützten Bohrloches ist nach DIN 4126 nachzuweisen. Nach Erreichen der Endtiefe werden im Regelfall ein Bewehrungskorb und danach der Beton im Kontraktorverfahren eingebaut.
(3) Der Bodenaushub wird bei Kreisquerschnitten in der Regel mit den oben beschriebenen diskontinuierlich arbeitenden Bohrwerkzeugen durchgeführt. Für die Herstellung nicht-kreisförmiger Querschnitte werden Schlitzwandgreifer oder -fräsen eingesetzt.
(4) Die Pfähle werden kreisförmig mit Durchmessern bis ca. 3 m oder rechteckig als Barette (s. 2.2.1.7) mit Breiten von 0,4 m bis 2,0 m und Längen von 2,2 m bis 7 m ausgeführt. Auch aus Rechtecken zusammengesetzte, z. B. T-förmige Querschnitte, sind möglich.
(5) Aufgrund der möglichen großen Querschnittsabmessungen können diese Pfähle sehr hohe vertikale und horizontale Lasten aufnehmen. Pfahllängen von über 60 m sind möglich.
(6) Das Verfahren eignet sich auch für die Herstellung von Primärstützen bei der Deckelbauweise. Dabei handelt es sich um vertikale Bauglieder, die beim Bauen „von oben nach unten“ als Auflager für die Geschossdecken dienen. Die Primärstütze besteht aus einem Ortbetonpfahl im Fußbereich und einer aufgehenden Fertigteilstütze aus Stahl, Stahlbeton oder Verbundmaterial.
2.2.1.4 Erdgestützt mit durchgehender Bohrschnecke hergestellte Bohrpfähle
(1) Bei erdgestützt mit durchgehender Bohrschnecke hergestellten Bohrpfählen wird eine über die gesamte Länge reichende Bohrschnecke in den Boden gedreht und anschließend beim Ziehen der Schnecke der Beton eingepumpt. Die Pfähle können unbewehrt oder bewehrt hergestellt werden. Die Herstellung erfolgt erschütterungsfrei.
(2) Diese Pfahlsysteme werden auch als Schneckenbohrpfähle bezeichnet. Es werden Bohrschnecken mit kleinem und großem Seelenrohr unterschieden. Bei Schnecken mit kleinem Seelenrohr ist das Verhältnis von Seelenrohrdurchmesser Di zu Außendurchmesser Da der Bohrschnecke üblicherweise Di/Da < 0,4. Bei Schnecken mit großem Seelenrohr (Teilverdrängungsbohrpfähle) ist Di/Da > 0,6.
(3) Gängige Außendurchmesser der Bohrschnecken liegen zwischen 0,4 m und 1,2 m.
(4) Pfähle mit durchgehender Bohrschnecke und großem Seelenrohr werden auch als Teilverdrängungsbohrpfähle bezeichnet, siehe auch 5.4.7 und 11.2.6. Bei diesen Pfählen wird ein Teil des Bodens seitlich verdrängt. Das geförderte Bodenvolumen sollte ca. 70 % des Pfahlvolumens nicht überschreiten.
(5) Die Bohrlochwandung wird beim Bohrvorgang durch den auf dem Wendelgang der Bohrschnecke liegenden und nach oben geförderten Boden gestützt. Während des Abteufvorgangs sind Vortriebsgeschwindigkeit und Drehzahl der Bohrschnecke den Untergrundverhältnissen anzupassen, um die Bodenförderung zu begrenzen und damit die Bodenstützung zu erhalten.
(6) Das Seelenrohr ist z. B. durch eine verlorene Fußplatte zu verschließen, damit dieses frei von Bodenmaterial und Wasser bleibt.
(7) Bedingt durch die Schneckengeometrie kann bei Verwendung von Bohrschnecken mit kleinem Seelenrohr ein Bewehrungskorb nur nach Fertigstellung des Pfahls in den Frischbeton eingebracht werden, bei Bohrschnecken mit großem Seelenrohr kann dagegen ein Bewehrungskorb im Schutze des Seelenrohres vor dem Betonieren eingebaut werden.
(8) Das Ziehen der Bohrschnecke sollte ohne oder nur mit geringer Drehbewegung im gleichen Drehsinn wie beim Abteufvorgang erfolgen, um einen Bodentransport über die Schnecke nach unten in den noch weichen Beton auszuschließen.
(9) Bohrpfähle mit durchgehender Bohrschnecke sollten nach DIN EN 1536 nicht in gleichförmigen, nichtbindigen Böden (d60/d10 < 1,5) unter dem Grundwasserspiegel, in lockeren nichtbindigen Böden mit einer Lagerungsdichte D < 0,3 und in weichen bindigen Böden mit einer undränierten Scherfestigkeit cu < 15 kN/m2 hergestellt werden, es sei denn, die Machbarkeit des Herstellungsverfahrens wird vor Beginn der Bauausführung durch Probepfähle oder örtliche Erfahrungen nachgewiesen. Außerdem weist die Norm darauf hin, dass gleichförmige nichtbindige Böden mit 1,5 < d60/d10 < 3,0 unter dem Grundwasserspiegel empfindlich sein können.
(10) Die charakteristischen Pfahlwiderstände im Gebrauchszustand liegen, je nach Pfahldurchmesser und Untergrundverhältnissen, in einer Größenordnung zwischen etwa 0,5 MN und 2 MN.
2.2.1.5 Erdgestützt mit teilweise durchgehender Bohrschnecke hergestellte Bohrpfähle
(1) Pfähle mit teilweise durchgehender Bohrschnecke und großem Seelenrohr werden auch als Teilverdrängungsbohrpfähle bezeichnet, siehe auch 5.4.7.
2.2.1.6 Bohrpfähle mit Fußaufweitungen
(1) Fußaufweitungen können dann sinnvoll sein, wenn die Tragfähigkeit der Pfähle ganz oder überwiegend auf Spitzenwiderstand beruhen soll oder Pfähle auf einer tragfähigen Schicht abgesetzt werden sollen und/oder nur geringfügig in diese einbinden. Fußaufweitungen ermöglichen weiterhin bessere Ausnutzungen der Betonfestigkeiten und dadurch Materialersparnis im Pfahlschaft, da die anzusetzenden Spitzenwiderstände meist sehr deutlich unter den Betonfestigkeiten liegen.
(2) Durch Bodenvermörtelung im Düsenstrahlverfahren, durch Tiefenrüttlung o. ä. hergestellte Baugrundverbesserungen im Fußbereich eines Pfahles sind nicht als Fußaufweitung zu verstehen.
(3) Fußaufweitungen können nur in Böden ausgeführt werden, die standfest sind, oder die zum Herstellen der Aufweitungen geeignet stabilisiert werden, z. B. durch Bentonit- oder Zementsuspension.
(4) Die Herstellung von Fußaufweitungen ist i. d. R. nur bei vertikalen Pfählen und verrohrten Pfahlbohrungen möglich und erfordert besondere Aufweitungswerkzeuge; dies sind spezielle lange Bohreimer, die über die Kellystange geführt und mit kontrolliert ausfahrbaren Schneidflügeln versehen sind. Das Ausfahren der Schneidflügel geschieht i. d. R. durch den Vorschub der Kellystange und einen Scherenmechanismus im Inneren des Aufweitungsbohreimers, wobei das Maß des Vorschubs mit dem Maß der Aufweitung korreliert und dadurch kontrollierbar ist. Aus konstruktiven Gründen sind die Schneidflügel ein gewisses Maß oberhalb des Bodens des Bohreimers angeordnet und dieser Teil des Eimers ist zur Aufnahme gelösten Bohrgutes ausgebildet. Die Form einer Fußaufweitung entspricht daher einem Kegelstumpf mit kalottenförmiger Grundfläche und einem unteren zylindrischen Fortsatz.
(5) Bei der Ausführung einer Fußaufweitung wird die Bohrung mit einem der in 2.2.1.1 genannten Werkzeuge (z. B. einem Bohreimer) zunächst so tief abgeteuft, dass die Unterkante der ausgefahrenen Schneidflügel der vorgesehenen Solltiefe der Aufweitung entspricht. Anschließend wird die Verrohrung bis zur Oberkante der Schneidflügel gezogen und, bei Erfordernis, der nun unverrohrte untere Teil des Bohrloches stabilisiert. Danach wird die Kellystange mit dem Aufweitungswerkzeug in das Bohrloch eingefahren und die Aufweitung durch reine Rotation des Eimers und konusförmiges Abschälen der unverrohrten Bohrlochwandung hergestellt. Je nach dem zu erzielenden Maß der Aufweitung und der im unteren Teil des Eimers aufgenommenen Menge abgeschälten Materials muss das Aufweitungswerkzeug gezogen und entleert und der Aufweitungsvorgang wiederholt fortgesetzt werden.
(6) Nach der Aufweitung wird das Bohrloch gereinigt, die Bewehrung eingesetzt und der Pfahl betoniert. Die Betonierung des gesamten Aufweitungsbereiches muss bis in die Verrohrung hinein ohne Unterbrechung erfolgen, da sonst ein Risiko von Einschlüssen aus Fremdmaterial bestünde.
(7) Bei Fußaufweitungen bleibt der über den zylindrischen Pfahlschaft hinausgehende konische Teil unbewehrt. Die Lastausbreitung erfolgt aus dem Schaft in die Fußfläche allein durch Schubspannungen im Beton. Diese Lastausbreitung und die Stabilisierung der überhängenden Wandung der Aufweitung sind die Gründe für die geometrische Beschränkung der Aufweitung und die Beschränkung des Verhältnisses Fuß- zu Schaftdurchmesser.
(8) Zu den anzusetzenden Spitzenwiderständen bei Fußaufweitungen siehe 5.5.
2.2.1.7 Schlitzwandelemente/Barette
(1) Schlitzwandelemente/Barette sind nach DIN EN 1536 Bohrpfähle, wenn
– sie in einem Arbeitsgang betoniert werden,
– sie quadratische, rechteckige, T- oder L-förmige oder ähnliche Querschnittsformen aufweisen,
– die kleinste Seite Wi ≥ 0,4 m beträgt,
– das Verhältnis zwischen der größten Abmessung Li und der kleinsten Abmessung Wi des Schlitzwandelementes Li/Wi ≤ 6 beträgt,
– die kleinste Abmessung für Stahlbetonfertigteile, die in Schlitzwandelemente eingebaut werden, Dp ≥ 0,3 m bzw. Wp ≥ 0,3 m ist (Dp als Durchmesser eines runden Fertigteiles, Wp als kleinere Seitenlänge eines rechteckigen Fertigteiles) und
– die Gesamtquerschnittsfläche kleiner als 15 m2 ist.
2.2.2 Fertigrammpfähle
2.2.2.1 Allgemeines
(1) Unter Fertigrammpfählen nach DIN EN 12699 versteht man vorgefertigte Pfahlelemente aus Stahlbeton, Spannbeton, Stahl oder Holz, die den Boden beim Einrammen oder Einpressen vollkommen verdrängen und dadurch üblicherweise verdichten. Die Pfähle werden in ganzer Länge oder in Abschnitten werkseitig hergestellt, zur Baustelle transportiert und mit geeigneten Geräten eingerammt. Fertigrammpfähle können lotrecht oder mit Neigung eingebracht werden. In Abschnitten angelieferte Pfähle müssen je nach geforderter Gründungstiefe durch Kupplung oder Schweißung verlängert werden.
(2) Aufgrund des Verdrängungseffekts und der Art der Einbringung, die wie eine dynamische oder statische Pfahlbelastung wirkt, sind zur Mobilisierung der äußeren Tragfähigkeit nur geringe Setzungen bzw. Hebungen des fertiggestellten Pfahls erforderlich.
2.2.2.2 Fertigrammpfähle aus Beton
(1) Fertigrammpfähle aus Stahlbeton haben meist quadratische Querschnitte von 20 × 20 cm, bis 45 × 45 cm, seltener kommen auch Schleuderbetonpfähle als Rundpfähle mit Hohlquerschnitt in ähnlichen Dimensionen zum Einsatz. Die Pfähle sind standardmäßig bewehrt oder vorgespannt für die Beanspruchungen bei Transport, Einbringung und die Bauwerkslasten (Druck, Zug, Biegung). Vorgefertigte Betonpfähle werden für Standardeinsätze in Längen zwischen 6 m und 15 m produziert, in Ausnahmefällen bis ca. 25 m. Praktikabler lassen sich, bei Pfahllängen über 15 m, Teilstücke durch geprüfte und zugelassene Stahlkupplungen miteinander verbinden. Die Pfähle sind dadurch nahezu beliebig verlängerbar; es wurden schon Fertigrammpfähle aus Beton mit bis zu 80 m Länge ausgeführt. Sonderpfähle können mit einbetonierten Verpressrohren zur Nachverpressung (z. B. zur Erhöhung der Tragfähigkeit) ausgestattet werden.
(2) Fertigrammpfähle aus Beton werden heute üblicherweise eingerammt (Hydraulikbär, Dieselbär, Freifallbär). Zwischen Rammgewicht und Pfahl befindet sich eine Schlaghaube mit Puffermaterial z. B. aus Holz, Kunststoff, o. ä. Um die mechanischen Beanspruchungen beim Einrammen aufnehmen zu können, wird Beton der Güteklasse C 50/60 oder höher verarbeitet, der für die Expositionsklassen XC 4 bzw. XS 3 geeignet ist. Wegen der beim Rammen auftretenden Kräfte (Druck, Spaltzug) sind die Pfähle auf gesamter Länge bewehrt und verbügelt, jeweils an Kopf und Fuß liegt die Bügelbewehrung zur Verstärkung auf ca. 1 m Länge in engerem Abstand. Die Pfähle können mit einer Spitze hergestellt werden, normalerweise sind aber Kopf und Fuß in gleicher Weise stumpf ausgebildet. Bei harter Rammung in festen Böden oder auf Fels kann eine Stahlspitze einbetoniert werden, die bei Schleuderbetonpfählen generell notwendig ist.
(3) Die charakteristischen Pfahlwiderstände im Gebrauchszustand von Fertigrammpfählen aus Beton liegen, je nach Querschnitt und Untergrundverhältnissen, in einer Größenordnung zwischen etwa 0,5 MN und 2 MN.
2.2.2.3 Fertigrammpfähle aus Stahl und Gusseisen
2.2.2.4 Fertigrammpfähle aus Holz
(1) Holzpfähle spielen in der heutigen Baupraxis nur eine untergeordnete Rolle. Sie werden überwiegend für temporäre Baumaßnahmen eingesetzt, z. B. Gründung von Lehrgerüsten usw. Zur Gründung von Bauwerken werden sie wegen der Nachteile im Material und der vergleichsweise geringen Tragfähigkeit kaum noch verwendet. Holzpfähle werden auch aus gestalterischen Gründen, z. B. bei Verbaumaßnahmen an Flüssen und Seen oder für Geländeabtreppungen im Landschaftsbau oder leichte Gründungen z. B. in Naturschutzgebieten verwendet.
(2) Holzpfähle werden als Rundpfähle mit Durchmessern von 15 cm bis 35 cm hergestellt und können für die Rammung an Kopf (Schlagring) und Fuß (Spitze) durch Stahl verstärkt werden. Normalerweise werden für Holzpfähle leichte Rammgeräte mit Fallgewichten bis maximal 1 t verwendet.
(3) Die charakteristischen Pfahlwiderstände im Gebrauchszustand von Holzpfählen liegen, je nach Querschnitt, Länge und Untergrundverhältnissen, in einer Größenordnung zwischen etwa 100 kN und 600 kN.
2.2.3 Ortbetonrammpfähle
2.2.3.1 Ortbetonrammpfahl mit Innenrohrrammung (Frankipfahl)
(1) Der Frankipfahl ist ein Ortbetonrammpfahl mit Innenrohrrammung nach DIN EN 12699 und wird mit aufgeweitetem Pfahlfuß hergestellt.
(2) Das Vortreibrohr wird mittels Freifallrammung im Rohr (Innenrohrrammung) in den Boden getrieben. Vor Beginn des Einrammvorganges wird im Fußbereich des Vortreibrohres ein Pfropfen gebildet, der entweder aus nahezu trockenem Beton oder einem Sand- bzw. Kies-Sandgemisch besteht. Das Pfropfenmaterial wird mit dem Rammbär verdichtet und verspannt sich im Rohr. Dieser Pfropfen erfüllt einen doppelten Zweck. Er dient einerseits als Rammpolster, auf das der Freifallbär schlägt und damit das Rohr in den Boden zieht, andererseits dichtet der Pfropfen das Rohr unten ab und verhindert das Eindringen von Wasser und Boden. Nach Erreichen der Endtiefe wird das Vortreibrohr durch Seile im Mäkler gehalten und die Fußherstellung beginnt mit dem Austreiben des Pfropfenmaterials. Angepasst an die örtliche Bodenfestigkeit und die geplante Pfahltragfähigkeit kann weiteres Material ausgestampft und der Pfahlfuß soweit aufgeweitet werden, bis das erforderliche Fußvolumen erreicht ist, das der Bemessung zugrunde liegt.
(3) Anschließend wird im Regelfall ein Bewehrungskorb eingestellt und fließfähiger Beton im Trockenen eingefüllt. Durch Ziehen des Rohrs und Nachfüllen von Beton wird der Pfahlschaft ausgebildet.
(4) Um die Baugrundeigenschaften zu verbessern und die Pfahltragfähigkeit zu steigern, kann die Pfahlherstellung vor dem Betonieren durch eine zusätzliche Bodenverbesserung sowohl im Schaft- als auch Fußbereich modifiziert werden.
(5) Für eine Kiesvorverdichtung im Fußbereich wird das Rohr 1 bis 2 m unter die spätere Pfahlunterkante gerammt und dann unter Ausstampfen und Verdichten von Kies oder Schotter über ca. 2 bis 4 m gezogen. Anschließend wird das Rohr in das zuvor ausgestampfte und verdichtete Material bis zur geplanten Tiefe zurückgerammt. Der Eindringwiderstand steigt hierbei gegenüber der ersten Rammung deutlich, worin sich die erreichte Baugrundverbesserung widerspiegelt. Falls erforderlich, können weitere Kiesvorverdichtungen durchgeführt werden, bis der erforderliche Verbesserungsgrad erreicht ist. Die anschließende Herstellung des Pfahlfußes und -schafts erfolgt wie unter (2) und (3) beschrieben.
(6) Frankipfähle werden mit Rohrdurchmessern von 42 cm bis 71 cm ausgeführt. Sie können als Lotpfähle oder als Schrägpfähle mit einer Neigung bis 4:1 hergestellt werden.
(7) Die charakteristischen Pfahlwiderstände im Gebrauchszustand liegen, je nach Untergrundverhältnissen und Durchmesser, in einer Größenordnung zwischen 1 MN und 6 MN.
2.2.3.2 Ortbetonrammpfahl mit Kopframmung (z. B. Simplexpfahl)
(1) Der Ortbetonrammpfahl mit Kopframmung ist ein Verdrängungspfahl nach DIN EN 12699.
(2) Bei diesem Verfahren wird das Vortreibrohr mittels Kopframmung durch einen Diesel-, Hydraulik- oder Vibrationsbär in den Boden gerammt. Das Rohr ist unten mit einer verlorenen Fußplatte verschlossen. Wenn die Absetztiefe erreicht ist, wird im Regelfall ein Bewehrungskorb eingestellt und fließfähiger Beton im Trockenen eingefüllt. Beim anschließenden Ziehen des Rohres löst sich die Fußplatte und der Beton fließt aus. Durch Nachfüllen von Beton und sukzessivem Herausziehen des Rohrs wird der Pfahl fertiggestellt. Die Fußplatte verbleibt im Boden und bildet die Aufstandsfläche des Pfahls.
(3) Auch bei diesem Verfahren kann eine Baugrundverbesserung durch Kiesvorverdichtung erfolgen. Dazu wird das Vortreibrohr mit der verlorenen Fußplatte 1 bis 2 m unter die spätere Pfahlunterkante gerammt, Kies eingefüllt und das Rohr wieder komplett bis zur Geländeoberfläche gezogen. Dabei füllt das lose austretende Kiesmaterial den freiwerdenden Hohlraum aus. Anschließend wird das Rohr wieder mit einer Fußplatte verschlossen und in die Kiessäule bis auf die erforderliche Tiefe gerammt. Die weitere Pfahlherstellung erfolgt wie unter (2) beschrieben.
(4) Simplexpfähle werden in der Regel mit Durchmessern von ca. 40 bis 60 cm ausgeführt. Sie können als Lot- oder als Schrägpfähle mit einer Neigung bis 4:1 hergestellt werden.
(5) Die charakteristischen Pfahlwiderstände im Gebrauchszustand liegen, je nach Untergrundverhältnissen und Durchmesser, in einer Größenordnung zwischen etwa 0,5 MN und 2,5 MN.
(6) Bei Ortbetonrammpfählen mit Kopframmung kann auch eine Fußausrammung erfolgen. Dabei sind zwei Varianten zu unterscheiden. Zum einen kann nach dem Erreichen der Endtiefe, dem Einbau des Bewehrungskorbs und dem Einfüllen des fließfähigen Betons das Vortreibrohr um ca. 2 m gezogen werden; danach wird das Vortreibrohr komplett mit Beton gefüllt, am Rohrkopf verschlossen und per Kopframmung wieder zurück auf die ursprüngliche Tiefe gerammt.
(7) Bei der anderen Variante wird nach dem Einrammen des Vortreibrohrs mit Hilfe eines Diesel- oder Hydraulikbären auf Endtiefe erdfeuchter Beton ins Rohr eingefüllt und danach ein zusätzliches Stampfrohr in das Vortreibrohr eingestellt. Anschließend wird über dieses Stampfrohr mittels Kopframmung der Fuß ausgerammt.
(8) Für die unter (6) und (7) beschriebenen Pfahlsysteme sind die in 5.4.5.2 angegebenen Erfahrungswerte von Pfahlfußwiderstand und Pfahlmantelreibung nicht anwendbar.
2.2.4 Schraubpfähle (Vollverdrängungsbohrpfähle)
2.2.4.1 Allgemeines
(1) Schraubpfähle sind Verdrängungspfähle nach DIN EN 12699.
(2) Bei Schraubpfählen werden die Vortreibrohre ohne dynamische Einwirkungen in den Boden eingedreht. Aus diesem Grund und wegen der vollständigen Bodenverdrängung ist die Einbindetiefe dieser Pfähle in dichte oder feste Bodenschichten begrenzt. Die Einbringung erfolgt erschütterungsfrei.
2.2.4.2 Atlaspfahl
(1) Bei der Herstellung des Atlaspfahls wird ein Vortreibrohr mit einem eingängigen Schraubenflügel am Schneidkopf mit einem leistungsstarken Drehbohrantrieb bei gleichzeitigem vertikalem Anpressdruck in den Boden gedreht, wobei der Boden vollständig verdrängt wird. Der Schneidkopf ist unten durch eine verlorene Fußspitze wasserdicht verschlossen.
(2) Nach Erreichen der Solltiefe wird im Regelfall ein Bewehrungskorb eingesetzt, das Rohr und der oben aufgesetzte Vorratsbehälter mit fließfähigem Beton gefüllt. Durch rückwärtiges Drehen und Ziehen des Rohrs löst sich die Fußspitze und der austretende Beton füllt den vom Schneidkopf geformten Hohlraum. Bedingt durch den eingängigen Schraubenflügel am Schneidkopf erhält der fertige Pfahlschaft einen umlaufenden, wendelförmigen Betonwulst, so dass das Aussehen des fertigen Pfahls einer Schraube gleicht.
(3) Da der Herstellvorgang nur mit statisch wirkenden Kräften erfolgt, arbeitet das Verfahren erschütterungsfrei.
(4) Der Durchmesser des Pfahlschafts ist abhängig von der Größe des austauschbaren Schneidkopfs. Übliche Durchmesserkombinationen sind 31/41 cm und 51/56 cm. Der erste Wert gibt den Mindestdurchmesser des Betonquerschnitts an (maßgebend für die innere Tragfähigkeit), der zweite Wert den äußeren Durchmesser des wendelförmigen Betonkörpers (maßgebend für die äußere Tragfähigkeit).
(5) Die Pfähle können lotrecht oder bis zu einer Neigung von 4:1 hergestellt werden.
(6) Übliche charakteristische Pfahlwiderstände im Gebrauchszustand liegen, je nach Untergrundverhältnissen und Durchmesser, in einer Größenordnung zwischen etwa 0,5 MN und 1,7 MN.
2.2.4.3 Fundexpfahl
(1) Zur Herstellung des Fundexpfahls wird ein glattes Vortreibrohr mit einem Durchmesser von 38 cm oder 44 cm, das durch eine wendelförmig abgestufte Spitze verschlossen ist, in den Boden gedreht und gedrückt. Der Boden wird vollständig verdrängt. Übliche Durchmesserkombinationen sind 38/45 cm und 44/56 cm (der zweite Wert gibt den Durchmesser der Spitze an).
(2) Nach Erreichen der Endtiefe wird im Regelfall ein Bewehrungskorb in das Vortreibrohr eingesetzt und fließfähiger Beton eingefüllt. Anschließend wird das Rohr mit oszillierender Drehbewegung gezogen, wobei sich die Fußspitze vom Rohr löst. Sie verbleibt als Pfahlfuß im Boden.
(3) Die Pfähle können lotrecht oder bis zu einer Neigung von 4:1 hergestellt werden.
(4) Die gesamte Pfahlherstellung erfolgt erschütterungsfrei.
(5) Übliche charakteristische Pfahlwiderstände im Gebrauchszustand liegen, je nach Untergrundverhältnissen und Durchmesser, in einer Größenordnung zwischen etwa 0,5 MN und 1,5 MN.
2.2.5 Verpresste Verdrängungspfähle
2.2.5.1 Verpressmörtelpfähle (VM-Pfähle)
(1) Ein VM-Pfahl ist ein Stahlrammpfahl mit spezieller Fußausbildung, der unter gleichzeitiger Zugabe von Mörtel in den Boden gerammt wird. Unter diesen Begriff fallen auch die früher als MV- oder RV-Pfähle bekannten, z. T. patentgeschützten Rammverpresspfähle.
(2) Charakteristisch für diese Pfähle ist ein am Fuß aufgeschweißter, keilförmiger Pfahlschuh mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt. Durch das Einrammen dieses gegenüber dem Pfahlschaft vergrößerten Fußquerschnittes entsteht ein Hohlraum, der bereits während des Einbringens mit Zementmörtel verfüllt wird.
(3) Da im Gegensatz zu Mikropfählen nach DIN EN 14199 der zu verfüllende Hohlraum nach oben offen ist, wird das Verpressgut lediglich mit dem hydrostatischen Druck eingebracht. Die Steuerung der Verpressleistung ist so vorzunehmen, dass eine vollkommene Ummantelung der Pfähle sichergestellt ist.
(4) Verpressmörtelpfähle werden überwiegend als Zugpfähle eingesetzt. Übliche charakteristische Pfahlwiderstände im Gebrauchszustand liegen, je nach Untergrundverhältnissen und Querschnitt, in einer Größenordnung zwischen etwa 1 MN und 2,5 MN.
2.2.5.2 Rüttelinjektionspfähle (RI-Pfähle)
(1) RI-Pfähle beruhen auf einem ähnlichen Herstellprinzip wie VM-Pfähle. Durch einen gegenüber dem Pfahlschaft leicht vergrößerten Pfahlfuß wird beim Einrütteln ein Hohlraum erzeugt, der kontinuierlich mit Verpressmörtel verfüllt wird.
(2) Beim RI-Pfahl wird am Fuß durch eine Aufdoppelung über die gesamte Abwicklung ein schmaler Spalt zwischen Pfahlschaft und Boden geschaffen und im Zuge des Einrüttelns verfüllt; im Gegensatz dazu hat der Verpressmörtelpfahl eine über den gesamten Pfahlumriss ausgebildete Spitze, die eine sehr große Bodenmenge verdrängen muss.
(3) Somit hat der RI-Pfahl einen wesentlich geringeren Eindringwiderstand, der es ermöglicht, ihn im Rüttelverfahren einzubringen. Über Injektionsrohre wird Zementmörtel eingepumpt und somit eine innige Verzahnung mit dem Baugrund gewährleistet.
(4) Der RI-Pfahl führt aufgrund des o. g. Rüttelverfahrens zu geringeren Lärmemissionen als bei gerammten Pfählen. Die schwingungstechnischen Auswirkungen des Rüttelns auf die Umgebung bzw. auf benachbarte bauliche Anlagen sind zu berücksichtigen.
(5) Herstellbedingt bestehen Einsatzgrenzen bei sehr dicht gelagerten Sanden und Kiesen. Einbringhilfen (Nieder-/Hochdruckspülung) können sinnvoll sein. In bindigen Böden ist der RI-Pfahl abhängig von der Konsistenz nur bedingt einsetzbar.
(6) RI-Pfähle werden überwiegend als Zugpfähle eingesetzt. Übliche charakteristische Pfahlwiderstände im Gebrauchszustand liegen, je nach Untergrundverhältnissen und Querschnitt, in einer Größenordnung zwischen etwa 0,5 MN und 1,5 MN.
2.2.6 Mikropfähle
(1) Mikropfähle sind als Pfähle mit Durchmessern kleiner als 0,3 m definiert und in DIN EN 14199 geregelt.
(2) Hierzu gehören u. a. die früher häufig eingesetzten Wurzelpfähle wie auch die in den letzten 20 Jahren überwiegend verwendeten Einstab- oder Rohrverpresspfähle.
(3) Ihre Vorteile liegen darin, dass sie mit kompakten Geräten auch unter beengten Platzverhältnissen hergestellt werden können und dass die Herstellung weitgehend lärm- und erschütterungsarm ist.
(4) Die Kraftübertragung zum umgebenden Baugrund wird durch Verpressen mit Beton oder Zementmörtel erreicht. Dabei ist zu unterscheiden zwischen:
a) Ortbetonpfahl, der eine durchgehende Längsbewehrung aus Betonstahl aufweist. Er kann mit Beton oder mit Zementmörtel hergestellt werden. Hierbei beträgt der erforderliche Mindestschaftdurchmesser 150 mm.
b) Verbundpfahl, der durch ein Tragglied aus Stahl mit einer Zementsteinummantelung gekennzeichnet ist. Das Tragglied wird in eine Bohrung eingestellt.
(5) Zur Herstellung der Bohrung für den Mikropfahl eignen sich Schlag- und Drehbohrverfahren mit Innen- und Außenspülung, Ramm- und Rüttelverfahren. Ein Lösen des Bodens allein mit Spülverfahren ist nicht zulässig. Beim Bohren unter dem Grundwasserspiegel muss durch Überdruck der Spül- oder Stützflüssigkeiten verhindert werden, dass Boden in das Bohrloch eintreibt. Das abgeteufte Bohrloch ist von Bohrrückständen zu säubern.
(6) Als Verpressen ist das Einbringen des Verpressgutes unter höherem als dem hydrostatischem Druck an der Austrittstelle zu verstehen. Beim „Nachverpressen“ werden ein- oder mehrmalig Verpressungen nach dem Abbinden oder dem Aushärten des ersten Verpressguts durchgeführt. Verpressgut, -drücke und -mengen sind dem Baugrund und den örtlichen Verhältnissen anzupassen. Das Verpressgut ist so zusammenzusetzen, dass Aufsprengungen im erstarrten oder erhärteten Material der ersten Verpressung wieder ausgefüllt werden. Bereits unter Last stehende Pfähle dürfen nicht nachverpresst werden. Das Nachverpressen wird. i. d. R. über kleine Verpressschläuche und mit Drücken zwischen 10 bar und maximal 60 bar ausgeführt.
(7) Übliche charakteristische Pfahlwiderstände im Gebrauchszustand liegen, je nach Untergrundverhältnissen und Querschnitt, in einer Größenordnung bis etwa 1,0 MN.
2.2.7 Rohrverpresspfähle
(1) Der Rohrverpresspfahl ist ein Mikropfahl nach DIN EN 14199, wenn sein Durchmesser kleiner als 30 cm ist. Er ist als Verbundpfahl einzustufen. Bei Durchmessern größer als 30 cm kann er nach DIN EN 1536 als Bohrpfahl mit einem Stahlrohr als Sonderbewehrung angesehen werden.
(2) Sofern der Verbund des äußeren Verpressmörtels zum Stahlrohr für die Tragfähigkeit und den Korrosionsschutz herangezogen wird, kann eine Zulassung erforderlich sein.
(3) Der Rohrverpresspfahl ist ein eingebohrter, dickwandiger Stahlrohrpfahl mit einer Schaft- und Fußverpressung aus Zementsuspension.
(4) Der zur Abtragung hoher Zuglasten geeignete Pfahl wird erschütterungsund lärmarm hergestellt und ist deshalb in immissionsempfindlichen Bereichen eine sinnvolle Alternative zu gerammten und konstruktiv angeschlossenen Verankerungselementen.
(5) Bei Bodenverhältnissen, bei denen große Bohrspülverluste auftreten können, ist diese Pfahlart nicht oder nur in Verbindung mit besonderen Zusatzmaßnahmen einsetzbar.
(6) Der Rohrverpresspfahl besteht aus einzelnen ca. 3 m langen Stahlrohrschüssen, die während des Einbaus durch Verschrauben oder Verschweißen miteinander gekoppelt werden.
(7) Zur besseren Haftung des Verpressmörtels am Rohr kann dieses mit einem aufgewalzten Gewinde versehen werden.