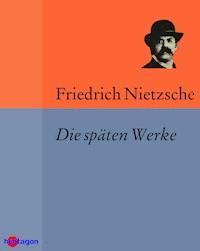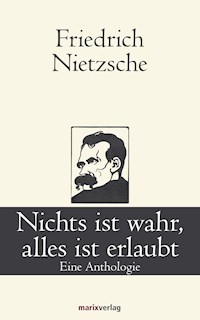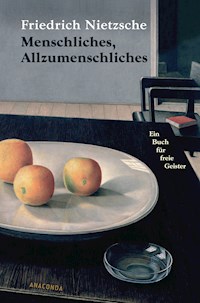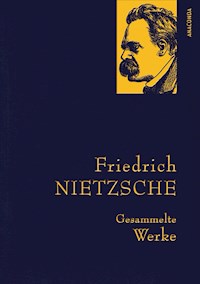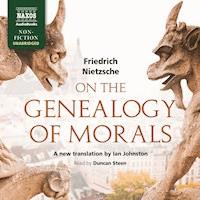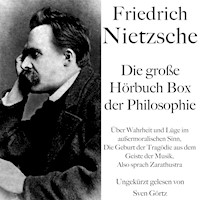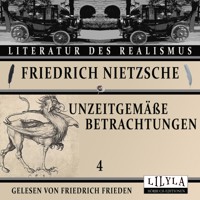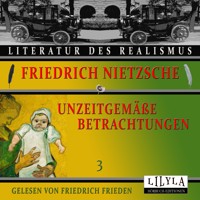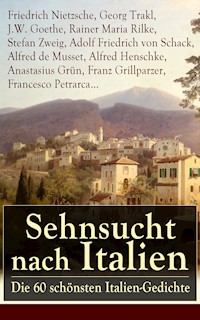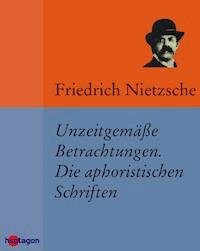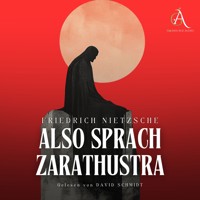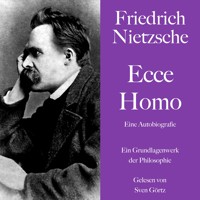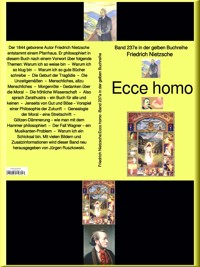
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: gelbe Buchreihe
- Sprache: Deutsch
Der 1844 geborene Autor Friedrich Nietzsche entstammt einem Pfarrhaus. Er philosophiert in diesem Buch nach einem Vorwort über folgende Themen: Warum ich so weise bin – Warum ich so klug bin – Warum ich so gute Bücher schreibe – Die Geburt der Tragödie – Die Unzeitgemäßen – Menschliches, allzu Menschliches – Morgenröte – Gedanken über die Moral – Die fröhliche Wissenschaft – Also sprach Zarathustra – ein Buch für alle und keinen – Jenseits von Gut und Böse – Vorspiel einer Philosophie der Zukunft – Genealogie der Moral – eine Streitschrift – Götzen-Dämmerung – wie man mit dem Hammer philosophiert – Der Fall Wagner – ein Musikanten-Problem – Warum ich ein Schicksal bin. Mit vielen Bildern und Zusatzinformationen wird dieser Band neu herausgegeben von Jürgen Ruszkowski. – Rezession: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Friedrich Nietzsche
Ecco homo – Band 237 in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski
Band 237 in der gelben Buchreihe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Der Autor Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche – Buchbeginn Ecce homo – Wie man wird, was man ist
Warum ich so weise bin
Warum ich so klug bin
Warum ich so gute Bücher schreibe
Die Geburt der Tragödie
Die Unzeitgemäßen
Menschliches, allzu Menschliches
Morgentöte
Die fröhliche Wissenschaft
Also sprach Zarathustra
Jenseits von Gut und Böse
Genealogie der Moral
Götzendämmerung
Der Fall Wagner
Warum ich ein Schicksal bin
Die maritime gelbe Buchreihe
Weitere Informationen
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Vorwort des Herausgebers
Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche.
Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.
Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere. 2023
Jürgen Ruszkowski
Ruhestands-Arbeitsplatz
Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers
* * *
Der Autor Friedrich Nietzsche
Der Autor Friedrich Nietzsche
https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/nietzsch.html
Der 1844 geborene Friedrich Nietzsche philosophiert in diesem Buch über folgende Themen: Warum ich so weise bin, Warum ich so klug bin, Warum ich so gute Bücher schreibe, Die Geburt der Tragödie etc.
Friedrich Wilhelm Nietzsche, * 15. Oktober 1844 in Röcken; † 25. August 1900 in Weimar, war ein deutscher klassischer Philologe und Philosoph. Nietzsche, der im Nebenwerk auch Dichtungen und musikalische Kompositionen schuf, sprengte mit seinem eigenwilligen Stil bis dahin gängige Muster und ließ sich kaum einer klassischen Disziplin zuordnen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
Friedrich Nietzsche wurde am 15. Oktober 1844 in Röcken bei Lützen geboren. Er stammt väterlicher- und mütterlicherseits von Pastoren ab. Er studierte von 1864-1865 klassische Philologie in Bonn und Leipzig. Mit 25 Jahren wurde er außerordentlicher Professor der klassischen Philologie in Basel.
Nietzsche kam 1876 wegen eines Nerven- und Augenleidens vorübergehend und 1879 endgültig in den Ruhestand. 1889 brach seine Geisteskrankheit vollends aus, er kam in die Irrenanstalt in Basel. Er lebte seit 1897 in Weimar (in geistiger Umnachtung), wo er am 25. August 1900 starb.
* * *
Friedrich Nietzsche – Buchbeginn Ecce homo – Wie man wird, was man ist
Friedrich Nietzsche – Buchbeginn Ecce homo – Wie man wird, was man ist
https://www.projekt-gutenberg.org/nietzsch/eccehomo/chap001.html
* * *
Vorwort
1
In Voraussicht, dass ich über Kurzem mit der schwersten Forderung an die Menschheit herantreten muss, die je an sie gestellt wurde, scheint es mir unerlässlich, zu sagen, wer ich bin. Im Grunde dürfte man's wissen: denn ich habe mich nicht „unbezeugt gelassen“. Das Missverhältnis aber zwischen der Größe meiner Aufgabe und der Kleinheit meiner Zeitgenossen ist darin zum Ausdruck gekommen, dass man mich weder gehört, noch auch nur gesehen hat. Ich lebe auf meinen eignen Kredit hin, es ist vielleicht bloß ein Vorurteil, dass ich lebe? ... Ich brauche nur irgend einen „Gebildeten“ zu sprechen, der im Sommer ins Oberengadin kommt, um mich zu überzeugen, dass ich nicht lebe ... Unter diesen Umständen gibt es eine Pflicht, gegen die im Grunde meine Gewohnheit, noch mehr der Stolz meiner Instinkte revoltier , nämlich zu sagen: Hört mich! denn ich bin der und der. Verwechselt mich vor allem nicht!
2
Ich bin zum Beispiel durchaus kein Popanz, kein Moral-Ungeheuer, – ich bin sogar eine Gegensatz-Natur zu der Art Mensch, die man bisher als tugendhaft verehrt hat. Unter uns, es scheint mir, dass gerade das zu meinem Stolz gehört.
Ich bin ein Jünger des Philosophen Dionysos, ich zöge vor, eher noch ein Satyr zu sein als ein Heiliger. Aber man lese nur diese Schrift. Vielleicht gelang es mir, vielleicht hatte diese Schrift gar keinen anderen Sinn, als diesen Gegensatz in einer heiteren und menschenfreundlichen Weise zum Ausdruck zu bringen.
Dionysos
Das Letzte, was ich versprechen würde, wäre, die Menschheit zu „verbessern“. Von mir werden keine neuen Götzen aufgerichtet; die alten mögen lernen, was es mit tönernen Beinen auf sich hat. Götzen (mein Wort für „Ideale“) umwerfen – das gehört schon eher zu meinem Handwerk. Man hat die Realität in dem Grad um ihren Wert, ihren Sinn, ihre Wahrhaftigkeit gebracht, als man eine ideale Welt erlog ... Die „wahre Welt“ und die „scheinbare Welt“ – auf Deutsch: die erlogene Welt und die Realität ... Die Lüge des Ideals war bisher der Fluch über der Realität, die Menschheit selbst ist durch sie bis in ihre untersten Instinkte hinein verlogen und falsch geworden bis zur Anbetung der umgekehrten Werte, als die sind, mit denen ihr erst das Gedeihen, die Zukunft, das hohe Recht auf Zukunft verbürgt wäre.
3
Wer die Luft meiner Schriften zu atmen weiß, weiß, dass es eine Luft der Höhe ist, eine starke Luft. Man muss für sie geschaffen sein, sonst ist die Gefahr keine, kleine, sich in ihr zu erkälten. Das Eis ist nahe, die Einsamkeit ist ungeheuer – aber wie ruhig alle Dinge im Licht liegen! wie frei man atmet! wie viel man unter sich fühlt! – Philosophie, wie ich sie bisher verstanden und gelebt habe, ist das freiwillige Leben in Eis und Hochgebirge – das Aufsuchen alles Fremden und Fragwürdigen im Dasein, alles dessen, was durch die Moral bisher in Bann getan war. Aus einer langen Erfahrung, welche eine solche Wanderung im Verbotenen gab, lernte ich die Ursachen, aus denen bisher moralisiert und idealisiert wurde, sehr anders ansehen als es erwünscht sein mag: die verborgene Geschichte der Philosophen, die Psychologie ihrer großen Namen kam für mich ans Licht. – Wie viel Wahrheit erträgt, wie viel Wahrheit wagt ein Geist? das wurde für mich immer mehr der eigentliche Wertmesser. Irrtum (– der Glaube ans Ideal – ) ist nicht Blindheit, Irrtum ist Feigheit ... Jede Errungenschaft, jeder Schritt vorwärts in der Erkenntnis folgt aus dem Mut, aus der Härte gegen sich, aus der Sauberkeit gegen sich ... Ich widerlege die Ideale nicht, ich ziehe bloß Handschuhe vor ihnen an ... Nitimur in vetitum (Wir sind auf das Verbot angewiesen): in diesem Zeichen siegt einmal meine Philosophie, denn man verbot bisher grundsätzlich immer nur die Wahrheit. –
4.
Innerhalb meiner Schriften steht für sich mein Zarathustra.
Zaratushtra, avestisch: Zaratuschtra, auch Zaratushtra, bzw. Zoroaster (griechisch Ζωροάστρης und (persisch) Zardoscht, genannt auch Zarathustra Spitama, war ein iranischer Priester (Zaotar) und Philosoph.
Ich habe mit ihm der Menschheit das größte Geschenk gemacht, das ihr bisher gemacht worden ist.
Dies Buch, mit einer Stimme über Jahrtausende hinweg, ist nicht nur das höchste Buch, das es gibt, das eigentliche Höhenluft-Buch – die ganze Tatsache Mensch liegt in ungeheurer Ferne unter ihm –, es ist auch das tiefste, das aus dem innersten Reichtum der Wahrheit heraus geborene, ein unerschöpflicher Brunnen, in den kein Eimer hinabsteigt, ohne mit Gold und Güte gefüllt heraufzukommen. Hier redet kein „Prophet“, keiner jener schauerlichen Zwitter von Krankheit und Willen zur Macht, die man Religionsstifter nennt. Man muss vor allem den Ton, der aus diesem Mund kommt, diesen halkyonischen Ton richtig hören, um dem Sinn seiner Weisheit nicht erbarmungswürdig Unrecht zu tun. „Die stillsten Worte sind es, welche den Sturm bringen, Gedanken, die mit Taubenfüßen kommen, lenken die Welt.“
Die Feigen fallen von den Bäumen, sie sind gut und süß: und indem sie fallen, reißt ihnen die rote Haut. Ein Nordwind bin ich reifen Feigen.
Also, gleich Feigen, fallen euch diese Lehren zu, meine Freunde: nun trinkt ihren Saft und ihr süßes Fleisch! Herbst ist es umher und reiner Himmel und Nachmittag –
Hier redet kein Fanatiker, hier wird nicht „gepredigt“, hier wird nicht Glauben verlangt: aus einer unendlichen Lichtfülle und Glückstiefe fällt Tropfen für Tropfen, Wort für Wort, eine zärtliche Langsamkeit ist das Tempo dieser Reden. Dergleichen gelangt nur zu den Auserwähltesten; es ist ein Vorrecht ohne Gleichen hier Hörer zu sein; es steht niemandem frei, für Zarathustra Ohren zu haben ... Ist Zarathustra mit alledem nicht ein Verführer? ... Aber was sagt er doch selbst, als er zum ersten Mal wieder in seine Einsamkeit zurückkehrt? Genau das Gegenteil von dem, was irgend ein „Weiser“, „Heiliger“, „Welt-Erlöser“ und anderer dekadent in einem solchen Fall sagen würde ... Er redet nicht nur anders, er ist auch anders...
Allein gehe ich nun, meine Jünger! Auch ihr geht nun davon und allein! So will ich es.
Geht fort von mir und wehrt euch gegen Zarathustra! Und besser noch: schämt euch seiner! Vielleicht betrog er euch.
Der Mensch der Erkenntnis muss nicht nur seine Feinde lieben, er muss auch seine Freunde hassen können.
Man vergilt einem Lehrer schlecht, wenn man immer nur der Schüler bleibt. Und warum wollt ihr nicht an meinem Kranz rupfen?
Ihr verehrt mich: aber wie, wenn eure Verehrung eines Tages umfällt? Hütet euch, dass euch nicht eine Bildsäule erschlage!
Ihr sagt, ihr glaubt an Zarathustra? Aber was liegt an Zarathustra! Ihr seid meine Gläubigen, aber was liegt an allen Gläubigen!
Ihr hattet euch noch nicht gesucht: da fandet ihr mich. So tun alle Gläubigen; darum ist es so wenig mit allem Glauben.
Nun heiße ich euch, mich verlieren und euch finden; und erst, wenn ihr mich alle verleugnet habt, will ich euch wiederkehren...
Friedrich Nietzsche
* * *
An diesem vollkommenen Tag, wo alles reift und nicht nur die Traube braun wird, fiel mir eben ein Sonnenblick auf mein Leben: ich sah rückwärts, ich sah hinaus, ich sah nie so viel und so gute Dinge auf einmal.
Nicht umsonst begrub ich heute mein vierundvierzigstes Jahr, ich durfte es begraben, – was in ihm Leben war, ist gerettet, ist unsterblich. Die Umwertung aller Werte, die Dionysos-Dithyramben und, zur Erholung, die Götzen-Dämmerung – alles Geschenke dieses Jahres, sogar seines letzten Vierteljahres!
Wie sollte ich nicht meinem ganzen Leben dankbar sein? Und so erzähle ich mir mein Leben.
* * *
Warum ich so weise bin
Warum ich so weise bin
1
Das Glück meines Daseins, seine Einzigkeit vielleicht, liegt in seinem Verhängnis: ich bin, um es in Rätselform auszudrücken, als mein Vater bereits gestorben, als meine Mutter lebe ich noch und werde alt. Diese doppelte Herkunft, gleichsam aus der obersten und der untersten Sprosse an der Leiter des Lebens, dekadent zugleich und Anfang – dies, wenn irgendetwas, erklärt jene Neutralität, jene Freiheit von Partei im Verhältnis zum Gesamtproblem des Lebens, die mich vielleicht auszeichnet. Ich habe für die Zeichen von Aufgang und Niedergang eine feinere Witterung als je ein Mensch gehabt hat, ich bin der Lehrer par excellence hierfür, – ich kenne beides, ich bin beides. – Mein Vater starb mit sechsunddreißig Jahren: er war zart, liebenswürdig und morbid, wie ein nur zum Vorübergehen bestimmtes Wesen, – eher eine gütige Erinnerung an das Leben, als das Leben selbst. Im gleichen Jahr, wo sein Leben abwärts ging, ging auch das meine abwärts: im sechsunddreißigsten Lebensjahr kam ich auf den niedrigsten Punkt meiner Vitalität, – ich lebte noch, doch ohne drei Schritt weit vor mich zu sehen. Damals – es war 1879 – legte ich meine Basler Professur nieder, lebte den Sommer über wie ein Schatten in St. Moritz und den nächsten Winter, den sonnenärmsten meines Lebens, als Schatten in Naumburg. Dies war mein Minimum: „Der Wanderer und sein Schatten“ entstand währenddessen. Unzweifelhaft, ich verstand mich damals auf Schatten ... Im Winter darauf, meinem ersten Genueser Winter, brachte jene Versüßung und Vergeistigung, die mit einer extremen Armut an Blut und Muskel beinahe bedingt ist, die „Morgenröte“ hervor. Die vollkommene Helle und Heiterkeit, selbst Exuberanz (Üppigkeit, Überfluss, Überschwänglichkeit) des Geistes, welche das genannte Werk wiederspiegelt, verträgt sich bei mir nicht nur mit der tiefsten physiologischen Schwäche, sondern sogar mit einem Exzess von Schmerzgefühl. Mitten in Martern, die ein ununterbrochener dreitägiger Gehirn-Schmerz samt mühseligem Schleimerbrechen mit sich bringt, – besaß ich eine Dialektiker-Klarheit par excellence und dachte Dinge sehr kaltblütig durch, zu denen ich in gesünderen Verhältnissen nicht Kletterer, nicht raffiniert, nicht kalt genug bin. Meine Leser wissen vielleicht, in wie fern ich Dialektik als Dekadenz-Symptom betrachte, zum Beispiel im allerberühmtesten Fall: im Fall des Sokrates. – Alle krankhaften Störungen des Intellekts, selbst jene Halbbetäubung, die das Fieber im Gefolge hat, sind mir bis heute gänzlich fremde Dinge geblieben, über deren Natur und Häufigkeit ich mich erst auf gelehrtem Weg zu unterrichten hatte. Mein Blut läuft langsam. Niemand hat je an mir Fieber konstatieren können. Ein Arzt, der mich länger als Nervenkranken behandelte, sagte schließlich: „nein! an Ihren Nerven liegt's nicht, ich selber bin nur nervös.“ Schlechterdings unnachweisbar irgendeine lokale Entartung; kein organisch bedingtes Magenleiden, wie sehr auch immer, als Folge der Gesamterschöpfung, die tiefste Schwäche des gastrischen Systems.
Auch das Augenleiden, dem Blindwerden zeitweilig sich gefährlich annähernd, nur Folge, nicht ursächlich: so dass mit jeder Zunahme an Lebenskraft auch die Sehkraft wieder zugenommen hat. – Eine lange, allzulange Reihe von Jahren bedeutet bei mir Genesung, – sie bedeutet leider auch zugleich Rückfall, Verfall, Periodik einer Art Dekadenz. Brauche ich, nach alledem, zu sagen, dass ich in Fragen der Dekadenz erfahren bin? Ich habe sie vorwärts und rückwärts buchstabiert. Selbst jene Filigran-Kunst des Greifens und Begreifens überhaupt, jene Finger für Nuancen, jene Psychologie des „Um-die-Ecke-sehens“ und was sonst mir eignet, ward damals erst erlernt, ist das eigentliche Geschenk jener Zeit, in der alles sich bei mir verfeinerte, die Beobachtung selbst wie alle Organe der Beobachtung. Von der Kranken-Optik aus nach gesünderen Begriffen und Werten, und wiederum umgekehrt aus der Fülle und Selbstgewissheit des reichen Lebens hinuntersehen in die heimliche Arbeit des Dekadenz-Instinkts – das war meine längste Übung, meine eigentliche Erfahrung, wenn irgend worin wurde ich darin Meister. Ich habe es jetzt in der Hand, ich habe die Hand dafür, Perspektiven umzustellen: erster Grund, weshalb für mich allein vielleicht eine „Umwertung der Werte“ überhaupt möglich ist.
2
Abgerechnet nämlich, dass ich ein Dekadent bin, bin ich auch dessen Gegensatz. Mein Beweis dafür ist, unter anderem, dass ich instinktiv gegen die schlimmen Zustände immer die rechten Mittel wählte: während der Dekadent an sich immer die ihm nachteiligen Mittel wählt. Als summa summarum war ich gesund, als Winkel, als Spezialität war ich dekadent. Jene Energie zur absoluten Vereinsamung und Herauslösung aus gewohnten Verhältnissen, der Zwang gegen mich, mich nicht mehr besorgen, bedienen, beärzteln zu lassen – das verrät die unbedingte Instinkt-Gewissheit darüber, was damals vor allem not tat. Ich nahm mich selbst in die Hand, ich machte mich selbst wieder gesund: die Bedingung dazu – jeder Physiologe wird das zugeben – ist, dass man im Grunde gesund ist. Ein typisch morbides Wesen kann nicht gesund werden, noch weniger sich selbst gesund machen; für einen typisch Gesunden kann umgekehrt Kranksein sogar ein energisches Stimulans zum Leben, zum Mehr-leben sein. So in der Tat erscheint mir jetzt jene lange Krankheits-Zeit: ich entdeckte das Leben gleichsam neu, mich selber eingerechnet, ich schmeckte alle guten und selbst kleinen Dinge, wie sie Andere nicht leicht schmecken könnten, – ich machte aus meinem Willen zur Gesundheit, zum Leben, meine Philosophie ... Denn man gebe acht darauf: die Jahre meiner niedrigsten Vitalität waren es, wo ich aufhörte, Pessimist zu sein: der Instinkt der Selbst-Wiederherstellung verbot mir eine Philosophie der Armut und Entmutigung ... Und woran erkennt man im Grunde die Wohlgeratenheit! Dass ein wohlgeratener Mensch unsern Sinnen wohltut: dass er aus einem Holz geschnitzt ist, das hart, zart und wohlriechend zugleich ist. Ihm schmeckt nur, was ihm zuträglich ist; sein Gefallen, seine Lust hört auf, wo das Maß des Zuträglichen überschritten wird. Er errät Heilmittel gegen Schädigungen, er nützt schlimme Zufälle zu seinem Vorteil aus; was ihn nicht umbringt, macht ihn stärker. Er sammelt instinktiv aus allem, was er sieht, hört, erlebt, seine Summe: er ist ein auswählendes Prinzip, er lässt viel durchfallen. Er ist immer in seiner Gesellschaft, ob er mit Büchern, Menschen oder Landschaften verkehrt: er ehrt, indem er wählt, indem er zulässt, indem er vertraut. Er reagiert auf alle Art Reize langsam, mit jener Langsamkeit, die eine lange Vorsicht und ein gewollter Stolz ihm angezüchtet haben, – er prüft den Reiz, der herankommt, er ist fern davon, ihm entgegenzugehen. Er glaubt weder an „Unglück“, noch an „Schuld“: er wird fertig, mit sich, mit anderen, er weiß zu vergessen, – er ist stark genug, dass ihm alles zum Besten gereichen muss. – Wohlan, ich bin das Gegenstück eines dekadent: denn ich beschrieb eben mich.
3
Ich betrachte es als ein großes Vorrecht, einen solchen Vater gehabt zu haben: die Bauern, vor denen er predigte – denn er war, nachdem er einige Jahre am Altenburger Hof gelebt hatte, die letzten Jahre Prediger – sagten, so müsse wohl ein Engel aussehen. – Und hiermit berühre ich die Frage der Rasse. Ich bin ein polnischer Edelmann pur sang, dem auch nicht ein Tropfen schlechtes Blut beigemischt ist, am wenigsten deutsches. Wenn ich den tiefsten Gegensatz zu mir suche, die unausrechenbare Gemeinheit der Instinkte, so finde ich immer meine Mutter und Schwester, – mit solcher Kanaille mich verwandt zu glauben, wäre eine Lästerung auf meine Göttlichkeit. Die Behandlung, die ich von Seiten meiner Mutter und Schwester erfahre, bis auf diesen Augenblick, flößt mir ein unsägliches Grauen ein: hier arbeitet eine vollkommene Höllenmaschine, mit unfehlbarer Sicherheit über den Augenblick, wo man mich blutig verwunden kann – in meinen höchsten Augenblicken, ... denn da fehlt jede Kraft, sich gegen giftiges Gewürm zu wehren ... Die physiologische Kontiguität ermöglicht eine solche Disharmonia praestabilita. ... Aber ich bekenne, dass der tiefste Einwand gegen die „ewige Wiederkunft“, mein eigentlich abgründlicher Gedanke, immer Mutter und Schwester sind. – Aber auch als Pole bin ich ein ungeheurer Atavismus. Man würde Jahrhunderte zurückzugehen haben, um diese vornehmste Rasse, die es auf Erden gab, in dem Maß instinktrein zu finden, wie ich sie darstelle. Ich habe gegen alles, was heute Noblesse heißt, ein souveränes Gefühl von Distinktion, – ich würde dem jungen deutschen Kaiser nicht die Ehre zugestehen, mein Kutscher zu sein. Es gibt einen einzigen Fall, wo ich meinesgleichen anerkenne; ich bekenne es mit tiefer Dankbarkeit.
Cosima Wagner
Frau Cosima Wagner ist bei Weitem die vornehmste Natur; und, damit ich kein Wort zu wenig sage, sage ich, dass Richard Wagner der mir bei Weitem verwandteste Mann war...
Richard Wagner, * 22. Mai 1813 – † 13. Februar 1833
(Siehe Band 231 in dieser gelben Buchreihe!)
Der Rest ist Schweigen ... Alle herrschenden Begriffe über Verwandtschafts-Grade sind ein physiologischer Widersinn, der nicht überboten werden kann. Der Papst treibt heute noch Handel mit diesem Widersinn. Man ist am wenigsten mit seinen Eltern verwandt: es wäre das äußerste Zeichen von Gemeinheit, seinen Eltern verwandt zu sein. Die höheren Naturen haben ihren Ursprung unendlich weiter zurück, auf sie hin hat am längsten gesammelt, gespart, gehäuft werden müssen. Die großen Individuen sind die ältesten: ich verstehe es nicht, aber Julius Cäsar könnte mein Vater sein – oder Alexander, dieser leibhafte Dionysos ... In diesem Augenblick, wo ich dies schreibe, bringt die Post mir einen Dionysos-Kopf...
4
Ich habe nie die Kunst verstanden, gegen mich einzunehmen auch das verdanke ich meinem unvergleichlichen Vater – und selbst noch, wenn es mir von großem Wert schien. Ich bin sogar, wie sehr immer das unchristlich scheinen mag, nicht einmal gegen mich eingenommen. Man mag mein Leben hin- und herwenden, man wird darin, jenen einen Fall abgerechnet, keine Spuren davon entdecken, dass jemand bösen Willen gegen mich gehabt hätte, – vielleicht aber etwas zu viel Spuren von gutem Willen ... Meine Erfahrungen selbst mit Solchen, an denen jedermann schlechte Erfahrungen macht, sprechen ohne Ausnahme zu deren Gunsten; ich zähme jeden Bär, ich mache die Hanswürste noch sittsam. In den sieben Jahren, wo ich an der obersten Klasse des Basler Pädagogiums Griechisch lehrte, habe ich keinen Anlass gehabt, eine Strafe zu verhängen; die Faulsten waren bei mir fleißig. Dem Zufall bin ich immer gewachsen; ich muss unvorbereitet sein, um meiner Herr zu sein. Das Instrument, es sei, welches es wolle, es sei so verstimmt, wie nur das Instrument „Mensch“ verstimmt werden kann – ich müsste krank sein, wenn es mir nicht gelingen sollte, ihm etwas Anhörbares abzugewinnen. Und wie oft habe ich das von den „Instrumenten“ selber gehört, dass sie sich noch nie so gehört hätten ... Am schönsten vielleicht von jenem unverzeihlich jung gestorbenen Heinrich von Stein, der einmal, nach sorgsam eingeholter Erlaubnis, auf drei Tage in Sils-Maria erschien, jedermann erklärend, dass er nicht wegen des Engadins komme.
Heinrich von Stein, * 21. November 1833 in Rostock – † 28. Mai 1896 ebenda, war ein deutscher Philologe, Philosoph und Rektor der Universität Rostock.