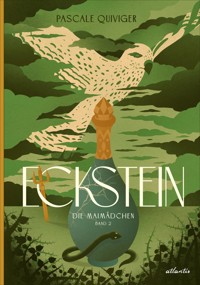
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Königreich Eckstein
- Sprache: Deutsch
König Tibald ist wieder in Sicherheit. Nachdem er der Catastrophe, dem gefährlichen Wald im Süden Ecksteins, entkommen konnte, versuchen er und seine Gemahlin Ema wieder in die Normalität zurückzufinden. Aber Tibald ist nicht mehr derselbe: Nachts plagen ihn Albträume, tags driften seine Gedanken ab, und er kann sich an nichts mehr erinnern. Ecksteins König ist unfähig zu regieren. Dabei darf der Thron des Inselreichs niemals länger als zwölf Tage unbesetzt bleiben - und Jesko kann es kaum erwarten, den Platz seines Halbbruders einzunehmen. Gemeinsam mit ihren Vertrauten versucht Ema, Tibald zu heilen und die Geheimnisse der Catastrophe zu ergründen. Doch auch Ema quält ein dunkles Geheimnis: Um Tibald zu retten, war sie gezwungen, mit dessen Stiefmutter Sidra einen Pakt zu schließen: Sie muss der Catastrophe ihr ungeborenes Kind als Maimädchen opfern. Und nicht nur am Königshof, auch im restlichen Land stehen die Zeichen schlecht: eisige Temperaturen, knappe Lebensmittelvorräte und eine herannahende Epidemie machen den Bewohnern Ecksteins das Leben schwer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pascale Quiviger
Eckstein
Band 2. Die Maimädchen
Roman
Aus dem Französischen von Sophia Marzolff
atlantis
Ich danke Élie für die Inspiration
und Alan für seine tausend Arten der Unterstützung.
1
Es hatte die ganze Nacht geschneit. Eckstein erwachte unter einer dicken weißen Decke, wie das noch leere Blatt einer ganz neuen Erzählung. Die Geräusche waren gedämpft, die Vögel versteckten ihre Schnäbel im Gefieder, das Meer war glatt, der Himmel klar. Ema schlief. Sie lag im Bett des königlichen Gemachs, und neben ihr hatte Tibald sich bis in die frühen Morgenstunden unruhig bewegt. Sie war ihn holen gegangen, hatte ihn im Schneesturm nach Hause gebracht, ohne von jemandem gesehen zu werden. Alle hielten Tibald noch immer für einen Gefangenen der Catastrophe, wo er vier Tage zuvor auf rätselhafte Weise verschwunden war. Alle außer Königin Sidra, mit der Ema einen ungeheuerlichen Pakt geschlossen hatte: Tibalds Freiheit im Tausch gegen die Prinzessin, deren Geburt im Frühling erwartet wurde.
Seit dem vergangenen Abend hielt Ovid vor Emas Suite Wache. Er wusste nicht, dass von ihrer Kleiderkammer ein Geheimgang abging, den sie benutzt hatte, um nach draußen zu gelangen; er wusste nicht, dass er eine leere Suite bewachte. Im Schloss wurde es allmählich lebendig, und da von der Königin kein Mucks zu hören war, dachte er, sie würde lange ausschlafen. Doch je mehr Zeit verging, desto unwahrscheinlicher wurde die Sache mit dem Ausschlafen. Emas Kammerzofe Madeleine überredete Ovid schließlich dazu, an die Tür zu klopfen. Als keine Antwort kam, erhob sich Ovid vorsichtig auf seine dicken Zehenspitzen und trat ein. Keine Königin.
Ovid geriet in Panik und stürzte ins Nebenzimmer.
»LUKAS! DIEKÖNIGINISTVERSCHWUNDEN!«, schrie er.
Lukas richtete sich auf einen Ellenbogen auf und rieb sich die Augen.
»Was?«
»Die Königin! Sie ist weg, sage ich!«
Lukas sprang aus dem Bett, schlüpfte in seine Hose und rannte los, während er gleichzeitig seine Haare zusammenband.
»Verdammt, Ovid, du solltest sie doch bewachen!«
»Ich schwöre dir, ich hab mich nicht vom Fleck gerührt. Ich bin nicht mal eingenickt. Ich hab die ganze Nacht gepfiffen, um wach zu bleiben, Ehrenwort. Madeleine wartete schon länger drauf, dass die Königin ihr Frühstück bestellt, und hat an der Tür gehorcht, und als sie nichts hörte, nicht den kleinsten Laut, meinte sie zu mir, ich soll aufmachen. Kein Wunder, dass man nichts hören konnte, es ist ja auch keine Menschenseele im Zimmer! Die Königin hat sich verluftigt.«
»In Luft aufgelöst.«
»Sage ich ja: verluftigt. Ich frage dich, Lukas, will sie nun, dass man sie bewacht oder nicht? Also ehrlich!«
Ovid hielt sich den bandagierten Kopf. Seine Teilnahme an der (vergeblichen) Rettungsaktion, die den König den Fängen des Waldes entreißen sollte, war ihn teuer zu stehen gekommen. Es fühlte sich an, als steckte der Stein, der sein Auge zerschmettert hatte, noch irgendwo in seinem Schädel fest. Die Kopfschmerzen waren unerträglich.
»Jetzt beruhige dich«, sagte Lukas zu ihm. »Niemand kann sich einfach so in Luft auflösen.«
»Schau doch selbst nach!«, drängte Ovid und öffnete Emas Tür. »Sie hat sich verluft… verlüftigt … wie auch immer! Ob das wieder so ein Spuk ist, Lukas? Denn du weißt ja, ich und Geister …«
»Ich weiß, ich weiß.«
Lukas hatte jetzt anderes im Kopf als Ovids Geisterphobien. Die »Verluftigung« ließ sich in seinen Augen leicht erklären: Er durchquerte zügig das Boudoir und trat in die Kleiderkammer. Der Zugang zu dem unterirdischen Tunnel war zwar verschlossen, doch die Riegel waren nicht eingerastet und das Sitzbänkchen verschoben.
»Heilige Fresse!«, fluchte er.
»Na, hör mal, du sprichst immerhin von der Königin. Oder nicht?«, meinte Ovid.
»Ja. Nein. Ach, vergiss es.«
Lukas trat das Bänkchen wütend mit dem Fuß weg.
»Sieh doch nur, was du gemacht hast«, tadelte Ovid ihn und zeigte auf die Kratzer am Boden.
»Ich bin nicht der Erste.«
»Was meinst du damit?«
»Lass gut sein, Ovid. Ich weiß, wo sie ist.«
»Du weißt, wo sie ist?«
»Wir brauchen Manfred.«
Lukas hatte nicht nur verstanden, wie Ema nach draußen gelangt, sondern auch, auf welchem Wege sie wieder zurückgekommen war. Er selbst hatte sie am Vortag zum königlichen Arbeitszimmer begleitet, wo sie angeblich etwas in den Akten des Ältestenrats nachschauen wollte. Wahrscheinlich hatte sie den Moment genutzt und in Vorbereitung ihres heimlichen Ausflugs das Fenster geöffnet.
Da die königliche Suite in die Zuständigkeit des Kammerherrn fiel, wollte Manfred die Angelegenheit selbst überprüfen. Er schlich leise durch das Arbeitszimmer, wo ihm ein intensiver Geruch nach Pfefferminze und verbranntem Leder in die Nase drang, und folgte der nassen Spur aus geschmolzenem Schnee, die geradewegs zum Schlafgemach führte. Seinen eigenen Prinzipien zuwiderhandelnd trat er ein, ohne vorher anzuklopfen. In der nächsten Sekunde wich er schockiert zurück und schlug sich die Hände vor die Augen. Er hatte die krausen Locken der Königin und ihre milchkaffeefarbene Haut erkannt – jenen bärtigen Mann aber, der einen mageren Arm um sie gelegt hatte … Nein, den kannte er nicht.
Ehebruch? Im Schlafgemach des Königs?
Und er selbst hatte der untreuen Frau auch noch den Schlüssel ausgehändigt!
»Manfred, was ist denn?«, wollte Lukas wissen.
Der Kammerherr holte tief Luft, ja er atmete die Luft des gesamten Raumes ein.
»Die Königin«, erklärte er in einem so neutralen Ton, wie er vermochte, »liegt im Bett mit einem … Mann.«
»Mit einem was?«, rief Ovid.
»Ihr habt es doch gehört.«
»Einem was?«, fragte Ovid erneut.
»Ich werde Euch nicht auch noch eine Zeichnung anfertigen!«
Da tauchte Ema hinter Manfred auf. Mit flatternden Bändern, denn sie hatte sich hastig angekleidet, und nackten Füßen. Alle drei starrten sie ungläubig an.
»Was ist?«
Keiner von den Männern brachte ein Wort heraus.
»Ach, richtig. Bitte verzeiht, ich bin der Leibwache entwischt. Aber es wird mir wohl keiner vorwerfen, dass ich die Nacht mit meinem Mann verbracht habe.«
Die drei blickten immer verwirrter drein.
»Oder etwa doch?«
»Hoheit …«, setzte Manfred an, doch er wusste nicht weiter.
»Hoheit«, versuchte es nun Lukas, »redet Ihr etwa … vom König?«
»Aber Lukas, wie viele Ehemänner habe ich denn noch?«
Sie musterte die drei aufmerksam.
»Hat es euch den Verstand geraubt?«
Manfred hielt es nicht mehr länger aus. »Ihr erlaubt?«, flüsterte er mit einer raschen Verbeugung und eilte mit seinen langen, weichen Schritten ins Schlafgemach.
»Der König schläft«, warnte Ema ihn.
Manfred ging trotzdem bis ans Bett, beugte sich über Tibald und kam schnell wieder zurück. Er versuchte, sich eine Haltung zu geben, bevor er verkündete:
»Es ist der König.«
»Natürlich ist es der König!«, sagte Ema ungeduldig.
»Aber er sieht so … Er ist …«
»In einer schlechten Verfassung, ja.«
Tatsächlich hatte Tibalds Rückkehr nichts von der Rückkehr eines Herrschers. Er war völlig durcheinander. Die ganze Nacht hatte er gegen seine Albträume, sein Fieber und seine Bettdecke gekämpft und war immer wieder aus dem Schlaf geschreckt, mit einem ebenso furchterfüllten wie furchterregenden Blick.
»Außerdem hat er …«, begann Manfred und deutete mit seinen flatternden Fingern den Bartwuchs an. (Er verabscheute Härchen jedweder Art.)
»Ich weiß«, sagte Ema.
»Dabei hatte ich Benedikt doch angeraten, ihn jeden Morgen zu rasieren.«
»Das hat er auch. Benedikt hat ihn so gründlich rasiert, dass der König meinte, er werde wohl den Rest seines Lebens bartlos bleiben«, bemerkte Ovid mit einem nervösen Kichern.
»Wann war das?«, wollte Manfred wissen.
»Am Morgen seines Verschwindens. Vor vier Tagen.«
»Vergesst erst mal den Bart«, meinte Lukas. »Ich würde viel lieber wissen, wie er es geschafft hat zurückzukommen. Hoheit?«
»Er ist …«, begann Ema zögernd. »Er ist einfach zurückgekommen.«
»Wirklich, Hoheit? Er ist einfach so zurückgekommen, hat spätabends an seine Zimmertür geklopft, und rein zufällig wart Ihr dort, und zufällig auch noch ganz allein?«
»Ein bisschen mehr Respekt«, ermahnte Manfred ihn.
»Sagen wir, ich befand mich gerade im Arbeitszimmer, um eine wichtige Akte des Ältestenrats einzusehen, als er eintraf«, log Ema.
Damit gab sie Lukas deutlich zu verstehen, dass er sich nicht weiter einmischen sollte, aber er war zu wütend, um klein beizugeben. Nicht auszumalen, welche Risiken sie eingegangen war, um Tibald zurückzuholen …
»Und der König, Hoheit, wie erklärt er selbst seine Rückkehr?«
»Er erklärt gar nichts, Lukas«, antwortete sie scharf. »Er ist fiebrig und verwirrt, hat einen Blick wie ein gehetztes Tier, eine Narbe über das ganze Gesicht, einen Schopf weißen Haars und schlimme Albträume. Er … braucht Hilfe.«
»Ich werde unverzüglich Doktor Schnitzer und Doktor Zwillich holen«, versicherte Manfred und eilte durch die Tür, die er lautlos hinter sich schloss.
»Ovid«, bat Ema, »könntest du Blasius von Frixeln holen? Jetzt, wo sein Onkel nicht mehr da ist … Sagen wir, ich vertraue ihm mehr als den beiden Ärzten.«
»Gib unterwegs Madeleine Bescheid, dass wir die Königin gefunden haben, Ovid«, fügte Lukas hinzu. »Die Ärmste ist außer sich vor Sorge.«
Ema hörte den vorwurfsvollen Ton sehr wohl heraus.
»Und ruh dich danach aus, Ovid«, ergänzte sie schuldbewusst. »Du siehst erschöpft aus.«
»Ja, Hoheit.«
Ovid hätte gerne Manfreds Eleganz besessen, aber bei ihm fiel die Tür mit einem Krachen zu.
Als Lukas endlich mit Ema allein war, brach es aus ihm hervor:
»WIEBITTE? Man beliebt also, durch unterirdische Gänge zu spazieren, während ein Dummerjan von Wächter stundenlang vor der Tür vor sich hin pfeift? Kein Wunder, dass Ovid erschöpft aussieht, er hat die ganze Nacht kein Auge zugetan! Er ist verwundet, er ist fix und fertig, seine Kopfschmerzen bringen ihn fast um – doch er hält sich auf den Beinen, und warum? Um dich zu schützen, Ema, UMDICHZUSCHÜTZEN!«
»Lukas …«
»Muss ich dir noch erklären, warum du Leibwächter hast?«
»Hör auf, Lukas, ich …«
»Du hältst mich wohl für einen Idioten? Sieh dich doch einmal an! Dein Kleid ist nass, deine Hände sind ganz rot, und deine Schuhe? Was ist mit deinen Schuhen? Du bist bei heftigem Schneetreiben hinausgegangen. Mitten in der Nacht, mitten im Unwetter.«
Er verschränkte die Arme vor der Brust und blickte ihr direkt in die Augen.
»Hat diese Sidra dich losgeschickt, ganz allein den König zu holen?«
Vor zwei Tagen war Königin Sidra urplötzlich in Emas Boudoir aufgetaucht, doch Lukas hatte hinausgehen müssen und nicht gehört, worüber die beiden sprachen. Jetzt war er sich fast sicher, dass hinter der geschlossenen Tür über Tibalds Schicksal verhandelt wurde.
Ema hatte nicht geahnt, zu welchem Zorn Lukas fähig war. Er machte ihr beinahe Angst.
»Diese Sidra … O Lukas, hör dich an, wie du von einer Königin sprichst«, sagte sie, um seiner Frage auszuweichen.
»Da sie nicht hier ist, spreche ich von ihr, wie ich will. Ausgerechnet du wirst mich wohl nicht über höfische Sitten belehren, Majestät.«
»Ich hatte keine andere Wahl, Lukas. Ich konnte es nur allein tun. Bitte verlange keine weiteren Erklärungen von mir …« Sie senkte den Kopf. »Bitte.«
Lukas seufzte. Er wusste, er würde mit seinem Wutanfall nichts erreichen. Aber die Dinge nahmen einen so verhängnisvollen Verlauf, und er ertrug es nicht, Ema in Gefahr zu wissen.
»Kann ich trotzdem irgendetwas tun?«, brummte er. »Etwas Sinnvolleres, als ein leeres Gemach zu bewachen?«
»Du kannst mir helfen, ein kaltes Gemach warm zu kriegen«, antwortete Ema und ging vor dem Kamin in die Knie.
Lukas reagierte nur zögerlich. Ema spürte, wie es in ihm rumorte. In gewisser Weise war das tröstlich. Sie, die so wenig Freundschaft in ihrem Leben erfahren hatte, nahm an, dass nur einem Freund so sehr an ihrer Sicherheit gelegen sein konnte.
2
Ovid fand Blasius von Frixeln im Zimmer der Totenwache. Er war am Bett seines verstorbenen Onkels Clemens eingeschlafen, der bei dem tragischen Brand im Turm des Observatoriums umgekommen war, und sein Kopf lag schnarchend auf dem Kissen des Toten. Ovid verharrte auf der Türschwelle. Eigentlich sollte er Blasius wecken und zum König bringen, aber da er die Anwesenheit von Geistern fürchtete, brachte er es nicht so schnell über sich, den Raum zu betreten. So kam es, dass Blasius, als er endlich in der königlichen Suite erschien, dort schon die beiden Ärzte antraf.
Diese erörterten gerade ihre Diagnose. Schnitzer lehnte sich wichtigtuerisch an den großen Schreibtisch, hinter dem er sich seit je in seinen geheimsten Träumen sitzen sah. Er war von zierlicher, leicht buckliger Gestalt und trug ein Monokel, das er nicht wirklich brauchte und das ihm das Aussehen eines Strichpunkts verlieh. Zwillich hatte es sich in dem Sessel mit den Löwenpranken bequem gemacht. Er hatte ein hartnäckiges Schuppenproblem, und da die offizielle Dienstkleidung der Ecksteiner Ärzte unglücklicherweise dunkelblau war, schien er fortwährend von einer Schneewehe umgeben.
»Er hat da eine üble Schnittwunde im Gesicht, Durchlaucht«, meinte Doktor Schnitzer. »Wieso habt Ihr keinen Arzt konsultiert?«
»Ich habe diese Wunde heute Nacht zum ersten Mal gesehen«, erklärte Ema.
»Aber Hoheit, sie ist längst vernarbt! Er muss schon während seiner Rundreise einen Ast ins Gesicht bekommen haben …«
»Doktor Schnitzer, zieht Ihr immer voreilige Schlüsse?«, fragte Ema verärgert.
»Nun, wollen wir einmal nicht darauf bestehen«, sprang Zwillich seinem Kollegen beschwichtigend bei. »Ihr sagtet, meine Königin, er sei, bevor er einschlief, nicht ganz in seinem Element gewesen?«
»Er war verwirrt, Doktor. Sehr geschwächt. Und dann hatte er schreckliche Albträume.«
»Ein Fieberanfall«, urteilte Schnitzer, der in der Tat immer voreilige Schlüsse zog.
»Oder ein Trauma«, warf Blasius ein, der dank seiner langen Tätigkeit in der Nervenheilanstalt ein Experte auf dem Gebiet seelischer Krankheiten war.
Schnitzer tat überrascht, als hätte er Blasius’ Anwesenheit noch gar nicht bemerkt. Er zog seine Augenbraue hoch, wie um zu sagen: »Ihr habt keinerlei medizinische Kompetenz«, und dabei fiel ihm fast das Monokel heraus.
»Lassen wir ihn zur Ader«, beschloss Zwillich.
Schnitzer warf die Hände in die Luft. Ständig und immerzu diese Aderlässe … Allmählich hatte sein Kollege etwas von einem Vampir. Aber bevor er etwas erwidern konnte, tauchten neue Besucher vor der Tür auf.
»Wir haben etwas gehört … also über den König …«, stammelte Felix. Seine Pranken ruhten auf Lysanders Schultern, der sich unmerklich herauszuwinden versuchte.
»Ihr habt etwas gehört?«, wiederholte Manfred und trat ihnen in den Weg.
»Nun ja … Alle wissen’s, um ehrlich zu sein.«
Die Patienten des Festsaal-Lazaretts hatten nämlich mitbekommen, wie Doktor Zwillich in die königliche Suite gerufen wurde. Darauf hatte die Neuigkeit von der Rückkehr des Königs die Runde durchs Schloss gemacht und soeben zu einer Inselrunde angesetzt.
»Geht wieder, das hier ist eine private Angelegenheit«, befahl Manfred und schickte sich an, die Tür zu schließen.
»Nein, lasst sie herein. Sie sind Freunde«, widersprach Ema.
Felix warf dem Kammerherrn einen überlegenen Blick zu und schob Lysander rasch ins Zimmer. Er hatte dem Jungen extra sorgfältig die Haare gekämmt – sein Scheitel sah aus wie ein Strich Kreide auf einer schwarzen Tafel. Lysander wartete ungeduldig auf einen Moment, in dem er allein sein und diese Bemühungen wieder zunichtemachen konnte.
Sein Lehrer Blasius von Frixeln lächelte ihn breit an.
»Grüß dich, Lysander, hübsche Perücke.«
»Wie geht es dem König?«, wollte Felix wissen.
»Tja, alsoo …«, begann Schnitzer im Ton des Gelehrten.
»Er ist völlig durch den Wind«, fiel Blasius ihm ins Wort. »Ich hätte da vielleicht eine Idee, aber ich weiß nicht, ob ich es wagen darf …«
»Wagt es ruhig, wagt es unbedingt«, ermunterte Ema ihn, bevor die beiden Ärzte etwas einwenden konnten.
»Also gut: Um den Folgen eines Schocks entgegenzuwirken, kann es hilfreich sein, dem Betroffenen einen ähnlichen Schock zu versetzen.«
»Oh!«, stießen Zwillich und Schnitzer entrüstet aus.
»Ich weiß, es ist eine heikle Sache. Ein Übel mit einem anderen Übel zu bekämpfen, birgt durchaus Risiken. Aber oft zeitigt es ganz erstaunliche Ergebnisse.«
Zwillich fegte sich nervös die Schuppen von den Schultern. Schnitzer klemmte sein Monokel fest. Manfred hüstelte.
»Nun, wir haben wohl nicht viel zu verlieren«, meinte Ema.
»Aber, Durchlaucht …«, protestierte Schnitzer.
»Um ehrlich zu sein, haben wir überhaupt nichts zu verlieren, Doktor«, schnitt Ema ihm das Wort ab und kehrte ihm den Rücken. »Kommt mit mir, Herr von Frixeln.«
Doch sie hatten noch keine drei Schritte gemacht, als der König höchstpersönlich aus dem Schlafzimmer kam, auf den Schultern den Hermelinpelz und darunter völlig nackt. Erschüttert schlug Manfred die Hand vor den Mund. Lukas tat das Gleiche, aber um einen Lachkrampf zu unterdrücken. Die Ärzte wandten schamhaft ihren Blick ab, während Felix die Szene mit Interesse betrachtete.
»Der König ist nackt«, bemerkte Lysander ungerührt.
»Hoooheit!«, rief Manfred aus. »Eure intimen Zooonen!«
»Mir war kalt …«, verteidigte Tibald sich und blickte ausdruckslos in die Runde. Er hatte keinen von ihnen erkannt.
»Ach, du grüne Neune«, murmelte Felix und rang die Hände, »schlimmer als Dorec …«
Er hatte nicht ganz unrecht mit seiner Feststellung. Auch Admiral Dorec hatte, als er in der Bucht der Catastrophe dem Wahnsinn verfiel, diesen leeren Blick gehabt – wie das offene Fenster eines verlassenen Hauses.
»Komm, Tibald, komm mit mir«, sagte Ema sanft und nahm seine Hand, um ihn ins Schlafzimmer zurückzuführen.
Dort stand der große Kleiderschrank offen, und sein Inhalt lag auf dem Boden vor dem Bett verstreut. Vielleicht hatte Tibald sich den Hermelin herausgesucht, weil dieser so zart und leicht überzuziehen war. Ema brachte es nicht übers Herz, ihn ihm wegzunehmen. Stattdessen half sie ihm, über die Kleider hinwegzusteigen, und setzte ihn, so wie er war, in einen Sessel neben dem Kaminfeuer. Blasius kauerte sich vor ihm hin. Er wartete einen Moment, dann begann er sehr langsam zu sprechen:
»Mein König. Hört mir gut zu. Ich muss Euch etwas Wichtiges sagen. Clemens von Frixeln ist tot.«
In einer verzögerten Reaktion blinzelte Tibald langsam und presste die Zähne aufeinander, während er seinen Kopf leicht hin- und herwiegte. Dann wurden seine Lider schwer, und er schien kurz davor einzuschlafen. Blasius hielt ihn davon ab, indem er mit lauter Stimme fortfuhr:
»Euer alter Lehrmeister ist während eines Brands umgekommen. Sein Studierzimmer ist in Flammen aufgegangen.«
Tibald begann wieder mit dem Kopf zu wackeln, und seine Hände krampften sich um die Armlehnen. Blasius war nicht nur ein Erforscher von Geisteskrankheiten, er war auch ein Experte im Fliegenfischen. Und jene kleinen Regungen sagten ihm, dass die Forelle kurz vor dem Anbeißen war.
»Clemens’ Gelehrtenzimmer ist niedergebrannt. Man hat ihn tot aufgefunden. Im Rauch erstickt.«
Tibald erstarrte kurz, dann entspannte er sich wieder. Er strich mit der Handfläche über den weichen Hermelin und sah aus, als würde er abermals ins Vergessen abtauchen.
»Tibald? … Tibald?«
Blasius berührte seine Knie.
»Hört mir zu, Tibald. Es ist wichtig, dass Ihr mich anhört. Es ist für Ema wichtig. Es ist für ganz Eckstein wichtig.«
Das Experiment musste mehrmals wiederholt werden. Anfangs versteifte Tibald sich stets, dann wurde er wieder schläfrig. Doch Blasius, der Freund der Irren und Verstörten, wusste abzuwarten. Er wollte einen letzten Versuch wagen, bevor er es zu einem späteren Zeitpunkt erneut angehen würde.
»Clemens ist ganz allein in seinem Observatorium gestorben. VER-SCHIE-DEN. VER-BRANNT. Mitsamt seinen Büchern.«
Diesmal reagierte Tibald, als hätte er einen Faustschlag auf die Nase bekommen. Er warf den Kopf zurück, bevor er nach vorne schwang, um Blasius am Kragen zu packen.
»Wiederhol das noch mal. Wiederhole, was du eben gesagt hast.«
Diese Forelle besaß eindeutig Temperament. Der Fischer begann eifrig die Angelschnur einzuholen.
»Clemens von Frixeln ist bei einem Brand umgekommen. In seinem Observatorium gab es ein Feuer.«
Tibald ließ Blasius los, sank in seinen Sessel zurück und machte die vertraute Geste, sich im Nacken zu kratzen. Es sah aus, als würde er gleich anfangen zu weinen.
»Clemens von Frixeln?«, fragte er nach.
»Ja, Hoheit.«
»Ist das also eine schlechte Nachricht?«
»Ja. Die gute Nachricht hingegen ist, dass Ihr wieder bei uns seid, mein König.«
Tibalds Miene verschloss sich. »Natürlich. Wo sollte ich auch sein«, entgegnete er und versuchte aufzustehen. »Ihr müsst Euch schon etwas klarer ausdrücken.«
Da ihm schwindelig wurde, setzte er sich wieder, und gleichzeitig blickte er an sich hinunter. Unbeholfen zog er den Hermelinpelz in seinen Schoß.
»Was habe ich denn da an?«
Ema angelte etwas aus dem Kleiderhaufen und half ihm, sich anzuziehen, während Blasius diskret nach nebenan ins Arbeitszimmer ging. Als die Ärzte seinen triumphierenden Blick sahen, ließen sie beleidigt ihre Koffer zuschnappen. Aber da erschien auch schon der König selbst, dicht gefolgt von Ema.
»Was macht Ihr denn alle hier?«, knurrte Tibald finster, während Ema ihnen unauffällig bedeutete zu verschwinden.
»Wir … wir wollten gerade gehen, mein König«, erklärte Felix, der Lysander vor sich her zur Tür schob.
»Warum denn?«, fragte Lysander trotzig.
»Darum.«
»Ich hole sofort das Mittagessen«, verkündete Manfred in einem möglichst alltäglichen Ton.
»Und ich halte draußen Wache«, erklärte Lukas.
Nur die Ärzte konnten sich nicht zum Gehen entschließen.
»Nun?«, fragte Tibald gereizt. »Antwortet mir! Was wollt Ihr hier?«
»Ihr habt einen Fieberanfall, Eure Majestät«, brachte Schnitzer vorsichtig hervor. »Es … es geht Euch nicht sehr gut.«
»Ob es mir gut geht oder nicht, entscheide ich selbst!«
Auf seiner Stirn standen dicke Schweißperlen, und seine Hände zitterten. Er erkannte keinen von ihnen wieder. Und doch hatte Blasius ihn ein kleines bisschen näher an die Oberfläche geholt.
»Tja, Eure Majestät, dann gibt es wohl nichts hinzuzufügen«, kapitulierte Zwillich, der es allmählich leid war, sich herabgesetzt zu fühlen. »Trinkt fleißig Kamillentee, vermeidet Zugluft, nehmt Honig zu Euch und schlaft reichlich.«
»Wir stehen Euch natürlich jederzeit zu Diensten, Hoheit«, fügte Schnitzer mit Nachdruck hinzu. »Ihr könnt uns jederzeit …«
Lukas zog ihn aus dem Zimmer, und beide Ärzte gingen vom Gewicht ihrer Koffer gebeugt davon. Blasius wollte sich ebenfalls empfehlen, doch Tibald rief ihn zurück:
»O nein. Ihr bleibt.«
»Ich bleibe, Hoheit?«
»Ihr bleibt und werdet mir das eine oder andere erklären.«
»Aber sehr gern, mein König.«
Tibald suchte sich den Sessel vor dem Kamin aus, der dem Schachbrett am nächsten stand. Als ihm die Aufstellung der Figuren ins Auge fiel, runzelte er die Stirn. Diffuse Erinnerungsfetzen an eine schmachvolle Niederlage gegen Kapitän Schöne stiegen in ihm auf. Er wedelte mit der Hand durch die Luft, als wollte er sie verscheuchen, dann krümmte er sich plötzlich zusammen.
»Ich habe Hunger. Aua! Ich habe Hunger, das tut weh.«
»Manfred kommt gleich mit dem Essen, Tibald, es kann nicht lange dauern«, versicherte Ema ihm.
Tibald wand sich vor Schmerzen.
»Es tut weh, es tut so weh, es tut überall weh … wie Säure, das ist Säure, meine Eingeweide lösen sich auf … Es tut so weh, weh, weh!«
Ema riss die Augen auf. Sie erkannte die schrecklichen Schmerzen wieder, die auch sie erfasst hatten, als Tibald verschwunden war, jene Schmerzen, die auch den Hengst Epinal quälten, seit er dem verfluchten Wald entkommen konnte. Sie streichelte sanft über Tibalds Haar, seinen Nacken, seine Schultern. Er nahm ihre Hand und drückte sie so fest, dass er ihr die Knochen quetschte.
Blasius verfolgte höchst interessiert die Szene. Er wusste nicht, woran der König litt, aber er wollte es unbedingt herausfinden. Irgendwann sank Tibald matt in die Rückenlehne des Sessels.
»Ema? Ema?«
Ema setzte sich direkt vor ihn, aber er suchte weiter nach ihr. Da übernahm Blasius das Kommando.
»Seht mich an, Hoheit. Seht mir in die Augen.«
Er klopfte ihm aufs Knie. Tibald stieß ihn heftig zurück, und Blasius fiel auf seinen Hintern. Dankbar für seine faszinierende Aufgabe lächelte er.
»Da gibt’s nicht viel zu sehen. Ihr sitzt hier auf meinem Teppich wie ein Kind, das mit Murmeln spielt.«
»Gut, sehr gut, mein König«, lobte Blasius ihn.
»Wer seid Ihr überhaupt?«
»Ich bin Blasius von Frixeln.«
In diesem prekären Moment erschien Manfred mit einem Servierwagen voller Speisen, die für eine Schiffsreise nach Basilis ausgereicht hätten. Als er Blasius mit seinem dicken Hintern auf dem Boden sitzen sah, regten sich in ihm einmal mehr Zweifel an dessen Methoden.
»Danke, vielen Dank, das wird reichen«, sagte Ema zu ihm.
»Seid Ihr sicher, meine Königin?«
»Ganz sicher.«
»Soll ich für die Morgentoilette wiederkommen, Hoheit?« (Manfred konnte es kaum erwarten, den Bart fallen zu sehen.)
»Später.«
»Soll ich vielleicht schon mal das Schlafgemach in Ordnung bringen, Eure Majestät?«
Tibald hatte ihm verboten, während seiner Reise auch nur den geringsten Gegenstand in seinem Arbeitszimmer zu verrücken, und Manfred lechzte danach, Ordnung zu schaffen.
»Später, später.«
Endlich begriff Manfred die Botschaft und zog sich zurück.
»Wer war das?«, fragte Tibald. »Dieser Mann mit dem Servierwagen und dem großen Schlüsselbund, wie heißt er?«
»Manfred. Er heißt Manfred und ist Kammerherr, dein Kammerherr.«
»Mein Kammerherr? Pfff. Als wäre ich König …«
Ema warf Blasius einen verzweifelten Blick zu, doch dieser gab sich hoffnungsfroh. Die Forelle zappelte zwar noch nicht am Haken, aber sie wollte anbeißen. Während Ema einen Vorspeisenteller füllte, setzte Blasius wieder langsam, laut und deutlich zum Reden an:
»Ihr werdet jetzt etwas essen, Hoheit. Ihr esst etwas und kommt so wieder zu Kräften.«
Ema hatte die Krebspastete in Zitrusgelee gewählt, die Tibald so liebte, aber er verzog das Gesicht.
»Kaffee. Ich will einen starken Kaffee.«
»Nicht auf leeren Magen, Tibald.«
»Kaffee. Mein Kopf ist wie Mus.«
»Aber dein Magen …«
»KAFFEE, HABEICHGESAGT!«
Ema brachte ihm eine Tasse. Er kippte die dunkle Flüssigkeit in einem Zug hinunter. Der vertraute, tröstliche Geschmack breitete sich in seinem Mund aus und wärmte ihm die Kehle. Zufrieden leckte er sich die Lippen.
»Noch mehr.«
»Nun esst erst einmal etwas, Hoheit«, drängte Blasius von Frixeln, der fürchtete, das Koffein könnte sich unheilvoll auf die zerrütteten Nerven auswirken.
Tibald akzeptierte ein paar Löffel Sahne, dann ein Hörnchen, das er mit großer Aufmerksamkeit auf den Orientteppich krümelnd aß, dann eine Birne, die er nur langsam kaute, weil ihn immer wieder Krämpfe durchfuhren. Allmählich gewann er mehr Sicherheit, und schließlich verputzte er zwei hart gekochte Eier, drei Brötchen, einen Hähnchenflügel, eine Schüssel Obstsalat sowie die berühmte Krebspastete in Zitrusgelee. Blasius staunte über seine Unersättlichkeit; er, der selbst ein Genussmensch war, hätte spätestens beim Obstsalat die Segel gestrichen.
»Ich glaube, das genügt erst einmal«, bremste Ema Tibald, als dieser Interesse an dem Apfelkuchen zeigte.
»Ja. Ich bin müde.«
»Ich lasse Euch allein, Hoheit, damit Ihr Euch ein wenig ausruhen könnt«, sagte Blasius.
»O nein. Ihr bleibt. Das habe ich doch schon gesagt. Ihr müsst mir noch das eine oder andere erklären.«
»Gut, Hoheit. Sehr, sehr gut«, lobte Blasius.
Das Kurzzeitgedächtnis schien ausgezeichnet zu funktionieren.
»Erklärt mir noch einmal genau, was Herrn von Frixeln zugestoßen ist.«
Doch schon während er die Worte aussprach, befiel Tibald Unsicherheit. Da war noch etwas Verwirrendes: Wie sollte Herr von Frixeln tot sein, wenn Herr von Frixeln sich doch gerade mit ihm unterhielt? Er war kurz davor, wieder aus der Spur zu geraten.
»Von Frixeln … Heißt Ihr nicht auch von Frixeln? Aber Ihr seid nicht tot …«
»Nein, Hoheit. Ich bin sehr lebendig. Ich heiße Blasius. Gestorben ist Clemens.«
»Clemens …«
»Clemens von Frixeln, Hoheit.«
»Aber wie? Wie ist er gestorben?«
Blasius lehnte sich zurück. Er musste jetzt ganz behutsam vorgehen.
»Clemens befand sich allein in seinem Studierzimmer, Hoheit. Im Turm brach ein Feuer aus. Clemens ist im Qualm erstickt.«
»Wann?«
»Vorgestern, Hoheit.«
»Vorgestern? Aber … das hättet Ihr mir doch früher erzählen können!«
»Ähm … nein, Hoheit. Nein. Ich konnte es Euch nicht früher erzählen.«
»Und warum nicht? Hm? Warum denn nicht?«
Tibald beugte sich vor und packte Blasius wieder am Wickel.
»Tibald …«, setzte Ema an. »Du warst … Du warst nicht hier. Erinnerst du dich nicht?«
»Woran?«
»Ihr wart weg, Hoheit. Nicht auf dem Schloss«, sagte Blasius.
»Nicht auf dem Schloss! Aber wo denn dann? Wo?«
Weder Blasius noch Ema fanden den Mut zu antworten. Tibald saß wütend auf seinem Sesselrand, drauf und dran, Blasius wie eine Vogelscheuche zu schütteln.
»RÜCKTIHRNUNENDLICHMITDERSPRACHEHERAUS?«
Ema war besorgt, doch Blasius sah etwas Gutes in diesem Wutausbruch. Der Verstand des Königs löste und lockerte sich stoßweise, wie dies oft der Fall ist. Doch es blieb eine kippelige Angelegenheit, und die Antwort auf Tibalds Frage besaß explosive Sprengkraft. Womöglich würde ihn der neue Schock abermals in die Tiefe reißen, und Blasius ließ nicht gerne eine so dicke Forelle entwischen.
»Erinnert Ihr Euch an gar nichts, Hoheit?«, fragte er mit ruhiger Stimme.
Endlich ließ Tibald ihn los.
»Nein! Was wollt Ihr nur, woran ich mich erinnere?«
»Ich will überhaupt nichts, mein König«, sagte Blasius besänftigend und rückte seinen Kragen zurecht. »Ich möchte Euch nur helfen, das ist alles.«
Abrupt stand Tibald auf, stützte sich auf die nächstbeste Kommode und begann im Zimmer auf und ab zu wandern. Das war ein weiteres gutes Zeichen. Er geriet nur unmerklich ins Taumeln. Allerdings war er schnell erschöpft und ließ sich, bevor er den Schreibtisch erreicht hatte, in den Löwenfußsessel fallen.
»Tibald«, begann Ema, »vielleicht erinnerst du dich, dass wir in der Großen Kurhütte waren?«
»In der Großen Kurhütte … Das sagt mir etwas … Dort war es irgendwie seltsam, nicht? Frost. Alles war vereist?«
»Ja. Alles war vereist. Es sah sehr schön aus. Wie eine Welt aus Kristall.«
»Kristall … Das sagt mir etwas.«
Er fröstelte.
»Ist dir kalt?«
»Ein bisschen, ja. Nur ein bisschen.«
Und er schlug einen unsichtbaren Mantelkragen hoch.
»Da war ein Spatz, auf einem Zweig. Er hatte seinen Schnabel ins Gefieder gesteckt und sah so … allein aus.«
Seine Worte wurden nuscheliger. Tibald blickte auf einen unbestimmten Punkt über Blasius’ Schulter.
»Ja, Hoheit, ein Spatz, ganz richtig«, wiederholte Blasius absichtlich laut. »Und erinnert Ihr Euch, wo Ihr wart, als Ihr den Spatz gesehen habt?«
»In einem Wald? Im Unterholz? Zusammen mit Ovid. Auf Pferden.«
Tibald sah plötzlich wieder vor sich, wie sie durchs Unterholz ritten. Er hörte das dumpfe Hufgeklapper der Arbeitspferde, sah deutlich die Schäfer, die ihm von ihren toten Schafen berichtet hatten, sah ihre dicken Holzschuhe, ihre schweren Kapuzenmäntel, ihre Wollmützen. Irgendetwas beunruhigte ihn, aber was? Wieder fröstelte er. Und wie er es auch dort gemacht hatte, führte er unwillkürlich seine Hand zu dem Medaillon, das Emas Bildnis enthielt.
Aber das Medaillon hing nicht mehr um seinen Hals. Aufgeregt zog er an den Bändeln seines Hemdes.
»Hoheit?«
Ein Bändel riss entzwei.
»Das Medaillon!«
»Was für ein Medaillon, Hoheit?«
»Ihr scherzt wohl? Ich lege es niemals ab.«
Sein Blick wanderte hoch zur Zimmerdecke. Blasius beschloss, nun alles auf eine Karte zu setzen.
»Euer Medaillon ist verschwunden, Hoheit. Aber Ihr wisst, wo es sich befindet. Forscht in Eurem Gedächtnis. Strengt Euch an. Wo habt Ihr das Medaillon zurückgelassen?«
Tibald presste die Kiefer aufeinander, ballte seine Fäuste, wand sich in seinem Sessel. Er führte einen schrecklichen Kampf gegen sich selbst.
»Das Medaillon, Hoheit. Versucht Euch zu erinnern. Ihr habt es irgendwo gelassen.«
Plötzlich riss Tibald seine Augen weit auf. Er sah das Medaillon vor sich, wie es an einem niedrigen Ast baumelte. Ein heftiger Schmerz fuhr durch seinen Schädel. Seine Finger berührten eine aschige Fläche. Riesige Bäume umschlangen ihn, zerdrückten ihn, pressten ihm die Luft aus der Lunge. Eine Stimme tönte in seinem Blut, und Blut war auch in seinem Mund. Tibald hob schützend die Armbeuge vor sein Gesicht.
»Nein …«, stöhnte er und rutschte auf den Boden.
Blasius stürzte zu ihm, tätschelte ihm die Wange, gab ihm regelrecht Ohrfeigen. Vergeblich. Mit großer Anstrengung schleppte er den König ins Nebenzimmer zu seinem Bett.
»Ich habe den Fisch entwischen lassen …«, murmelte er zerknirscht.
Er untersuchte Tibalds Pupillen und fühlte seinen Puls.
»Er schläft, meine Königin.«
»Aber niemand schläft so plötzlich ein …«
»Ihm blieb kein anderer Ausweg, Hoheit. Er hat sich an etwas erinnert, was ihn erschüttert hat.«
»Wird er wieder zurückkommen, Blasius?«
»Er hat schon begonnen zurückzukommen. Sogar erstaunlich schnell, wenn man es recht bedenkt. Und er war fast eine Stunde wach, Hoheit … Üben wir uns in Geduld.«
»Was meint Ihr, wie lange es dauern wird?«
»Das lässt sich unmöglich sagen, Hoheit. Jede Seele ist einzigartig.«
Schweigend betrachteten sie das Häufchen König. Den Bart, die Narbe, seine Magerkeit. Ein Bart von mindestens zwei Wochen, eine Narbe von einem Monat, ein drastischer Gewichtsverlust: Die Zeit war erstaunlich schnell über seinen Körper hinweggegangen. Tibald stöhnte in seinem Schlaf und ballte das Laken in seiner Faust.
Der Ecksteiner Thron blieb niemals länger als zwölf Tage unbesetzt. Und Tibald blieben noch acht, um seine Herrschaft zu retten.
3
Granit.
Der Zweig wird länger, kommt näher, eine Hand. Hand, Zweig? Der Himmel ist rund. Das Rund ist grün. Der Zweig kehrt zum Stamm zurück, der kein Stamm ist, sondern eine Frau. Granit, Asche, die Frau ist keine Frau, sondern ein Mädchen. Es streicht über meine Stirn. Sieht die Blüte auf meiner Stirn. Zeigt etwas Glänzendes, das schwingt – Medaillon.
Das Mädchen lächelt, ich kenne es. Kenne ich es?
Ja.
Nein.
Noch nicht.
Ich will schreien, muss schreien.
Schreien.
Ein trockener Zweig Stechginster klatschte gegen die Fensterscheibe. Tibald schreckte aus dem Schlaf, warf seine Decke zu Boden.
Es war der zweite Morgen nach seiner Rückkehr. Draußen war es grau und windig, aber drinnen knisterte das Feuer und warf seine flackernden warmen Schatten an die roten Wände. Ema ließ eine große Kupferwanne neben dem Kamin aufstellen, und als Tibald einwilligte, in das warme Wasser zu steigen, wusch sie ihn vorsichtig. Wie gerne hätte sie auch all den Schrecken von ihm abgespült und den Schleier weggezogen, hinter dem er sich verschanzte. Mit dem Dampf des warmen Bades verflüchtigten sich seine Albträume, und er konnte sich nicht mehr an sie erinnern. Ab und zu hob er einen Finger aus dem Wasser und wartete darauf, dass ein Tropfen fiel. Dann beobachtete er gebannt die sich bildenden Kreise auf der bernsteinfarbenen Wasseroberfläche. Er sprach nicht.
Der vergangene Tag war geprägt gewesen von plötzlichen Wutausbrüchen, unruhigen Schlafphasen und seltenen Momenten der Klarheit. Die Forelle war hin- und hergerissen zwischen der Oberfläche und dem Grund des Sees. Ema hatte ihr Bestes getan, um die Anfragen und Gesuche abzuwehren, die sich vor der Tür des königlichen Arbeitszimmers anstauten. Das Volk wartete ungeduldig darauf, dass sich der König auf dem höchsten Turm zeigte. Der Friedensrichter und die Ältesten der Hafenregion wünschten ihn zu sprechen. Der Kanzler mahnte Unterschriften an, der Duke of Oats war völlig aus dem Häuschen, und Elisabeth kam, um ihre Hilfe anzubieten. Blasius versicherte, »noch mehr Schocks auf Lager« zu haben, und Benedikt wollte den berühmten Bart sehen. Madeleine wusste zu berichten, die Kerzen im Zimmer der Totenwache seien immer noch nicht heruntergebrannt und Clemens von Frixeln allem Anschein nach ein Heiliger. Manfred, den der Auftritt im Hermelinpelz nachhaltig verstört hatte, zauberte eine reiche Auswahl praktischer Kleider hervor, die sich ohne große Mühe anziehen ließen. Lysander überbrachte Neuigkeiten von Epinal. Willem Schöne war der Einzige, der abwartete, dass man ihn rief.
Die ganze Insel wusste, dass der König der Catastrophe entkommen war. Doch nur eine Handvoll Menschen hatte ihn in Fleisch und Blut gesehen. War er wirklich wieder da? Und wenn er wieder da war, war er auch in der Lage zu regieren?
Nein.
Ema war vor allem daran gelegen, dass er sich in aller Ruhe und Wärme erholen konnte. Deshalb würde sie für heute lediglich Blasius’ Schocks und Elisabeths Freundschaft zulassen.
Den Vormittag über konnte Blasius nicht viel bewirken; er versprach, später wiederzukommen. Elisabeth erschien am frühen Abend. Tibald, der versunken in einem der vielen Sessel seines Arbeitszimmers saß, schien nur Aufmerksamkeit für seine Schuhe zu haben. Elisabeth ging zu ihm und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Er wandte sich ihr ein wenig zu und lächelte sie freundlich an.
»Guten Tag, Cousin.«
Langsam verschwand das Lächeln aus seinem Gesicht.
»Erkennst du mich nicht?«
Er kniff die Augen zusammen, gab seine Bemühungen aber schnell auf und widmete sich wieder seinen Schuhen. Elisabeth strich ihm leicht über die Schulter und ging zu Ema hinüber, um sich zu ihr zu setzen.
»Du bist müde«, stellte sie fest. »Und er … ist viel schweigsamer als sonst, wie mir scheint. Hat er irgendetwas erzählt?«
»Er kann sich an nichts erinnern. Er ist immer noch nicht ganz bei uns angekommen, wie du siehst.«
»Wie ist er aus dem Wald gelangt?«
Ema schwieg.
»Du willst es mir nicht sagen, nicht wahr? Oder du kannst nicht. Wie auch immer. Das macht nichts, Ema.«
Elisabeth streifte sich nachdenklich eine Strähne hinters Ohr, während sie ihren Cousin nicht aus den Augen ließ. Sie zog die Brauen zusammen, wodurch die kleinen Dachgiebel zu Regenrinnen wurden.
»Weißt du, ich habe ihn schon einmal so erlebt. Nachdem seine Mutter gestorben war. Da war er ungefähr sechs Jahre alt.«
»War er da auch so wie jetzt?«
»Natürlich noch ohne Bart. Ohne Narbe im Gesicht und ohne graue Haare. Aber ansonsten, ja. Ebenfalls so in sich zurückgezogen. Damals lungerte er tagelang am Teich herum, wo er Äste ins Wasser tauchte und den Tropfen beim Fallen zusah.«
»Das Gleiche hat er vorhin auch beim Baden gemacht.«
»Das überrascht mich nicht. Er verkriecht sich in sich selbst, bringt Dinge in Ordnung, und dann kommt er wieder zurück.«
»Hat es nach Luises Tod lange gedauert, bis er wieder zurückkam?«
»Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Sein Vater hat ihn sehr bald in die Obhut von Clemens von Frixeln gegeben. Vielleicht hat ihn das wieder auf die Beine gebracht.«
»Clemens von Frixeln …«
»Ach ja«, seufzte Elisabeth. »Du findest da schon heraus, nicht wahr, Tibald? Du wirst dich wieder berappeln?«
Tibald reagierte nicht.
»Im Grunde«, fuhr Elisabeth fort, »war er danach nie mehr ganz derselbe. Hast du den leichten Schatten von Traurigkeit in seinem Blick bemerkt?«
»Natürlich. Ohne diesen Schatten würde er ständig amüsiert wirken.«
»Und er verleiht ihm ungeheuren Charme. Wegen dieses Schattens haben sich schon mehrere Frauen in ihn vernarrt. Aber du, Ema, bist die Einzige, in die Tibald sich vernarrt hat.«
Elisabeth beobachtete ihren Cousin, der sich immer noch über seine Schuhe beugte.
»Auch Alberich mochte diesen Schatten«, fügte sie hinzu. »Er sah darin die Verheißung eines guten Königs.«
Sie verstummte, und Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus. Ema fiel ein, dass es irgendwo eine Teekanne und Kekse gab, und wollte schon aufstehen.
»Lass nur, ich kümmere mich darum.«
Elisabeth brachte zwei dampfende Tassen. Ema zwang sich dazu, einen Schluck zu trinken, und erzählte dann, um die Atmosphäre aufzulockern:
»Ich habe einen neuen Freund gewonnen. Ein Eichhörnchen.«
Zwei Tage zuvor war sie in ihren Garten gegangen, um ein bisschen Nachtluft zu schöpfen. Da war überraschend ein Eichhörnchen zu ihr gekommen und hatte eine Haselnuss in ihre Hand fallen lassen, die sie seither bei sich trug. Sie zeigte sie Elisabeth.
»Ein Eichhörnchen hat dich aufgesucht? Wann war das?«, fragte die Cousine mit sichtlichem Entzücken.
»Vorgestern Abend. Weshalb?«
»Ich könnte mir vorstellen … Ich glaube … Weißt du, wer das war, dein Eichhörnchen?«
»Wie meinst du das? Ein Eichhörnchen eben.«
»Nein. Es war Clemens von Frixeln.«
»Wie bitte?«
»Oh, ganz sicher. Eigentlich hätte ich mir das denken können. Ein Mann wie er musste ja unweigerlich zurückkommen.«
»Elisabeth, er ist tot.«
»Aber die Toten kommen zurück! Nur ein einziges Mal. Gewöhnlich in der Woche nach ihrem Ableben. Sie nehmen die Gestalt irgendeines Lebewesens an, um jemanden aufzusuchen, der sie noch braucht. Oder jemanden, den sie noch brauchen. Man erkennt es daran, dass sie in einer untypischen Jahreszeit auftauchen oder sich merkwürdig verhalten. Wie ein Murmeltier mitten im Dezember. Oder eine Kuh in der Kapelle. Pfingstrosen im Winter, so etwas in der Art.«
»Aber …«
»Kommen in der Südsee die Toten nicht zurück?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Nun, hier geschieht das recht häufig. Alberich hat uns immer wieder angekündigt, er werde einst als Albatros erscheinen. Was für ein Glück du hast … Clemens von Frixeln! Wahrscheinlich hofft die halbe Insel auf seinen Besuch …«
»Aber … nehmen wir an, er war es wirklich, warum sollte er mir dann eine Nuss bringen?«
»Tja … ich weiß nicht. Das musst du selbst herausfinden. Er hat seine Vorräte mit dir geteilt. Es verspricht ein rauer Winter zu werden. Eine Haselnuss ist für ein Eichhörnchen ein Schatz. Wer weiß, vielleicht hatte er das Gefühl, dir etwas schuldig zu sein. Hattest du auch etwas mit ihm geteilt?«
Ema stieg die Hitze ins Gesicht. Sie hatte ihr Geheimnis mit Clemens von Frixeln geteilt – und aus diesem Grund hatte er sterben müssen. War er gekommen, um ihr zu danken oder um ihr zu vergeben?
»Ema? Du weinst?«
»Nein … Ich … Ach, tatsächlich«, sagte sie verwundert und wischte sich über die Wange.
Tibald hob abrupt seinen Kopf.
»Du weinst, Ema?«, fragte er entsetzt.
Sie wollte ihn schon beruhigen, doch in diesem Moment kam Ovid zur Tür herein.
»Kapitän Schöne, meine Königin. Soll ich ihn einlassen?«
Willem hatte es nicht mehr ausgehalten, dass ständig alle etwas von ihm über den König erfahren wollten, und beschlossen, sich selbst einen Eindruck zu verschaffen, auf die Gefahr hin, Tibald in seiner Privatsphäre zu stören. Der Weg zum königlichen Arbeitszimmer war ihm endlos erschienen, denn sein vierfacher Knöchelbruch – eine Folge der Catastrophenschlacht – zwang ihn, mit Krücken zu gehen.
Alle waren überrascht, als Tibald selbst antwortete:
»Ja, ja, Küfer, lass den Kapitän hereinkommen.«
Verblüfft darüber, dass man ihn wiedererkannt hatte, blieb Ovid wie angewurzelt stehen. Willem wiederum war wie gelähmt von Elisabeths Anblick. Während der Totenwache hatte sie ihn geblendet wie der reinste Diamant der Welt, der plötzlich aus der Verborgenheit zum Vorschein gekommen war. Jetzt, wo er nüchtern war und nicht mehr ganz so starke Schmerzen hatte, fand er sie noch umwerfender. Er vergaß völlig, dass er eigentlich wegen des Königs gekommen war, und ebenso, wie man sich auf Krücken fortbewegte. Aber auch Tibald machte einen verdutzten Gesichtsausdruck. Er musterte aufmerksam Willems Krücken und Ovids Kopfverband.
»Sagt mal, habt ihr euch verkleidet?«
»Ähm … nein, Hoheit«, stotterte Ovid. »Der Festsaal ist voll von solchen Bandagierten wie uns.«
»Eine Karnevalsfeier also?«
»Sie sind verwundet«, erklärte Ema in der Hoffnung, einen heilsamen Schock dadurch zu bewirken.
Tibald schüttelte verärgert den Kopf.
»Verwundet? Warum das denn? Wieso erzählt mir keiner was?«
»Lieber Cousin …«, setzte Elisabeth an.
»NEIN, NEIN«, unterbrach Tibald sie wütend, »ANTWORTETMIRENDLICH! ERKLÄRTEUCH!«
»Mein König, wenn Ihr erlaubt …«, begann Willem, dem eine Idee gekommen war.
»Solltest du mich nicht Tibald nennen?«
Der König hatte Willem gebeten, ihn beim Vornamen zu nennen und – noch unerhörter – zu duzen. Es verlangte dem Kapitän jedes Mal eine große Willensanstrengung ab. Und es nun auch noch vor Zeugen zu tun (darunter Elisabeth), erschien ihm als Ding der Unmöglichkeit. Aber ihm blieb nichts anderes übrig.
»Hör zu … Tibald. Lass mich deinen schönen alten Ebenholzsessel heranrücken, ja? In dem Ebenholzsessel kannst du gut nachdenken, hast du immer gesagt. Er ist gerade genug unbequem, um dich wach und klar zu halten.«
Ema bedauerte, dass sie nicht selbst darauf gekommen war. Wenn Tibald schon die Mitglieder seiner Mannschaft wiedererkannte, würde er durch die Berührung mit dem Sessel, in dem er so viel Zeit auf See verbracht hatte, vielleicht noch weitere Erinnerungen zurückgewinnen. Willem wartete allerdings darauf, dass jemand seinen Vorschlag in die Tat umsetzte, denn er konnte den Sessel nicht selbst holen, es fiel ihm ja schon schwer, sich überhaupt auf den Beinen zu halten. Er machte Ovid ein Zeichen, der es jedoch wegen seiner Einäugigkeit nicht sah. Elisabeth war die Einzige, die reagierte.
Als Tibald in seinem Lieblingssessel saß, straffte er seine schönen breiten Schultern und zeigte auf das Schachbrett, dessen Figuren unübersehbar ein strategisches Fiasko bezeugten.
»Willem. Welche Farbe hattest du gespielt?«
Der Kapitän bekam einen Schreck. Was für eine Zwickmühle … Sagte er die Wahrheit, riskierte er, den König zu demütigen. Schwindelte er hingegen, bestand die Gefahr, dass dessen Verwirrung weiter anwuchs. Er entschied sich für die Schmeichelei. Es war sonst nicht seine Art, aber Elisabeths Gegenwart ließ ihm keine andere Wahl.
»Äh … Schwarz?«
Tibald zog eine unzufriedene Miene.
»Bist du sicher?«
»Ähm … Nicht ganz sicher, nein. Ich weiß es nicht mehr.«
»ALSO?«, fuhr Tibald ihn an.
»W-was?«, stammelte Willem.
»Erklärt ihr’s mir nun oder nicht? Die Sache mit den Verwundeten? WER und WIE?«
Die Frage schwebte unbeantwortet im Raum, als es erneut an der Tür klopfte. Es war Lukas, der Ovid ablösen kam.
»Jetzt kommt auch noch der Krankenpfleger«, brummte Tibald, als würde dessen Anwesenheit das Ausmaß der Verwundungen bekräftigen.
Die Tür war noch nicht wieder zu, als Blasius von Frixeln hereinschlüpfte. Er kam wie verabredet, um die nächste Therapiesitzung abzuhalten. Lysander war mitgekommen, um dem König von Epinal zu erzählen.
»Nanu, so ein Rummel?«, rief Blasius aus, als er die vielen Menschen sah. Ema hatte die Besucherströme offenbar nicht länger zurückhalten können, und die Schleusen waren nun geöffnet.
»Nein, Karneval …«, knurrte Tibald.
Als Lysander ihn so, umgeben von besorgten Gesichtern, auf dem steifen Holzsessel thronen sah, begriff er plötzlich, was das war, ein König: der Vater einer zahlreichen Familie. In diesem Fall ein ziemlich unzulänglicher Vater. Drei neuerliche Schläge an der Tür spitzten die Lage weiter zu.
»Das ist Euer Bruder, Hoheit«, erriet Blasius, und seine Ohren wurden ganz blass.
Prinz Jesko machte nur einen einzigen Schritt in den Raum. Tibald musterte ihn unsicher. Alle erwarteten etwas von ihm, aber was? Was wollten sie nur von ihm? Sollte er einen Befehl geben, eine Entscheidung treffen? Befand er sich in einer Art Theaterstück? Dann kannte er jedenfalls seine Einsätze nicht. In seinem Kopf schwirrte es.
Plötzlich brüllte er »RAUS!« und fegte das Schachbrett vom Tisch. Die Bauern, die Springer, die Türme flogen durch den Raum.
»LOS! RAUS! ALLE!«
Und mit der Handkante hieb er auf die Fläche seiner anderen Hand, jene unmissverständliche Geste, die besagte: »Alle Mann von Deck.«
In Jeskos schwarzen Augen blitzte etwas auf. Vielleicht war es Triumph, vielleicht Verachtung, vielleicht Mitleid. Jedenfalls musste er nichts weiter wissen: Sein Bruder war völlig außerstande, das Zepter zu schwingen. Jetzt galt es nur noch, die Tage zu zählen.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
4
Es war spät. Der Tag hatte Ema erschöpft. Sie bereute jetzt, dass sie die Woge ungebetener Besucher ins Arbeitszimmer hatte schwappen lassen. Im Fensterglas, durch das man in den bereiften Garten hinausblickte, sah sie ihre eigenen müden Züge. Der mit Sidra geschlossene Pakt verursachte ihr Bauchschmerzen. Tibalds Zustand bekümmerte sie. Er saß zusammengesunken auf seinem Stuhl und hielt seinen Kopf in den Händen. Ema presste die Fingerspitzen auf ihre Augenlider. Sie musste unbedingt wach bleiben. Für Tibald, für Eckstein. Es musste sich irgendeine Lösung finden lassen.
Sie hatte jede Hoffnung schon fast aufgegeben, als ihr Spiegelbild sie auf eine Idee brachte. Alle waren über Tibalds Äußeres bestürzt gewesen, aber er selbst hatte sich noch nicht im Spiegel gesehen. Schocktherapie …
Tibald hatte dem Kammerherrn frühzeitig klargemacht, dass er Spiegel als Zeitvergeudung betrachtete, deshalb musste Ema lange suchen, bevor sie im hintersten Winkel eines Schranks einen fand. Er war schon ziemlich fleckig. Im letzten Augenblick zögerte sie. War es zu riskant? Was würde Blasius sagen, wenn die Forelle die Angelschnur zerriss?
Mit unsicherer Hand hielt Ema den Spiegel vor Tibald und hob sanft sein Kinn an. Tibald kniff die Augen zusammen, als würde das Bild ihn blenden. Sein Blick wanderte zunächst vom Spiegel zu Ema, bevor er länger auf seinen eigenen Zügen verweilte. Neugierig beugte er sich vor, um die Narbe in seinem Gesicht zu betrachten. Er berührte sie mit seinem Finger und zog ihn jäh zurück, wobei er gegen das Glas stieß. Er runzelte die Stirn und drehte ein wenig den Kopf, um sich etwas mehr vor der Seite zu sehen.
»Wer ist das?«
Ema schloss daraus, dass er für die Antwort noch nicht bereit war, und schwieg.
»Er sieht ziemlich mitgenommen aus«, fuhr Tibald fort. »Was ist ihm passiert? Er muss sich sehr erschrocken haben. Ich glaube, er hatte große Angst. Vielleicht hat er irgendwo etwas verloren. Oder jemanden. Hat er jemanden verloren?«
»Ja«, murmelte Ema mit zugeschnürter Kehle.
»Jemanden, den er wohl sehr mochte.«
Tibald verstummte. Er wartete darauf, dass sein Spiegelbild eine Erklärung gab. Da sein Spiegelbild aber nichts sagte, fragte er schließlich:
»Ist jemand gestorben?«
»Ja. Es ist jemand gestorben. Jemand, den er wirklich sehr mochte.«
»Ah ja.«
Tibald sah zufrieden aus.
»Wenn er will, kann er diesen Menschen noch sehen«, schlug Ema vor. Sie dachte an die Kerzen im Zimmer der Totenwache, die immer noch nicht niedergebrannt waren. Wie es der Brauch war, würde man Clemens erst bestatten, wenn sie erloschen waren. Wer weiß, vielleicht wartete er ja auf einen verspäteten Besucher?
»Ja, ich denke, das würde ihm helfen«, pflichtete Tibald ihr bei.
Er hatte die Phase des Zorns überwunden und das Mitgefühl entdeckt. Was auf ein gesundes Herz hinwies. Ema legte den Spiegel mit der Glasfläche nach unten. Tibald suchte einen Moment nach dem Bild, gab es aber schnell auf. Ema half ihm aus seinem Sessel und führte ihn dann quer durchs Schloss, wobei sie ihn wie ein Kind an der Hand hielt. Glücklicherweise kam ihnen niemand entgegen. Tibald widmete jedem seiner Schritte die größte Aufmerksamkeit; manchmal blieb er stehen, um ihnen nachzulauschen, und wunderte sich dann, wenn er nichts mehr hörte. Im Flur vor dem Zimmer der Totenwache stolperte er über den schwarzen Teppich. Erschöpft legte er seine Wange an die Tür. Ema spürte instinktiv, dass sie ihn allein hineingehen lassen sollte. Sie bereitete sich auf das Schlimmste vor, schob ihn in den Raum und machte die Tür hinter ihm zu.
Die müden Kerzen verbreiteten einen schwachen, unsicheren Lichtschein. Ein Geruch wie von altem Kohl lag in der Luft. Clemens schien zu schlafen. Um ihn besser sehen zu können, beugte Tibald sich so tief hinunter, dass er seine Stirn berührte.
Kalt.
Erst da traf ihn die Realität mit voller Wucht. Clemens von Frixeln war tot. Clemens … tot. Eine Lawine von Bildern stürzte auf ihn ein, und mit einem Mal kamen manche Erinnerungen wieder hoch. Gerissene Tiere, Epinal in wildem Galopp. Ema. Ema erwartete ein Kind, ihrer beider Kind. Tibalds Herz schlug heftig. Er schloss die Augen und presste eine Hand auf seine Brust. Er machte die Augen wieder auf und blickte auf den Verstorbenen. Jetzt sprudelten die Erinnerungen wie ein reißender Bach. Die Rundreise, der königliche Tross, die Fahrt durch die Inselregionen. Vor seiner Abreise war er ins Observatorium hochgestiegen. Was hatte Clemens da zu ihm gesagt? Er hatte von Zwiebelschalen gesprochen, vom Winter. Er hatte gesagt: »Deine Kindheit war meine schönste Reise.« Tibald berührte wieder die Stirn des alten Lehrers.
»Wo seid Ihr jetzt, Herr von Frixeln?«
Die Mitternachtsglocken antworteten ihm. Wie ein Hammer trieben sie ihn mit jedem Schlag weiter in die Wirklichkeit. Mit jedem Glockenton spürte er deutlicher seine ermatteten Muskeln, seinen keuchenden Atem, das Ziehen in seinen Schläfen. Die Schrunden an seinen Händen spannten wie zu enge Handschuhe. Die Schnittwunde in seinem Schenkel pochte bis ins Knie. Er fühlte sich völlig zerschlagen, überall. Schwer stützte er sich auf das Totenbett. Der Nebel in seinem Kopf lichtete sich rasend schnell, als führte Clemens persönlich ihn durch das Labyrinth seiner Erinnerungen. Mit erschreckender Klarheit sah er den Ritt durch das Unterholz vor sich, das tote Schaf im Graben, die Frostbeulen an den Fingern der Schäfer, die gefrorenen Erdschollen auf der Weide. Die Wölfe, die Epinal umkreisten, der gewaltige Sprung über sie hinweg, die Meute, die sie verfolgte. Der Schneesturm.
Hier verlor sich die Szene im Schnee.
Was war dann gewesen? Der Wald war ganz nah, war dicht vor ihm. War er hineingeritten? Unmöglich. Niemand gelangte in den Wald hinein.
Eine der Kerzen erlosch. Gleich würde die Totenwache zu Ende sein. Langsam, ganz langsam ging Tibald durch den Raum. Er fühlte den Boden unter seinen Füßen. Boden. Er fühlte das Gewicht seines ganzen Körpers. Körper. Es war, als wäre er gerade auf der Erde gelandet, so überraschten, schmerzten und trösteten ihn seine Bewegungen. Er machte das Fenster auf. Ein kalter Luftstoß wehte herein und löschte die anderen Kerzen. Um ihn herum breitete sich Dunkelheit aus, die gesättigt war vom Qualm der Dochte und dem Geruch nach geschmolzenem Wachs. Tibald tastete sich bis zum Bett vor und berührte ein letztes Mal Clemens’ Stirn – die Stirn, hinter der eine so einzigartige Intelligenz gelebt hatte.
»Danke. Für die Bussole und alles andere. Für alles.«
Anschließend harrte Tibald in der Stille aus. Hätte er sich auf der Isabelle befunden, wäre er zum Vorderdeck gegangen. Hätte vom Bug aus den Horizont betrachtet, und der Horizont hätte ihn besänftigt. Doch hier, im Zimmer der Totenwache, blieben ihm nur die Schmerzen seines Körpers, die Erinnerung an den Schneesturm, das Dunkel und die Reglosigkeit des Mannes, der neben ihm lag und den es nun zu beerdigen galt.
5
Der Rücken zerschmettert, die Adern aufgerissen, fließende Asche, fließende Erde und Steine.
Ein Stiefel im Steigbügel. Ein Stiefel auf dem Granit. Da ist jemand. Da ist jemand im Wald. Da ist eine Frau in der Stimme des Waldes. Sie sieht mich an. Mein Kopf, mein Kopf tut so weh. Weh, weh, weh. Licht zwischen den Zweigen, meine Lider. Eine Hand auf meiner Hand. Frisch. Etwas glänzt. Das Mädchen ähnelt mir. Sie lächelt. Ich will sie nicht erkennen. Ich erkenne sie. Ich weiß es, ich will es nicht wissen, ich will schreien, ich kann nicht schreien, mein Mund ist voller Steine, Erde, Steine.
»… der Totengräber, Eure königliche Majestät. Er meint, die Erde sei zu fest gefroren, um ein Grab auszuheben.«
Tibald öffnete die Augen und tastete unwillkürlich nach seinem Dolch.
»Ah! Ihr seid wach, Eure königliche Majestät.«
Wenn der Herrscher sich in einer Position unter ihm befand, sprach Manfred ihn stets mit Eure königliche Majestät an. Es war eine dieser Feinheiten alter Schule, die ihn im Bedienstetentrakt zu einer wahren Legende machten.
»Wie viel Uhr ist es?«
»Halb zehn, Eure königliche Majestät.«
»Morgens?«
»Sicher, Eure königliche Majestät …«
Die königliche Majestät richtete sich schlaff und verschwitzt auf. Sie rieb sich einen Arm und stellte fest, dass er schmerzte.
»Und was erzählt Ihr mir da um halb zehn Uhr morgens von einem Totengräber?«
»Möchten Eure königliche Majestät eine ehrliche Antwort hören?«
»Aber natürlich, Manfred.«
»Man nennt es Schocktherapie, Eure königliche Majestät.«
»Wie bitte?«
»Und ich muss sagen, es funktioniert, Eure königliche Majestät. Ich habe vergeblich versucht, Eure Aufmerksamkeit zu gewinnen, ich ließ die Schlüssel über Eurem Bett klirren, bot Euch sogar einen Kaffee an, und Ihr habt nicht reagiert. Doch bei der ersten Erwähnung des Totengräbers seid Ihr zu Euch gekommen.«
»Kann ich den Kaffee trotzdem haben?«
»Den Kaffee, natürlich, Eure königliche Majestät.«
Und sofort reichte Manfred ihm seine Lieblingstasse, die aus so feinem Metall war, dass er sich immer die Finger daran verbrannte. Tibald trank sie in einem Zug leer und setzte sich dann im Bett auf. Er ließ geschehen, dass der Kammerherr ihm mit einem feuchten Schwamm über den Oberkörper fuhr, streckte folgsam seine Arme aus, damit er ihm das Hemd überziehen konnte, und wartete ab, bis er ihm die Bänder zugebunden hatte. Er war zu schwach, um sich allein anzuziehen.
»Wie viel Uhr ist es?«, fragte er wieder.
Manfred schaute der Genauigkeit halber auf seine Uhr.
»Neun Uhr siebenundvierzig, Hoheit.«
»Wo ist die Königin?«
»Die Königin ist im Laufe der Nacht in ihr Gemach gewechselt, Hoheit«, teilte Manfred ihm mit, während er den Trauerrock abstaubte, der auf einem Bügel am Kleiderschrank hing.
»Warum?«
»Bei allem gebotenen Respekt, Hoheit, sie hat angedeutet, dass sie hier nicht zur Ruhe kommen würde.«
»Und was bedeutet das, Manfred?«
»Ihr habt einen sehr unruhigen Schlaf, Eure Majestät«, antwortete Manfred vage, während er ihm mit geübter Hand den Rock anzog; er hatte die Gabe, jeglichen Stoff wie kostbaren Damast aussehen zu lassen.
»Sehr unruhig?«
»Äußerst unruhig, Hoheit.«
Tibald war ohne seine Decke aufgewacht, mit schweißnassen Händen und rasendem Puls, aber er konnte sich nicht daran erinnern, geträumt zu haben.
»Die Königin bat, ihr Bescheid zu geben, sobald Ihr aufgewacht seid, Hoheit.«
»Ach was. Sie soll sich nur ausruhen. Wie viel Uhr ist es?«
Manfred blickte ihn verwundert an.
»Nicht viel später als vor zwei Minuten, mein König«, antwortete er. Er trat ein paar Schritte zurück, um den Sitz der Kleidung zu überprüfen, wie ein Maler sein Werk begutachtet. »Ich erlaube mir die Bemerkung, dass Euch Schwarz gut steht. Schade, dass diese Farbe so traurigen Anlässen vorbehalten ist. Frühstück?«
Der Servierwagen stand schon im Arbeitszimmer bereit. Tibald biss herzhaft in ein Croissant und ließ dabei einen ganzen Krümelregen auf den schwarzen Stoff niedergehen.
»Oh, verflixt. Tut mir leid«, sagte er, während er einen zweiten, ebenso verheerenden Bissen nahm.
Manfred musste an sich halten, um ihn nicht zeitgleich abzubürsten, als ihn ein Geräusch vom Flur aufhorchen ließ.
»Ah, endlich, der Friseur«, sagte er und ging aufmachen.
»Der was?«
»Der königliche Hoffriseur, Hoheit.«
Manfred sehnte schon den Moment herbei, in dem sich der König endlich wieder sehen lassen konnte.
»Herein, herein. Kommt und seht Euch das an …«
Der Hoffriseur gab seinen üblichen Spruch zum Besten:
»Ein gepflegter Kopf denkt besser.«
»O ja. Und alle werden es Euch danken«, flüsterte Manfred ihm zu.
Der Friseur betrachtete den König zunächst aus einer gewissen Entfernung und trat dann näher, um sein Verdikt zu äußern.
»Ich werde Euch nicht den Bart abrasieren, Hoheit. Das ist ein zu übler Schmiss, den Ihr da auf der Wange habt … Das würde ich nicht wagen.«
Manfred stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.
»Ich werde höchstens die Kehle frei machen und den Bart in Form trimmen. Euer Vater, unser König Alberich seligen Angedenkens, war ja selbst ein großer Bartträger, also letztlich eine gute Idee. Trotzdem ist es ein bisschen seltsam, dass Ihr ihn ausgerechnet während der Inselreise habt wachsen lassen, wo doch Benedikt und sein Rasiermesser mit dabei waren. Nun, aber warum nicht, Hoheit, o ja, warum nicht?«
Der Friseur machte sich an die Arbeit. Er stutzte den Bart zurecht, doch als er zum Haupthaar übergehen wollte, hielt er verblüfft inne.
»Wenn ich über das Mittel verfügte, das dieses Haar so schnell hat wachsen lassen, wäre ich der Liebling aller Damen.«
Manfred, der sich in den Hintergrund verzogen hatte, gab ihm ein Zeichen loszulegen. Doch der zunehmend verunsicherte Friseur ließ seine Schere langsam ins Leere schnippen, ohne etwas zu berühren. Schließlich ging er zu dem Kammerherrn in seiner Ecke, um sich leise mit ihm zu bereden.
»Was ist mit ihm passiert? Er verliert büschelweise Haare.«
»Ich weiß.«
»Ein derartiger Haarausfall … Er muss einen ungeheuren Schrecken durchlebt haben. Blankes Entsetzen. Und dann diese grauen Strähnen …«
Manfred schickte ihn wieder zurück. »Macht ihn vorzeigbar, das ist alles, was man von Euch verlangt.«
Was er wirklich dachte, behielt er für sich: Selbst mit gepflegtem Kopf würde es beim König mit dem Denken hapern.
Und tatsächlich fragte Tibald nun: »Wie viel Uhr ist es?«
Entmutigt ging Manfred zu ihm und zog seine Taschenuhr hervor. Er hoffte, wenn der König das Zifferblatt sähe, würde er die Uhrzeit endlich in Erinnerung behalten.
»Exakt zehn Uhr zwei, Eure königliche Majestät.«
Tibald starrte fasziniert auf die Uhr und streckte die Hand danach aus. Noch nie hatte er etwas mehr begehrt als diesen kleinen Gegenstand mit dem verzierten Deckel, der am Ende einer vergoldeten Kette hing. Manfred trat einen Schritt näher, der Friseur zwei zurück. Tibald strich mit den Fingerspitzen über die Uhr, schloss ihren Deckel, öffnete ihn, schloss ihn wieder: Er verwechselte sie mit seinem verlorenen Medaillon. Auf einmal nahm er die Uhr fest in die Hand und zog an der Kette. Die Weste folgte nach und in ihr der Kammerherr. Derart auf Tuchfühlung mit dem Monarchen wurde es Manfred unbehaglich zumute, und er schlug vor:
»Wünscht Eure königliche Majestät die Uhrzeit vielleicht selbst zu überprüfen?«
Und während er sprach, löste er mit einer Hand die Kette von seiner Weste. Freigekommen nahm er wieder den gebührenden Abstand ein. Tibald betrachtete gebannt das runde kleine Ding, ja es schien, als wollte er sich selbst hypnotisieren, indem er es hin- und herschwingen ließ, während der verlegene Friseur ihm eilig einen einfachen Bürstenschnitt verpasste und sich dann aus dem Staub machte, bevor Manfred die Frisur beanstanden konnte.
Aber der Kammerherr hatte jetzt andere Sorgen. Er hob an, sehr laut zu sprechen, um die Aufmerksamkeit des Königs zu wecken, der noch immer in das goldene Funkeln versunken war.
»Der Totengräber möchte wissen, wie er hinsichtlich der Bestattung des verstorbenen Herrn von Frixeln vorgehen soll, Eure königliche Majestät. Die Erde ist gefroren. Sie haben es mit zehn Mann versucht, sogar einen Ochsenpflug auf den kleinen Friedhof gebracht. Aber nichts zu machen.«
»Gut, Manfred, dann eben keine Beerdigung«, erklärte Tibald schlicht und steckte die Uhr in seine Tasche.
Das war platterdings Diebstahl, doch der Kammerherr wagte nicht, einen solchen Vorwurf zu formulieren.
»Und was heißt das?«, fragte er nur.
»Das heißt, wir begraben ihn nicht in der Erde«, verkündete Tibald und stand von seinem Stuhl auf.
»Nicht, Hoheit?«
»Wir bestatten ihn im Meer. Heute Nachmittag.«
»Im Meer, sehr wohl, mein König …«, wiederholte Manfred, verblüfft über diesen Geniestreich.
Und Tibald fühlte sich auf einmal von einem so hellen, reinen Licht durchdrungen, dass ihm schien, er könne selbst das Unsichtbare sehen. Seine kleptomane Anwandlung war einem Moment größter Klarsicht gewichen. Ja, er glaubte sogar, eine Gefühlsregung in Manfreds Gesicht zu lesen (was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit war). Konnte das sein? Er beschloss, es zu testen.
»Manfred«, verkündete er rundheraus, »die Königin erwartet ein Kind.«
Augenblicklich wurde der Kammerherr so stocksteif, dass er einen Kopf größer erschien. Als er die Totenwaschung für den
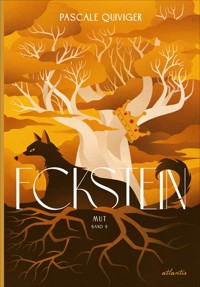

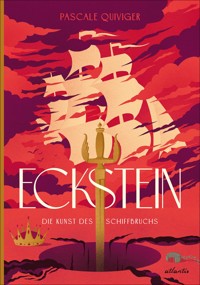













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












