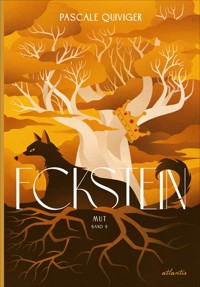
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Kinderbuch
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Königreich Eckstein
- Sprache: Deutsch
König Tibald ist tot. Nach Jahren auf der Flucht und einem unerbittlichen Kampf hat Tibalds Halbbruder Jesko sein Ziel erreicht: Die Krone Ecksteins gehört ihm. Kaum ist das Totengeläut über der Insel verklungen, besteigt Jesko schon den Thron, und er regiert mit eiserner Hand. Das einst so friedliche Königreich ist kaum mehr wiederzuerkennen: Während die Adeligen bei Hofe in Köstlichkeiten schwelgen, darben die Bewohner der Insel. Tibalds Vertraute wollen Ema außerhalb des Königreichs in Sicherheit bringen. Doch Ema will sich nicht geschlagen geben. Schließlich hält die Catastrophe, der verfluchte Wald im Süden der Insel, noch immer ihre Tochter gefangen – und Prinzessin Miriam ist die rechtmäßige Thronfolgerin. Ema ist fest entschlossen, gemeinsam mit Lukas und Lysander nicht nur ihre Tochter zu retten, sondern auch für Frieden und Gerechtigkeit zu kämpfen. Werden sie es schaffen, die letzten Geheimnisse der Catastrophe zu enthüllen und das Königreich aus Jeskos Fängen zu befreien?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 939
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pascale Quiviger
Eckstein
Band 4. Mut
Roman
Aus dem Französischen von Sophia Marzolff
Atlantis
Für meine Eltern, die sich, jeder auf seine Weise, immer für eine bessere Welt eingesetzt haben.
1
Meine schöne Ema.
Wenn Du diesen Brief liest, bist Du am Leben, und ich bin tot.
Ich habe Dir ein glückliches Land versprochen und mein Wort nicht gehalten. Bitte vergib mir.
Manfred hatte Bauchschmerzen. Er verspürte eine Art kaltesBrennen, das er zunächst zu ignorieren versuchte, weil er damit befasst war, die Reinigung des Festsaals zu beaufsichtigen. Die Tische waren schon abgeräumt, die Böcke zusammengeklappt, die Stühle entlang der Wände aufgereiht, der Boden gefegt, gewischt und gebohnert. Die fünfstöckige Hochzeitstorte war samt Zuckerblüten und dem Liebespaar aus Marzipan zurück in die Küche gewandert. Was für ein trostloser Abend. Die Braut an der Schulter ihrer Mutter in Tränen aufgelöst, der Bräutigam verschwunden, die Gäste in alle Winde zerstreut, das Königspaar … Wo war das Königspaar?
Wieder stach es in seinem Bauch. Heiß oder kalt? Leber oder Milz? Manfred zog sich ein wenig in den Hintergrund zurück. Draußen vor dem Fenster tüpfelten große weiße Flocken die dunkle Nacht. Er presste die Hand auf seinen Magen, hörte das Knittern von Papier unter der Livree und begriff, dass ihm nicht der Bauch wehtat – der Brief tat ihm weh.
Und so war Manfred der Erste, der vom Tod des Königs erfuhr.
Im Morgengrauen setzten nicht weit von Mittling ein Flussschiffer und sein Sohn wie jeden Morgen ihren Kahn aufs Wasser. Das Land war schneebedeckt, und über der Konstanzia hingen Nebelschleier. Am Ufer herrschte eine seltsame Stille, und auch der Fluss strömte geräuschlos dahin. Als der Schiffer mit seinem Ruder gegen etwas Festes stieß, glaubte er zunächst, es sei ein Baumstamm. Er drängte ihn zur Seite, um vorbeizufahren.
»Ach du Schreck! Alexander, schau dir das an!«
Es war ein Mensch. Ein Mann, der mit ausgebreiteten Armen bäuchlings im Wasser trieb.
Sie hievten ihn in den Kahn. Der aufgedunsene Tote trug ein prunkvolles Wehrgehänge; seine weit geöffneten Augen zeigten fast kindliches Erstaunen. Dazu das weiße Haar, die lange Narbe, die fuchsförmigen Knöpfe, der feine Stoff des zerrissenen Festanzugs …
»Teufel auch, das ist der König!«
Der König mit einem abgebrochenen Pfeil in der Kehle.
Der Schiffer war kein Dummkopf. Er steuerte den Kahn ans Ufer, ließ seinen Sohn zwischen dem Schilf aussteigen und befahl ihm, nach Hause zu rennen und in sein Bett zu schlüpfen, als wäre er noch gar nicht aufgestanden. Vor allem dürfe er mit keinem über das reden, was er gerade gesehen habe. »Mit keinem, Alexander.«
Dann fuhr er selbst zum nächsten Anlegesteg, an dem schon ein Fuhrmann auf ihn wartete, um mit dem Pferdekarren über den Fluss zu setzen. Statt ihn an Bord zu nehmen, fragte der Schiffer, ob er sein Fuhrwerk von ihm borgen könne.
»Wofür denn?«
»Für ihn.«
Der Fuhrmann blickte auf die Leiche.
»Ach verdammt, der arme Kerl. Also ist er es, nach dem sie suchen …«
Er zeigte auf die undeutlichen Gestalten weiter flussabwärts, die sich im Nebel das Ufer entlangbewegten und dabei immer wieder über die Böschung beugten.
»Ich möchte ihn nach Hause bringen«, sagte der Schiffer.
»Ich komme mit.«
»Besser, du bleibst hier.«
»Es ist aber mein Pferdekarren.«
»Und es ist mein König.«
»Meiner auch.«
»Denk doch mal ein bisschen nach, Fuhrmann. Ein Pfeil! Das ist eine deutliche Handschrift. Am besten du vergisst, was du gesehen hast, und bleibst schön hier.«
»Und mein Fuhrwerk?«
»Warte hier bis Mittag auf mich. Falls ich nicht zurückkomme, nimmst du stattdessen meinen Kahn und verkaufst ihn. Er ist mehr wert als dein Karren.«
Gemeinsam hoben sie die Leiche auf den Wagen, wo sie unter der Plane verborgen blieb. Anschließend setzte sich der Fuhrmann an den Rand des Anlegestegs und ließ die Füße baumeln. Bei näherer Betrachtung hielt er sich lieber aus der Sache heraus. Mit dem heller werdenden Tag lösten sich die Nebelschwaden auf oder waberten weiter, und auch die undeutlichen Figuren unten am Fluss verzogen sich. Der Karren fuhr los.
Die Räder drehten sich ruckelnd, und das alte, schorfbedeckte Pferd schritt nur langsam voran. Der Schiffer war noch nicht weit gekommen, als eine Gestalt aus dem Nebel trat, sich mitten auf die Straße stellte und ihm ein Zeichen machte anzuhalten.
»He, guter Mann! Kommst du vom Fluss?«
»Ja.«
»Und wohin fährst du?«
»Zum Schloss.«
»Was hast du geladen?«
»Eine Fracht.«
Der Unbekannte zeigte sich sehr interessiert. Er war ein gut aussehender junger Mann, der bei all seiner Eleganz einen halbseidenen Eindruck machte.
»Darf ich einen Blick darauf werfen?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, lupfte er die Plane und ließ sie hastig wieder sinken.
»Wer hat ihn sonst noch gesehen?«
»Niemand.«
»Bist du sicher?«
»Ich schwör’s.«
Der junge Mann dachte einen Moment nach. Dann sagte er mit Blick auf das gebrechliche Fuhrwerk und den alten Klepper:
»Könntest du vielleicht ein neues Fuhrwerk gebrauchen?«
»Nicht wirklich …«
»Du kriegst einen nagelneuen Karren, samt Zugtier natürlich, im Tausch gegen deine Fracht. Unter einer Bedingung: Diese Fracht hast du nie gesehen. Haben wir uns verstanden?«
Dem Flussschiffer brach der kalte Schweiß aus. Es passierte genau das, was er befürchtet hatte. Vielleicht hätte er den König im Wasser treiben lassen sollen. Aber … den König! Voller Zweige im Haar und Flussgräsern zwischen den Fingern auf die Meeresmündung zutreibend wie ein simpler Fisch? Das kam gar nicht infrage.
»Haben wir uns verstanden?«, wiederholte der andere.
»Und ob!«, schrie der Schiffer. »Ich habe nicht die leiseste Ahnung, dass der König mit einem Pfeil erschossen wurde, mitten in den Hals, und ich habe auch keinen Schimmer davon, dass sein Bruder der beste Schütze im Königreich ist! Ist es das, was Ihr meint, ja?«
»Du lebst gefährlich, mein Lieber. Aber da du ja ach so ahnungslos bist, lass dir gesagt sein, dass der König ertrunken ist. Dass er durch die Hände seines Vertrauensmannes Willem Schöne umgekommen ist. Und dass man in diesem Moment überall nach dem Täter fahndet. Also, was ist mit dem neuen Fuhrwerk? Haben wir vielleicht unsere Meinung geändert?«
Der Schiffer besaß nichts als seinen alten Flusskahn und sein Ehrgefühl. Das eine konnte er leicht aufgeben, aber nicht das andere. Dass der Unbekannte ihn für einen Fuhrmann hielt, begriff er als seinen Vorteil. So würde man seine Familie weniger leicht aufspüren können.
»Nein, wir haben unsere Meinung nicht geändert.«
»Tja, das ist dann Pech für dich.«
Der junge Mann blickte hinüber zum Ufer. Eigentlich hätte er den anderen Bescheid geben müssen, dass die Suche nun ein Ende hatte, aber es war eine allzu schöne Gelegenheit, um die ganzen Lorbeeren allein einzuheimsen.
»Du erlaubst?«, fragte er, stieg auf den Karren und ergriff die Zügel. »Ich nehme das jetzt in die Hand.«
»Und was gibt Euch das Recht?«
Der brünette Schönling zeigte ihm ein Lächeln, das wegen des blitzenden Metalls in seinem Mund nicht nur befremdlich, sondern vor dem tragischen Hintergrund auch unangemessen war.
»Die Tatsache, dass deine Fracht mein Cousin ist.«
Eine Stunde später saß der Schiffer im improvisierten Kerker des Schlosses und hörte die Glocken vom hohen Turm läuten. Dieselben Glocken waren schon tags zuvor erklungen, als sie jenen falschen Alarm verkündeten, auf den hin Tibald zur Frixelner Grotte geflohen war. Er hatte nicht geahnt, dass der Tod ihn ausgerechnet dort ereilen würde, wo er ihm zu entgehen hoffte. Nun ertönten ein langer Schlag, dann zwei kurze und ein vierter, endloser: Der König ist tot. Anders als am Vortag sprachen die Glocken diesmal die Wahrheit.
Genau auf diese düstere Melodie hatte Jesko jahrelang hingearbeitet. Und beim Klang des ersten Glockentons tauchte er wie aus dem Nichts auf. Niemand kündigte ihn an, niemand sah ihn kommen, aber auf einmal war er da, auf dem Platz vor dem Schloss. Ausgemergelt, mit dichten Bartstoppeln und einer schauderhaften Schulterwunde stieg er ganz allein die monumentale Freitreppe hoch. In einer unbegreiflichen Anwandlung von Demut klopfte er an, damit man ihn einließ, und putzte seine Stiefel ab, bevor er hineinging. So unpompös endete sein langes Warten, als sei er selbst von den Glocken überrascht worden, als hätte er mit der ganzen Tragödie nichts zu tun, als wäre er ohne dieses Geläut für immer fortgeblieben.
Dabei entsprach alles genau seinem Kalkül. Im Wissen, dass er gegen Tibalds Leibgarde allein nicht ankommen würde, hatte Jesko die Konfrontation mit ihr gemieden und stattdessen alles darauf angelegt, sein Zielobjekt zu isolieren, um dieses letzte Hindernis, das zwischen seinem Leben auf der Flucht und seiner unangefochtenen Herrschaft stand, mit einem einzigen Pfeil zu erledigen. Auch als Verbrecher folgte er einem eigentümlichen Ehrenkodex. Als mit der Rückkehr der Isabelle sein eigener Königstraum ein jähes Ende fand, hatte er sich etwas geschworen: Erst wenn er seinen Bruder mit eigenen Händen vernichtet hätte, würde er die Königskrone für sich beanspruchen.
In der Duellnacht hatte er seinen Moment gekommen geglaubt. Und nachdem er aus dem zermürbenden Kampf als Verlierer hervorgegangen war, war seine Entschlossenheit nur noch größer geworden. Mit eigenen Händen, so musste es sein. In den Wochen danach hatte Tibald sich in sein Arbeitszimmer zurückgezogen und darüber gebrütet, wie er Jesko aus seinem Versteck hervorlocken konnte – und Jesko, der sich bei seinem einflussreichen Beschützer verschanzt hatte, dachte über genau dasselbe nach. Mit der Ankündigung von Willem Schönes Hochzeit hatte sich dann schlagartig eine neue Möglichkeit ergeben. Im Festsaal würden alle zusammenkommen: der König und seine Entourage, die Ratsältesten und andere Honoratioren aus den fünf Regionen. Alle führenden Köpfe des Reichs unter ein und demselben Dach – was für eine unverhoffte Gelegenheit! Jesko musste nur noch falsche Festgäste einschleusen und überall auf dem Land seine Gruppen postieren. Es war ein Kinderspiel gewesen, den Sohn des Fechtmeisters, Lanzelot Beinlein, zu bestechen, der für die Ausbildung der Wächter in der Provinz zuständig war. Ohne dass seine Rekruten es ahnten, gehorchten sie den Anweisungen eines Verräters, und Jesko hatte sämtliche Wachtürme unter seiner Kontrolle. Beim verabredeten Signal – dem in Westwalden ausgelösten Glockenalarm – sollte sein Plan in Kraft treten.
Der Westwaldener Notruf würde zwei mögliche Folgen haben: Entweder würde Tibald zum Ort des Notrufs aufbrechen oder er würde mit nur wenigen Wächtern im Festsaal zurückbleiben. Entschied sich Tibald für Ersteres, würde man ihn, sobald er das Schlossgelände verließ, fassen und an Jesko ausliefern. Wegen der beständigen Drohungen gegen Lysander, den Tibald nicht gern allein ließ, war jedoch auch die zweite Option denkbar, die Jesko die liebste war, weshalb er sie sorgfältig vorbereitet hatte. Benedikt würde den König in ein Hinterzimmer locken, und die falschen Gäste würden solange die anderen im Saal festhalten. Wofür Tibald sich auch entschied – der Pfeil würde ihn treffen, unbemerkt und unwiderruflich.
Jesko hatte gewusst, es war seine letzte Chance. Denn um Tibald zu besiegen, musste er notgedrungen aus der Versenkung auftauchen. Tauchte er aber auf, ohne ihn zu besiegen, würde er nicht wieder so einfach verschwinden können, wie er es schon dreimal getan hatte. Der Geheimgang unter dem Nordflügel, die vorgetäuschte Abreise ins Lamottinger Exil, die hohle Felsnische am Kap des Vergessens … Zu oft schon hatte er das Schicksal herausgefordert. Die Hochzeitsfeier würde über sein Geschick bestimmen: Krone oder Kerker.
Doch dann hatte Tibald, als die Glocken ertönten, keine der beiden erwarteten Optionen gewählt. Er war weder dem Notruf gefolgt noch im Saal geblieben. Mit seiner Flucht durch den Geheimgang zur Frixelner Grotte hatte er sämtliche Pläne seines Bruders durchkreuzt und wäre beinahe davongekommen. Es war eine winzige Kleinigkeit, die letztlich sein Todesurteil fällte: Die Natur hatte Benedikt wider Erwarten mit einem Hirn ausgestattet, und zufällig hatte der Kapitän ausgerechnet ihm die Zeichnung anvertraut, die das Versteck des Königs verriet. Benedikt kannte die Grotte, weil er Tibald auf seiner Reise zu Admiral Dorec dorthin begleitet hatte. Er kannte auch den unterirdischen Tunnel, der von der Zisterne abging, da Ovid, der sich schrecklich vor Geistern fürchtete, ihn angefleht hatte, mit ihm zu kommen, als er einen Haufen verdächtiger Dinge (Kleider, Reiseproviant, Decken) dorthin schleppte.
Als Benedikt auffiel, dass der König zusammen mit Ema und Lysander das Fest verließ, hatte er sofort reagiert. Er hatte Jesko, von dem er wusste, dass er sich am Hafen versteckte, eine Nachricht zukommen lassen. In seinem Übereifer beschloss er auch noch auf eigene Faust, den Tunnel zu fluten. Daraufhin war Jesko zum Tunnelausgang in der Schlucht galoppiert, wo er zwar keine Leichen fand, dafür aber eine Blutspur, der Styx’ Nase bis zur Frixelner Grotte folgte. Dort war es dann zu der Konfrontation gekommen, die für ihn – endlich – siegreich ausging.
Allerdings ging Jesko nicht ungeschoren daraus hervor: Tibalds Schwert hatte nur knapp sein Herz verfehlt. Die Klinge war über seinen Rippen ins Muskelfleisch gedrungen und hatte direkt unter seinem Arm einen Nerv durchtrennt. Es waren so grässliche Schmerzen gewesen, dass Jesko die Grotte nicht weiter in Augenschein genommen hatte. Stattdessen war er in Windeseile zum Hafen geritten, wo Doktor Heineken ihn untersuchte, während er selbst Zeter und Mordio schrie. Doch mitten in seinem Gebrüll hatte sich Jeskos Stimmung langsam aufgehellt. Nun brauchte er nur noch einen Leichnam, und all seine Ziele wären erreicht.
Und als der Tag anbrach, in der unwirklichen Stille, die über dem Land lag, wurde sein Wunsch überraschend Wirklichkeit. Der Zufall hatte ihm nicht nur einen Leichnam beschert, sondern auch einen Täter: Willem Schöne, der auf rätselhafte Weise verschwunden war und verschollen blieb. Der Kapitän, ein Königsmörder! Jesko wusste, einen solchen Glückstreffer hatte er gar nicht verdient. Aber er kassierte ihn nur zu gerne ein.
2
Benedikt beging die neue Ära in der Geschichte Ecksteins miteinem himmeldicken Schnupfen. Er hatte die denkwürdige Nacht, die gerade zu Ende gegangen war, gefesselt im Vorratskeller verbracht. Dort auf dem kalten Boden hockend hatte er die Totenglocken läuten gehört, die darauf einsetzende Unruhe in der Küche, die aufgeregte Marthe, die schluchzende Sabina und die Schritte der Küchengehilfen, die von Jeskos Männern grob in Reih und Glied gescheucht wurden. Und er, Benedikt, Dreh- und Angelpunkt der Revolution und zukünftiger Kammerherr, schlotterte in seiner Unterwäsche, und keiner kam auf die Idee, ihn zu befreien. Der Kellermeister entdeckte ihn nur durch Zufall, als er sich einen Wein holen ging, um seinen Kummer zu ersäufen.
Benedikt musste sich erst einmal anziehen und seine Korkenzieherlöckchen glätten, bevor er loszog, um sich dem Prinzen in Erinnerung zu bringen. Er fand ihn nach langem Suchen im Amtszimmer des Schatzkanzlers am Ende eines hell erleuchteten Flurs, während draußen das trübe Tageslicht kaum durch die Wolken drang. Fackeln über Fackeln – es war, als hätte Feuer das ganze Schloss erfasst. Benedikts Schweiß aber war kalt und seine Nebenhöhlen völlig dicht.
Ein Wächter ließ ihn in den kargen Raum, in dem Jesko sich mit einem Mann unterhielt, der von oben bis unten in Samt gekleidet war, einen perfekt gestutzten Ziegenbart trug und mit scharfen kleinen Augen umherblickte.
»Ah, Benedikt«, sagte der Prinz beiläufig. »Dies hier ist Herr von Höll, mein neuer Kanzler. Von Höll, Benedikt.«
Der Ziegenbart lächelte, ohne zu lächeln, der Kammerdiener verneigte sich, der Hund bleckte seine gelben Zähne.
»Hast du das hier gesehen, Benedikt? Diesen Raum? Haha! Ein Blick in das Amtszimmer des Schatzkanzlers, und man weiß über den König Bescheid!«
Mit seinem gesunden Arm machte Jesko eine weit ausholende spöttische Geste, die auch den anderen Kanzler – Tibalds Schatzkanzler – umfasste, der grau und niedergedrückt in einem Winkel kauerte. Er versuchte verzweifelt, den Moment hinauszuzögern, in dem er die Gewölbekammer, wo zahlreiche Schätze aus den Nördlichen Gebieten lagerten, öffnen musste. Dank seiner politischen Neutralität war Eckstein ein beliebter Einlagerungsort für Wertsachen all jener Länder, die wegen ihrer anhaltenden Kriege von Plünderungen bedroht waren. Dafür erhielt das Reich Zahlungen, deren Höhe sich nach dem Wert des jeweiligen Lagerguts bemaß. Diese Zahlungen finanzierten wiederum die Bedürfnisse der Inselbewohner. Tibalds Kanzler ahnte, dass Jesko all die Reichtümer für sich haben wollte und damit ernsthafte diplomatische Verwerfungen riskierte. Kannte der Prinz erst einmal das Geheimnis des Türschlosses, war der Frieden im Reich in Gefahr. Übrigens wurde auch die granatbesetzte Königskrone in der Gewölbekammer aufbewahrt – womöglich wollte Jesko sie sich ohne jedes Zeremoniell einfach aufsetzen.
Bislang stellte der Prinz ihm immer die falsche Frage:
»Wo ist der verdammte Schlüssel?«
»Ich weiß es nicht, Hoheit«, antwortete der Kanzler wahrheitsgemäß.
Und jedes Mal näherte Jesko sein Gesicht der dreifachen Tür mit den Eisenbeschlägen.
»Ich kann nicht mal ein Schlüsselloch finden!«
»Ich auch nicht, Hoheit.«
In der Tat war das Schlüsselloch nicht zu sehen. Tibald hatte sich den komplizierten Mechanismus der Tür mit großem Vergnügen und Erfindergeist ausgedacht: Inmitten der üppigen Holzschnitzereien befand sich ein blühender Kirschbaum, unter dem eine Schäferin ihre mollige Herde herzte. Drückte man den Rand ihrer Haube ein, verschob sich ihre Quaste und gab eine Kurbel frei. Wenn man die Kurbel nach unten drehte, bewegte sich das dickste Schaf zur Seite und gab wiederum das Schlüsselloch frei. Ein Schlüsselloch war jedoch bedeutungslos ohne einen Schlüssel, und dafür musste man auf einen anderen Gegenstand zurückgreifen, der sich in einem anderen Raum befand, in einem Versteck, das nur der Monarch und sein direkter Nachfolger kannten: das königliche Zepter. Schraubte man nämlich den Fuchskopf aus Jade am oberen Ende des Ebenholzstabs ab, kam der Schlüssel zum Vorschein.
Das war aber noch nicht alles: Verließ man die Gewölbekammer, musste man den Schlüssel dreimal umdrehen, und ein unter dem Rock der Schäferin verborgenes Zählwerk zählte die Schließvorgänge mit. Bei der Zahl hundert blockierte sich das Schloss. In der angespannten Lage kurz vor der Hochzeitsfeier hatte Tibald seinem Schatzkanzler befohlen: »Öffnet und schließt die Tür so oft, bis Ihr bei hundert angelangt seid. Bleibt aber bloß nicht drinnen, sonst verpasst Ihr das Festessen.« Um in der Folge die Tür zu öffnen, musste man das Zählwerk wieder auf null stellen, indem man das Auge des kleinsten Schafs mithilfe einer Nadel oder eines Zahnstochers eindrückte.
Der ehemalige Kanzler zerbrach sich den Kopf darüber, wie er nun vorgehen sollte, und Nadel oder Zahnstocher waren dabei das geringste Problem. Jesko wusste zwar, wo sich das Zepter befand, weil sein Vater es ihm kurz vor seinem Tod offenbart hatte, er wusste jedoch nicht, dass es sich dabei um den Schlüssel handelte. Der Schatzkanzler wiederum wusste, dass es sich um den Schlüssel handelte, aber nicht, wo sich das Zepter befand. Der arme Mann zitterte, seine Nasenspitze war ganz weiß, und seine dunkel umringten Augen irrten ängstlich umher. Styx geiferte schon auf seine Schuhe, und Jesko war kurz davor, ihn zu würgen. Die Ankunft des verschnupften Benedikt verschaffte ihm einen kleinen Aufschub.
»Also, Benedikt, was willst du?«, blaffte der Prinz in seiner Frustration.
Benedikt wurde steif wie ein Stock. Statt des triumphalen Empfangs, den er sich erwartet hatte, erntete er nur ein Blaffen? Es war traurig, aber wahr: Jesko mochte ihm zwar den Thron verdanken, zeigte ihm aber dennoch keinen Respekt. Nichtsdestotrotz näselte Benedikt durch seine verstopften Nebenhöhlen den für diesen Anlass vorbereiteten Satz:
»Guder Brinz, ich gomme, mich Eurer Bachd zu beugen und, wenn Ihr es wünschd, Eure Befehle endgegenzunehmen.«
Wo er schon dabei war, hätte er gerne auch vorgeschlagen, einem so edlen Antlitz die Bartstoppeln wegzurasieren, aber er war klug genug, es zu unterlassen.
»Du hast freie Hand, Kammerherr«, antwortete Jesko, um ihn loszuwerden. »Fang am besten mit der Aufbahrung des Toten an.«
Aufbahrung? Oha! Kammerherr? Na, wer hätte das gedacht! Das bedeutete Verantwortung für das königliche Gemach und (warum nicht?) für das gesamte Personal! Benedikt eilte zum Bedienstetentrakt. Bevor er sich Tibalds Aufbahrung widmen würde, musste er selbst noch jemanden entthronen. Und kurz darauf händigte Manfred ihm auch schon den allmächtigen Schlüsselbund aus und fand sich seinerseits gefesselt zwischen Einmachgläsern wieder. Dieselbe Vorratskammer, dasselbe Seil und quasi die gleiche Unterwäsche – doch Manfred ertrug seine Erniedrigung mit Eleganz und ohne den kleinsten Tropfen an der Nase.
Nach außen hin ließ er sich nichts anmerken. Doch in seinem Innern wütete und gärte es. Er, der sich zeit seines Lebens an Regeln und Konventionen gehalten hatte, fühlte mit einem Mal eine heftige Rebellion in sich aufsteigen. Ja, es war beschlossene Sache: Künftig würde er nur noch seinen eigenen Gesetzen folgen. Und wie es seine Art war, würde er auch im Ungehorsam nur höchste Standards gelten lassen (Diskretion, Konsequenz, Präzision). Im Grunde hatte er mit seinem Ungehorsam schon am vergangenen Abend begonnen, als er sich von Karl einen kompletten Schwung Schlüssel für alle Schlossräume nachmachen ließ und sie hinter dem alten Parkwächterhäuschen im Boden vergrub. Im Übrigen war er davon überzeugt, dass Benedikt sich letzten Endes seiner Autorität beugen würde, ohne es überhaupt zu merken. Der Idiot würde noch bei ihm antanzen und ihn bei seinen anspruchsvollen Aufgaben um Hilfe anflehen, würde ihn fragen, wie der oder die Bedienstete hieß, welcher Schlüssel zu welcher Tür gehörte und so fort. Manfred wartete nur darauf.
Er musste nicht lange warten. Es waren noch keine zehn Minuten vergangen, da klopfte Benedikt an die Tür der Vorratskammer, als würde er bei einem Privatgemach Einlass erbitten.
»Herein.«
»Die Drauergerzen, Banfred, wo hasd du die undergebrachd?«
»Du musst delegieren, Benedikt«, antwortete Manfred seelenruhig, während der kalte Luftzug ihm die Härchen aufrichtete. »Jemand anderes soll sich um das Zimmer der Totenwache kümmern.«
»Gommd nichd infrage. Also, wo sind die Drauergerzen?«
»In der Kerzenkiste hinten im Zimmer der Totenwache, wo auch die Sargtücher liegen.«
Benedikt knallte die Tür zu. Eine Viertelstunde später tauchte er wieder auf.
»Welches Grawaddenduch für den Doden?«
»Der Tote hat nie ein Krawattentuch getragen.«
»Und Rüschengragen?«
»Der Tote hasste Rüschenkragen.«
»Aha. Und was für Bünzen legd ban ihm auf die Augenlider?«
»Seine Augen sind geöffnet?«
»Jabohl.«
Manfred hätte zu gerne gewusst, welchen Ausdruck Tibalds Augen hatten. Er hätte zu gern seinen Leichnam gesehen, ihn mit aller Ehrfurcht gewaschen, angekleidet, ihm Respekt gezollt, wie er es vor noch nicht langer Zeit mit Alberich und Clemens gemacht hatte. Zu gerne hätte er sich von ihm verabschiedet, als Kammerherr und auch als Freund.
»Die schwersten Münzen«, antwortete er nur.
Benedikt warf die Tür zu. Eine halbe Stunde später:
»Wer isd für die Drauerfeier zusdändig?«
»Derselbe Priester wie bei der Hochzeit gestern.«
»Und welchen Schneider beaufdrage ich mid der Garderobe des Brinzen?«
»Huber.«
»Huber vom Hafen?«
»Genau.«
»Wirklich?«
»Er ist der Beste.«
Er war der Schlechteste.
So verging der halbe Vormittag. In seiner Unterwäsche zwischen Eingemachtem sitzend orchestrierte Manfred immer noch alle Dienertätigkeiten. Im Lauf von wenigen Stunden sorgte er mit Unschuldsmiene dafür, dass der Prinz von den größten Dumpfbacken des Personals bedient wurde. Seine Speisen würden ihm kalt serviert werden, sein Kaminfeuer sofort ausgehen, seine Öllampen würden rußen, seine Löschwiege voller Tintenkleckse sein. Wenn alles seinen rechten Gang ging, würde Jesko zu kurze Hosen, zu lange Hemden und schlecht gewichste Stiefel mit lockeren Sohlen tragen. Benedikt, der sich nie für seine Kollegen interessiert hatte, kannte weder ihr jeweiliges Temperament noch ihre Fähigkeiten. Er würde nicht einmal merken, dass er Jesko keinen Ehrendienst, sondern einen Bärendienst erwies.
Was er immerhin bemerkte, war, dass die Küchenleute ihn nicht ernst nahmen, wenn er in den Vorratskeller hinunterstieg. Marthe schrie ihm nach, er solle Gewürzgürkchen mitbringen, Sabina verlangte Steckrüben. Kurz: Es mangelte ihm eindeutig an einer gewissen Brillanz, und aus diesem Grund wurde Manfred bereits um ein Uhr mittags von ihm im großen Speisesaal als »Berater« postiert.
3
Schon den ganzen Tag hüllte die Natur sich in tiefes Schweigen.Reiner weißer Schnee hellte den Erdboden auf, und am Himmel schimmerten seltsame grüne Lichtreflexe. Es ging nicht der geringste Windhauch. Nur die Wipfel der Catastrophe schwangen leicht hin und her, als wollte der Wald das kleine Mädchen wiegen, das seinen Vater niemals kennenlernen würde.
Ema befand sich in ihrem weißen Boudoir und lief unruhig auf und ab. Jeskos Männer hatten sie mitten in der Nacht aufs Schloss zurückgeholt, ohne ein Wort über Tibald zu verlieren. Nach seinem Sturz in den Wasserfall war sie ihm hinterhergesprungen, und Lysander mit ihr. Unten hatten die kalten Wasserwirbel sie von einem Becken ins nächste geschwemmt, bis sie zu der Stelle getrieben wurden, wo die Konstanzia in sanften Windungen zwischen grasbestandenen Ufern dahinfloss. Lysander hatte mit klappernden Zähnen nach Tibald Ausschau gehalten – vergeblich. Sie konnten ihn beide nicht sehen, weil er ein Stück hinter ihnen an einer Wurzel festhing, so lange, bis irgendwann sein Anzugärmel in der Strömung zerreißen sollte. Auch vom Kapitän war nichts zu sehen gewesen. Ob er ebenfalls gesprungen war? Lysander und Ema durften jedoch keine Zeit verlieren und flohen durch die Wiesen Richtung Frixeln. Als man sie auf dem Berghang fasste, hatten die Königin und der Junge nur noch einen Blick miteinander gewechselt, der in der weltweiten Sprache der Waisen bedeutete: Wir sind niemand mehr.
Und nun tigerte Ema in ihrem Boudoir hin und her, wie Tibald es selbst getan hätte. Sie hatte eine lange Schnittwunde an der Wade, die sie sich mit Felix’ Degen zugezogen hatte, doch Gehen war die beste Art, sich aufrecht zu halten. Von Zeit zu Zeit warf sie einen Holzscheit in den Kamin und bedachte Tibald in den aufstiebenden Funken mit den wildesten Verwünschungen.
Er hatte nicht das Recht, sie auf seiner verfluchten Insel, in seinem verkommenen Reich allein zu lassen!
Vor der Tür waren Wachen postiert. Ema ertrug es nicht, dass man sie gefangen hielt. Sie spürte, wie sich mit aller Macht ihr alter Fluchtinstinkt in ihr regte. Ihm verdankte sie ihre Freiheit. Fliehen, fliehen, fliehen, an nichts anderes konnte sie denken. Aber wohin? Und wie?
Sie warf soeben einen neuen Holzscheit ins Feuer, der gehörig Qualm verursachte, als eine Bäuerin im Boudoir erschien, ihr mit plumpen roten Händen ein Abendessen hinstellte und ihr riet, sich in Schwarz zu kleiden. Die Schüssel war gut gefüllt und roch appetitanregend. Zuerst wollte Ema das Essen nicht anrühren, aber dann besann sie sich anders. Sie musste stark bleiben. Es kam nun auf ihren Mut an. Der Mut saß im Herzen und im Geist; und Herz und Geist brauchten einen Körper. Also aß sie ein Ei. Reflexhaft versteckte sie etwas Brot, Käse und Hühnchen in einem Unterrock. Sie sammelte bereits Fluchtproviant.
Dann wühlte sie im Kleiderschrank. Schwarz? Nein. Leuchtend rot. Die Farbe ihrer Landgänge aus der Zeit der Isabelle. Ema suchte nach ihren Handschuhen, Armreifen oder Seidenbändern, doch man hatte ihr alles weggenommen, womit sie ihre Narben hätte bedecken können. Es spielte auch keine Rolle mehr, da mit dem König zugleich die Königin gestorben war. Als sie in den Spiegel blickte, erkannte sie in dem wilden, trotzigen und misstrauischen Gesicht kaum sich selbst. Und doch war sie es. Dasselbe Gesicht hatte sie gehabt, bevor sie zu Tibald Vertrauen fasste. Die Vergangenheit holte die Gegenwart ein und gab einen Ausblick auf die Zukunft. Ema kehrte in die Einsamkeit zurück, aus der sie gekommen war und die Tibald nur vorübergehend gefüllt hatte.
Ein Wächter in rübenroter Uniform klopfte an die Tür.
»Ich soll Euch zum Zimmer der Totenwache begleiten«, erklärte er und machte eine Bewegung, die irgendetwas zwischen einer Verbeugung und Hackenschlagen war.
Ema blieb das Herz stehen. Wenn es eine Totenwache gab, dann gab es auch einen Toten. Sie folgte dem Wächter durch die verlassenen Flure. Sie würde erst an Tibalds Tod glauben, wenn sie ihn mit eigenen Händen berührt hatte, doch schon jetzt fingen ihre Beine an zu zittern. Die Rote Rübe begleitete sie mit dem Hut in der Hand in den dunklen Raum. Auf dem Bett zwischen den flackernden Kerzen lag eine undeutliche Gestalt, und diese Gestalt war Tibald. Ema trat näher, ohne etwas zu fühlen. Er sah gar nicht aus wie er, mit den Münzen auf den Augenlidern und dem perfekt frisierten Haar. Er trug eine bis zum Hals geknöpfte Weste, ein Krawattentuch um die Kehle und die engen Schuhe, die er hasste.
»Geh hinaus«, sagte sie zu dem Wächter.
»Mir wurde befohlen zu bleiben.«
»Geh hinaus, sage ich.«
»Mir wurde befohlen zu bleiben.«
»Kennst du noch andere Wörter? Kannst du selber denken?« Sie stieß ihn zur Tür. »Geh schon, lass mich allein!«
»Ich habe den Befehl bekommen zu bl…«
»Von wem? Wer hat es dir befohlen? Wer gibt hier die Befehle?« Sie zeigte auf Tibald, der in der ganzen Aufregung absurd regungslos blieb. »Er ist dein König! Seine Leiche ist noch nicht erkaltet, und du nimmst schon Befehle von jemand anderem entgegen? Hinaus mit dir! RAUS, SAGEICH! SOFORT!«
Der verdatterte Wächter wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Im Grunde hatte sie ja recht. Warum sollte er nicht ihr gehorchen? Noch vor einem Tag hatte man sie »Durchlaucht« oder »Hoheit« genannt, hatte sich vor ihr verneigt, in ihrer Nähe respektvoll geschwiegen. Warum sollte er jemand anderem gehorchen? Nun ja, weil er Angst hatte, wie alle anderen auch.
»Geh! Sonst schlage ich das Fenster ein, zertrümmere die Tür und schreie um Hilfe.«
Der Wächter knetete seinen Federhut in den Händen. Ema griff nach einer Trauerkerze, um sie nach ihm zu schleudern, als Jesko zur Tür hereinkam, gefolgt von Styx.
»Mein Beileid«, sagte er mit seiner heiseren, tiefen Stimme so ruhig, dass es aufrichtig klang.
Die Kerze flog auf ihn zu. Er fing sie mit seiner behandschuhten Hand ab und nickte mit dem Kinn zu dem aufgebahrten Toten hinüber.
»Du willst allein mit ihm bleiben?«
Ema gab keine Antwort. Hier spazierte der Landesfeind Nummer eins seelenruhig im Schloss umher, als wenn nichts wäre. Wo waren die anderen, wo waren sie alle? Was war aus dem so gut organisierten Verteidigungssystem geworden? Hatte die Welt sich binnen weniger Stunden um hundertachtzig Grad gedreht?
»Willst du allein mit ihm bleiben?«, fragte Jesko noch einmal.
Ema musterte ihn stumm. Trotz der großen Müdigkeit, die sich auf seinem schönen Gesicht abzeichnete, strahlte er eine unbeugsame Kraft und ein natürliches Selbstbewusstsein aus, wie ein Gewitter im August oder ein Schneesturm im Dezember.
»Ich gebe dir zwei Minuten. Anschließend kommen die Trauergäste«, sagte Jesko und drückte ihr die Kerze in die Hand. »Nur wenige ausgewählte Besucher. Es ist ein so trostloser Anblick, den ich möglichst allen ersparen will.«
Aber was war mit den vielen Untertanen, die Tibald die letzte Ehre erweisen wollten? Ema wollte zum Protest ansetzen, doch Jesko schnitt ihr das Wort ab:
»Du siehst ja, dass die Kerzen schon niederbrennen. Zwei Minuten.«
Der Tradition nach dauerte eine Totenwache so lange, wie die Trauerkerzen brannten, doch diese hier schienen auf ein Viertel gekürzt zu sein, und die Flammen ließen das Wachs im Nu hinunterschmelzen. Der Prinz ging hinaus und schubste den Wächter vor sich her. Noch durch die massive Holztür hörte Ema, wie er ihn einen Dummkopf schimpfte.
Die zwei Minuten verbrachte Ema damit, Tibalds Hand zu halten, seine Stirn zu streicheln und sie zu küssen. Sie brachte seine Frisur in Unordnung, indem sie sanft an seinen Haaren zupfte, wie er es mochte. Und die ganze Zeit wunderte sie sich darüber, dass er nicht aufwachte, sich die Weste aufknöpfte und rief: »Menschenskind, habe ich einen Hunger. Wer hat mir denn diesen Krawattenlappen verpasst? Und diese Schuhe …« In der vergangenen Nacht in der Grotte war es stockdunkel und der Wasserfall so laut gewesen. Tibald hatte noch nach ihrer Hand gegriffen, bevor er vom Schwall mitgerissen wurde. Was war passiert? Wie war er genau zu Tode gekommen?
Die Trauerkerzen sollten nicht mehr lange brennen. Noch am selben Nachmittag warf Ema die erste Handvoll Erde in die Friedhofsgrube. Sie hörte sie dumpf auf den Sarg fallen und blieb über das große Loch gebeugt stehen, eine rot gekleidete Schwarze unter schwarz gekleideten Weißen. Elisabeth, die immer noch ihren Brautschleier trug, trat zu ihr. Sie hob ebenfalls eine Handvoll Erde auf und umklammerte sie wie einen ganzen Kontinent. Dann folgte eine Reihe von Gestalten, die nacheinander an den beiden auf ihre jeweils eigene Art verwitweten Frauen vorüberzogen. Wer von diesen Figuren hatte an Tibalds Untergang mitgewirkt? Wer empfand aufrichtige Trauer? Trotz der von Jesko angeordneten Besucherbeschränkung quoll die Menschenmenge weit über den Friedhof hinaus, zog sich als Warteschlange bis in den Park der Damhirsche, zum Kapellenwäldchen und weiter in den Schlosspark, wo sie den Steingarten zertrampelte. Die Trauernden waren so zahlreich, dass der Totengräber gar nicht seine Schaufel benötigen würde, um die Grube aufzufüllen. Doch Ema nahm niemanden von all den Menschen wahr, nicht einmal Lukas und Madeleine. Beide sagten etwas zu ihr, aber sie war wie betäubt vom dröhnenden Lärm des Hasensprungfalls, von den gewaltigen Wassermassen, die in eine endlose Tiefe stürzten. Nur Lysander konnte ihren Blick einfangen.
Man hatte ihn seit letzter Nacht von ihr ferngehalten, weshalb er ausgiebig Zeit zum Nachdenken gehabt hatte. Da waren zum einen der Tod, zum anderen die Ewigkeit. Lysanders Großmutter hatte seinen Großvater nie wirklich verlassen; und so würde auch Tibald sich nicht von Ema lösen. Wegen ihrer besonderen Verbindung konnte er nicht ganz und gar sterben, solange sie am Leben war. Ganz bestimmt war Tibald bei seiner eigenen Beerdigung zugegen, unsichtbar zwar, aber zugegen.
»Es ist nicht das Ende. Er ist nicht weg«, versicherte Lysander Ema, aber sie reagierte nicht darauf.
Plötzlich drängte ihn jemand zur Seite, um einen Weg für Jesko zu bahnen. Der Prinz trat als Letzter an die Grube und blieb eine ganze Weile dort stehen, um feierlich das Ende seines Bruders auszukosten, des einzigen Ecksteiner Herrschers, dessen Abbild keine Münze zierte, von dem weder eine Büste noch ein Porträt noch irgendein repräsentatives Gebäude blieb, ganz zu schweigen von einer Nachkommenschaft, die ihm auf den Thron folgen konnte. Tibalds einziges Vermächtnis war die Zuschüttung der unterirdischen Gänge, ein Werk der Vernichtung, eine Rücknahme. Nach der kürzesten Regentschaft aller Zeiten verschwand er ohne ein eigenes Gesicht.
Dieser Gedanke hätte Jesko normalerweise ein Grinsen entlockt, aber etwas hatte ihm die Freude verdorben. Vorhin, als er im Zimmer der Totenwache allein mit dem Leichnam geblieben war, hatte er so eine Kälte in seinem Nacken verspürt, als wollte ihn etwas von hinten angreifen. Daraufhin war etwas Unerklärliches passiert, das er zu vergessen versuchte und niemandem je erzählen würde, von dem er jedoch seltsamerweise eine Erinnerung in seiner Hosentasche trug. Tibald hatte … etwas gemacht. In gewissem Sinne. Auf seine Art und Weise. Er hatte gehandelt, sofern eine Leiche handeln konnte. Und in Reaktion darauf hatte sich etwas lang Verschüttetes in Jesko zu rühren begonnen, etwas zugleich Harmloses und Gefährliches, das es schleunigst wieder in die Versenkung zu schicken galt. Aber hier auf dem Friedhof war das schwierig. Die metallische Kälte streifte ihn wieder im Nacken wie die Klinge eines Schwerts. Jesko war so angespannt, dass ihn der geringste Windstoß in die Grube zu werfen drohte. Über ihm flackerte der Himmel mit seinen grünlichen Lichtstreifen, als würde die ganze Insel ins Schlingern geraten. Jesko hatte Sidra in Verdacht, dass sie zu Tibalds Ehren das Nordlicht hervorgerufen hatte; sie war dazu fähig. Die Vorstellung erbitterte ihn. Zum Glück bat der Priester ihn nun, die Zeremonie zu beschließen, und Viktoria, die das allgemeine Geschluchze leid war, zog ihn zum Friedhofstor.
Ema ging hinter den anderen her durch die schiefen Grabreihen. Sie fühlte nicht den nassen Schnee an ihren Knöcheln, nicht das Gewicht ihrer Beine, nicht die Schwere des aufziehenden Abends. Sie bemerkte das Nordlicht nicht. Jemand nahm vorsichtig ihre kalte Hand und schob mit größter Diskretion einen blauen Umschlag zwischen ihre Finger. Sie blickte nicht einmal auf, um nachzusehen, wer es war. Als sie sich dem Friedhofstor näherte, verlangsamte sie ihre Schritte. Wie sollte sie diesen Ort verlassen, wo Tibald doch hierblieb? Ema wollte wieder zurückgehen, doch die vielen Menschen drängten sie in Richtung Park – sie hatten es eilig, ihre Leben wiederaufzunehmen, die doch nie mehr dieselben sein würden.
Während die Menge sich langsam zerstreute, begannen auf einmal die Glocken vom hohen Turm zu läuten, und nach und nach antworteten ihnen die Glocken rund um die Insel. Die Glöckner wählten freie Melodien und veranstalteten ein wildes Getöse. Man konnte unmöglich sagen, ob es sich um einen medizinischen Notfall handelte, um eine Feuersbrunst, eine Taufe, eine Beerdigung oder alles zusammen. Noch unklarer war, ob es echte oder falsche Anlässe waren. Sicher war jedoch, dass großer Schmerz darin schwang.
Jesko versuchte vergeblich, die Glocken zum Schweigen zu bringen. Als diese zwei Stunden später nach und nach verklangen, trug der Wind immer noch die Töne aus Frixeln herüber, wo die Glocken die ganze Nacht lang läuteten.
4
Meine schöne Ema.
Wenn Du diesen Brief liest, bist Du am Leben, und ich bin tot.
Ich habe Dir ein glückliches Land versprochen und mein Wort nicht gehalten. Bitte vergib mir.
Bleibe frei. Lebe Dein ganzes Leben.
Wenn es in meiner Macht steht, werde ich Dich begleiten.
Andernfalls warte ich auf Dich.
So oder so liebe ich Dich.
Tibald
Ema zerknüllte den Brief, den Manfred ihr am Friedhofstorheimlich in die Hand gedrückt hatte, und pfefferte ihn auf den Teppich. Dann hob sie ihn auf und faltete ihn wieder auseinander. Sie glättete ihn, küsste ihn, las ihn noch einmal, faltete ihn sorgfältig zusammen und versteckte ihn in ihrer Bluse. Danach tat sie mehrere Stunden gar nichts, spürte nur das Papier, wie es sich im Rhythmus ihrer Atemzüge hob und senkte.
Abends brachte die Bäuerin ihr wieder einen Servierwagen voll üppiger Speisen. Ema aß nur wenig und bewahrte die besten Stücke für ihren Reiseproviant auf. Sie machte sich Vorwürfe, dass sie in der vorletzten Nacht, nachdem der Sternenhimmel erloschen war, nur geschlafen hatte. Hätte sie gewusst, dass Tibalds Tod so nah bevorstand, hätte sie noch seine Wärme genossen und seinem Herzschlag gelauscht. Nun war es zu spät.
Der Servierwagen wurde wieder abgeholt, und vor der Tür wechselten sich die Roten Rüben ab. Ema zog sich langsam aus. In dem großen weißen Bett würde sie ihre Einsamkeit stärker spüren als irgendwo sonst. Sie legte den Brief auf das Kopfkissen und schmiegte ihre Wange daran. Der Wasserfall dröhnte ihr in den Ohren. Sie sprang von hoch oben. Fiel tief. Ema tauchte in einen traumlosen Schlaf.
Spät in der Nacht erwachte sie in der plötzlichen Überzeugung, dass jemand im Zimmer war. Die Nachtlämpchen am Bett waren erloschen, sie konnte nichts sehen. Abgesehen von dem Wasserfall in ihrem Kopf konnte sie auch nichts hören. Nach einer Weile drang jedoch ein Geräusch von nebenan zu ihr, aus dem Zimmer der Wachen. Fünf Klopftöne. Wer konnte das geheime Signal verwenden? Simon und Ovid waren tot. Wieder erklangen fünf Klopftöne. Wer …?
Es konnte nur jener Leibwächter sein, der keiner mehr war und nur deshalb noch lebte. Ema antwortete mit ihrer Faust. Wieder ertönte das Klopfen, etwas weiter weg an der Wand. Ema stieg aus dem Bett, um ihm nachzugehen. Die Klopftöne wanderten weiter, bis sie schließlich an der Außenwand ertönten. Lukas wartete draußen auf sie.
Ema nahm ihre Bettdecke mit hinaus und sicherheitshalber auch gleich ihr Proviantbündel. Wenigstens in ihrem Gärtchen hatte sich nichts verändert. Da waren immer noch der rostige Tisch und die wackeligen Stühle, die Kletterpflanzen und die schlafenden Blumenzwiebeln. Ema setzte sich auf den Boden und lehnte ihren Kopf an das raue Holz des hohen Bretterzauns, genau wie Lukas auf der anderen Seite.
»Bist du jetzt wieder Leibwächter?«, flüsterte sie.
»Ein bisschen.«
»Wie bist du in das Zimmer gelangt?«
»Ich habe das Fenster eingeschlagen. Es wird ihnen erst morgen früh auffallen.«
»Lassen sie dich denn aus dem Schloss hinaus? Mich nicht. Wirst du bewacht?«
»Jeder wird von irgendjemandem bewacht. Aber im Augenblick kann ich nach draußen, ja.«
»Bewachen sie auch meinen Garten?«
»Nein. Sie glauben nicht, dass du über die Mauer klettern kannst.«
»Da täuschen sie sich.«
»Ich weiß.«
Lukas verstummte. Seit Tibalds Beerdigung erschienen ihm alle Worte absurd. Nach einer Weile sprach er weiter:
»Was ist gestern Nacht passiert, Ema?«
»Ich weiß nicht. Es war so dunkel dort … Tibald ist in den Wasserfall gestürzt. Ich bin ihm hinterhergesprungen, aber … nichts. Er war einfach weg.«
Schritte knirschten über einen Pfad. Jesko, der einen Anschlag fürchtete, hatte nächtliche Kontrollgänge veranlasst. Lukas kauerte sich in seinen Winkel. Die Patrouille ging vorüber, ohne ihn zu sehen.
»Hast du etwas gegessen?«, fragte Ema, als die Schritte verklungen waren.
»Nein. Und du?«
»Sie mästen mich wie eine Gans. Hier, nimm.«
Sie warf ihr Bündel über den Bretterzaun, und es landete direkt auf Lukas’ Kopf.
»Ein Unterrock? So was habe ich mir immer schon gewünscht.«
»Schweig und iss.«
Lukas zog einen Honigkrapfen heraus. Der so intensive, einzigartige Geschmack des Kastanienhonigs beschwor ihm eine andere Welt herauf als die, in der er an diesem Morgen erwacht war. Solche Köstlichkeiten waren verdächtig. Normalerweise mästete man Gefangene nicht … Aber er dachte nicht weiter darüber nach, schließlich war er aus einem ganz bestimmten Grund hergekommen.
»Weißt du, Ema, am Abend des Duells … Da musste ich Tibald etwas versprechen. Für den Fall, dass er nicht mehr zurückkommt.«
»Diesmal kommt er nicht mehr zurück.«
»Nein, ich weiß.«
»Und?«
»Er wollte, dass ich dich nach Basilis bringe.«
»Nach Basilis? Aber wie?«
»Ich habe Felix’ Bruder kontaktiert, Bugspriet. Er fährt immer noch als Rudergänger zur See. Er kann dich im Morgengrauen auf die Fregatte schmuggeln, die König Immanuel die Todesmeldung überbringt.«
Ema lächelte traurig. Das musste die Fregatte sein, die Tibald hatte segelfertig machen lassen, um ihr und Lysander im Notfall die Flucht zu ermöglichen.
»Bugspriet … Weiß er von Felix?«
»Was sollte er wissen?«
»Felix ist tot. Auch Ovid. Und Simon.«
Von Lukas’ Seite war kein Laut mehr zu hören. Tibalds Tod hatte alle anderen Tode überlagert, und Jesko würde sich hüten, sie publik zu machen. Wahrscheinlich hatte er das kläglich wenige, was von den treuen Wächtern übrig geblieben war, verschwinden lassen.
Ema klopfte fünfmal leise. »Bist du noch da?«
»Ja.«
»Was haben sie mit Lysander gemacht?«
»Auch er wird bewacht. Sie halten ihn für einen Augenzeugen, der ihnen gefährlich werden könnte.«
Ema vergrub ihr Kinn in ihrer Bettdecke. Genau wie sie hatte Lysander Styx’ Bellen gehört, hatte Bewegungen wahrgenommen und wie Tibald zum Wasserfall getaumelt war. Mehr nicht.
»Es gibt keine Augenzeugen, Lukas. Niemand weiß, was genau passiert ist. Höchstens vielleicht der Kapitän …«
»Er ist unauffindbar.«
Ema stieß einen tiefen Seufzer aus.
»Mit Lysander habe ich schon gesprochen«, fuhr Lukas fort. »Er hat einen epileptischen Anfall vorgetäuscht, mit Schaum vor dem Mund und allem. Er meinte, wenn du nach Basilis willst, kommt er mit.«
»Und du, kommst du auch mit?«
»Ich bringe euch dorthin. Und gebe euch mein restliches Geld. Es ist nicht viel, aber besser als nichts. Dann komme ich wieder her. Ich kann nicht tatenlos dabei zusehen, wie Eckstein untergeht.«
Erneut näherte sich die Patrouille. Diesmal sah Lukas dabei auch Esmee. Sie begleitete zwei Rote Rüben, die wie Hähne dahinstolzierten und sich die Schnurrbärte glätteten. Seit die Botin ihren Zopf abgeschnitten hatte, stand ihr Haar im Nacken struppig ab, und sie strich sich fortwährend die zu kurzen Strähnen hinters Ohr. Ganz offensichtlich spielte sie ihre Rolle weiter. Die Rolle der Seitenwechslerin, die ihre Freunde und den König verraten hatte. Was erhoffte sie sich davon? An Jeskos Sturz mitzuwirken? Oder schlicht und einfach zu überleben? Als besäße sie einen sechsten Sinn, wandte Esmee plötzlich ihren Kopf in Lukas’ Richtung. Sie blinzelte durch die Dunkelheit, riss dann die Augen auf und lenkte schnell die Aufmerksamkeit der Wächter auf das Nordlicht. Die Blicke zum Himmel gerichtet, verschwanden die drei um die Ecke des Südflügels.
»Weg sind sie.«
»Wer war das?«
»Niemand.«
Ema befiel eine große Ratlosigkeit. Sie wusste nicht, was sie mit Lukas’ Angebot anfangen sollte. Natürlich wollte sie von hier weg. Den ganzen Tag hatte sie an nichts anderes gedacht. Doch nun, da sich eine Gelegenheit bot, hielt etwas Schmerzliches sie zurück. Sie hüllte die Decke enger um sich.
»Hör zu, Lukas … Ich danke dir, dass du dein Versprechen wahrmachen willst. Und ich bin so dankbar für …«
Ihre Stimme versagte.
»Wofür?«
»Für alles. Für deine Freundschaft.«
»Das klingt, als wolltest du dich von mir verabschieden.«
»Im Gegenteil. Ich kann nicht von hier weg.«
»Du kannst aber auch nicht bleiben, Ema, es ist zu gefährlich.«
»Ich kann vielleicht nicht auf dem Schloss bleiben, aber auf der Insel. Solange Miriam hier ist, bleibe ich auch.«
Lukas wurde ganz mutlos. Ema ging aus Liebe zu ihrem verschwundenen Kind ein großes Risiko ein, aber er wusste, wenn sie einmal etwas beschlossen hatte, war es unmöglich, sie umzustimmen. Er nahm sich vor, sein Versprechen auf andere Weise einzulösen, auch ohne Reise nach Basilis. Nur jetzt durfte er keine Zeit verlieren.
»Ich komme wieder«, flüsterte er und knotete das Proviantbündel zu.
Noch lange nachdem Lukas weg war, blieb Ema im Blumenbeet sitzen. Sie hoffte, ein Eichhörnchen würde ihr eine Nuss bringen, so wie damals, als Clemens ihr nach seinem Tod erschien. Sie wünschte sich so sehr irgendein Zeichen von Tibald. Eine Iris in ungewöhnlicher Jahreszeit, ein dem Park entlaufener Damhirsch – jeglicher Wink aus dem Jenseits würde ihr willkommen sein. Aber nichts passierte. Sie schwankte, ob sie ihn noch inständiger herbeirufen oder wütend auf ihn werden sollte.
Statt Tibald tauchte schließlich ein Wächter bei ihr auf.
»Ah, hier seid Ihr!«
»Wo sollte ich denn sein?«
»Na, im Zimmer! Hier draußen ist es verdammt kalt.«
»Warum suchst du mich überhaupt?«
Der Wächter zögerte. Er war hin- und hergerissen zwischen den Befehlen und seiner Scham.
»Nun«, druckste er, »ich komme nur schauen, ob alles in Ordnung ist.«
»Alles ist in bester Ordnung«, sagte Ema und stand auf.
Ihr Sarkasmus machte ihn noch verlegener.
»Na, dann ist ja alles gut. Schön, schön«, murmelte er, während er die Bettdecke hinter ihr hertrug wie eine der Schleppen, die sie nie wieder anziehen würde.
»Ich brauche keinen Leibwächter. Ich habe nichts zu verlieren.«
»Aber … wisst Ihr denn nicht? Kapitän Schöne! Solange man ihn nicht gefasst hat, ist auch Euer Leben in Gefahr.«
Mit Verachtung starrte sie ihn an. War der Kerl nur ein Feigling oder wirklich so dumm?
»Verschwinde.«
Eine halbe Stunde später durchquerten zwei neue Rote Rüben Emas Boudoir, um in ihrem Gärtchen Posten zu beziehen.
5
Auf dem Friedhof hielten Menschen die ganze Nacht Totenwache.Sie stellten oder hängten überall bunte Laternen auf – um Tibalds Grab, auf der Friedhofsmauer und an den niedrigen Zweigen der großen Platane. Noch vor Tagesanbruch verließ die Trauerfregatte nach Basilis den Hafen. Außer der Todesmeldung transportierte sie in ihrem Kielraum den geknebelten Flussschiffer, der die Leiche des Königs gefunden hatte und von dem nie wieder jemand etwas hören sollte.
Durch alle Schlossflure hallten die Befehle des Prinzen, der selbst gar nicht zu sehen war, so als würde er immer noch im Untergrund leben. Anders als Tibald würde man ihn niemals dabei ertappen, wie er die Hörnchen persönlich aus dem Backofen zog, einen Plausch in den Ställen hielt oder zu Fuß den Hügel zum Hafen hinabstieg. Jesko »ließ« seine Wünsche lieber durch andere »wissen«.
So »ließ er wissen«, dass er an der Seite seiner Königingemahlin gekrönt werden wolle und zu diesem Zweck noch am selben Abend heiraten werde. Damit rollte eine Lawine von Aufgaben auf Benedikt zu und begrub ihn unter sich. Im Zeitraum von achtundvierzig Stunden musste er nicht nur Willem Schönes Hochzeit und Tibalds Beerdigung, sondern nun auch noch Jeskos Hochzeit und dessen Krönung bewältigen. Die rasche Aufeinanderfolge war schon für sich ein Ding der Unmöglichkeit, aber nun »ließ« Jesko auch noch »wissen«, dass er eine glamouröse Feier erwarte, der die gute Gesellschaft von Ys und die Crème de la Crème von Westwalden beiwohnen solle. Auch die Höflinge sollten alle in Festgala erscheinen und ja nicht in Schwarz, schließlich handele es sich um einen glanzvollen Anlass. Jesko selbst bildete natürlich eine Ausnahme, da er niemals etwas anderes trug als schwarze oder dunkle Stoffe, was nebenbei Unmengen von Färbemittel in Anspruch nahm und dementsprechend hohe Kosten verursachte.
Der ganze Trakt der Bediensteten verfiel in wilde Hektik. Während sie Tischtücher bügelten, Teppiche ausrollten, Soßen anrührten und Blumenbouquets arrangierten, wurde den Klügeren unter ihnen bewusst, dass hinter all den Extravaganzen eine schlaue Taktik steckte: Jesko hielt den ganzen Hof beschäftigt, damit die Menschen sich nicht länger der Trauer hingaben und gar nicht erst auf die Idee kamen, seine Krönung zu verhindern.
In Emas Boudoir erschien ein Wächter, um sie über das Tagesprogramm zu informieren und ihr ferner mitzuteilen, dass eine »vornehme Dame« ihre Suite beziehen werde. »Mit anderen Worten, Ihr zieht um.«
»Wann?«
»Jetzt gleich.«
»Und wohin?«
Er zuckte mit den Schultern. Daraufhin eilte Ema rasch durch Boudoir und Schlafgemach, zog alle Schubladen auf und beschloss, nicht mehr Gepäck mitzunehmen als damals bei ihren heimlichen Bordgängen: das rote Kleid, das sie am Leibe trug, Tibalds Brief und den silbernen Anhänger, den er ihr zur Hochzeit geschenkt hatte.
Fast gleichzeitig wurde Lukas Lindmeyer des Schlosses verwiesen. Auch er nahm nicht viel mit: seine Gitarre und seinen Seesack voll knittriger Kleider. Darüber hinaus erhielt er ein Schreiben von Doktor Heineken, der – nun wieder Vorsitzender der Ärztekammer – Lukas die Lizenz zum Praktizieren wegen der »schändlichen Weise«, auf die er sie sich »erschlichen« habe, unwiderruflich entzog. Wie eine Schlange aus ihrer alten Haut pellte Lukas sich aus seinem blauen Arzthemd und machte sich auf die Suche nach einer neuen Bleibe.
Auch den Duke of Oats verjagte man vom Hof. Noch stand er weinend in seinem Gemach vor den Gepäckstücken, die er seit dem Vorabend zusammenschnallte und verschnürte. Jedes Mal, wenn das Reich in eine brenzlige Situation geriet, hatte er seine Koffer gepackt, war aber letztlich nie fortgegangen. Doch diesmal gab es kein Zurück. Sein großer Schrankkoffer quoll über von Tagebüchern, unvollendeten Gedichten und anderen Schreibentwürfen, von Seidenstrümpfen, Halskrausen und Pluderhosen. Selbst wenn er sich, von seinen Tränen übermannt, daraufsinken ließ, bekam er den Deckel nicht zu. Und seine Verzweiflung erreichte ihren Höhepunkt, als ein wohlmeinender Kammerdiener ihn informieren kam, dass ausländischen Gästen ab sofort das Tragen von Perücken untersagt sei.
»Und wer sollen diese ausländischen Gäste sein?«, fragte der Duke arglos, der sich selbst als Mitglied der königlichen Familie betrachtete.
»Derzeit gibt es nur einen einzigen, mein Herr. Euch.«
Jesko hatte diesen Hofpoeten, der Tibald so bewunderte, nie weiter beachtet, fürchtete aber, seine Lächerlichkeit könnte auf ihn selbst abfärben. Was der zutiefst gekränkte Duke daraufhin tat, gehörte zu den wichtigsten Entscheidungen seines Lebens. Er ging einfach los – ohne Gepäck, ohne Perücke – und schlich durch eine Dienstbotentür nach draußen, um zu Fuß den Hügel hinunter ins Dorf zu eilen, dort nicht lange zu verweilen und sich – zu einem Wucherpreis, aber sei’s – ein Maultier zu buchen, um Zuflucht im Norden zu suchen. (Natürlich vollzog sich sein Aufbruch in Reimen.)
Auf dem Maultier ritt er bis nach Norfels, zum Gasthof Bei Babsi, wo er sich im Hühnerstall versteckte. Die Wirtin hatte sich zwar für die Hochzeit ihres Neffen Willem Schöne zum Schloss begeben, würde aber sicher bald zurück sein. Und der Duke of Oats, der sie schon lange verehrte, würde endlich um ihre Hand anhalten.
In der Schlossküche sah es unterdessen aus wie nach einem Blutbad. Jesko, der sich, während er untergetaucht war, hauptsächlich von wildem Knoblauch und Waldpilzen ernährt hatte, hatte in dieser Zeit von wüsten Fleischorgien geträumt. Deshalb stand die Speisenfolge für das Krönungsbankett seit Monaten für ihn fest. Aus Ys reiste eigens ein Meisterkoch an und streckte bei seiner Ankunft das Menü wie eine Trophäe in die Höhe. Beim Anblick der aufgeführten Speisen standen der Schlachter und der Wurstlieferant, der Fischverkäufer, der Kellermeister, der Konditor, der Pralinenmeister, die Bäckerin, die Köchin und ihre Gehilfen nur sprachlos da. Da hatte man ihnen beigebracht, jede kleinste Erbse, jedes Reiskorn und jeden Hauch Butter zu ehren, und nun … Ihnen traten Tränen in die Augen.
»Sechzig Wachteln?«
»Jawohl. Kümmert euch darum.«
»Erdbeerkuchen mitten im November …?«
»Seht zu, wie ihr die auftreibt.«
»Und Austern! Langustinen! Ihr wisst doch, Meeresfrüchte sind verboten. Wegen der Cholera …«
»Das interessiert mich nicht.«
»Schweinsrouladen, Rindermedaillons, Kalbsschnitzel … Das … das ist doch unmoralisch! Blutwürstchen, Thymianschinken, Wacholdermett …«
»Ich denke, ihr solltet euch langsam mal sputen.«
Also stob das Personal nach allen Seiten auseinander, um die gewünschten Dinge zu besorgen. Was das Fleisch und die Meeresfrüchte betraf, mussten sie wohl oder übel auf Wilderer und Schwarzhändler zurückgreifen. Aber wo sollte man so viel Trinkwasser hernehmen, nachdem doch Benedikt die Schleusenklappen geöffnet und damit die Zisterne verunreinigt hatte? Wenn man nicht wollte, dass alle Durchfall bekamen, musste man gezwungenermaßen Vorratsfässer von den Hafenschiffen beschaffen, und die mussten auch noch transportiert werden.
Marthe, die wie gewohnt in der Küche loslegen wollte, wurde vom Meisterkoch aus Ys bei jeder kleinsten Gelegenheit belehrt. Sie hielt es nicht länger als fünf Minuten aus.
»Was habt Ihr mit Eurem Zuchtbullengehabe überhaupt in meiner Küche zu suchen?«
»Ich behalte Euch im Auge.«
»Ich weiß, wie man kocht.«
»Wenn ich Euch so zusehe, habe ich meine Zweifel. Aber darum geht es nicht.«
»Worum dann?«
»Um die Sicherheitslage.«
»Was meint Ihr damit? Die Hygiene?«
»Ach was, da hat der Prinz schon Schlimmeres erlebt.«
»Um was dann? Hat er Angst, dass ich die Küche in Brand stecke?«
»Nein.«
»Fürchtet er, ich könnte ihn vergiften?«
»Ganz genau.«
Marthe riss sich die Schürze vom Leib.
»Ich werd Euch mal was sagen, Herr Meisterkoch: In diesem Fall hat er recht.«
Sie warf ihm die Schürze ins Gesicht und stapfte aus ihrer geliebten Küche, die sie nie wieder betreten sollte. Also übernahm der Yser Koch das Kommando über das kollektive Chaos. Nach einer halben Stunde hatte er das Schlossleben bereits gründlich satt.
Im Laufe des Nachmittags fuhr die so groß angekündigte »vornehme Dame« in der törtchenförmigen Königskarosse vor. Die beschwerliche Reise über die verschneiten Straßen hatte sie in äußerst schlechte Laune versetzt, und der Lakai, der den Wagenschlag öffnete, fing sich gleich zwei Ohrfeigen ein. Die als Schlossherrin zurückgekehrte Viktoria Golding ließ sich zu der Suite bringen, die gerade erst von Ema verlassen worden war. Sie ließ ihren Blick durch die Gemächer gleiten, zog mit Schmollmiene ihre langen Handschuhe aus und ließ sie in jede Richtung knallen, während sie nacheinander bestellte: nachtblaue Wände, einen großen Privatgarten mit neuen Möbeln sowie Polsterstühle mit ihrem Familienwappen. Zwar hatte die Familie Golding nie ein Wappen besessen, aber dieses Problem hatte Viktoria behoben, indem sie einfach selbst eines entworfen hatte: Ein Löwe, Symbol der Macht, saß einer weißen Taube, Symbol der Reinheit, gegenüber.
Der Kammerdiener musste schlucken, als er ihre Tirade über sich ergehen ließ.
»Sehr wohl, gnädige Frau.«
Viktoria warf ihren türkisen Damastmantel auf einen Sessel und sich in einen anderen.
»Und was ist mit meinem Gepäck? Kommt das nun oder nicht?«
»Es kommt, gnädige Frau. Umgehend.«
»Ein bisschen umgehender, sonst bist du deine Stelle los. Der Weg von Mittling war lang und es ist bitterkalt, ich muss mich umziehen. Wo ist meine Kammerzofe?«
»Sie ist in Eurem Gefolge gereist, gnädige Frau, und sollte unverzüglich eintreffen.«
»Ein bisschen unverzüglicher! Ah, verschwinde lieber, bevor ich mich noch aufrege.«
In diesem Moment kam die Kammerzofe angekeucht. Sie erntete ebenfalls eine Backpfeife. Gleich darauf ließ Viktoria sich von ihr in eine cremefarbene Taftrobe einkleiden, die sie als passender für die Nachmittagsstunden erachtete. Anschließend befahl sie ihr, das Brautkleid vorzubereiten.
»Es ist eine sagenhafte Robe, etwas nie Dagewesenes! Damit der Königshof endlich mal sieht, was der Ys-Stil ist.«
Zunächst aber wollte sie jemandem einen Besuch abstatten. Mangels Orientierung im Schloss ließ sie sich zu ihrem Ziel begleiten und nutzte den Weg durch die Flure, um ihre Ansichten über dies und jenes kundzutun, Anweisungen zu geben und dekorative Änderungsmaßnahmen zu planen. Ihr schwebte vor, in jeder Nische ihre eigene Büste unterzubringen, in sämtlichen Holzreliefs ihr Familienwappen, auf den Schlusssteinen ihre Initialen, in den bunten Glasscheiben ihre zarte, durchscheinende Gestalt. Ferner verlangte sie, dass man die Wollstoffe durch Satin und Bronzenes durch Gold ersetzte und an jedem Fenster ein Opernglas platzierte, damit man den Park genießen konnte, ohne nasse Füße zu kriegen. Schon seit frühester Kindheit hatte Viktoria davon geträumt, durch das Schloss zu streifen, von dem so viel gesprochen wurde. Nun, da sie endlich hier war, sah sie an jedem freien Wandflecken ihr Bildnis.
Als sie die angestrebte Tür erreicht hatte, blieb sie davor stehen und ließ ihre Finger über das Eichenholz gleiten. Sie wusste, dass der Raum dahinter bittere Erinnerungen in ihr wecken würde. Hier hatte man sie gedemütigt, entblößt, entlaust. Hier hatte Tibald ihre Unterschrift unter eine Nachricht erzwungen, die Jesko fast das Leben gekostet hätte. Nie wieder! Nie wieder würde man sie vor jemand anderes niederknien sehen. Das Blatt war gewendet. Viktoria öffnete die Tür.
Auf dem einzigen Stuhl im Raum saß Ema mit geradem Rücken und blickte auf das vernagelte Fenster, ohne sich darum zu kümmern, wer hereinkam.
»Ema Beatriz Ejea Casarei, erhebe dich!«
Ema zeigte keine Reaktion.
»Steh auf.«
»Vielleicht morgen«, sagte Ema zu dem Fenster. »Noch bist du nicht Königin.«
Viktoria wurde furchtbar wütend. In Wahrheit konnte sie nämlich nichts gegen diese Frau ausrichten. Jesko hatte ihr verboten, ihr auch nur eines ihrer lächerlich krausen Haare zu krümmen.
»Wie ich sehe, hat man dir ein Kaminfeuer gelassen«, fauchte sie. »Und dir eine Decke gegeben. Wie großzügig. Tja, dafür hast du kein Fenster und keinen Sessel. Um deine Zukunft brauchst du dir übrigens keine Gedanken zu machen, das haben andere schon getan. Du bist dem Prinzen nämlich sehr wertvoll.«
Viktoria kam so dicht an ihr Ohr, dass Ema ihren Pfefferminzatem riechen konnte.
»Er hat alles von langer Hand geplant«, flüsterte sie. »Schon seit Monaten sagt er: Die Casarei rühren wir nicht an. Ich will sie frisch wie eine Blüte.«
Ema überlief ein Schauder. Dies war die Sprache jener Menschen, die sie damals ihrer Mutter entrissen hatten. Frisch wie eine Blüte, wir rühren sie nicht an. Man hatte sie genährt und gepäppelt, um ihren Handelswert zu steigern, und, als man sie als Sklavin weiterverkaufte, eine große Summe kassiert. Viktoria begriff, dass sie einen wunden Punkt getroffen hatte, und beschloss, Ema in ihrer Angst schmoren zu lassen.
»Bis heute Abend«, sagte sie nur und ging.
Der Abend kam viel zu schnell. Die meisten Gäste, die sich im Mosaikhof versammelten, waren gegen ihren Willen da. Es war so voll, dass sie sich gegenseitig auf die Zehen traten, als sie Viktoria Platz machen mussten, die feierlich in den Hof einzog. Jesko erwartete seine Braut, mit Styx zu seinen Füßen, vor dem offenen Portal des Thronsaals. Wie immer fiel es ihm schwer still zu halten. Er trug eine Lederjacke mit zu langen Ärmeln und war schlecht rasiert (ganz wie Manfred es vorausgesehen hatte), doch das tat seiner Schönheit keinen Abbruch. Er war die strahlende Verkörperung von Männlichkeit, einschließlich jener untilgbaren Spuren – Schmiss, fehlender Finger, Arm in der Schlinge –, die Tibalds Schwert hinterlassen hatte. Hinter der schreitenden Viktoria erhob sich ein Raunen. Das berühmte Diadem auf ihrem Kopf wurde fast zur Nebensache angesichts ihres atemberaubenden Kleides: Von oben bis unten funkelnde Saphire; Paspeln, die mit Topasen besetzt, ein Mieder, das mit schimmernden Opalen bestickt war – dieses Brautkleid besaß den Wert einer ganzen Flotte.
Tibalds Schatzkanzler hatte am Ende die Nerven verloren und Jesko verraten, wie man die Gewölbekammer öffnete. Das Brautkleid stammte aus Greiland und war bis zu diesem Tag nie getragen worden. Im Grunde war es nicht wirklich ein Kleidungsstück, sondern vielmehr die Wertanlage eines Juweliers, der der Erhebung einer Sondersteuer hatte entgehen wollen, die nämlich alle Waren bis auf Textilien betraf. Im Futter des Kleids waren ebenso viele Juwelen versteckt, wie auf dem Oberstoff prangten. Viktoria trug diesen Steuerbetrug wie eine zweite Haut.
Die Trauzeremonie war kurz, eine reine Formalität. Das glamouröseste Königspaar der Nördlichen Gebiete war auch das unbeliebteste, und als es zum Ringetausch kam, spendeten die Gäste nur lauwarmen Beifall.
»Stehende Ovationen, Jes«, gluckste Viktoria, dabei gab es gar keine Sitzgelegenheiten.
Doch Gewalt zieht Gewalt nach sich, und ein Pfeil einen anderen. Was im nächsten Moment geschah, raubte allen den Atem. Der halbherzige Applaus ebbte gerade ab, als Jesko und sein Hund plötzlich aufblickten und in dieselbe Richtung starrten. Der Prinz stieß seine Frau zu Boden und machte einen Satz zur Seite, während ein Pfeil durch den Mosaikhof schoss, genau dorthin, wo sich Jeskos Herz hätte befinden müssen. Da sein Herz aber nicht mehr dort war, flog der Pfeil weiter, durch das offene Portal in den Thronsaal und blieb in einer Stufe des Podests stecken. Ein Schaft aus Eschenholz, eine Befiederung mit Adlerfedern, eine Spitze mit Widerhaken. Die Musketiere hatten noch gar nicht reagiert, als Jesko sich in die Schusslinie stellte, die Faust hochreckte und schrie:
»GLÜCK, DUBISTTOT!«
Für einen frisch vermählten Bräutigam mochte das ein seltsamer Ausruf sein, aber sein Verdacht war richtig. Wer sonst sollte hinter diesem Anschlag stecken, wenn nicht Silvan Glück, der Kammerdiener und Pfeileschnitzer? Der Pfeil war von genau derselben Machart wie jener, der Tibald getötet hatte.
Während Meister Beinlein, der Anführer der Musketiere, Viktoria eilig in den Thronsaal eskortierte, schwang Jesko im Hof weiter seine Faust und seinen Schlingenarm und suchte mit dem Blick vergeblich die Dächer ab.
»ERGREIFTIHN! BRINGTIHNMIRLEBEND, DAMITICHIHNFERTIGMACHE! DASWAR’S, GLÜCK, DUBISTAMENDE!«
Beinlein machte vier zackige Gesten, und seine Wächter hasteten in jede Himmelsrichtung davon. Einige kletterten erst die Gäste, dann die tragenden Säulen hoch. Andere rannten Richtung Garten oder boxten sich durch die Menge, um sich im Schlossgebäude zu verteilen, während die Gästeschar Schutz suchend in den Thronsaal strömte und wie eine Flutwelle den Prinzen mit sich schwemmte.

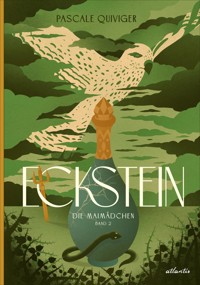
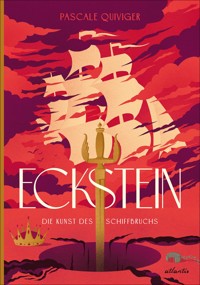













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












