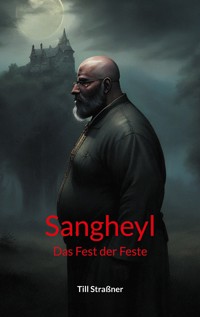Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Edgemoore-Zyklus
- Sprache: Deutsch
Ein Land verdrehter Wälder und nebeliger Küsten, - Heimat irrer Künstler, unheimlicher Folklore und verbotener Sekten. Als seine Schwester Cassy dort verschwindet, überquert Atticus Copperhand den Atlantik, um sie zu finden. Doch jeder Hinweis wirft nur neue Fragen auf: Wo ist der Detektiv, der das Kind hätte beschützen sollen? Welches Geheimnis verbindet Atticus´ Vergangenheit mit den Inseln? Hat Cassys seltsame Krankheit etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Und welcher uralte Schrecken brütet wirklich im Land des Nebels?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung
Danke Mama, dass du immer an mich geglaubt hast, mir immer zugehört hast und mein erster Kritiker warst. Dieses Buch ist ebenso deine Arbeit.
Danke Papa, dass du mich ermutigt hast, meinen Traum zu verfolgen. Nicht jeder Vater schenkt seinem Kind so viel Freiheit und Zuversicht.Ich liebe euch.
Danke den Freunden, die mich unterstützt und mir geholfen haben: Bene, Hagen, Patricia und Dalina
Besonderer Dank an Sophie für ihre Expertise und künstlerisches Talent
Till Straßner wurde im Winter 1996 in Heidelberg geboren und lebt seit 2003 in Rheinland-Pfalz.
Seit seiner Kindheit begeistert er sich für das Mysteriöse und Fantastische in der Literatur.
Im Jugendalter fand Straßner seinen Traumberuf in der Schriftstellerei und veröffentlichte im Jahr 2023 mit „Edgemoore“ den ersten Band seiner eigenen Buchreihe.
Widmung
Ich widme dieses Buch meiner Großmutter, der stärksten Frau, die ich je kannte.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1. Greyhound Hill
2. Nachtmahr
3. Bristol
4. Die Träumerin I
5. Auf hoher See
6. Port Avalon
7. Fogarthy
8. Die Träumerin II
9. Eine Zugfahrt
10. Cheer´s Crossing
Wenn man einmal auf die außergewöhnlichsten Orte, die diese Welt zu bieten hat, zu sprechen kommt, so wird der Kundige nicht umhinkommen, irgendwann einmal den Namen Edgemoore in den Mund zu nehmen.
Obwohl der Name jenes düsteren Inselreiches mitten im Atlantik, seit seiner Entdeckung jedenfalls, selten bis gar nicht die Titelseiten bedeutender Zeitungen oder anderer literarischer Informationsquellen schmückt, so gehört es doch ganz gewiss zu den sowohl faszinierendsten, wie auch bedrückendsten Orten der Erde.
Ganzjährig eingehüllt von einem nahezu undurchdringlichen Nebel, ruhen die Inseln in gespenstischer Anmut in den Wogen des Ozeans. Nur die erfahrensten Seemänner wagen eine Reise ins Reich des Nebels und lediglich eine Route kommt dabei für sie infrage.
Bei etwa 50 Grad nördlicher Breite und 31 Grad westlicher Länge kann Edgemoores natürliche Mauer über die als „Nebelpassage“ bezeichnete Route sicher durchdrungen werden.
Dem Abenteuerlustigen bietet sich daraufhin ein wahrlich einprägsamer Anblick, denn selbst unter den einzigartigen Maßstäben, die viele der von Isolation geprägten Eilande dieser Welt setzen, sticht Edgemoore mit seiner fremdartigen Flora und Fauna hervor.
Einige moderne Gelehrte bringen diesen Ort mit altbekannten Sagen und Mythen, wie Avalon, Jotunheim oder Platons Atlantis in Verbindung, geht man doch davon aus, dass sie von verirrten Seefahrern, die den Nebel durch Zufall sicher durchquerten und zurück fanden, inspiriert wurden.
Man kann an dieser Stelle nur mutmaßen.
Doch es gibt auch andere Stimmen - Geflüster mehr, über die weniger märchenhaften, vielmehr alptraumhaften Kräfte, die an diesem uralten, unberührten Ort dunkler Wälder und nebelverhangener Küsten brüten sollen.
Es kursieren Geschichten über die dort zu findenden, seltsam anmutenden Steinformationen; die Gräber in den Bergen und ferne Schreie von den vom Donner umtosten Gipfeln zu mitternächtlicher Stunde.
Manche sprechen vom Zusammentreffen der Leylinien; andere von uraltem, teuflischem Zauber, der die Erde tränkt.
Natürlich sind dies bloße Spekulationen - Hirngespinste.
Und doch glaube ich als Gelehrter an etwas Unnennbares, Böses im Boden von Edgemoore[…]
- „Die Nebel von Edgemoore“, 1. Auflage(unzensiert), 1789
Prolog
Stoneholm, frühes 19. Jahrhundert
Mona hatte ihn nie gesehen.
Nur einmal meinte sie in der Dunkelheit des mitternächtlichen Waldes eine Andeutung, eine bloße Ahnung dessen beobachtet zu haben, was manche als seinen Körper, andere nur als ein Gefäß bezeichneten.
Nun war er hier gewesen.
Auch diesmal hatte sie ihn nicht sehen dürfen. Mutter hatte es verboten. Doch sie war zu neugierig gewesen, um es zu verpassen.
Auf den obersten Absatz der alten Holztreppe hatte sie sich gekauert, um von dort durch den schmalen Schlitz zwischen Decke und Wohnzimmertür zu spähen. Doch sie hatte kein Glück gehabt. Nur für einen flüchtigen Augenblick war ihren Augen ein kurzer, angsterfüllter Blick auf seinen Schatten erlaubt gewesen, der sich im Licht des Kamins von der braunen Holzwand abgezeichnet hatte - ein tanzender, buckliger Schatten, der zu groß für einen Menschen und zu menschlich für ein Tier war.
Sie hatte Angst bekommen, wahnsinnige Angst, die ihr den Schweiß in den Nacken getrieben und ihre kleinen Hände hatte zittern lassen, wie die Flügel einer Fliege.
Doch er war nicht ihretwegen gekommen. Er kam nie wegen der Mädchen. Die interessierten ihn nicht.
Es ging um Großvater.
Manchmal hatte er mitten in der Nacht angefangen zu schreien.
„Er sieht mich, er sieht mich!“, hatte er gebrüllt. Sie hatte es sogar von ihrem Zimmer aus gehört und Mutter und Vater waren aufgesprungen, um ihn zu beruhigen.
Nach einigen Tagen hatten die Träume aufgehört.
Großvater war nicht mehr so bleich gewesen. Er schlief auch wieder besser und man dachte schon, es sei vielleicht alles nur einer seiner bösen Streiche oder gar ein unglückseliger Zufall gewesen.
Doch dann begannen die „Momente“. So jedenfalls hatten Mutter und Vater es genannt.
In diesen „Momenten“ vergaß Großvater zuweilen, wer er war, wo er war und was er tat. Statt seiner gewohnten, strengen, kontrollierten Art, legte er dann ein gänzlich anderes Verhalten an den Tag, dass so gar nicht zu einem Mann seines Schlages passen wollte. Mediziner hätten es wohl seinem fortgeschrittenen Alter zugeschrieben und dem seltsam abweichenden Gebaren des älteren Mannes keine besondere Beachtung geschenkt. Doch die Familie wusste es besser.
Er lächelte so seltsam, sprach kaum und wenn, dann glich seine Stimme einem so diabolischen Flüstern, dass es ihr stets kalt den Rücken hinunter gelaufen war.
Manchmal ließ er es nicht dabei bewenden, sondern begann laute, tierische Laute von sich zu geben; zu hecheln, zu kreischen und sogar zu jaulen.
Einmal hatte er einen Dienstboten angefallen. Sie konnte sich gut an all das Blut erinnern, das sie hatten aufwischen müssen.
Nun mehr vier Tage war es her, dass sie Großvater im Keller hatten einsperren müssen, trotz Monas vehementer Proteste.
„Er ist nicht mehr er selbst.“, hatte Vater gesagt.
Als die anderen Familien kamen, beratschlagte man. Die Butchers hatten ein paar gute Einfälle gehabt, ebenso wie die LaSalles und die Weatherbys. Doch stets wurden sie von den Älteren sofort entkräftet oder gleich für wahnsinnig gehalten und als undurchführbar abgestempelt worden.
Man konnte ihn nicht betrügen.
So stand es außer Zweifel, dass Großvater den Weg gehen musste, den so viele vor ihm schon gegangen waren.
Doch Mutter wollte sich dem nicht fügen. Sie war schon immer stolz gewesen und aufbrausend gewesen. Vater hatte immer gesagt, das sei es, was er an ihr so liebte, doch es sei auch der Grund, warum sie so viele Schwierigkeiten mit den anderen Familien gehabt hatte und dass es ihr irgendwann einmal großen Ärger einbringen würde.
Dieser Tag war nun gekommen.
Sie hatte ihn einberufen und er war niemals glücklich, darüber einbestellt zu werden, wie eine gemeine Dienstmagd, auch wenn Vater und Mutter ihm alle Höflichkeit hatten zuteilwerden lassen.
Mona sah es nicht, sondern lauschte nur. Doch die Worte ihrer Eltern verstand sie nur zu gut.
Er antwortete nicht.
Er lachte nur und dieses tiefe, kalte unmenschliche Lachen würde die kleine Mona Zeit ihres Lebens nicht mehr vergessen.
Nachdem fortgegangen war, schlossen Mutter und Vater sich im Arbeitszimmer ein. Mona hatte sie noch nie so verängstigt gesehen. Sie waren so zerstreut, dass sie Mona nicht einmal fürs Lauschen bestraften.
Zuerst entließen sie die Dienstboten, dann öffneten sie den Hundezwinger, sodass all ihre geliebten Hunde blindlings in den Wald rasten und nicht mehr zurückkamen. Kisten wurden gefüllt.
Sie packten nicht viel, nur das Nötigste, denn sie hatten genug Geld und konnten sich neue Sachen kaufen, wenn sie das Land erst verlassen hatten.
„Das Land?“, fragte Mona.
„Ja, Täubchen, das Land. Wir verlassen Edgemoore.“
„Aber, wie weit müssen wir denn weg?“
„So weit das nächste Schiff uns bringt.“
Im Laufe dieser Nacht wurde das Geschrei, das seit seinem Besuch aus dem Keller drang, unerträglich und auch Mona verstand jetzt, dass dies nicht mehr Großvater sein konnte. Mutter und Vater sprachen nur noch von „Es“ und „Es“ hatte begonnen am Holz der alten Tür zu kratzen und zu schaben, dass das ganze Haus von einer schaurigen Melodie erfüllt wurde.
„Es bricht durch.“, flüsterte Vater geistesabwesend. Sein Gesicht war totenbleich und seine Haare, die sonst immer geschnitten und gepflegt waren, fielen ihm strähnig in die Augen.
Eine Kutsche fuhr vor. Man warf alles hinein, was auf die Ladefläche passte.
„Verabschieden wir uns denn gar nicht?“, fragte Mona.
Mutter schüttelte nur den Kopf und blickte zum Haus zurück. Auch Mona betrachtete das alte Anwesen, dass ihr Heim und Heimat gewesen war, seit sie denken konnte. Ein letztes Mal glitt ihr Blick über die schwarzen Ziegel, die steinernen, alten Mauern, die breiten Erkerfenster, die immer so viel Sonnenlicht hinein gelassen hatten und den einsamen Apfelbaum im Vorgarten, an dem ihre selbstgemachte Schaukel hing.
All das sah sie nun zum letzten Mal.
Mona beobachtete wie Vater die Lampen im Flur umdrehte und ihren Inhalt ausleerte. Mit einer letzten Kiste kam er hinaus gerannt und warf sie auf die Ladefläche.
„Beeil dich!“, rief Mutter. Das Kratzen und Schreien aus dem Keller nahm ohrenbetäubende Lautstärke an und es würde nicht lange dauern, bis der gesamte Ort erwachen und nachsehen würde, woher der Radau rührte.
Doch gerade als sie losfahren wollten, rief Vater: „Ich muss noch einmal hinein. Ich habe etwas vergessen.“
Mit diesen Worten drehte er sich um.
Mutter schrie ihm etwas nach und war bereits selbst im Begriff sich wieder nach drinnen zu begeben. Doch stattdessen warf sie einen Blick auf ihre Tochter und drückte das Kind an sich, als könnte es im nächsten Moment davon fliegen.
Ein Krachen unterbrach die nächtliche Stille.
Es war durch die Tür gebrochen.
Dem Geräusch folgte ein überraschter Aufschrei.
Unverkennbar entstammte er der Kehle von Monas Vater.
Kampfgeräusche flammten auf. Glas und Keramik splitterten, Holzbalken barsten und das ohrenbetäubende Geschrei ging in ein triumphierendes Geheul über.
Da sah Mona die ersten Flammen.
Sie kamen aus dem hinteren Teil des Hauses, leckten schnell am Gebälk und zogen sich in rasender Geschwindigkeit an den Öllachen entlang, die Vater verschüttet hatte. Binnen eines Augenblicks verbrannte Monas ganze Welt vor ihren Augen zu Asche - zu schnell, als dass sie auch nur eine Träne hätte vergießen können.
Die Schreie verstummten und eine merkwürdige Stille legte sich über Stoneholm und das ehemalige Anwesen der Familie.
Das Licht der knisternden Flammen erleuchtete den kalten, gleichgültigen Nachthimmel und die nebelverhangenen Bäume des großen Waldes dahinter.
Mit totenbleichem Gesicht gab ihre Mutter dem Kutscher ein wortloses Zeichen und ihr Gefährt setzte sich rumpelnd in Bewegung, fort von den schwelenden Trümmern, die die Erinnerungen an jene teuflische Nacht und die Gebeine ihres Vaters für immer unter sich begraben sollten.
Unter einem geisterhaften Mond, dessen blasse Strahlen durch die watteartigen Nebelwolken am Himmel drangen, verloren die schiefen Dächer und Mansarden Stoneholms sich zwischen den knorrigen Ästen und Farnen des alten Waldes.
Ihre Heimat sollte sie nie wieder sehen.
Und obgleich sie traurig darum war, die dichten, feuchten Wälder in all ihrer einzigartigen Pracht und die Leute, die sie Freunde nannte nie wieder sehen zu können, wusste sie, dass es das Beste war.
Kein Mensch ihres Blutes sollte jemals einen Fuß nach Edgemoore setzen.
„Es gibt gute Menschen. Es gibt schlechte Menschen. Die Kunst besteht nicht darin, herauszufinden zu welcher Sorte ein Mann gehört, sondern darin ermitteln zu können, wie nützlich er einem trotzdem ist.“
- Quentin Turner, Unternehmer
1. Greyhound Hill
September, 1887
Gewaltige Ranken Efeus und anderes Schlinggewächs bedeckten die Außenwände von Greyhound Hill, jenem uralten Herrenhaus, das einige Meilen außerhalb Londons auf einem von noch älteren Bäumen gesäumten Grundstück lag und das Ziel meiner Reise war.
Als ich aus meiner Kutsche stieg, hatte der Regen gerade aufgehört, nur vereinzelte Tropfen fielen noch vom Himmel und perlten an der Krempe meines Zylinders herab. Die Luft war erfüllt vom Geruch des Wassers und der stummen, hölzernen Zeitzeugen, die das Anwesen vor neugierigen Blicken schützten.
Greyhound Hill.
Seit langem war ich nicht mehr am Ort meiner Geburt gewesen.
Zwei römische Säulen stützten das hohe Vordach, auf dem der Wahlspruch der vorherigen Besitzer in verblichenen, lateinischen Buchstaben eingraviert war.
Das Anwesen war nicht immer im Besitz meiner Familie gewesen. Erst seit wenigen Jahrzehnten durften die McCullens sich des adeligen Titels und dieser Ländereien rühmen.
Ich griff nach dem eisernen Türklopfer und hämmerte ihn gegen das Eichenholz. Er hatte die Form eines zweiköpfigen Hundes und der Anblick jenes Wappentieres entlockte mir einen kurzen, schwachen Seufzer.
Im Inneren hallte das Echo von der hohen Decke wieder.
Während ich wartete, kratzte ich mich an meinem Dreitagebart..
Es vergingen noch einige Minuten, bis man mir öffnete und ein mir unbekannter Mann mit ergrautem aber gepflegtem Haar und schwarzer, eleganter Kleidung fragte: „Ja? Sie wünschen?“.
Er hatte diese Mischung aus gehobener Sprache und nasalem Tonfall, die ihn als Butler höchster Güteklasse auszeichnete.
„Atticus McCullen. Mein Herr Bruder hat mich her zitiert.
Familiäre Angelegenheit, sie verstehen.“
„Mister Copperhand.“, begann er gedehnt. „Bitte kommen sie herein. Ich werde ihr Gepäck nehmen, wenn sie gestatten.“
„Nicht nötig.“
Als ich in ausladenden Schritten an ihm vorbei ins Haus marschierte, rümpfte er kaum merklich die Nase. Mir schien, meine verehrten Geschwister hatten ihn direkt von ihrer Majestät aller teuerstem Bettvorleger gekratzt.
„Wo ist Marvin?“, erkundigte ich mich neugierig.
„Mr. Gats weilt leider nicht mehr unter uns. Er verstarb letzten Winter an einem Lungenleiden. Sehr bedauerlich.“
Wenn ich sagte, dass ich schockiert wäre, wäre das eine gewaltige Untertreibung. Marvin war tot und keiner hatte mich informiert. Von unseren Zwistigkeiten einmal abgesehen, hätte ich doch zumindest dieses winzige Maß an Anstand erwartet.
„Er war eine Zierde seiner Zunft, wie mir mitgeteilt wurde.“, fuhr der Neue unbeirrt durch meinen Gesichtsausdruck fort. „Ein tragischer Verlust. Aber gegen Alter und Krankheit ist nun einmal auch der stärkste Wille nicht gefeit.“
„Und sie sind?“, unterbrach ich seine Lobrede hastig, bevor er sich noch daran verschluckte.
„Bronkhurst. Paul Bronkhurst, wenn´s genehm ist.“
„Ist es Paul. Gestatten sie Frage nach dem Verbleib der Hausherren?“
Diese ganze Angelegenheit wollte ich nur hinter mich bringen. Was immer meine Geschwister von mir wollten, es ging bestimmt nicht um einen verspäteten Geburtstagsgruß.
„Sie meinen den jungen Herrn Percival? Er und ihr Bruder erwarten sie hinten im Speisezimmer“
Er streckte den Arm aus, wohl in der Erwartung mich meines Mantels zu erleichtern.
„Danke mein Bester“, verneinte ich rasch und kniff ihm in die Wange, was mir einen schwer irritierten Blick einbrachte. „Meine Sachen bleiben mir. Die dritte Tür rechts, nicht wahr?“
Das Speisezimmer war ein großer, geschmackvoll eingerichteter Raum mit hölzernen Wänden und einer gewaltigen Eichenholztafel, die die gesamte linke Hälfte des Zimmers einnahm. Mit zweiundzwanzig gepolsterten Stühlen versehen, war sie nicht nur zum Essen, sondern auch zu repräsentativen Anlässen wie Feiern oder kleineren Versammlungen geeignet.
Entsprechend zeigten einige Vitrinen teure Antiquitäten und seltene Familienerbstücke, die sich hervorragend zum Angeben eigneten.
Die Tafel selbst, eine Monstrosität von einem Tisch, war an den Rändern und Beinen mit Holzschnitten versehen, die die Geschichte Wilhelm, des Eroberers darstellte.
Der kristallene Kronleuchter darüber konnte normalerweise den ganzen Raum erhellen, war aber nicht entzündet. Am Kopfende der Tafel hatte Vater ein großes Erkerfenster einbauen lassen. Es war das einzige Fenster im Raum.
Man könnte natürlich vermuten, es diente allein dazu, den Raum etwas heller zu machen, doch weit gefehlt.
Sollten Gäste an der Tafel dinieren, tauchte das Licht, welches von draußen durch das Fenster hineinschien, den Mann am Kopfende in gleißendes Licht – ein klug inszenierter Schachzug, der Eindruck hinterließ, wenn man zum Beispiel eine Rede hielt.
Auch wenn es lange her war, so konnte ich ihn mit etwas Vorstellungskraft immer noch dort sehen: im Anzug natürlich - nichts Auffälliges aber stets von hoher Qualität, die Rüstung des Unternehmers sozusagen - in der Linken ein Glas Wein, in der Rechten zuweilen eine Zigarre oder jene Pfeife, die später in meinen Besitz überging. Eingehüllt von Qualm und umgeben von einem bunten Pulk treuer Geschäftspartner und hiesiger Würdenträger, die jedem seiner Worte gebannt lauschten.
Es war zu lange her. Nur ein Bild an der Wand neben dem Kamin war von diesem Mann geblieben, der die McCullen Manufacturing Company ihren Namen verdankt.
Die rechte Seite des Raumes nahmen mehrere, bis an die Decke reichende Bücherregale sowie der gewaltige, marmorne Kamin ein, der zu diesem Zeitpunkt die einzige Lichtquelle darstellte. Mehrere, bequeme Ledersessel waren davor aufgereiht und darauf saßen meine Brüder. Das flackernde Licht des prasselnden Kaminfeuers tauchte ihre missmutigen Gesichter in rötlichen Glanz.
Direkt vor dem Kamin saß Lance – eigentlich Lancelot, aber den Atem sparte sich jeder.
Lance war der Älteste und ein Bild von einem Mann, was bedeutete, dass ich ihm die Beulenpest an den Hals wünschte, wann immer Damen in der Nähe waren.
Jetzt war seine Miene reglos und seine Augen verfolgten das flackernde Spiel der Funken im Feuer.
Etwas näher an der Tür saß Percival oder Percy. Über ihn gab es nicht viel zu sagen. Das Aufsehenerregendste an seiner Erscheinung war sein schmaler Oberlippenbart, der seinem blassen Gesicht die nötige Nuance verlieh, um es nicht mit einer Büste zu verwechseln.
Percy war ein stiller, aber intelligenter Mann, der sich niemals in die Karten schauen ließ und selten von oder über sich sprach - kurzum: ein Langweiler.
Aufgrund seines Geschicks mit Zahlen war ihm die Leitung des Familienunternehmens zugefallen. Mit seinem Seitenscheitel und der kleinen Brille auf der Nase machte er nicht viel her, aber die meisten Leute, sowohl im familiären Umfeld wie auch in geschäftlichen Kreisen, lobten stets seine außerordentliche Intelligenz.
In meinen Augen war sein herausragendes Merkmal jedoch die dicke Schleimspur, die er stets hinter sich her zog.
Paul kündigte meine Anwesenheit an, obwohl dies angesichts der zwei funkelnden Augenpaare, die mich beim Eintreten mit demselben Blick bedachten, den ein Löwe einer Hyäne zuwarf, recht überflüssig war.
„Mr. Atticus Copperhand für sie.“
Damit ging er rückwärts hinaus und schloss leise die Tür hinter mir.
Eine Weile herrschte eisiges Schweigen. Percy und ich taxierten uns. Lance´Blick hatte sich wieder den Flammen zugewandt.
„Ergebenste Grüße den Herren vom Hill.“, grüßte ich die beiden Kakerlaken mit einer tiefen Verbeugung.
„Atticus,“, sagte Percy ruhig aber mit einem bestimmten Unterton in der Stimme, „gut, dass du es einrichten konntest.“
„Ja, ich habe noch einen Platz in meinem Terminkalender finden können“, erwiderte ich und ließ dabei meinen Blick mit mäßigem Interesse über die Vitrinen schweifen.
„Du hast es also ernst genommen. Die Sache mit dem Namen, meine ich“, sagte Percy.
Es war eine zufriedene Feststellung, keine Frage.
„In der Tat, Bruderherz. Mit dem Namen McCullen bringt man heutzutage einfach zu viele Verbrecher in Verbindung.“, gab ich zurück und drehte mich schwungvoll zu Percy um.
„Wir sind nicht zum Streiten hier, Atticus.“
„Sind wir nicht?“, fragte ich keck. „Denn so, wie ich es in Erinnerung habe, war das stets unser liebster Zeitvertreib.“
Percy bedachte mich mit einem undeutbaren Blick.
Dann sagte er ruhig: „Bitte setz dich jetzt endlich.“
Nach zwei Tagen in Sätteln und harten Kutschensitzen fühlte sich das Sesselleder an, als würden Engel meinen Allerwertesten küssen.
„Möchtest du vielleicht etwas trinken? Einen Whisky zum Beispiel?“, fragte Percy zuvorkommend.
„Also mein Lieber, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich zu einem Whisky nicht nein sagen. Ist der Glenburys noch die Hausmarke? Dann sei so gut, schenk´ein Glas ein, schütte es in den Ausguss und bring mir was Vernünftiges. Ein 1796er Shutterville wäre ein guter Anfang und dazu vielleicht…“, ich wollte schon zum Hauptgang übergehen, doch Lance unterbrach mich jäh.
Endlich meldete sich der Fliegenfänger mal zu Wort.
„Ist es so schwer für dich, einmal ernst zu sein?“, brummte mein ältester Bruder.
„Lance! Wie schön! Ich hatte schon befürchtet, den ganzen Abend auf deine wortgewandten Beiträge verzichten zu müssen.“
Statt aber aufzustehen und mir eine Drohung nach der anderen um die Ohren zu hauen, wie ich es gewohnt war, wandte er nur wieder den Blick ab und starrte ins Feuer.
„Lance hat Recht, Atticus. Etwas mehr Ernst würde uns allen diese Sache deutlich einfacher machen. Glaub mir, niemand wünscht sich so sehr wie ich, dass du dieses ehrwürdige Haus wieder verlässt und dich zu den Ratten in der Gosse gesellst, aber im Moment hat die Familie Vorrang vor allem Anderen; auch unseren persönlichen Differenzen.“
„Welche Sache denn, wenn mir die Frage gestattet ist?
Ihr beordert mich her, ohne einen nennbaren Grund. Ich reite zwei Tage, wie ein Gepeitschter hier her und abgesehen von Marvins bedauerlichem Tod, von dem ihr mich sicherlich noch unterrichten wolltet, erscheint mir hier alles beim Alten. Ihr süffelt teuren Schnaps am Kamin und Cassy verkriecht sich in ihrem Zimmer. Da fällt mir ein wie geht es ihr eig...“.
Lance tiefe Stimme unterbrach mich. Er hatte noch immer nicht vom Feuer aufgesehen, als er mit matter Stimme raunte: „Darum geht es. Sie ist weg.“
Einen Moment starrte ich ihn entgeistert an, bevor ich behutsam zu sagen begann: „Mein lieber Bruder. Ich weiß sehr wohl, dass dein Geist ein eigenes, äußerst faszinierendes Mysterium darstellt, weshalb ich sicher bin, mich verhört zu haben.“
Er gab einen undeutbaren Zisch-Laut von sich.
„Wisst ihr zuweilen hilft es, seine Schritte zurückzuverfolgen“ Sie warfen sich einen vielsagenden Blick zu.
„Ihr meint es ernst.“, stellte ich fest, ohne es begreifen zu können.
„Ihr wisst, dass sie nicht allein zurecht kommen kann, wie zum Teufel habt ihr... wie...?!“
„Atticus, wir müssen dich über etwas aufklären.“, begann Percy behutsam. Offenbar wählte er seine Worte mit großem Bedacht.
„Wie du sehr wohl weißt ist Cassy schon immer anders gewesen als andere Mädchen ihres Alters. Oder überhaupt andere Menschen. Ihre Krankheit hat es uns die letzten Jahre nicht einfach gemacht...“
„Oh, ihr hattet es schwer? Mein Beileid Percy.“
Ohne darauf einzugehen fuhr er fort: „Es ist in den letzten Jahren stetig schlimmer geworden. Nicht radikal. Aber wenn man die Häufigkeit ihrer Anfälle über diesen Zeitraum betrachtet, so konnte man doch eine gewisse Zunahme beobachten. Jedes Jahr wurden es ein wenig mehr. Ihre Konzentration ließ immer weiter nach, sie kam mit dem Stoff nicht hinterher. Stattdessen vergrub sie sich in ihrem Zimmer, las irgendwelche alten Schmöker und sonderte sich ab. Ständig lagen ihre Lehrer mir in den Ohren.“
Er seufzte.
„Wie du ebenso weißt,“, fuhr er fort, „habe ich im Laufe der letzten Jahre zahlreiche Ärzte einbestellt: Landärzte, Fachmediziner, auch Experten, die sich mit noch unerforschten Krankheitsbildern auseinandersetzen. Die haben jedoch alle nur eine Menge Geld verschlungen, ohne auch nur eine hilfreiche Diagnose stellen zu können. Jedenfalls bin ich deshalb zu dem Schluss gekommen, dass es an der Zeit ist, sich nach Hilfe außerhalb Europas Grenzen zu erkundigen. Deshalb...“
„Komm bitte zum Punkt Percy.“, warf ich unruhig ein. Das Thema kam ihm nicht leicht über die Lippen.
„Also kurzum: Ich habe einen Experten in Amerika ausgemacht. Ein gewisser Dr. Hawthorne. Er ist emigrierter Brite, Oxford-Absolvent und ein Pionier auf dem jungen Gebiet der Psychologie. Einige Monate lang standen wir in regelmäßiger Korrespondenz. Ich schilderte ihm Cassandras Krankheitsbild und er schien zuversichtlich, ihr helfen zu können.
Letztes Jahr war Cassy bei ihm. Probeweise.
Abe hat sie begleitet und sie verbrachte drei Wochen in seinem Zentrum bei Boston, bevor sie zurückkehrte.
Nach eingängiger Studie teilte Dr. Hawthorne mir mit, dass er durchaus im Stande wäre ihre Leiden behandeln zu können. Allerdings erfordere das eine mehrjährige Behandlung und...“
„Aber darauf hast du dich nicht eingelassen oder Bruderherz? Du würdest niemals unsere kleine, kranke Schwester auf eine Reise ans andere Ende der Welt schicken. Ganz allein. Und das für Jahre.“
Natürlich lag die Antwort auf der Hand, doch es verlangte mich danach, Percy es aussprechen zu hören. Es war jedoch Lance, der mir statt seiner antwortete: „Ich war zunächst auch dagegen, Atticus. Es schien mir ebenso...gewagt, aber diese längerfristige Behandlung klingt sehr vielversprechend. Ich habe diverse Berichte gelesen und der Doktor...“
„Ihr wolltet sie ernsthaft einweisen lassen? Ein dreizehnjähriges Mädchen, allein in einer Anstalt für Geisteskranke?“
„Es ist doch keine Anstalt für Geisteskranke.“, widersprach Percy. „Wir stecken sie doch nicht nach Bedlam.“
„Sieh doch mal“, schaltete Lance sich erneut ein, „dort wären viele Menschen, die an Ähnlichem leiden. Sie könnte endlich ein paar Freunde finden. Vielleicht einmal ganz normal leben...“
„Sie ist ganz normal.“, versuchte ich ihm zu erklären.
„Ich versuche nur zu sagen, dass die Argumente von...“
„Von Percy sehr überzeugend waren, nicht?“, fuhr ich dazwischen. „Was denkt ihr beiden Hohlköpfe euch eigentlich, Cassy zu irgendeinem Quacksalber zu schicken, den ihr noch nicht einmal persönlich getroffen habt? Wie könnt ihr es...“
„Du weißt so gut wie wir, dass man sie behandeln muss, Atticus.“
„Das ist allein eure Meinung.“ ,murrte ich und verschränkte die Arme.
„Was sollen wir denn tun? Sie ihr Leben lang in dieses Haus einsperren? Sie vor der Welt verstecken?!“, echauffierte sich Lance und diesmal lagen Ungeduld und auch eine Spur Ärger in seiner Stimme.
„Bisher hat das doch hervorragend funktioniert.“, konterte ich sarkastisch.
„Vielleicht würde es reichen ihr einfach etwas Freiraum zu lassen.“, fuhr ich in gemäßigterem Tonfall fort.
„Sie ist doch nicht gefährlich. Wie oft habt ihr mit ihr gesprochen seit ich weg bin? Mit wie vielen Kindern ihres Alters hat sie überhaupt Kontakt? Es verlangt mich wirklich zu wissen, was euch zu dieser Entscheidung trieb ihr Esel.“, schloss ich wütend Percys braune Augen hielten meinem Blick gelassen stand.
„Ihre Erziehung ist nicht deine Sache Atticus.“, verkündete er nach einer Weile gedehnt und die Genugtuung in seiner Stimme schmerzte wahrlich.
„Stimmt.“, hielt ich gefasst dagegen, lehnte mich zurück, legte die Fingerspitzen aneinander und fuhr genüsslich fort: „Und eure genauso wenig. Abe ist ihr Vormund. So will es das Testament und daran kann keiner von euch rütteln. Wie du Abe dazu bekommen hast, bei diesem Wahnsinn mitzumachen, werde ich wohl nie verstehen, aber lass dir von dem Bruder, der dir noch die Unterhose über den Kopf ziehen konnte, als du schon einen Kopf größer warst, gesagt sein, dass ich ihn umstimmen werde und…“
Ich war bereits im Begriff mich in Rage zu reden, hätte mich nicht eine tiefe Stimme aus der linken Zimmerhälfte jäh unterbrochen. Aufgrund der zwielichtigen Lichtverhältnisse war ihr Verursacher mir bis jetzt gar nicht aufgefallen.
Nun trat ein Hüne von einem Mann in den flackernden Lichtkegel des Kamins. Seine Haut war schwarz wie Kohle, was auf seine nubische Herkunft zurückzuführen war. Über einer buschigen, ergrauenden Gesichtsbehaarung sitzend, blickte ein glühendes Augenpaar auf mich herab.
Der Hüne hatte die massigen Oberarme vor der Brust verschränkt, wodurch er noch einschüchternder wirkte, als er sowieso schon war. Die Nähte seines Anzuges waren zum Platzen gespannt.
„Reden ist Silber. Schweigen ist Gold“, begann er. Seine Stimme war ruhig und leise, hätte aber dennoch ein ganzes Bataillon aufgeregt durcheinander quatschender Menschen zum Schweigen gebracht. In ihr lag diese selbstverständliche Autorität; eine Art natürlicher Erhabenheit.
„Diese Tugend hast du bis heute nicht gelernt, oder?“, fuhr der Mann fort, während er langsam nähertrat.
„Abe, da bist du ja.“, stellte ich überrascht fest.
Das eben Gehörte trübte meine Freude über seinen Anblick etwas. „Aber du hättest dich nicht im Schatten zu verstecken brauchen, mein Lieber.“, fuhr ich im Kavalierston fort. „Ein unfairer Heimvorteil übrigens, da drüben bist du so gut wie unsichtbar.“
Seine Augen glühten.
Abe war ein gutmütiger Mann, aber wenn man es einmal geschafft hatte, ihn wirklich zu reizen, ... Gnade Gott.
Ich bin wohl der Einzige, der sich rühmen darf, das zwölfeinhalb Mal vollbracht zu haben. Das halbe Mal hing übrigens mit einem Baum, drei Flaschen Whisky und einer Katze zusammen, aber wir wollen uns an dieser Stelle nicht in mathematischen Unmöglichkeiten verlieren.
Ich kann nicht sagen, ob es die Schatten des flackernden Kaminfeuers oder tatsächlich das Alter waren, aber sein Gesicht sah deutlich verhärmter aus, als ich es in Erinnerung hatte.
Von dem Lächeln, das sonst immer auf seinem Gesicht hing, zeugten nur noch die Lachfältchen. Grimmig sah er aus und auch betrübt. Seltsamerweise machte mir dieser Umstand mehr aus als das seltsame Gebaren meiner seltsamen Brüder.
Da ich nicht in der Stimmung für zwanglose Konversation war, kam ich direkt zur Sache. „Du hast diesem Unsinn also zugestimmt?“
Abe nickte bedächtig und sagte: „Ich habe sie nach Amerika begleitet, mir die Einrichtung angesehen und mit Dr. Hawthorne gesprochen. Das war meine Bedingung.
Der Mann ist vernünftig, intelligent und kennt sich in seinem Fach aus. Daher: Ja, ich habe mein Einverständnis gegeben.“
Wieder schweigen.
Ich starrte sie nacheinander an, nicht wissend, wem der Großteil meiner Frustration zustehen sollte.
„Und Cassy? Hat sie auch mal jemand nach ihrer Meinung gefragt?“, fragte ich, vielleicht eine Spur zu angriffslustig. Der gute Percy wandte nicht mal die Augen ab.
„Das spielt im Moment ohnehin keine Rolle.“, raunte er nur.
Erneut trat ein betretenes Schweigen ein. Ich seufzte, bevor ich nun, nachdem ich meinem Ärger etwas Luft gemacht hatte, zu der Frage kam, die Priorität genoss:
„Was meintet ihr vorhin damit, dass sie verschwunden sei? Ich meine habt ihr sie versehentlich verlegt, oder was zum Teufel wolltet ihr mir mitteilen?“
Es war erneut Percy, der zu sprechen begann: „Das eben habe ich dir nicht erzählt, weil es dich im Grunde etwas anginge, sondern damit du verstehst, wie es zu...diesem Dilemma gekommen ist.“
Er lehnte sich zurück, trank einen Schluck aus seinem Glas und hielt den Blick weiter auf mich gerichtet.
„Dilemma?“, wiederholte ich skeptisch.
„Nachdem ich mich mit dem Doktor geeinigt hatte, sollte Cassy vor einigen Wochen nach Übersee aufbrechen.
Leider war es im selben Zeitraum zu mehreren Zwischenfällen im Unternehmen gekommen und weder Lance noch ich oder Abe hatten Zeit, die Reise mit ihr anzutreten, also habe ich jemanden engagiert, der...“
„Du hast was?“, fragte ich schockiert. „Irgendein Fremder sollte sie begleiten?“
„Mir war klar, dass du so reagieren würdest, aber bitte lass mich ausreden.“, erwiderte Percy, dessen Geduld offenbar langsam erschöpft war.
„Der Mann jedenfalls, Rufus, ist von Pinkerton und einer ihrer Besten. Er ist seit knapp sieben Jahren in einer Außenstelle in London stationiert und wir arbeiten bereits beinahe ebenso lange sehr erfolgreich im Rahmen wirtschaftlicher Interessen der Company zusammen. Ich vertraue ihm blind. Glaub mir, niemand war besser geeignet für diese Aufgabe. Rufus holte Cassy hier ab, sie fuhren nach Bristol und setzten über.“
Er ließ die Worte kurz im Raum stehen, bevor er fortfuhr.
Jetzt kam der wichtige Punkt, das Problem, der Casus Belli, dem ich meine Anwesenheit im familiären Tartarus verdankte.
„Leider kam es an Bord ihres Schiffes zu einem Zwischenfall. Offenbar waren die Maschinen beschädigt worden und da das Schiff unmöglich allein mit Windkraft die Strecke in annehmbarer Zeit hätte zurücklegen können, mussten sie einen Zwischenstopp einlegen.“
So langsam ahnte ich, worauf das alles hinauslaufen würde.
„Der Kapitän ließ das Schiff Port Avalon in Edgemoore anlaufen. Die Inseln solltest du kennen, sie...“
„Ja, ich weiß.“, antwortete ich knapp. Natürlich kannte ich die Inseln. Wer nicht?
„Nun…kurz nach ihrer Ankunft muss wohl…etwas schiefgelaufen sein.“
Wieder legte er eine kurze Pause ein. Seine Augen ließen von den meinen ab und schweiften nur für einige kurze Momente ziellos durch den Raum. Es war keine besondere Geste, aber genug für mich zu erkennen, dass das Folgende ihm nicht leichtfiel.
„Wir erhielten vor einigen Tagen einen Brief von Rufus.
Ich will es kurz machen: Cassy ist ihm mitten in der Stadt… abhanden gekommen. Sie ist verschwunden und er kann sie nicht finden.“
Darauf folgte erneut ein unangenehmes Schweigen.
„Abhanden gekommen?“
Mir hatte es die Sprache verschlagen.
„Abhanden gekommen?“, wiederholte ich, „Sagtest du nicht etwas von „der Mann meines Vertrauens“? Denn etwas dergleichen ist mir im Gedächtnis geblieben.
„Einer ihrer Besten“. Das hattest du doch gesagt. Und jetzt willst du mir erklären, dass dein Experte, bei seiner einzigen Aufgabe, ein verträumtes, dreizehnjähriges Mädchen zu beschützen, gescheitert ist. Und sie, als ein erfahrener Detektiv, nicht finden kann? Ihr erlaubt euch einen Scherz, oder?“
Er antwortete nicht.
Keiner tat das.
Sie starrten nur vor sich hin und wechselten bedeutungsschwangere Blicke, als warteten sie, bis ich mich abreagiert hätte, um anzusprechen, worum es ihnen wirklich ging.
„ANTWORTET MIR MAL JEMAND?“
Seltsam hohl hallten meine Worte von der hohen Holzdecke wieder und hinterließen eine bleierne Stille in der Luft, nur unterbrochen vom regelmäßigen Knistern der Kohle.
Das Kaminfeuer war beinahe heruntergebrannt und die Gesichter meiner Gegenüber wirkten mit einem Mal gespenstisch fahl; getaucht in roten Schimmer und schwarze Dunkelheit.
Abes glühende Augen beäugten mich mit einer Mischung aus Misstrauen und Schuld.
„Wann macht ihr euch auf den Weg?“, fragte ich sie trocken, während ich mich mit einem großzügigen Schluck aus Lance Glas zu entspannen versuchte und die Antwort abwartete, die ich ziemlich sicher schon kannte.
„Wir gar nicht.“, erklärte Percy rundheraus. Er zuckte nicht einmal mit der Wimper. „Zur Zeit halten die Firmengeschäfte uns auf Trapp. Abgesehen davon können die leitenden Direktoren nicht einfach so auf unbestimmte Zeit verschwinden. Wie sähe das aus? Wir haben Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden, Anteilseignern und den Arbeitern.“
„Vorsicht Percy. Nicht, dass du an deinem Edelmut erstickst. Warst du es nicht, der immer gesagt hat: „Die Familie steht an erster Stelle“. Erst schmeißt du mich aus dem Haus, jetzt lässt du deinen letzten, verbliebenen Schützling allein in der Fremde zurück. Ist die Familie nicht ein Segen?“
Ich klatschte gemächlich in die Hände. Natürlich war sein Gesicht immer noch eine steinerne Maske, aber ich glaubte, die ersten Steinchen bröckeln zu sehen.
„Was damals passiert ist, hast du dir selbst zuzuschreiben.“, sagte er leise, „Charles hast du zu verantworten, nicht ich. Wegen einer verdammten Frau hast du…“
„Untersteh dich es auszusprechen, du elende Schnecke.
Du Lügner wolltest an mein Erbe und hast es ja auch bekommen!“, platzte es zischend aus mir heraus.
„Brüder bitte...“ sagte Lance entrüstet, doch offenbar hatte ich da etwas in Percy losgetreten, dass unbedingt heraus musste.
„Sicherlich.“, begann ich gedehnt und lehnte mich in meinem Sessel nach vorne. Bei genauerem Hinsehen konnte man da etwas in Percys Visage zerbrechen sehen und ich wollte unbedingt wissen, welches Wunderland hinter diesem Spiegel lag. „Welch glückliche Fügung es doch gewesen ist, dass du einen guten Grund auf dem Silbertablett bekamst, mich endlich loszuwerden.“
„Lügner! Eben noch hast du uns als verantwortungslose Brüder bezeichnet, dabei geht es dir doch kein Stück um Cassy, richtig? Es geht dir nur darum!“, fuhr Percy fort. Er war aufgesprungen und ich konnte deutlich eine dicke Ader an seinem blassen Hals pulsieren sehen. Ich hatte nicht viele Talente, aber Menschen zur Weißglut zu treiben, hatte mir stets sehr gelegen.
„Alles dreht sich darum.“, entgegnete ich laut, „Dir kam Charlies Tod doch gerade recht. Statt durch vier, galt es nur noch durch zwei zu teilen, wie praktisch!“
„Was willst du damit andeuten?“, zischte Percy, dem Tobsuchtsanfall nahe.