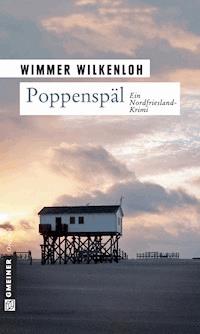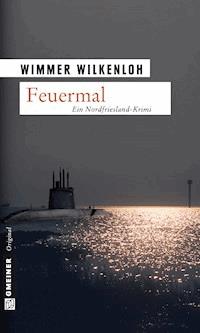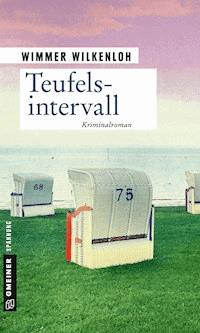Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar Jan Swensen
- Sprache: Deutsch
In der Kirche des kleinen Dorfes Witzwort bei Husum liegt eine grausam zugerichtete weibliche Leiche. Kommissar Jan Swensen gerät schon bald unter Druck: Im Laufe der Ermittlungen werden in verschiedenen Kirchen der Region weitere ermordete Frauen aufgefunden - mehrere von ihnen waren Mitarbeiterinnen eines großen Lebensmittel-Discounters. Das Werk eines Serienmörders? Und welche Verbindung gibt es zu der Frau, die seit einer Herztransplantation von seltsamen Träumen geplagt wird?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cover
Titel
Wimmer Wilkenloh
Eidernebel
Der vierte Fall für Jan Swensen
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2011–Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 07575/2095-0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2011
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Katja Ernst
Korrekturen: Sven Lang, Katja Ernst
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart,
unter Verwendung des Fotos »Schutz vor mehr Meer …
Eidersperrwerk« von: © Sobotta-Photo / fotolia.de
ISBN 978-3-8392-3598-0
Vorwort
Es könnte sein, dass einige meiner Leser geneigt sind, den folgenden Roman in das Genre Mystery einzuordnen. Um dem vorzubeugen, möchte ich ein paar Worte über die neusten Forschungen auf dem Gebiet der Biologie voranschicken.
Es ist nicht lange her, da herrschte bei Naturforschern das einfache Konzept: Alle Organismen, bis hin zu den Organen des Menschen, sind kleine Maschinen. Dieser Glaube ist mittlerweile außer Kraft gesetzt. Die Biologie hat ihre Objektivität aufgehoben, denn selbst die sensationelle Entschlüsselung des menschlichen Genoms hat nicht dazu geführt nachzuvollziehen, wie sich aus den Genen ein fertiger Körper bilden kann. Je mehr heute das Leben auf der Mikroebene studiert wird, desto mehr häufen sich die Beweise, wie komplex und intelligent beispielsweise eine menschliche Zelle arbeitet. Jeder Mensch besitzt 50 bis 100 Billionen davon, und jede einzelne Zelle sucht aktiv nach einer geeigneten Umgebung, die ihr Überleben fördert, das heißt sie wird von einem übergeordneten Wissen zusammengehalten, was für sie gut ist und was ihr schadet.
Seit einigen Jahren treten im Zusammenhang mit der Transplantationsmedizin zunehmend Phänomene auf, die transplantierte Organe nicht nur als ein Stück Fleisch erscheinen lassen. Den Organen scheint eine Erinnerungsfähigkeit innezuwohnen, die bis dahin nur dem Gehirn zugeschrieben wurde. Besonders Organempfänger von Herzen haben nach ihren Operationen von Veränderungen ihrer Persönlichkeit berichtet, die auf den Spender hindeuten.
Das bestätigt die alte These des italienischen Philosophen Eugenio Rignano (1870–1930): Alle Materie, besonders aber lebende Materie, besitzt ein Gedächtnis.
Die folgende Geschichte ist zwar frei erfunden, stützt sich aber auf Erfahrungen, die nach realen Herztransplantationen gemacht wurden.
Das Leben ist unendlich viel seltsamer als irgendetwas, das der menschliche Geist erfinden könnte. Wir würden nicht wagen, die Dinge auszudenken, die in Wirklichkeit bloße Selbstverständlichkeiten unseres Lebens sind.
Sherlock Holmes zu Dr. Watson
In höheren, bewussten Lebensformen entwickelte das Gehirn eine Spezialisierung, die es dem gesamten System ermöglichte, sich auf seine regulatorischen Signale einzuschwingen. Die Evolution des limbischen Systems erzeugte einen einzigartigen Mechanismus, der chemischen Kommunikationssignale in Empfindungen übersetzte, die von allen Zellen der Gemeinschaft wahrgenommen werden konnten. In unserem Bewusstsein erfahren wir diese Signale als Emotionen. Das Bewusstsein nimmt nicht nur den Fluss der koordinierenden Zellsignale wahr, sondern kann auch Emotionen erzeugen, die sich im Nervensystem in Form kontrollierter Freisetzung von regulatorischen Signalen manifestieren.
Zellbiologe Bruce Lipton
Juni 1998
Vor ihm gibt es nichts zu sehen, nur die Leuchtziffern seiner Digitaluhr schweben direkt vor seinen Augen durch den freien Raum. Es ist kurz nach 4 Uhr. Der Mann erhebt sich von der Holzkiste und streckt sich stumm. Seit einigen Stunden ist es stockfinster um ihn herum, selbst durch das kleine vergitterte Fenster zur Straße fällt kein noch so schwaches Licht in den Heizungskeller. Er setzt seine Infrarotbrille auf und ist nicht mehr blind. So erreicht er mit wenigen Schritten problemlos die Eisentür, die ins Treppenhaus führt, öffnet sie mit dem angefertigten Nachschlüssel, drückt sie einen Spalt auf und lauscht hinauf.
Vor einer Stunde hatte er das Gleiche schon einmal gemacht. Aber, obwohl er keinen Laut vernommen hatte, war er sicherheitshalber weiterhin an seinem Platz geblieben. Gegen zwei waren die letzten Schritte und Stimmen im Treppenhaus zu hören gewesen, seitdem ist es still geblieben.
Neben der Tür steht seine Tasche mit dem Spezialequipment. Er hängt sie um und schließt die Tür hinter sich wieder ab. Das Schloss hatte er beim Kommen routinemäßig geölt, jetzt dreht es sich butterweich. Als er die Kellertreppe nach oben steigt, beginnt er leise vor sich hin zu summen: Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Das Lied stammt aus dem uralten Ufa-Film Tanz auf dem Vulkan. Es wird von dem berühmten Gustaf Gründgens gesungen, der den rebellischen Schauspieler Debureau darstellt und zur Nazizeit damit sogar den Zorn von Goebbels auf sich gezogen hatte.
Seit er hier im Westen seine Brötchen verdient, hat er ein Faible für alte Schwarz-Weiß-Filme entwickelt. Tanz auf dem Vulkan lief gestern Vormittag im Fernsehen und seitdem spukt der Ohrwurm unentwegt in seinem Kopf herum:
Wenn die Bürger schlafen geh’n
in der Zipfelmütze
und zu ihrem König fleh’n,
dass er sie beschütze,
zieh’n wir festlich angetan
hin zu den Tavernen.
Schlendrian,
Schlendrian,
unter den Laternen.
Im ersten Stock dringt nirgends Licht unter den Türen hervor. Auch im zweiten Stock ist alles dunkel, alles ruhig. Im dritten Stock geht er sorgfältig von Büro zu Büro, legt ein Ohr an jede Tür und horcht.
Unnötig, alle ausgeflogen. Hier treibt sich niemand mehr herum.
Gleich neben dem Büro für Gebäudeservice liegt das gesuchte Anwaltsbüro Detlef von der Heide.
Na, dann man los, spornt er sich selbst an, was zu geht, geht auch wieder auf. Schlösser knacken ist keine Sache von Kraft, man braucht nur ein halbwegs ruhiges Händchen.
Den Rüttler lässt er unberührt in der Tasche. Seit es diese Erschütterungsmelder gibt, benutzt er keinen Hochleistungsvibrator mehr, der die Sperrstifte des Profilzylinders auf die gleiche Höhe schütteln kann. Der Sputnik dagegen ist ein spezieller Grundschlüssel, der auf drei kleinen Messingbeinen sitzt. Mit denen kann er winzige Drähte aus der Schlüsselleiste ausfahren und vorsichtig auf die Sperrstifte schieben. Der Clou daran ist sein eingebautes Hochleistungsmikrofon, mit dem er das Geräusch wahrnehmen kann, wenn die Drähte aufsetzen. Er setzt die Kopfhörer auf, noch ein Tröpfchen Öl, den Schlüsselteil des Sputnik langsam einführen und die Drähte ausfahren. Das Schloss gibt ohne Widerstand nach. Das Ganze hat keine zehn Minuten gedauert.
Wer rein will, kommt rein. Überall.
Der Mann schiebt die Tür behutsam einen Spalt auf. Es ist immerhin denkbar, dass an der Eingangstür eine Alarmanlage montiert ist. Um das zu checken, stellt er sich auf mindestens 15 Minuten Wartezeit ein, erst dann will er das Büro betreten. Er nimmt die Brille ab, massiert mit den Handballen die Augen und starrt in die plötzliche Finsternis. Nur sein Atem ist zu hören, er geht gleichmäßig und leicht.
Eigentlich kann er diese Aufträge nicht ausstehen, aber sie werden einfach saugut bezahlt. Außerdem lässt er keine Gelegenheit aus, einem untreuen Weib eins auszuwischen. Sein jetziger Klient möchte jedenfalls unbedingt erfahren, was seine Gattin zusammen mit ihrem Scheidungsanwalt über seine Vermögensverhältnisse auskakelt. Im Grunde macht er heute dasselbe wie zu seinen besten DDR-Zeiten. Damals, in seinem ersten Leben, wie er immer zu sagen pflegt. Prompt fluten die Bilder der Erinnerung in sein Bewusstsein.
Er war gerade 19 gewesen und absolvierte den Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee, als er von einem Vorgesetzten zu einer Unterredung in einen Sonderraum abkommandiert wurde. Dort drinnen wurde er von einem Mann empfangen, der eindeutig westliche Klamotten trug.
»Herr Rösener, haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, was Sie in Zukunft gerne mit Ihrem Leben machen wollen?«, fragte der eindringlich und zog demonstrativ an einer Stuyvesant.
»Fußballspielen bei Dynamo Dresden!«, hatte er spontan geantwortet. 1987 wusste jeder Bürger, Dynamo war der Sportklub der Sicherheitskräfte und der Stasi. Der Mann zog eine Verpflichtungserklärung für die Stasi hervor und gab ihm zu verstehen, dass er es nicht bereuen würde, wenn er die jetzt unterschreiben würde. Er überlegte nicht lange, doch aus ihm wurde trotzdem kein begnadeter Fußballer. Da ihm nichts Besseres einfiel, blieb er bei der Firma, wie die Stasi unter Kollegen genannt wurde. Nach einer gründlichen Ausbildung verpflichtete er sich zum Dienst bei der konspirativen Überwachung. Man teilte ihn für die Raststätte Michendorf ein, die letzte Anlaufstelle, bevor die Westler nach West-Berlin kamen.
Während er einen Blick auf seine Digitaluhr wirft, erscheint vor seinem inneren Auge sein damaliger Arbeitsplatz, das alte Gebäude im Landhausstil aus der Nazizeit. Daneben der neue zweistöckige Betonklotz mit dem Intershop, grau wie die gesamte DDR. Das obere Dachgeschoss war Tag und Nacht mit Stasileuten besetzt. Kein Außenstehender wusste, was da oben ablief, nicht mal die Tankwarte, von denen die meisten ebenfalls Informanten waren. Die Stasi hatte immer mindestens zwei Personen in Zivil für die Bodenüberwachung abgestellt. Er ging immer mit einem Tonbandgerät seinem Dienst nach. Sein Westwagen besaß eingebaute Kameras in den Scheinwerfern und mit Richtmikrofonen fing er Gespräche aus verdächtigen Autos auf. An den Zapfsäulen gab es auch Kameras, die er per Fernauslöser bedienen konnte, um Großaufnahmen von einem Überwachten machen zu können. Er sollte die Fahrzeuge aufspüren, in denen Ostdeutsche über die Grenze geschmuggelt wurden. Damals hielt er alle Menschenschmuggler für Kriminelle, schließlich hatte er das von klein auf in der Kinderkrippe gelernt. Er vertrat hier das Gesetz, nicht den Sozialismus. Ideologien waren schon damals nicht seine Sache.
Jetzt sind die 15 Minuten fast um!
Weit und breit ist kein Martinshorn zu hören. Für den Moment fühlt er sich sicher.
Der nächste Schritt steht an!
Der Mann streift die Latexhandschuhe über, setzt die Sichtbrille wieder auf und drückt mit äußerster Vorsicht, im Zeitlupentempo, die Tür weit auf.
Langsame Bewegungen nehmen die meisten Bewegungsmelder nicht wahr!
Er nimmt den Funkwellendetektor aus der Tasche und schaltet ihn ein. Das Gerät zeigt nichts an, er kann sich endlich normal bewegen.
Tür abschließen. Hier drinnen ist er erst mal sicher!
Die Büroräume sind verhältnismäßig groß. Im Eingangsbereich ein breiter Empfangstresen mit Telefonanlage, Computer und Faxgerät. Direkt gegenüber eine kleine Teeküche und drei Toiletten. Am Ende des Flures eine Art Konferenzraum mit breiter Fensterfront. Darin ein Diaprojektor, eine Leinwand und sechs Stühle um einen massiven, rechteckigen Tisch. Daneben das Büro vom Chef, ›Von der Heide‹ steht auf einem kleinen Messingschildchen. Konzentriert inspiziert er den Rest der Räumlichkeiten. Auf dem Schreibtisch ein DeTeWe.
Das dürfte schon bessere Zeiten gesehen haben!
Damit kennt er sich immerhin gut aus, also kein Problem für seine Telefonwanze. Die Schaltknöpfe und Lämpchen des Geräts benötigen fünf Volt Gleichstrom, er kann auf die Akkuwanze verzichten. Hinter der Metallmanschette des Deckenstrahlers verschwindet ein Minisender mit Rundum-Mikro. Neben dem mächtigen Aktenschrank steht ein Kopierer, an der Decke darüber hängt eine Klimaanlage, deren Metallschacht nach draußen führen dürfte. Er klopft die Wand mit einem Schraubenzieher ab, der Schacht geht nach links. Der ideale Platz für eine Linse in einem Glasfaserstrang. Von hier aus hat er den Aktenschrank im Blick. Wenn es darauf ankommt weiß er sofort, aus welcher Akte ein wichtiges Schriftstück verschwinden muss. In den Schacht lassen sich auch gleich der Sender und die Antenne einbauen. Danach kommt der Empfang an die Reihe und den Konferenzraum sollte er aus Sicherheitsgründen nicht auslassen. Ein Glück, dass er dafür genügend Zeit zur Verfügung hat.
*
Wenn ich die nächsten Stunden überleben sollte, wird mein Herz dann wirklich mein eigenes sein, überlegt Lisa Blau. Wird es der gleiche Herzschlag sein, oder wird er für immer etwas Fremdes bleiben, etwas ewig Unbekanntes, das zwar für mich schlägt, mich am Leben hält, sonst aber nicht das Geringste mehr mit mir zu tun hat?
»Liebe Frau Blau!« klingen ihr die beruhigenden Worte von Professor Rollesch in den Ohren nach. Der Chefarzt des Transplantationszentrums des Uniklinikums in Kiel hatte ihre rechte Hand zwischen seine Hände genommen. »Wir sollten uns keine unnötigen Sorgen machen. Eine Herztransplantation gehört heute gewissermaßen zum Standardprogramm einer guten Herz- und Gefäßchirurgie. Stellen Sie sich doch einfach eine Pumpe vor, die nicht mehr ausreichend Wasser fördert. Ihr Herz ist momentan so eine Pumpe. Sie pumpt nicht genügend Blut, damit Sie gut versorgt sind. Die neue Pumpe wird diesen Defekt beseitigen. Danach kann Ihr Leben wieder ganz normal weitergehen.«
Lisa Blaus Finger krallen sich in die Bettdecke, während sie durch endlose Gänge geschoben wird. Den Blick an die Decke gerichtet, schweben kleine Sonnen über sie hinweg, unterbrochen vom surrenden Geräusch der elektronischen Flügeltüren. Dann kommt die Fahrt ins Stocken.
»Wir müssen einen kurzen Moment warten bis die Schleuse zum OP frei wird«, erklärt eine unbekannte Stimme.
Lisa Blau bemerkt, dass sie unwillkürlich ihre Schultern anspannt. Ihr Atmen wird gehetzt, verfolgt von einer Angst, es könne ihr noch kurz vor dem entscheidenden Moment die Luft wegbleiben. Vor ihrem inneren Auge rauschen Bilder wie im Zeitraffer durch ihr Bewusstsein.
Sie kann ihre Ausgelassenheit spüren. Es ist der 4. September 1997, der Abend ihres größten Triumphes. Harald Lehmann und sie haben mit einem hauchdünnen Vorsprung das Ranglistenturnier im Lateinamerikanischen Tanz in Ludwigsburg gewonnen. Wochen harten Trainings und übermäßiger Erschöpfung lagen hinter ihr. Sie sieht sich völlig aufgekratzt in den Flur ihrer Wohnung zurückkommen. Stolz tritt sie vor den Spiegel, um noch einmal ihren roten Rock aus Stretch-Satin und die schwarze Korsage mit den Strasssteinen zu bewundern, als ihr Herz zu rasen beginnt. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, sie hat in der stressgeplagten Vorbereitung zum Turnier eine Lungenentzündung verschleppt. Ihre rechte Hand fasst sich ans Herz. Schmerzverzerrt wankt sie ins Wohnzimmer zum Telefon und sackt, nachdem es ihr gerade noch gelungen ist die Wohnungstür zu öffnen, direkt vor die Füße der Sanitäter. Der Arzt im Rettungswagen lässt sie sofort ins nächste Krankenhaus einweisen. Ihr Zustand bleibt 68 Stunden lang kritisch. Ihre Herzleistung sinkt auf unter 20 Prozent, Diagnose: bakteriell bedingte Herzmuskelentzündung. Trotz gründlicher Untersuchungen kann das Bakterium aber nicht gefunden werden. Glücklicherweise schlägt das Antibiotikum an. Nach vier Wochen hat sich ihr Herz erholt und die Ärzte entlassen sie aus dem Krankenhaus. In den darauf folgenden vier Monaten steigt die Herzleistung wieder auf 70 Prozent an. Der Hausarzt sagt ihr, sie sei jetzt wieder gesund. Sie geht arbeiten und fängt langsam wieder an zu trainieren. Fünf Monate später bricht sie erneut zusammen, diesmal auf der Tanzfläche im Trainingsraum. Ihr Tanztrainer schüttelt sie und spritzt ihr kaltes Wasser ins Gesicht. Die Herzleistung ist abermals auf 20 Prozent abgesackt. An der Uniklinik Kiel wird nach einer Gewebeprobe aus dem Herzmuskel das Parvovirus B19 entdeckt. Die Struktur der Herzmuskelzellen ist bereits so weit verändert, dass diese in naher Zukunft ihre Funktion nicht mehr erfüllen können. Zu guter Letzt würde ihr Herz versagen, die Ärzte raten zu einer Transplantation.
Wieder zu Hause wird sie depressiv, vergräbt sich in ihrem Schlafzimmer, beobachtet stundenlang die Maserungen der Raufasertapete und grübelt ununterbrochen über den Sinn des Lebens nach. Am Ende kommt immer dieselbe Frage: »Warum gerade ich? Wieso ist mir das passiert?«
Am Anfang des nächsten Jahres arbeiten die Nieren nicht mehr richtig, ihre Leberwerte verschlechtern sich rapide. Sie muss sich des Öfteren übergeben, verliert fast zehn Kilo. Ihre Herzleistung sinkt erneut stark ab. Als sie endlich innerlich der Operation zustimmen kann, bricht eine noch schlimmere Phase an. Im Krankenhaus ist sie ans Bett gefesselt, wartet auf die Erlösung, kämpft gegen den Tod an, während sie kaum noch in den Schlaf findet, die Tage und Nächte zählt und die Angst ihr dabei fast die Kehle abschnürt. Der Speiseplan beginnt alle drei Wochen von vorn, sie lässt sich zur Abwechslung ab und zu Essen vom Italiener kommen. Es wird Sommer, gutes Wetter. Die beste Zeit für Menschen, die ein neues Organ brauchen, wird hinter vorgehaltener Hand geflüstert. Die Motorradsaison beginnt. Auch wenn es noch so makaber erscheint, aber sie weiß, ein neues Herz kann nur aus einem hirntoten Körper kommen. Die sterben ja nicht, weil ich ein neues Herz brauche, versucht sie sich zu beruhigen, der Tod lauert überall und irgendwann erwischt es eben auch deinen Herzspender. Doch die Zeit vergeht. Sie ist der Verzweiflung nah.
Das Bett rollt in den OP-Bereich und die Flügeltür schließt mit einem leisen Surren hinter ihr. Es ist 0.27 Uhr. Lisa Blau merkt, dass die Beruhigungstablette sie müde macht. Ihr ist kühl und die runde Lampe, die in der Mitte des Raumes über dem OP-Tisch hängt, wirft grünliches Licht an die hohen Wände. Professor Rollesch steht mit der OP-Schwester rechts neben ihr, zwei weitere Ärzte links. Am Kopfende, zwischen Computern und Monitoren weiß sie den Anästhesisten.
»Atmen Sie ganz ruhig«, hört sie seine tiefe Stimme, und die Kunststoffränder der Sauerstoffmaske drücken um Nase und Mund. Sie spürt einen kurzen Einstich, ihre Augenlider werden unendlich schwer. Ihre Augen schließen sich fast automatisch. Dunkle Nebelschwaben dringen durch ihre Haut, treiben langsam durch ihre Innenwelt, werden von Licht getränkt und legen sich wie eine watteweiße Wolke um ihr Herz.
*
1.17 Uhr. Vor halben Stunde war die Information vom Entnahmearzt aus dem Klinikum Nordfriesland in Husum eingegangen, die OP ist geglückt, das Organ entnommen. Er hat das Herz geprüft und es für gut befunden. In 10 Minuten ist der Hubschrauber in der Luft.
Eine Schwester reicht Professor Rollesch das Skalpell. Der setzt mit einer sicheren Handbewegung einen etwa 25 Zentimeter langen senkrechten Schnitt in Lisa Blaus Brustkorb. Mit einem elektrischen Messer durchtrennt der Chefarzt die nächsten Hautschichten. Durch den Mundschutz dringt der scharfe Geruch verbrannter Hautzellen. Das Brustbein liegt frei, eine Säge frisst sich mit einem hohen Ton durch den unterschiedlich dicken Knochen und trennt ihn genau in der Mitte. Mit einem Gerät, das einem Schraubstock gleicht, biegen die Ärzte von beiden Seiten den Brustkorb auseinander. Danach werden die aufgebogenen Knochen mit einer Thoraxsperre fixiert und während der Chefarzt an der Kurbel dreht, öffnet sich leise knacksend der Brustkorb von Lisa Blau.
Man kann jetzt zehn Zentimeter tief in den Körper sehen, das Herz ist im Blickfeld. Es ist eindeutig viel zu groß und wabbert bei jedem Schlag vor sich hin. In diesem Moment klingelt das Telefon.
»Unser Hubschrauber ist gelandet«, meldet einer aus dem Team, »wir können durchstarten.«
Der Kardiotechniker schiebt daraufhin eine Kanüle in die große Hohlvene der Patientin. Für die nächsten eineinhalb Stunden läuft hellrotes Blut durch die Schläuche der Herz-Lungen-Maschine neben dem OP-Tisch und wird über die Aorta wieder in den Körper von Lisa Blau zurückgepumpt. Ihr Kreislauf ist jetzt ausgelagert. Ihr Herz hat aufgehört zu schlagen. Wie eine dicke, tote Qualle liegt es da.
Der Entnahmearzt, eine blaue Kühltruhe in der Hand, betritt den Operationssaal. Er öffnet den Deckel und zieht eine große, durchsichtige Plastiktüte hervor, darin schwimmt das neue Herz.
»Hier ist euer Goldfisch«, scherzt er lächelnd, »ein kräftiges Superherz, mitten aus dem Leben!«
Professor Rollesch grinst zurück und sieht sich das hellbraune, beinahe farblose Organ aus der Nähe an. Er nimmt die Tüte, schneidet sie über einer flachen Silberschüssel auf, sodass sich das Eiswasser über die Ränder ergießt. Das Herz liegt vor ihm. Mit vier schnellen Schnitten schneidet der Chefarzt das alte Herz heraus. Unwirklich klafft ein großes Loch im leeren Brustkorb.
Wahnsinn, denkt er bei jeder Transplantation erneut, ein Mensch ohne Herz.
Vorsichtig versenkt er das neue Herz in den Hohlraum und näht es mit flinken Fingern an den entscheidenden vier Schnittstellen wieder an. Gleichmäßig summt die Herz-Lungen-Maschine. Das Team ist in äußerster Anspannung, nur das klappernde Besteck ist zu hören. Wie aus dem Jenseits kommen dazwischen die Anweisungen von Rollesch: »Sauger, Tupfer, Nadel, Faden!«
Nebelschwaden werden träge über den braunen Sand geblasen. Dunkelhäutige Menschen gehen ohne Eile über einen weiten Platz. Dazwischen ein Fremdkörper, eine blonde Frau, eindeutig eine Touristin, die jedem hier sofort ins Auge fällt. Unsicher folgt sie den Einheimischen, weiß nicht, wo sie sich befindet, so andersartig und fremd ist alles um sie herum. Nicht weit vor ihr schreitet eine Frau in Sandalen. Ihre Füße sind mit hennaroten Mustern bemalt, die offensichtlich kunstvoll mit der Hand aufgetragen wurden. Ihr tiefschwarzer Zopf hängt zwischen den Schulterblättern herunter. Sie trägt einen dunkelblauen Sari aus Seide, den sie fest um ihre Schulter gezogen hat. Ein Duft von Kardamom und Nelke liegt in der Luft und es riecht nach gekochter Milch. Der gemeinsame Weg zu einer Tempelanlage führt durch ein Spalier stoffüberdachter Karren mit großen Speichenrädern. Die Ladeflächen sind übersät von Nüssen, Bananen und kunstvoll aufgetürmten Orangenbergen. Von den bunten Stoffdächern hängen knallbunte Bonbonketten und Chipstüten herab. Die Händler preisen wortgewaltig ihre Waren, während die beiden Frauen die rosa getünchte Tempelmauer erreichen. In der Mitte befindet sich ein großer, geschwungener Torbogen aus schneeweißem Marmor, dessen silberbeschlagene Tore weit offen stehen. Die Frau im Sari berührt mit ihren Fingerspitzen ehrfürchtig den Rüssel einer Elefantenfigur aus schwarzem Stein. Weitere solche Figuren zieren die Seiten des Eingangsportals.
Trotz des frühen Tages ist es bereits brütend heiß. Der Himmel wirkt übernatürlich Blau. Die Sonne bringt die Marmorornamente zum Erstrahlen, sodass die blonde Touristin unwillkürlich die Augen zusammenkneifen muss. Ein Mann mit bernsteinfarbenem Gesicht und einem großen, roten Turban fordert sie mit Handzeichen auf, die Schuhe auszuziehen. Der Boden im Inneren des Tempels besteht aus einer Art Schachbrettmuster aus schwarzem und weißem Marmor. Er wird bevölkert von einer riesigen Schar zerzauster Ratten mit funkelnden Knopfäugelchen. Überall liegt verstreutes Futter und die Nager knabbern mit unbändigem Appetit an den kleinen safrangelben Reiskugeln oder fressen Getreidekörner aus unzähligen Tontöpfen. In den Ecken stehen rußschwarze Eisenschüsseln, bis zum Rand mit Milch gefüllt. Rundum auf den Rändern hocken dicht an dicht braune Felle, tunken ihre Barthaare ins süße Weiß und schlecken um die Wette. Weiter hinten, unter einem Dach, kochen mehrere Männer in riesigen Töpfen neues Futter.
Seit einer Stunde schlägt das neue Herz mithilfe der Herz-Lungen-Maschine, gefüllt mit dem Blut von Lisa Blau. Langsam verändert sich die blass-weißliche Färbung, die durch die Konservierungsflüssigkeit und den Blutmangel entstanden ist, in ein gesundes Rosa und danach in ein kräftiges Rotbraun. Wartezeit, das ganze Chirurgenteam fällt, kaum dass es auf Hockern Platz genommen hat, in eine Art Halbschlaf. Nach einer viel zu kurzen Zeit holt Professor Rollesch die müde Schar an den OP-Tisch zurück.
»Bybass zurücknehmen!«
Langsam wird die Herz-Lungen-Maschine heruntergefahren. Eine Schrecksekunde, das neue Herz bleibt stehen.
»Paddel! 200Joule!«
Der Chefarzt platziert den Defibrillator. Die anderen Ärzte treten zurück.
»Achtung!«
Der bebende Ton des Tempelgongs lässt den Körper der blonden Frau vibrieren. Sie sieht, wie die Ratten blitzartig in den Löchern des Mauerwerks verschwinden. Eine Gänsehaut kriecht ihr von den Schenkeln den Rücken hinauf. Sie spürt den Blick einer Person in ihrem Nacken, die sich unmittelbar hinter ihr befinden muss. Vor lauter Angst dreht sie ruckartig den Kopf herum, doch es ist kein Mensch zu sehen. Trotzdem ist etwas hinter ihr her, eine physische Bedrohung, die ihr unmittelbar vor die Brust springt. Sie kann einen Körper fühlen, der kein Körper ist. Ihr ist, als hätte eine unsichtbare Hand ihre Schulter gepackt. Aber die Berührung kommt nicht von außen, es ist ein Griff, der sie von innen anfasst, ein Griff der aus ihrem eigenen Herzen kommt. Die blonde Frau will laut schreien.
Im selben Moment holt ein Priester, der im Allerheiligen des Tempels steht, zu einem zweiten Schlag aus. Doch diesmal bleibt der bebende Ton aus, nur ein lautloser Schlag trifft ihren Kopf. Es knackt dumpf, als würde ihr Schädel zerspringen. Ein fürchterlicher Schmerz quillt zähflüssig wie glühende Lava aus den Ritzen ihres Bewusstseins. Sie wird in ein weißes Laken gehüllt, wird durch ein Labyrinth von engen Gassen getragen und auf einem ovalen Hügel abgelegt. Hier liegt sie neben mehreren toten Körpern auf gestapelten Holzstämmen. Eine breite Steintreppe führt zu einem halbmondförmigen Flussbecken hinunter, in dem das Wasser dunkel durch den Schein der Flammen strömt. Die Domra, Leichenverbrenner aus der Kaste der Unberührbaren, entfachen mit nackten Oberkörpern und um die Hüften gewickelten Baumwollstoffen immer neue Feuer. Flammende Holzstücke schleudern Funkenwirbel in die schwarze Nacht. Die Verstorbenen bäumen ihre Glieder ein letztes Mal in der Hitze auf. Der Gestank von kochenden Eingeweiden und verschmortem Fleisch liegt in der Luft. Ihr Körper liegt einsam in einem Kreis von lodernden Scheiterhaufen, die bereits seit Tausenden von Jahren brennen, Tag und Nacht, bis in alle Ewigkeit.
»Ram nam satya hai« – alles ist vergänglich, rezitierten die Trauernden unentwegt das Mantra des Lebens
Ist das alles nur ein Traum?
Bin ich bei der Operation gestorben?
Die taumelnden Feuerzungen vor ihren Augen verblassen. Eine kalte Dunkelheit breitet sich aus. Geisterhafte Stimmen rufen aus der Ferne. Sie hört ihren Namen, erst schwach, dann immer lauter.
»Frau Blau! Wachen Sie auf! Sie haben es geschafft!«
21. Februar 2003
Hauptkommissar Jan Swensen hat schlecht geschlafen. Er ist mehrmals in der Nacht aufgewacht. Annas Haus führt ein Eigenleben, das sich ziemlich konträr von seiner alten Wohnung in Husum verhält. Das Gebälk lässt von Zeit zu Zeit stöhnende Geräusche vernehmen, es ächzt und knackt unter der Last des Reetdachs, besonders wenn draußen ein kräftiger Wind vom Meer herüberbläst. Dazwischen ist es oft beunruhigend still, man könnte sagen totenstill. Nachts ist hier niemand unterwegs, kein Fahrzeug ist weit und breit zu hören. Erst in den frühen Morgenstunden schackern die Elstern und die Raben schicken ihr lautes Krickrack hinterher.
Anna, als notorische Langschläferin, bleiben die ersten Eindrücke eines neuen Tages weitgehend verborgen. Swensen hat heute Morgen keine Lust länger zu warten und schleicht sich aus dem Bett. Auf dem Weg zum Bäcker entdeckt er im Vorgarten die ersten Winterlinge, die ihre gelben Blüten durch die Schneedecke gebohrt haben. Es ist empfindlich kalt, dem Hauptkommissar zieht es die Schultern in die Höhe. Er klappt den Mantelkragen hoch und vergräbt die Hände tief in den Taschen. Am Himmel steht kein Wölkchen, es wird ein strahlender Tag, dank dem Hochdruckgebiet ›Helga‹, wie der Wetterbericht gestern Abend nach der Tagesschau verkündet hat. Der dicke Pullover hält nicht das, was er verspricht. Die Kälte findet ihren Weg durch die grob gestrickte Wolle.
Während der Kommissar die Dorfstraße hinuntermarschiert, grübelt er über die vielen Veränderungen nach, die nach dem Umzug von Husum nach Witzwort sein Leben gründlich auf den Kopf gestellt haben. Manchmal muss er sich über sich selbst wundern, dass er so naiv gewesen war zu denken, der Entschluss, endlich mit Anna zusammenzuwohnen, würde keine Auswirkungen auf ihre Beziehung haben.
Du warst schon immer mehr Eigenbrötler, nie ein wirklicher Gemeinschaftsmensch, denkt er fröstelnd, schaut zum Dach der Kirche hinüber, das mit Raureif überzogen sehnsüchtig auf die warmen Sonnenstrahlen wartet, und betritt den vollen Bäckerladen.
»Moin, Moin, Herr Swensen!«, ruft die mollige Frau hinter dem Tresen lauthals über die Kunden hinweg, die sich fast alle neugierig zu ihm umdrehen. Dem Hauptkommissar ist die herbeigerufene Aufmerksamkeit sichtlich unangenehm.
»Moin, Moin«, antwortet er etwas verlegen.
Im Dorf weiß offensichtlich schon jeder, wer er ist, obwohl er bisher nur mit den unmittelbaren Nachbarn von Anna und der Bäckerin gesprochen hat. Ob er will oder nicht, der fremde Mann aus Husum ist in den Dorffokus geraten und die Anonymität, die selbst eine Kleinstadt bietet, gibt es wohl nicht mehr. Swensen merkt, dass ihm das nicht sonderlich gefällt. Er versucht, sich möglichst unauffällig in die Schlange der Wartenden einzureihen. Doch die Bäckerin lässt, obwohl sie erst die Leute vor ihm bedient, nicht locker.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!