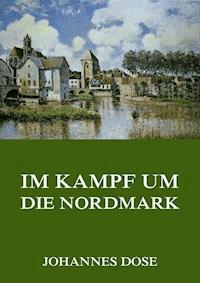Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein alter Afrikaner ist ein klassischer Abenteuerroman im Stile eines Karl May. Dose erzählt von den Abenteuern seiner Helden in Deutsch-Ostafrika, vom Urwald und den gefährlichen Tieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 649
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein alter Afrikaner
Johannes Dose
Inhalt:
Ein alter Afrikaner
Erster Abschnitt.
Zweiter Abschnitt
Dritter Abschnitt.
Vierter Abschnitt.
Fünfter Abschnitt.
Sechster Abschnitt.
Siebenter Abschnitt.
Achter Abschnitt
Neunter Abschnitt
Zehnter Abschnitt.
Elfter Abschnitt
Zwölfter Abschnitt
Dreizehnter Abschnitt
Vierzehnter Abschnitt
Fünfzehnter Abschnitt.
Ein alter Afrikaner, J. Dose
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849628109
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Ein alter Afrikaner
Erster Abschnitt.
Durch das grüne Tal windet sich das murmelnde Flüßchen, aus allen Gärten und Baumhainen lugen die schmucken Landhäuser und locken die weißgedeckten Tische der freundlichen Wirte. Es ist ein liebliches, trauliches Arkadien, das in seiner sonnenglänzenden Lenzschöne eitel Friede atmet und stillfröhlich macht. Und mitten in diesem fröhlich-friedlichen Tal die roten, düstren Häuser, die von der massigen, glasbestreuten Mauer umgeben sind! Ja – wie Widersinn und Widernatur – mitten im Grün der Wiesen, Weiden und Wäldchen, mitten im Blütenschnee der Lusthäuser und Gärten liegt die finstre, verschlossene Stätte des Schreckens und Grauens – die große Strafanstalt F., die einige Tausende der Verlorenen unsres Volks hinter ihren Gittem beherbergt, bewahrt und bewacht. Man betrachtet mit scheuem Blick die häßliche Mauer und die eisernen Tore, man hört keinen Ton noch Laut, es ist eine grabesstille Welt, aus der kein Schrei noch Fluch dringt. Drinnen schlurfen und schleichen die lebendig Begrabenen, die bürgerlich Toten,
Jetzt klingt ein Ton, der einzige in dieser Grabesruhe, der Schlüssel knirscht, die kleine Tür des Eisentores öffnet sich – ein junger, schlank gebauter, sehr gut, ja elegant gekleideter Herr verläßt die Anstalt. Nach seiner äußeren Erscheinung ein hoher Anstaltsbeamter! Aber der säbelbewaffnete Türhüter, der vor jedem Beamten, je nach Stand und Stellung, stramm, strammer und – vor dem Direktor – am strammsten salutiert, legt nicht die Hand an die Mütze, sondern sagt in der schläfrigen Weise, die ihm bei seiner einförmigen Tätigkeit zur Natur wurde: »Glückliche Reis'! Kamen Se man nich wedder to Besök bi uns!« Die ironisch angehauchte, gut gemeinte Mahnung gab er jedem Entlassenen mit auf den Weg.
Der Herr würdigt ihn keines Blicks und eilt mit raschen Schritten aus dem Bereich der Anstalt. Obwohl das seine, hübsche Gesicht in der lehmigen Farbe und dem verbissenen Ausdruck noch einen Stempel der Haft trägt, sieht man sofort, daß dieser entlassene Sträfling den gebildeten und besseren, ja besten Ständen angehört hat. Eine vortreffliche Erziehung und eine gute Kinderstube sollen dem Menschen sozusagen einen character indelebilis, rein äußerlich etwas Unverlierbares verleihen. Die straffe, adrette Körperhaltung verrät den einstigen Sportsmann, vielleicht sogar den Offizier a. D.
Erb von Erbenheim war der Sohn des angesehenen Landgerichtsrats, war einmal Leutnant in einem Artillerieregiment gewesen, beides, Sohn und Leutnant, war er gewesen. Die 20 Monate, die endlosen 600 Tage und die noch endloseren 600 Nächte hatten seinen graden Körper nicht gebeugt und seinen starken Geist nicht gebrochen. Wohl war sein dunkelblondes Haar im Zuchthausschnitt bis auf die Wurzeln geschoren und sein Gesicht von der fahlen Gefängnisfarbe überhaucht, aber, während die tausend Leidensgenossen mit hochgezogenen Schultern wie gekrümmte Sklaven und hüstelnde Schemen durch die Gänge schlichen, war sein Gang fest, seine Haltung aufrecht geblieben in dem ungeheuren Jammer. Obgleich er dulden mußte, daß der letzte, lumpigste Gefängniswärter ihn mit dem barschen Du anschnauzte und en canaille behandelte, war er im Gefängnisdrillich der aufrechte Mann, ja der gebildete Herr geblieben. Mit Verachtung gedachte er der Sklaventreiber. In der furchtbaren Stadt der Verlornen war nur ein einziger Mensch, dem Erb ein dankbares Gedächtnis bewahrte, nämlich der weißhaarige Anstaltspfarrer mit der großen Milde, der gütig, hilfbereit mit ihm gesprochen hatte und selbst den hartgesottenen Zuchthäusler als armes, elendes Menschenkind behandelte.
Die grelle Maiensonne blendete den Wanderer, der die lichtentwöhnten Augen beschattete. Dort wand sich der idyllische Fluß, hier durchschritt er einen hellgrünen Park mit Tulpenbeeten und Gänseblümchen im Grase, mit Hängeweiden und herrlichen Buchen, und er wanderte wie auf einer ganz andren Erde. Zwanzig Schritte hatten ihn in eine neue Welt hineinversetzt, hatten ihn aus dem fürchterlichen Inferno in den wonnigen Garten Eden, aus der toten Steingruft des ewigen Schweigens mitten in die Maienwelt voll Blumenduft, Vogelsang und Blütenschnee entrückt. Alle seine Sinne tranken die Luft des Lenzes, den Duft der Freiheit. Er mußte immerzu starren und staunen und fast sich erschrecken und, schüchtern wie ein Fremdling auf Erden, sich fragen: Bin ich noch ich, oder bin ich ein anderer geworden? Ich bin nicht mehr eine Nummer, ein eingesperrtes wildes Tier, sondern wieder Mensch unter Menschen und von neuem geboren.
Jeder Atemzug berauschte den Entlassenen, der die Wunder mit Auge, Ohr und allen Sinnen gierig trank und ganz benommen und taumelig wurde. Erb fühlte das Bedürfnis, sich zu setzen und nach dem ersten, erschütternden Eindruck sich zu sammeln. Kaum hatte er an einem der vielen leeren Tische einer Gartenwirtschaft Platz genommen, als ein Ganymed im abgegriffenen Frack im Vorbeihuschen »Ein Glas Helles?« murmelte und – da der gedankenvolle Gast nicht gleich antwortete – wie eine Selbstverständlichkeit ein schaumreiches Glas des Germanengetränks hinstellte.
Ohne zu trinken, stierte Erb das Glas an, als wenn er gegen den Inhalt Mißtrauen hege. Plötzlich schob er das Gefäß weit von sich, böse kräuselten sich seine Lippen: Du, du bist mein Feind! Wenn ich nicht den Alkohol, den Rotwein und die zwei Gläser Cliquot kurz vorher getrunken hätte, wäre ich nicht an den Spieltisch getreten, nicht ein Narr ... wäre ich vielleicht nicht ein Sträfling geworden.
Auf dem Nebentisch lag ein fettiges Kartenspiel, das er jetzt erst bemerkte und mit einem feindseligen Blick betrachtete, um plötzlich laut zu rufen: »Kell–ner! Bringen Sie mir eine Flasche Wasser, und nehmen Sie die – die Karten weg – weg!«
Während er unwillkürlich den Karten nachschaute, hielt seine Seele ein Selbstgespräch: Das war mein ärgster, mein Erb- und Erzfeind!
Erbenheim trank den Sauerbrunnen. Die 600 toten Tage zogen an ihm vorüber. O, die Scheußlichkeit und Schande hatte keine Spur von Reue, hatte nichts als verbissenen Grimm erzeugt und mit einem fressenden Haß gegen alles, was Mensch hieß und Kanaille war, sein Hirn erfüllt, sein Herz vergiftet. Ein wahnwitziger Wunsch irrte oft durch seine Gedanken: Wenn ich nur für einen Augenblick die Allmacht in Händen hätte, würde ich mit Hohnlachen die Welt und das ganze Gelichter, das darauf schmarotzt, in tausend Atome zerschmettern. War das Irrsinn? Hatte sein Verstand unter der langen Zellenhaft gelitten? Nein, sein Denken war logisch und klar und sein Gehirn bei dem jähen Sturz aus allen Himmeln in diese Hölle intakt geblieben.
Die grausige Chimäre der Weltvernichtung, womit ohnmächtiger Ingrimm spielt, wurde von dem sanften, freundlichen Bilde des alten, ehrwürdigen Gefängnispastors verdrängt. Heute noch, eine Stunde vor der Entlassung, hatte der Geistliche ihn rufen lassen und beide Hände ihm gereicht mit den Worten: »Sie gehen jetzt wieder in die Welt und Freiheit hinaus, wo Sie hart um Ihre Rehabilitation, vielleicht um Ihre Existenz ringen müssen ... wenn Sie des Beistandes bedürfen, kommen Sie, bitte, sofort zu mir! Wir haben nämlich einen Fürsorgeverein für Entlassene aus den gebildeten Ständen, im letzten Jahre haben wir acht Herren, darunter allein vier Rechtsanwälte, im Auslande, besonders in Argentinien, untergebracht. Ich nehme an, daß Ihr Vater Ihnen helfen wird. Wenn er es aber nicht tun kann oder will, kommen Sie zu mir! Wir bezahlen die Überfahrt und verschaffen einem jeden, so weit es möglich ist, eine bescheidene
Stellung in Amerika oder Afrika. Das unselige Vorurteil gegen einen Unglücklichen, der das Gesetz übertrat, ist ja unausrottbar wie die Sünde ...«
Erbenheim fuhr vom Stuhle empor und den milden Pastor hart an: »Herrrr! Ich übertrat kein Gesetz, ich bin unschuldig verurteilt! Die Richter haben einen Justizmord an mir begangen, alles Gute in mir ist ermordet, vergiftet worden. Ich schwöre bei dem allsehenden Gott – wenn es einen Gott gäbe –, daß ich kein Dieb bin.«
Der Geistliche im weißen Haar sah ihm fest ins Auge und sagte voll Sanftmut: »Von tausend, die hier in meinem Zimmer stehen, schwören fünfhundert, daß sie Opfer der Justiz sind. Mein Freund, was darf ich Ihnen antworten? Ich habe in vielen, vielen, auch in Ihren Augen gelesen, ich möchte an Sie glauben, ja ich will Ihnen glauben, aber ... aber ich kann nicht ein rechtskräftiges Urteil umstoßen.«
Da wischte sich der junge Mann über die Augen. »Ein Mensch möchte gern an meine Unschuld glauben! Ich habe allen Glauben an Gott und Menschen verloren ...«
»Was! Sie wollen mit dem Ewigen rechten!« rief der Geistliche ohne Nachsicht. »Sind Sie frei von Schuld?«
Bei diesem Gespräch verweilten die Gedanken des einsamen Gastes, der an dem Wirtshaustische grübelnd saß. Bin ich frei von Schuld? Nein, das Kartenspiel war mein Verderber und der Wein, der Alkohol, sein Gehilfe, der ihm schändliche Schlepperdienste leistete. Ohne den Sekt hätte ich meine Besonnenheit bewahrt, meinen Vorsatz gehalten, hätte ich den ersten Einsatz nicht gemacht. Die verfluchten Karten, die mir meine Offizierskarriere absägten! Der verruchte Alkohol, der den klügsten Kerl betrügt und den stärksten Kerl besiegt!
Wiederum streifte ein finstrer Blick das unberührte Bierglas. »Kell–ner! Nehmen Sie das schale Zeug fort! Ich will zahlen. Noch eine gute Zigarre!« Er, der Exsträfling, hatte Geld in der Tasche, ehrlich verdientes Geld, den Arbeitsverdienst des Gefängnisses, wo die paar lumpigen Pfennige in 20 langen Monaten zu blanken Talern werden.
O, mit einem unbeschreiblichen Behagen gab er sich dem schmerzlich entbehrten Tabakgenusse hin. Die erste Zigarre verschaffte ihm seit zwei Jahren die erste wahre Daseinsfreude!
Er ging zu Fuß durch die Vororte und in die große Stadt hinein. Es war ihm schauerlich, seinem Vater und seiner Mutter unter die Augen zu treten. Um den gefürchteten Augenblick hinauszuschieben, fuhr er nicht mit der Straßenbahn. In der Wielandstraße wohnten seine Eltern. Sein Fuß stockte, sein Blut stieg, sein Auge irrte scheu nach den Fenstern hinüber. Dort stand das vornehme, zweistöckige Mietshaus, dessen Oberstock der Landgerichtsrat bewohnte. Diesseits der Straße war der Wielandpark, ein kleiner, hochfeiner Schmuckpark, dem weder der plätschernde Springbrunnen, noch der unter tiefhängenden Weiden träumende Weiher, weder der vielfarbige Blumenteppich, noch der kurz rasierte Rasen fehlte. Die Kunst des Stadtgärtners hatte ihr Bestes und der Zauberer Lenz hatte das Meiste getan, um den Park zu einem Prunkstück, einem Paradies en miniature zu machen, allwo hochwohlerzogene Kinder, von der Bonne behütet, mit hochsauberen Kiesstücken spielten.
Erb von Erbenheim drückte sich auf eine Bank, um den häßlichen Moment hinauszuschieben. Ach, solch ein vornehmes, aber heiteres Paradies war seine Kindheit gewesen. Weder Krankheit noch Zeugnisnot noch Nichtversetzungskummer hatten je das Glück seiner Jugend getrübt. Als einziges Kind des Landrichters hatte er die Domschule von seinem neunten Jahre an besucht und von seinem neunten Jahre an gesagt, daß er Offizier werden wolle. Der Vater hatte die frühe Berufswahl seinem Sohn zu verleiden versucht, jedoch umsonst. Der kerngesunde, in allen Leibesübungen tüchtige Knabe fühlte sich schon in der Quinta zum Soldaten berufen, und die Mutter bestärkte ihren Liebling in seinen Vorsätzen. Erb hatte die Klassen erledigt, das Reifezeugnis erlangt und die Offizierswahl getroffen.
Worauf der Vater kurz nickte und lang rechnete. »Wir besitzen nur ein sehr kleines Vermögen, du mußt mit einer kleinen Zulage hauszuhalten verstehen. Ich will nicht versuchen, gegen den lauten Willen meines Sohnes, gegen den leisen Wunsch meines Weibes mich aufzulehnen, die Epauletten haben von jeher junge Männer- und Frauenherzen – und auch die alten, nicht wahr, meine Martha? – verlockt ...«
»Das Äußere hat meinen Entschluß nicht beeinflußt ... ich werde mit Leib und Seele Offizier sein.«
»Auch darin wirst du leider ein rechter Offizier sein, daß du, wie sie alle, Schulden machen wirst.«
»Nein, nie ...«
»Sei still und höre mich an und vergiß nie – hörst du? – niemals, was ich dir einschärfe! Einmal, wohlgemerkt, das erste und einzige Mal werde ich deine Schulden, wofern sie 3000 Mark nicht übersteigen, bezahlen und unser kleines Kapital angreifen, aber nie, nie wieder ... und wenn du den Rock ausziehen müßtest, ich werde im Wiederholungsfalle völlig unerbittlich bleiben. Das sprich dir alle Tage vor ... nur das versprich mir!«
»Vater, ich verspreche dir, daß ich keine Schulden mache.«
Erb von Erbenheim war mit zwanzig Jahren Leutnant in einem Artillerieregiment. Im Kasino ein sehr beliebter Kamerad, in Gesellschaften und auf Bällen ein schöner, schneidiger Leutnant und im Dienst ein sehr eifriger Offizier, dem man die Adjutantur oder gar den Generalstab prophezeite. Nach einem Jahre beichtete er der Mutter, daß Bank gehalten worden und von ihm ein Wechsel über 2400 Mark ausgestellt worden sei. Der Landrichter runzelte nur die Stirn, sagte kein Wort des Vorwurfs, verkaufte zwei Konsols und zahlte mit scheinbarer Ruhe seinem Sohne das Geld aus. Nur beim Abschiede sagte er mit sehr harter Stimme: »Du weißt, es ist das erste und letzte Mal. Wenn du wieder querschreibst, so schreibst du dem Offizier das Todesurteil. Dixi.«
Der junge Leutnant kehrte in seine Garnison zurück, lebte sehr zurückgezogen seinem Dienst und seinen Studien und hatte gute Aussicht, auf die Kriegsakademie zu kommen. In elf Monaten hatte er so solide gelebt, daß er sich von seiner Zulage 300 Mark ersparte. Da kam der lustigste Tag im Leben des deutschen Soldaten, der Geburtstag des Kaisers, und nach dem frohen Tage kam die traurige Unglücksnacht. Zu Ehren des höchsten Kriegsherrn war scharf getoastet und getrunken worden, jeder wahre Patriot mußte sein Räuschlein haben. Morgens um drei Uhr saßen elf Herren im diskreten Hinterzimmer, und Graf H. hielt Bank. Erb hatte viel Sekt getrunken, und der prächtige, prickelnde Göttertrank steigerte alle Kräfte und stärkte den Mut, schwächte aber seltsamer- und argerweise das Gedächtnis, so daß das eindringliche Wort des Vaters wie weggeblasen war. Freundlich aufgefordert, eine Kleinigkeit zu setzen, zog er die ersparten 300 Mark aus der Tasche, denn das war sein persönliches Eigentum. Bis vier Uhr hatte er die doppelte Summe gewonnen. Dann kehrte Fortuna ihm beharrlich und höhnisch den Rücken zu. Als er um zehn Uhr im Bett erwachte, packte ihn das entsetzliche Gefühl des Versinkens, der Vernichtung. Er hatte Ehrenschulden gemacht und dem Grafen H. Wechsel gegeben.
Seine Mutter weinte und flehte und wollte auf ihr kleines Versorgungskapital verzichten. Jedoch der Vater runzelte sehr tief die Stirn und sagte nur nein, nichts als das kalte, harte, unerbittliche Nein. Erb mußte seinen Abschied nehmen. Sein Oberst schüttelte bekümmert das Haupt: Himmelschade um den Menschen! Ein Jahr der Allersolideste, bricht er sich in einer betrunkenen Nacht den Hals. Das ist von meinen Kameraden der vierzehnte, der um die Ecke geht. Der Schuft, der die Karten erfand, müßte viviseziert werden. Wenn's der Graf H. gewesen wäre! Der Kerl ist mir nicht koscher, ich glaube, er korrigiert das Glück.
Nach einem Jahre wurde Graf H. ohne Uniform entlassen, und in Spa, wo er mit präparierten Karten spielte, starb er im Gefängnis an Gift.
Der zweiundzwanzigjährige Offizier a. D. hörte aus dem Munde des Landrichters keinen Vorwurf, sondern nur die kühle Frage: »Was willst du jetzt beginnen?«
»Ich will mir eine Tretmühle suchen, wo ich mir baldmöglichst mein Brot verdienen kann.«
Der Vater hatte gute Beziehungen in der Handelsstadt, sein Sohn wurde von dem alten Handelshause Vermehren u. Comp. zunächst als Volontär angenommen und an ein Stehpult gestellt. Der eine Chef sagte zu dem andem: »Wenn er nicht zu gebrauchen ist, lassen wir den Herrn Leutnant Kopien und Durchschläge machen, und wir sparen einen Schreiber.« –
Stunde um Stunde saß Erb im Park angesichts des Elternhauses und graute sich vor dem Wiedersehen. Sein Leben in den letzten vier Jahren zog vorüber. Das alte Patrizier- und Großkaufmannsgeschlecht Vermehren war im Mannesstamm ausgestorben und stand nur noch auf den zwei spitzen Augen des dreiundsechzigjährigen Fräuleins Vermehren, das keine Leibeserben, wohl aber etliche Millionen hinterließ und längst dafür Sorge getragen hatte, daß die Firma weiter bestand und der berühmte Name nicht mit ihr erlosch. Das Haus, das bedeutenden Ex- und Import hatte, seine eigene Rederei und große Salpeterlager in Chile besaß, war eine offene Handelsgesellschaft, und die früheren, langjährigen Prokuristen, die zwei Herren, die spaßigerweise Bengel und Engel hießen, waren die Geschäftsinhaber, die zum größten Teil mit dem Gelde der reichen Dame arbeiteten und hohe Nettoerträge erzielten. Die zwei Herren lebten in Eintracht und Harmonie, obgleich sie äußerlich und innerlich die schroffsten Gegensätze waren. Herr Bengel, ein behäbiger, freundlicher, guter Mann mit einer sanften Pastorstimme, hätte den engelhaften Namen mit mehr Recht verdient, als sein Sozius, der glatt rasierte, dürre, energische Herr Engel, der ein scharfer Besen und der gefürchtete Chef des Hauses war. Nie hatte man ihn lachen hören, und sein schmales Lächeln war meist eine spöttische Grimasse. Wenn er mit seinen stechenden Augen über die Brille hinwegschielte und wie ein brüllender Löwe, der einen Sünder sucht, um ihn zu verschlingen, durch die Kontore schritt, dann wurden alle Leute stillemsig, und die kratzenden Federn flogen über das Papier. Wehe einem jeden, der seine Pflicht nicht tat oder Schreibmaterialien, eine Feder oder einen Fetzen Papier, verschwendete! Die von ihm verfaßte Haus- und Geschäftsordnung unterschied Versehen und Vergehen. Wer ein Versehen beging, wurde mit einer Geldbuße zugunsten der Versorgungskasse bestraft; wer aber eines Vergehens sich schuldig machte, flog aus dem Hause, denn Herr Engel war ein höchst gestrenger Herr. Freilich wurde der Sünder, der den Herrn Bengel vor der Börse abfaßte und um Gnade anflehte, meistens nach drei Tagen wieder aufgenommen.
Der Leutnant a. D. war nicht lange Kopist gewesen, hatte sich überraschend schnell hineingearbeitet und war mit immer regerem Interesse, zuletzt mit Leib und Seele Kaufmann geworden. Die vielseitigen, fein verschlungenen Geschäfte eines großen Ex- und Importhauses, das in Amerika und Afrika seine Vertreter, überall seine Fäden und Fühler hat, sind in ihrer Art eine Wissenschaft und Kunst, die nicht bloß einen scharfen Verstand, eine blitzschnelle Initiative, die große Klugheit und die große Kühnheit eines ganzen Mannes, sondern auch die höhere Inspiration und den prophetischen Weitblick des königlichen Kaufmanns erfordern. Die stechenden Augen des Herrn Engel hatten wochenlang den neuen Volontär, den entgleisten Offizier, der zweifellos ein Schuldenmacher und Luftikus sei, mit tiefem Mißtrauen beobachtet, hatten aber beim besten Willen keinen Anlaß zum Tadel finden können, so daß der argwöhnische Ausdruck zum erstaunten Glotzen und das Erstaunen allmählich zu einem Gränchen Wohlwollen wurde. Der junge Erbenheim hatte eine Eroberung gemacht, die keinem Sterblichen gelungen war. Weil er nicht, wie die meisten Angestellten, eine bloße, menschliche, auf zwei Beinen montierte Schreib-, Kopier- und Rechenmaschine, sondern mit Seele und Geist, als wenn der Gewinn in seine Tasche flösse, bei der Sache war, hatte er das Zutrauen des herrschgewaltigen Chefs in solchem Maße gewonnen, daß dieser ihm die wichtigsten Arbeiten und sekretesten Korrespondenzen übertrug. Das Ansehen des Offiziers a. D., aber auch der Neid der vielen Bureauseelen war rasch, ja rapide gewachsen. Gewiß, dieser von Erbenheim war kein Ohrenbläser, sondern ein anständiger Kerl, aber man konnte es ihm nicht verzeihen, daß er als jüngster Kollege solche Stellung einnahm, daß er sogar die Sympathie des Fräuleins Vermehren durch einen infamen Glückszufall sich erworben hatte. Diese Dame nämlich war durch ihre stille Teilhaberschaft die allerhöchste Respektsperson des Geschäftshauses. Wenn sie würdevoll, von ihrer Gesellschafterin und ihrem Köter begleitet, durch die Kontorstuben spazierte und mit scharfen Blicken alles kontrollierte, mußte sogar der großmächtige Herr Engel in Ehrfurcht ersterben und den gehorsamen Diener machen, um die Geldtante sich warm zu halten. Der Glückspilz von Erbenheim hatte sogar den Weg zum Herzen dieser allmächtigen Dame gefunden. Durch einen verrückten Zufall, durch eine ritterliche Aufmerksamkeit war das Fräulein seine Gönnerin geworden.
Als die Dame eines Vormittags über den Erwerb eines Salpeterlagers verhandelt hatte und mit ihrer Gesellschafterin und ihrem Hunde das Geschäftshaus verließ, war die böse Dogge des Großschlächters, der eigene Equipage hielt, über das hochmütig knurrende King-Charles-Hündchen hergefallen. O, in dem Riesenmaule hing das zeternde, zornig geschüttelte Tierchen; die Herrin kreischte laut und schrie: »Schutz-mann, Schutz-mann!« Ein Schutzmann, der grundsätzlich nie da ist, wo nach ihm geschrien wird, kam nicht, aber Herr Erbenheim sprang in Sätzen die Treppe hinunter, versetzte der Dogge einen wuchtigen Fausthieb, riß und rettete das Schoßhündchen aus dem Raubtierfange.
Das Fräulein wimmerte und weinte: »Mein Ami, mein Ami stirbt mir!« Das Tierchen hatte nämlich eine ungefährliche Rißwunde, aber das schneeweiße Fell war rot von Blut und das Fräulein durch diesen Anblick einer Ohnmacht nahe. Erbenheim lief in die Apotheke drüben nach Sublimat, wusch die Wunde des Hundes, der seinen Samariter anknurrte, legte einen Verband an und trug den blessierten Ami in den Wagen, wo er ihm auf der Pelzdecke ein weiches Wundbett bereitete. Durch diesen raschen Ritterdienst hatte er das Herz der alten Dame, so viel davon noch gegen die hageren Rippen schlug, im Sturm genommen.
Gerührt gab sie ihm die Hand, die er küßte, und im Ton gnädiger Erlaubnis flüsterte ihr herber Mund: »Sie müssen mich besuchen an der Fernsicht ... zwischen 12 und 2 Uhr!«
Als das ruchbar wurde, standen alle Federn und alle Zungen vor Bestürzung still, bis sie zu tuscheln begannen. Solches war ja, solange die Welt und das Haus Vermehren am Fleet stand, noch nie vorgekommen, daß ein Angestellter, ein Korrespondent und nicht einmal Prokurist, von dem Fräulein empfangen wurde. Die alte Dame hatte nicht im Affekt der Dankbarkeit übereilt gehandelt, sondern reiflich erwogen, daß der junge Erbenheim von Adel sei, als Sohn des Landgerichtsrats zwar nicht den besten – den Markmillionären – oder gar den allerbesten – den Talermillionären –, wohl aber den besseren Familien der Großstadt zuzuzählen und daher in ihrer vornehmen Villa empfangsfähig sei.
Der Glückspilz besaß genug Klugheit und Geschäftsgeist, um die Konjunktur auszunutzen, um das warme Eisen zu schmieden und in der Gunst der Dame, der Hauptaktionärin, sich festzusetzen. Freudig seine karge Mittagspause opfernd, war er zum ersten Male im Frack erschienen, dann immer öfter im Smoking und Gehrock gekommen und zuletzt ein- bis zweimal alle Woche ein gern gesehener Gast des Hauses, das von außen eine hochfeine Villa, inwendig aber mit lauter alten, echt verbürgten, strengklassischen Gemälden, mit allen möglichen und unmöglichen Kunstsachen und Antiquitäten bis zum Dache vollgestopft war und in seinen meisten Räumen weit mehr einem Museum und einer Rumpelkammer als einer menschlichen Wohnung ähnelte.
Treu und immer treuer machte Erbenheim seine Besuche in der Villa, mit ritterlicher Selbstüberwindung drückte er die feuchtkalten Finger des Fräuleins an seine Lippen. Liebte er die alltägliche Unterhaltung der Dame? Oder spann er tollkühne Träume, worin er sich des Fräuleins Liebe in solchem Maße errang, daß sie ihn in ihrem Testament mit 300 000 Mark bedachte oder ihm die Möglichkeit gab, ein Mitinhaber der offenen Handelsgesellschaft Vermehren & Comp. zu werden? Solche grotesken Träume sollen in den Bureaus der großen Handelshäuser von den Lehrlingen und jungen Leuten, wenn die geistesabwesenden Augen über das Papier hinweg ins ferne Utopieland schweifen, viel und fleißig geträumt werden. Aber der Offizier a.D., der eine bitterböse Enttäuschung hinter sich hatte, träumte nicht, spielte nie mit törichten Illusionen.
Nicht um der alten Antiquitäten-Tante willen – wie böse Zungen das sammelwütige Fräulein nannten – wanderte er nach der Fernsicht, nein, in dem Hause mit der recht antiken Besitzerin und den Kunstschätzen war ein lebendiges Kunst- und Meisterwerk, das ihn lockte und nicht losließ, das er immer höher und heißer bewerten, bewundern, bestaunen mußte. Mitten unter den etwas muffigen und verblaßten Kostbarkeiten des Mittelalters webte und schwebte, lächelte, lebte und leibte das volle, frische Leben. Hinter dem alten, grämlichen, dürren Fräulein stand die leibhaftige Jugend und Schönheit. Das war die junge, schmucke, schüchterne Ella Ritterhus, die mit ihrem scheuen, süßen Blick ihm ins Herz gedrungen, ja geflogen war. Im Fluge war's gekommen. Das graziöse Mädchen mit dem vollkommenen Ebenmaß des Gesichts und der Gestalt hatte sofort einen ungeheuren, unwiderstehlichen, ihm selbst unfaßbaren Eindruck auf ihn, den früher von Frauen verwöhnten Offizier und darum kritischen Mann, gemacht.
Diese Ella Ritterhus spielte die vielseitige und vielgeplagte Rolle einer Gesellschafterin, war aber die einzige nähere Verwandte, ja die leibliche, durch Kirchenbücher und Standesamtregister als echt beglaubigte Nichte des Fräuleins Vermehren. Die alte Dame nämlich, stets auf der Hut vor Erbschleichern und Erbschleicherinnen, hatte zuerst alle kirchlichen und staatlichen Geburts- und Eheurkunden eingefordert und genau geprüft, ehe sie ihre neu entdeckte Nichte anerkannt und als Stütze ihres Alters ins Haus genommen hatte. Fräulein Vermehren besaß keinen Bruder, wohl aber eine Schwester, Mathilde mit Namen, die schon als Kind das kecke, eigenwillige enfant terrible gewesen und schließlich-selbstverständlich das räudige und verlorene Schaf der hochehrbaren Familie geworden war; denn diese Mathilde ging mit achtzehn Jahren gegen den Willen der Eltern nach Helgoland, um einen Schauspieler Ritterhus, der am Stadttheater kleine, obskure Rollen spielte und zwei bis drei Sätze sprach, zu heiraten, ja zu heiraten! Bei dem Gedanken lief noch immer über Fräulein Vermehrens Rücken eine Gänsehaut und ein Gruseln. Der Komödiant wurde von der stolzen Patrizierfamilie nie als Schwiegersohn anerkannt, Mathilde war, nachdem sie 5000 Kuranttaler als Abfindungssumme erhalten und allen weiteren Ansprüchen für sich und ihre Rechtsnachfolger durch notariellen Akt entsagt hatte, mit ihrem sauberen Gatten in die weite Welt gegangen und verschollen. »Den elenden Mammon, der euer Götze und Unglück ist, will ich euch gern lassen!« Das war ihr letztes, spöttisch lachendes Wort gewesen. Doch sie hat in dem bösen Leben das Lachen gründlich verlernt. Ihr windiger Herr Gemahl verschwand, nachdem die 5000 Taler verjuchheit waren, und ist nie mehr von Weib und Kind gesehen worden. Doch Mathilde war in der Not eine starke Frau, die sich und ihr Mägdlein ehrlich und mit Ausdauer ernährte; ja sie hat es durch Sparsamkeit und Energie erreicht, daß ihre Ella das Lehrerinnenseminar bezog; denn es war ihr höchster Herzenswunsch, daß ihr Kind, durch der Mutter Unglück gewitzigt, nicht in eine unselige Ehe hineinlaufe, sondern sicher und selbständig durchs Leben schreite. Dann starb sie, just als der Kampf zu Ende war und die guten Tage kommen sollten. Auf die Minute ausgerechnet, just an dem Tage, wo die Tochter erregt eintrat und der Schwerkranken ihr gut bestandenes Examen meldete, schloß sie die müden Augen zum langen Schlaf. Ella hatte ein paar Jahre als Lehrerin auf eignen Füßen gestanden, als plötzlich das reiche Fräulein ihre Existenz entdeckte, nach sorgfältiger Prüfung aller Urkunden die Gewißheit erlangte, daß besagte Ritterhus ein echtes und eheliches Kind ihrer seligen Schwester sei, und ihre einzige Verwandte zu sich ins Haus nahm.
Besonders im Anfang des Zusammenlebens, wenn die Launen und Schrullen der alten Jungfer unerträglich wurden, riß dem sanftmütigen, fügsamen Mädchen die große Geduld, und es forderte mit Ruhe seine Entlassung. Dann schrie die Tante entsetzt: »Bedenke, daß du meine Haupterbin bist! Willst du dein Glück verscherzen?« Diese Beschwörung hatte keine Wirkung, Ella fing an ihre Koffer zu packen. Sofort lief das alte Fräulein ihr lamentierend nach, und die hellen Tränen liefen über die dürren Wangen. »Willst du deine arme, alte Tante, die einzige Schwester deiner seligen Mutter, verlassen, allein lassen?« Das hatte bessere Wirkung und rührte Ella. Die alte Person, die trotz ihres Reichtums keinen Freund, kein Menschenherz besaß, tat ihr leid, und sie blieb. Allmählich hatten die Frauen sich aneinander gewöhnt, die schärfsten Ecken wurden abgeschliffen. Wohl konnte die Millionärin, vor der die Domestiken und alle andren Bedientenseelen dienerten und sich duckten, es nicht lassen, ihre Nichte zu tyrannisieren, jedoch es waren nur kleine Bosheiten und Nadelstiche, und wenn Ella die eisige Miene machte, legte sie schnell ein Pflaster auf die Wunde, um ihre Ungezogenheiten durch Geschenke wettzumachen.
Fräulein Vermehren konnte ihre Ella nicht mehr entbehren, während die sanfte und doch selbstsichere Nichte wußte, daß sie sehr wohl ohne die Tante existieren könne. So war das Verhältnis, als der junge Kaufmann die Antiquitätenvilla betrat.
Der Grübler auf der Bank des Wielandparks war nicht wiederzuerkennen. So groß war die Veränderung seiner Züge, daß es ein ganz anderes Gesicht zu sein schien. Die gefurchte Stirn hatte sich geglättet, die verbissenen Lippen des höhnischen Misanthropen waren voll geworden, so daß der schön geschwungene Amorbogen hervortrat, ja ein stilles, sonniges Lächeln spielte auf dem Antlitz, dem die Strafanstalt nicht mehr ihr furchtbares Stigma aufdrückte. Erb schmeckte und kostete noch einmal den ersten Kuß, den er von Ellas Lippen in scheuer Hingabe, heimlich hinter dem mächtigen Schrank mit den Elfenbeinintarsien erhalten hatte. O, darum war sein Mund so voll und verlangend, wie in jenen glücklichen Tagen der ersten, erwiderten Liebe.
Sofort beim ersten Er- und Anblicken packte es ihn wie eine höhere Gewalt: Das ist die mir vom Glück Bestimmte! Das ist die Eine, die ich im Traume, im Geiste gesehen, oder die ich schon in einer Präexistenz, in einem früheren Dasein, gekannt, geliebt haben muß.
Doch der junge Besucher merkte sehr bald, daß er der jungen Dame beileibe nicht unter den Argusaugen der alten die Kur machen dürfe. Wenn er Fräulein Ritterhus eine kleine Aufmerksamkeit erwies, machte die Herrin das spitzige Gesicht, dann die spitze Nase und zuletzt die gespitzten Augen, was ein Zeichen ihres steigenden Mißfallens war und allen, sogar dem autokratischen Herrn Engel, Furcht einflößte. Fräulein Vermehren duldete durchaus nicht, daß Herr von Erbenheim ihrer Nichte, wohl aber, daß er ihr selbst kleine Kourtoisien erwies. Ja, sie griff gierig nach dem Strauß, den der ritterliche Herr ihr brachte, und kraft des Gewohnheitsrechts betrachtete sie bald dieses Bukett, das ihm eine ärgerliche Geldausgabe war, als Pflicht. Mit der langen Nase nach den Blumen stochernd, lächelte sie kokett mit den großen, künstlichen Zähnen, lispelte sie den Dank: »Man merkt's, daß Sie Offizier gewesen und Kavalier geblieben sind.«
Ein etwas deplacierter Dank, sofern jede Erinnerung an sein Offiziertum ihm recht peinlich war.
Vor dem Auge des Träumers drängten sich die sonnigen, seligen Bilder. War ein kalter, trüber Nebelsonntag und doch ein Sonnentag seines Lebens, als er aus dem Strauße die allerschönste Rose zurückbehielt, unter dem Rockschoße versteckte und, sobald die Herrin sich über das Hundelager beugte, Ella mit einem beichtenden, bittenden, viel- ja allessagenden Blick überreichte. Das Mädchen, glutrot im Gesicht, hatte die Blume mit zittriger Hand genommen, hinter sich gehalten und geschwind im Nebenzimmer in Sicherheit gebracht. Er hätte die Kühnheit, die eine Erklärung war, nicht gewagt, wenn er nicht in ihrem leisen Erglühen, sobald er eintrat, eine scheue Zuneigung gelesen hätte. Ach, der Pfeil und Funke Amors war auch in ihr reines Herz hineingefahren. Wo waren nun die harten Urteile und die ernsten Mahnungen der seligen Mutter, die das männliche, starke Geschlecht ein schwächliches, klägliches, charakterloses Gezücht genannt und ihr Kind eindringlich vor dem Mann gewarnt hatte? Vergessen, verweht waren die Worte der teuren Toten.
Die Blumenzwiesprache der beiden, die verstohlene Rede der Blicke, die hinter dem Rücken der Tante hin- und herflogen, wurde ein paar Wochen fortgesetzt. Dann war am Stiel der Rose ein winziges Brieflein befestigt. Ella versteckte, Blume und Brief zerknitternd, beides an ihrem Busen. Erb hatte seine Liebe bekannt und kühn um ein Stelldichein und eine mündliche Antwort gebeten.
Fräulein Vermehren hielt alle Tage von drei bis vier Uhr ein Mittagsschläfchen, und das war die einzige Tagesstunde, wo die Nichte ohne Aufsicht war. Ella hatte die ganze Nacht gewacht, geweint, gebetet, gekämpft und gerungen und dennoch keine Minute lang geschwankt, sondern von Anfang an gefühlt, daß sie gehen müsse. Das Mägdlein gehorchte der Gewalt und Großmacht, der alles Menschentum unterworfen ist. Schlau bereitete sie den heimlichen Gang vor. Wenn der Köter kläffte, erwachte die Tante vorzeitig und schrie: »Ella, Ella, achte auf das arme Tierchen!« Darum nahm Ella den Hund auf den Arm, hielt ihm die Schnauze zu, bis sie außer Hörweite war, und so wurde Ami der zum Glück stumme Augenzeuge des Stelldicheins. Erb saß auf der Bank am prächtigen Parkufer des zum See gestauten Flusses und sprang ihr elastisch-eilig entgegen.
Das junge Mädchen konnte vor Bewegung kein Wort sprechen und hat ihm dennoch mit dem Munde viel mündliche und gründliche Antwort gegeben.
Wie oft hatten sie seitdem, selbst an eiskalten Wintertagen, mit glühenden Wangen und heißen Herzen auf der Bank gesessen, wie weltallein und selbstversunken waren sie gewesen.
Aber – aber! Die dumme, diabolische Tücke des Zufalls spielte den Liebenden einen üblen Streich. Die ekelhafte Ursache des Mißgeschicks war eine unverschämte Fliege, die so beharrlich-boshaft die spitze Nase des schlafenden Fräuleins kitzelte, daß die Dame zwölfmal mit der Hand ausschlug und zum dreizehnten Male wütend auf die Füße sprang, um mit der Fliegenklatsche die kleine Bestie zu morden und zu Brei zu quetschen. Wehe, wehe, wo war Ami der Einzige? Sein Lager leer! Fräulein Vermehrens Stimme schrillte durch das Haus. Die gerufene Magd grinste, daß »Fräulein« mit dem Hunde ausgegangen sei. Die alte Dame hatte eine atemraubende Ahnung, daß etwas Unerhörtes, Unmoralisches im Gange sei.
Um so ahnungsloser saßen die beiden Liebenden Hand in Hand, Schulter an Schulter. Da glaubten sie plötzlich einen Geist, ein Gespenst am hellen Tage zu sehen – Fräulein Vermehren stand, wie ein diabolus, richtiger eine diabola, ex machina vor ihnen und starrte sie an. Noch nie war ihr Gesicht, ihre Nase so nadelspitz gewesen. Erbost sagte die Tante: »Sie dürfen mein Haus nie mehr betreten, um hinter meinem Rücken meine unschuldige Nichte zu verführen.«
Ella hatte ihre Fassung gewonnen und protestierte energisch: »Ich bin weder verleitet noch ver-verführt worden, sondern ich liebe Erbenheim, wir haben uns verlobt und werden nicht voneinander lassen.«
»Du Närrin! Ich werde dich enterben ... Zwei bis drei Millionen willst du verscherzen ... die wären dir nach meinem Testamente zugefallen ... du wirst nichts, gar nichts bekommen, wenn du ...«
»Ich habe nie Ihr Geld begehrt,« sagte Ella kalt, »und werde noch heute Ihr Haus verlassen.«
»Und der Mosjö die Firma Vermehren!« Nach dieser Drohung zog die alte Dame schleunig andere Saiten auf; denn sie wollte Ella um keinen Preis entbehren. »Wir wollen zu Hause ruhig die Sache besprechen.«
Fräulein Vermehren machte ein Kompromiß und stellte in hinterlistiger Hoffnung die eine Bedingung: Ein Jahr lang dürfe Ella den Herrn von Erbenheim nicht sehen noch sprechen, auch nicht ein einziges Mal ihm schreiben. Das solle der Prüfstein sein, ob ihre Liebe lauter und standhaft sei. Wenn die Nichte diese Bedingung erfülle, werde die Tante mit sich reden lassen, d. h. sie legte ein hartes Joch auf und verpflichtete sich eigentlich zu nichts. Ella, die an Erbenheims Zukunft dachte, ging etwas vorschnell darauf ein. Die alte Dame glaubte bestimmt, daß in ein paar Monaten dieses Feuer erloschen und ihre Nichte von der Narretei geheilt sei. Ausbedungen war, daß Erbenheim seine Stellung behielt.
Ella fühlte bald, wie die Fessel schmerzte und ihr Herz zerschnürte, wollte jedoch um keinen Preis ihr Wort brechen. –
Der entlassene Sträfling rückte auf der Parkbank. Sein Gesicht verfinsterte sich und zeigte die verbissenen Züge des mit Gott und Menschen zerfallenen Mannes. Die Bilder wurden düster, widrig, häßlich, scheußlich – eine entsetzliche Erinnerung schüttelte ihn. Als Ella ihm schrieb, daß die harte Bedingung gewissenhaft erfüllt werden müsse, und daß das leidige Probejahr auch nur 12 Monate und 365 Tage habe, konnte er eine tiefe Verstimmung, als wenn seine Geliebte die Trennung zu leicht ertrage, nicht unterdrücken. Eine melancholische Sehnsucht, ein Hunger und Durst, der nicht durch einen Blick, einen Gruß gestillt wurde, zehrte an dem jungen Manne, der seine Gedanken abzulenken und besonders durch allerlei Sport zu zerstreuen suchte. Das Reiten und Rudern ermüdete und beförderte den Schlaf, der nicht wie früher war.
Der Sport ist gewiß von allen Zerstreuungen die lobesamste. Und doch kann hinter der harmlosesten Lust eine Schlange sich verstecken. In dem vomehmen Ruderklub, der den Herrn von Erbenheim um seines Adels willen aufgenommen hatte, war das Stiftungsfest gefeiert und viel Sekt getrunken worden. Und nachher wurde gejeut, wurde von den blasierten, reichen Kaufmannssöhnen immer höher gesetzt. »Herr von Erbenheim, halten Sie mit! Sie kennen doch die Karten.« Zweimal, dreimal schüttelte er den Kopf. »Zum Henker, Sie sind doch kein Philister, sondern ein Kavalier.« Zum vierten Male aufgefordert, nahm er die Karten in die bebende Hand – um bis morgens sechs Uhr zu spielen.
Welch ein grausiger Morgen! Nach anfänglichem Gewinnen wollte er aufhören, aber er durfte es nicht, denn sie schrien, daß nur ein Nassauer sich drücke und ein Ehrenmann seinem Gegner Revanche gebe. Um sechs Uhr hatte er nicht nur seine Barschaft verloren, sondern auch – o Schrecknis, o Scheußlichkeit! – einen Schuldschein über 1400 Mark ausgestellt. Der Verzweifelte verfluchte sich und seine Schwäche und die Stunde seiner Geburt und fragte sich: Bin ich mit einem Manko, einem Gehirnfehler, einem temporären Wahnwitz geboren worden, so daß ich Monate, Jahre lang ein vernunftbegabter Mensch bin und plötzlich in einer Nacht vom Wahnsinn befallen werde? Beherrschen mich triebhafte, tierische Instinkte, denen kein Wille gewachsen ist? Bin ich wie das Raubtier, das, wenn es einmal Blut leckt, einem unersättlichen Durst gehorchen muß?
Als er an dem grauen, grausigen Morgen am Fleet vorübereilte, irrten seine Augen in die Tiefe, und der Gedanke an Selbstmord gab ihm eine steinerne Ruhe. Pfui, nicht in dem Schmutzgrabe, sondern eine schnelle, auf der Jagd fehlgegangene Kugel war die anständige, aristokratische Flucht aus dem Leben. Von vornherein erkannte er die pure, platte Unmöglichkeit, die 1400 Mark zu beschaffen. Zwar hatte er vier Wochen Frist, was nur eine Folter und Galgenfrist war. Es war aus, er mußte ein Ende machen. Sein Leben und Glück, sein Höchstes und Heiliges, seine Ehre und seine Ella hatte er in einer verruchten, verfluchten Stunde verscherzt, verloren. Aber sein Selbsterhaltungstrieb verschob den Abschluß auf morgen und übermorgen.
Als Erb am Dienstag früh das Haus der Eltern verließ, begegnete ihm der Postbote, der ihm einen Brief überreichte. Einen Brief von ihr! Ella hatte die tyrannische Bedingung nicht gehalten und ihr Wort gebrochen. Wenn sie das tat, mußte Außerordentliches sich ereignet haben. Er riß den Brief auf und las.
»Ich habe unter der Sehnsucht nach dir unsagbar, unerträglich gelitten und doch den grausamen Pakt gehalten, aber jetzt kann ich die Not und Pein nicht mehr ertragen. Gott verzeihe mir! Ich muß wortbrüchig, schwach und erbärmlich sein; denn eine ungeheure Angst um dich verfolgt mich und wird mich töten, wenn ich ungetröstet bleibe. Seit dem letzten Sonntag verfolgt mich eine beständige Furcht, eine grauenhafte Ahnung, daß eine schwere Gefahr über deinem Haupte schwebt, verfolgt mich bei Tag und Nacht. Was bedroht dich, mein Geliebter? Welche finstren Mächte wollen mir mein Glück rauben? O, ich muß dich sehen, nur fünf, nur zwei Minuten lang dich sehen. Am Mittwoch um 3¼ Uhr auf der Bank.«
Erb hielt sich den Kopf. Woher kam ihr und just seit dem verhängnisvollen Sonntag die Ahnung und Angst um ihn? Das war eins von den Mysterien, die jeder Mensch mal erlebt und kein Mensch ergründet.
Pünktlich zur festgesetzten Stunde ging er zum verbotenen – zum letzten Stelldichein. Tief niedergeschlagen, ohne seine Verzweiflung verbergen zu können, nahte er sich der Bank, auf der sie seiner harrte. Ohne das Kindermädchen, das in der Nähe seine Karre schob, zu beachten, warf Ella sich an seine Brust und schluchzte. »Was ist dir, Geliebter? Ich lese auf deinem Antlitz ein schweres Unglück ... ich mußte dich sprechen, weil du meiner bedarfst.«
»Ja, Ella, ich bedarf deiner Vergebung und Gottes Erbarmens, denn ich bin durch meinen Leichtsinn ein verlorener Mensch.« Nichts, nichts verschwieg er, wenn auch seine Stimme oft versagte.
Ella war, obgleich sich ein Abgrund vor ihr auftat, gut, edel und groß. Sie hat nicht geklagt, geschweige denn gezürnt, sondern getröstet und aufgerichtet, ja geholfen und gerettet. Sie hat jene Liebe, die alles glaubt und leidet, duldet und trägt, in dieser Stunde, in seiner kleinsten und kläglichsten, in ihrer größten und höchsten Stunde bewiesen.
In kurzem Sinnen krauste sie die Stirn, um schnell und schlicht zu sagen: »Du! Ich habe in meinem Sparkassenbuch von den kleinen Geschenken der Tante eine Summe ... 1320 Mark ... das sende ich dir ... wenn es genügt ... sieh mir ins Auge!«
Er schämte sich in die Erde hinein und konnte ihr nicht ins Antlitz sehen.
»Der Schuldschein lautet doch über 1400 Mark, nicht wahr?« drängte sie angstvoll.
»Ja-a.« Gequält kam es, seine Stimme überschlug sich vor innerem Weh. Durfte er es von der Geliebten nehmen? War er nicht dann für alle Zeit ein Verächtlicher in ihren und seinen eigenen Augen? Ihre Großmut erdrückte ihn, zerknirschte, zerbrach seine Seele. Just in dem Augenblick, wo er von seiner männlichen Höhe so tief herabsank und in seiner ganzen Menschlichkeit und Erbärmlichkeit offenbar wurde, war sie so groß und hehr, ja eine Heilige.
»Erb, ist es nicht mehr?« flüsterte Ella, die das scheue Schweigen des Gedemütigten als ein Verschweigen deutete. Er schüttelte kaum den Kopf und konnte noch nicht ihren Blick ertragen. Da fiel ihr ihre Wortbrüchigkeit wie eine Schuld und Schande auf die Seele. Auch sie war Mensch und Weib geblieben. Errötend, erregt sagte und klagte sie: Einmal sei keinmal, diese Zusammenkunft dürfe nicht gewesen sein, er müsse ihr auf Ehre versprechen, ja schwören, daß kein Mensch jemals von ihrem Wortbruch erfahren werde, und daß er selbst ihren schmählichen Streich vergessen und aus seinem Gedächtnis löschen wolle.
»Nein, diese Stunde ist nicht gewesen, soll in Ewigkeit nicht ruchbar werden, das schwöre ich dir auf Ehre und Eid.«
Sie küßte ihn lange und zum – letztenmal.
Das Kindermädchen guckte um die Ecke und kicherte.
»Erb, es ist nicht mehr?« flüsterte es an seinem Munde, während er unwillkürlich einen scheuen Blick nach dem frechen Weibsbild hinüberwarf.
Eine Kirchenuhr schlug in dem Moment.
Ella schnellte zurück. »Ich sende das Sparkassenbuch. Lebewohl, mein Einziger!«
Sie flog von dannen, denn es war höchste Zeit, wenn ihr Verschwinden zu Hause nicht bemerkt werden sollte.
Tief aufatmend, tief beschämt und doch hoch beglückt, daß er einen Engel, eine Heilige, eine Heldin besaß, war er ins Bureau gefahren und am Abend nach Hause gegangen. Nach den zwei schlaflosen Nächten hatte er, von einer großen Müdigkeit und Beruhigung erfüllt, in den nächsten Nächten sehr fest geschlafen.
Am Donnerstag wurde er in die Privatwohnung des Herrn Engel, der an einer Erkältung litt, gerufen, um eine sekrete Korrespondenz zu erledigen. Das Vertrauen ehrte ihn und erregte den Neid seiner Kollegen. Am Spätnachmittag hatte er mit dem durch die Post gesandten Sparkassenbuch die 1320 Mark abgehoben und den unglückseligen Schuldschein bezahlt. »Donnerwetter, Sie sind ein ganzer Gentleman,« sagte der Empfänger, erfreut die Scheine streichelnd.
Da war am Freitag morgen das Unfaßbare, Unmenschliche geschehen. Während er noch im Bett sich dehnte, drangen ein Kriminalbeamter und ein Schutzmann ins Zimmer und erklärten ihn für verhaftet. Auf seine wilden Fragen, warum und weshalb, antworteten sie mit einem kalten Achselzucken und einem infamen Lächeln. »Das werden Sie, mein Herr, wohl selbst am besten wissen ... jaja, die bösen Ehrenschulden.«
Hatte der Unglückliche die Höhe seiner Schulden verschwiegen? Die Zeitungen meldeten eine Sensation: Der Sohn eines tief beklagenswerten, hohen Justizbeamten habe einen sehr kostbaren Brillantring gestohlen und durch einen Dienstmann für 2000 Mark versetzt, um seine Schulden zu bezahlen.
Das wurde dem Angeklagten vom Untersuchungsrichter bewiesen. Obgleich Erbenheim nicht bekannte, sondern aufgeregt seine Unschuld beteuerte, ist er durch klaren Indizienbeweis und einwandfreie Zeugenaussagen und Zeugeneide überführt und von der Strafkammer rechtskräftig verurteilt worden.
Heute hatte er seine Strafe in F. verbüßt und die Anstalt verlassen.
Zweiter Abschnitt
Der Grübler, der angesichts des Elternhauses Stunde um Stunde saß und sein Leben vorüberziehen ließ, erhob sich mit einem Ruck, ging mit müden, schweren Schritten über die Straße und drückte die Klingel der Etage.
Das Dienstmädchen prallte wie vor einem Gespenst zurück. »Der ... der junge Herr.«
Er lachte schrill und bitter. »Haha, Sie haben einen Schreck gekriegt ... ich tue Ihnen nichts ... ich bin ja kein berühmter Mörder, sondern nur ein armselig mausender Dieb. Sind meine Eltern im Wohnzimmer? Gut! Bleiben Sie hier!«
Der Landgerichtsrat, ein alter, vornehmer Herr, stolz auf seinen Adel, noch stolzer auf seinen Richterstand, hatte kalte, graue, inquisitorische Augen, weiße und wenig Haare, einen schneeweißen, kräftigen Schnurrbart, den er beim jähen Eintritt seines Sohnes mit der Lippe faßte und mit den Zähnen biß. Seine Augenbrauen zog er in die Höhe, und die hochgezogenen blieben lange auf den Eingetretenen gerichtet, was seinem scharfen Gesicht einen strengen, ja steinernen Ausdruck verlieh.
»Erb, mein armer ...« Der Rat blieb stumm, aber seine Gattin hob unwillkürlich die Arme und machte zwei Schritte, um dem Instinkt des Mutterherzens zu gehorchen und den Heimgekehrten zu umarmen, jedoch ein eisiger Blick ihres Mannes bannte und lähmte die Arme und Füße, die mitten in der hastigen Bewegung stockten.
Herr von Erbenheim senior räusperte sich und redete geschäftsmäßig, kurz und bestimmt: »Du hast dir jedenfalls selbst schon gesagt, daß deines Bleibens hier im Lande nicht ist, daß du, in Deutschland unmöglich geworden, über See gehen mußt, um in Afrika oder Amerika unterzutauchen und hoffentlich ein neues Leben anzufangen. Die Fahrkarte für die zweite Kajüte und 500 Mark in bar werde ich dir für die Überfahrt und den Anfang in der Fremde geben. Aber irgendwelche weitere Unterstützung – das ist unwiderruflich – hast du nicht zu erwarten ... du weißt, ich ... ich halte Wort. Wann und wohin willst du fahren? Antworte mir!«
Erb riß sich aus der Erstarrung, streckte erschüttert die Hände aus und schrie: »Vater, ich bin unschuldig verurteilt, ich schwöre es bei meiner Ehre ...«
»Hast du eine Ehre? Genug!«
»Ich schwöre mit heiligen Eiden, daß ich unschuldig und ein Opfer der irrenden Justiz bin.«
Der weiße Schnurrbart zuckte spöttisch in dem unbewegten, alten Gesicht. »Du sagst es ... von hundert Verurteilten singen fünfzig oder sechzig dasselbe Lied ... in meiner langen Richterpraxis habe ich nicht einen einzigen Justizmord erlebt. Du vergißt, daß du durch Zeugeneide und klare Beweise überführt bist. Wenn ich dein Richter gewesen wäre, ich hätte genau so wie meine Kollegen urteilen müssen ... so fest bin ich von deiner Schuld überzeugt, nachdem ich die Akten Buchstabe für Buchstabe geprüft. Es ist lächerlich zu leugnen, Erb Erbenheim. Von unsrem Adel wirst du in Amerika nicht Gebrauch machen.«
»Vater!« Es war ein Aufschrei, eine letzte Frage der Verzweiflung. »Vater, du glaubst an meine Schuld, daß ich ein Dieb ...?«
»Lassen wir das!« Ein abweisendes Achselzucken. »Du wirst einsehen, daß du nicht bei uns wohnen kannst ... mein Ansehen ist schwer geschädigt, meine Stellung als Richter sogar schwer erschüttert worden durch diese Schmach unsres Hauses. Darum habe ich in Liesemanns Hotel ein Zimmer für dich bestellt ... entschließe dich bald, wohin die Fahrt gehen soll!«
Der Landgerichtsrat nahm ein Aktenstück, das auf dem Tische lag, blätterte darin und biß sich auf den weißen Schnurrbart.
Der Sohn rang qualvoll die Hände und rief: »Ich kann von dir kein Geld annehmen, denn ich bin nicht mehr dein Sohn, du hast die Bande des Bluts zerrissen.«
»Phrasen!« Über die Akten hinweg kam ein harter Blick und das böse Wort.
Erbs bleiche Züge verzerrten sich, aber er warf trotzig den Kopf zurück und trat dicht an die Tür. Dort starrte er mit weit aufgerissenen Augen der leise weinenden Frau Rat ins Antlitz. »Mutter! Und du? Mutter, Mutter, glaubst du, daß ich ein Dieb bin?«
Die verhärmte Frau schnellte empor, als wenn sie ihr armes Kind von der Tür holen und halten wolle. Das Mutterherz antwortete hastig, hell und klar: »Ich ... ich glaube an dich und deine Unschuld.«
Da stürmte der Sohn drei Schritte vorwärts, umschlang ihr Haupt, küßte ihre Stirn unter plötzlich hervorströmenden Tränen, aber im nächsten Augenblick stürzte er mit langen Schritten aus dem Zimmer, aus dem Hause, das nicht mehr sein Vaterhaus war.
Der Herr Rat hatte sich geräuspert und mit dem Stuhle gerückt. Sobald Erb fort war, warf er die Akten heftig hin, und sein Auge ruhte unwillig auf der schluchzenden Gattin. »Was soll die unsinnige Szene und Sentimentalität, die ihn in seinem hartnäckigen Leugnen bestärkt! Beweine nicht seine Unschuld, sondern die ungeheure Schande seines Hauses und den bürgerlichen Tod unseres Kindes! Du bestärkst ihn in seinem verstockten Leugnen und emphatischen Abschwören, wodurch er seine Richter, die dem völlig Unbußfertigen, der sich noch auf den Offizier und Ehrenmann herausspielen wollte, alle Milderungsgründe versagten, wahrlich nicht für sich eingenommen hat.«
Heftig erwiderte die Frau: »Erb hat nie lügen können ... wenn er als kleiner Junge eine kleine Flunkerei versuchte, verriet er sich sofort durch seinen gesenkten Blick. Ich, ich kenne mein Kind. Sein Auge sieht offen, frei und flehend mich an ... er kann kein Dieb, er muß unschuldig sein, wenn ich auch keine ...«
Der Gatte schnitt, ja biß ihr die Rede ab. »Nein, nein, sogar die blasse Möglichkeit muß ich bestreiten. Ich, der alte, gewiegte Jurist, der dreißig Jahre lang Recht sprach, habe Nächte lang die Akten studiert, um einen Anfechtungsgrund, einen Formfehler, einen Strohhalm der Rettung zu entdecken, aber ich fand nichts, nichts, das für seine Unschuld sprach, obgleich ich mein Gehirn zermarterte. Eine so strenglogische, festgeschlossene, unwiderlegbare Indizienbeweisführung habe ich in meiner Praxis selten gesehen. Bedenke doch den Hergang! Herr Engel, der an einer starken Erkältung leidet und das Haus hütet, läßt den unglücklichen Menschen, damit ein wichtiger, sekreter Brief erledigt werde, in sein Privatzimmer rufen, hat den kostbaren Brillantring seiner Frau, der ihr zu eng geworden ist und zum Juwelier gebracht werden soll, auf dem Tische liegen lassen, während er ins Schlafzimmer für zwei Minuten geht, um gegen den lästigen Husten ein paar Emser Pastillen einzunehmen. Erb hat geschrieben und weilt während der Abwesenheit allein in dem ominösen Herrenzimmer. Er will mit dem zahmen Affen des Herrn Engel, der im Zimmer tollte, gespielt und von dem Ringe, der doch groß und glänzend auf dem Luthertische lag, gar nichts gesehen haben. Der Chef kehrt zurück, der Brief wird konzipiert, unser Sohn entfernt sich ... Herr Engel sieht mit Entsetzen, daß der Ring, der seine 10 000 Mark gekostet hat, verschwunden ist ... es steht fest und ist vom Gericht als erwiesen konstatiert worden, daß keine Menschenseele, außer dem Korrespondenten, in dem Raume gewesen ist. Der Verdacht muß auf den jungen Erbenheim fallen, aber Herr Engel will es nicht glauben, daß mein Sohn ein Dieb. Seine Frau jedoch, über den Verlust empört, verständigt die Polizei, die sehr diskret vorgeht und insgeheim nachforscht, weil es sich um die Familie des Landgerichtsrats handelt. Die Polizei findet aber mühelos den Missetäter, der unglaublich plump oder frech verfährt und ein grüner Neuling im kriminellen Fach sein muß; denn schon hatte ein alter, bisher unbescholtener Dienstmann, der Dienstmann Nr. 21, in einer Pfandleihe den Brillantring des Herrn Engel für 2000 Mark versetzt, im Auftrag eines feinen Herrn, wie er sofort nach seiner Arrestation ohne jede Unsicherheit aussagt. Der Mann, der unbestraft ist und des besten Leumundes sich erfreut, verwickelt sich in keine Widersprüche, sondern legt eine offene Beichte ab. Ein sehr vornehm aussehender Herr, der ...«
»Dessen Haar und Augen er gar nicht beschreiben kann,« unterbrach ihn die Gattin, die scharf wie ein Staatsanwalt aufpaßte.
»Das ist bei einem ungebildeten Menschen begreiflich! Ein Herr, der ganz wie ein schlanker, schneidiger Offizier in Zivil ausgesehen habe, sei an der Rathausecke an ihn herangetreten und habe ihn beauftragt, den Ring zu versetzen. Solche Kommissionen von Leuten, die eine Pfandleihe nicht betreten wollen, seien nicht selten. Er habe den Ring versetzt und 20 Mark erhalten für seinen Gang. Die Polizei mußte schweren Herzens dazu schreiten, unsren Sohn aus unsrem Hause weg zu verhaften ... aus unsrem Hause! Ein von Erbenheim! O, Martha, das wird mein Tod. O, könntest du das Urteil widerlegen, seine Unschuld beweisen, ich würde dafür gern von meinen paar Lebensjahren die Hälfte hingeben. Aber es war nicht anzuzweifeln, der eherne Ring der Beweisführung wurde zur Eisenkette, die mein Kind verstrickte und wie ein wildes Tier hinter Eisenstäben fesselte. Eine Konfrontation fand statt, Erb saß dem Untersuchungsrichter gegenüber, als der Dienstmann eintrat. Und sobald der den Angeklagten erblickt, streckt der alte Mann die Hände aus und ruft: ›Das ist er, der ist's!‹ – Das war vernichtend ... Martha, kannst du das widerlegen?«
Die Mutter wischte ihre Tränen weg und rief durchdringend: »Erb sprang wild und wütend auf und schrie: ›Du Lügner, du dreimal verlogener Hund, ich habe dich nie gekannt und nie gesehen!‹ und wollte dem Dienstmann an den Hals springen, so daß der Schutzmann ihn zurückreißen mußte. Dieser unmittelbare Wutausbruch spricht für unseren Sohn ... das haben die elenden Akten und die elenden Richter gar nicht beachtet.«
»Ach,« seufzte der Rat, »er hatte ja die Gegenüberstellung erwartet und sich darauf vorbereitet, die Rolle des Entrüsteten zu spielen.«
»Auch der Dienstmann konnte sich mit wenig Nachdenken sagen, daß man ihn einem Verdächtigen gegenüberstellen werde, konnte selbst der Dieb oder Hehler sein,« schrie die Mutter mit gellender Stimme.
Der alte Herr wedelte mit den Händen und wurde unwirsch. »Unsinn, Unsinn! Es war eine erwiesene Tatsache, daß der Dienstmann nicht im Zimmer, nie im Engelschen Hause, daß kein andrer Mensch als Erb zur fraglichen Zeit in dem fraglichen Raume gewesen. Das war schwer gravierend, aber die Feststellungen ergaben vernichtende Schuldbeweise. Der Unselige war wieder ein Opfer seiner scheußlichen Leidenschaft, die ihm den Offiziersrock vom Leibe riß, geworden, hatte gespielt und 1400 Mark verloren. Ausgerechnet an dem Tage, wo der Brillantring versetzt wurde, hat der wahnsinnige Mensch seine Schulden – Gott weiß wie viel, wohl 2000 Mark oder mehr – bar, ja bar bezahlt. Auf des Untersuchungsrichters Frage, wie er in den Besitz so großer Summen gekommen, wurde er totenblaß, tödlich verlegen, verweigerte er die Aussage. Das brach ihm den Hals! Und du sprichst von Unschuld, von elenden Richtern!«
Die Mutter schwieg eine Weile wie geschlagen, um laut aufzuschreien: »Mein Erb kann kein Dieb, kann nicht schuldig sein.«
Der Rat steckte die Nase in die Akten hinein und murmelte: » Cum muliere non est disputandum.«
Frau Martha verließ das Zimmer und suchte das stille Schlafgemach, die Stätte ihrer Kämpfe, Tränen und Gebete, auf; die Hartgeprüfte war eine Beterin geworden, obgleich ihr Gatte die Nase rümpfte und über ihre Bigotterie sarkastische Bemerkungen machte.
Als sie zurückkehrte, stellte er die spöttische Frage: »Meinst du, daß dein Gott Geschehenes ungeschehen machen kann? Das kann kein Gott.«
»Er kann alles, sogar ein Wunder tun,« antwortete sie beharrlich und unbelehrsam.
Und ein sonderbares Ereignis schien ihr Recht zu geben. In diesen Tagen geschah etwas, das ans Seltsame und Wunderbare streifte. Heiß, hochrot im Gesicht, in der zitternden Hand einen Brief hochhaltend, stürzte sie ins Zimmer des Gatten mit dem Freudenschrei: »Denke dir! Ich habe plötzlich von meinem Bruder, der seit 30 Jahren verschollen und totgesagt ist, einen Brief bekommen. Jobst lebt, lebt in Ostafrika.«
Dieser Jobst Renner hatte als junger Mann nach einer sehr sensationellen Geschichte und einem sehr häßlichen Gerede sein Vaterland verlassen und nichts mehr von sich hören lassen.
Der Herr Rat verlor das künstliche, kühle Gleichgewicht des Juristen, und das würdevolle Gesicht mit dem gaffenden Munde war fast lächerlich geworden. Der Mann, der jede unnütze Wiederholung und Tautologie wie eine Todsünde tadelte, sagte und fragte zehnmal dasselbe: »Das ist merkwürdig, sehr merkwürdig, außerordentlich eigentümlich, auffallend im höchsten Maße ... natürlich ein Zufallsspiel, aber ein sehr seltsames Zusammentreffen! Wo ist mein mir unbekannter Herr Schwager aus der Verschollenheit aufgetaucht? In Ostafrika? Er will am Ende Geld und Unterstützung von uns haben, da er sich seiner lieben Schwester erinnert?«
»Nein, nein, im Gegenteil!«
Die leise Furcht des Herrn von Erbenheim wurde zur lauten Aufregung. »Es geht ihm also gut in Afrika? Gott sei Dank! Er ist ein gemachter Mann ... mein lieber Schwager Jobst hat über See Reichtümer sich erworben?«
»Das wohl nicht, nach seinem Briefe hat er zweimal ein Vermögen erworben und wieder eingebüßt.«
»Hm, der Monsieur Renner ist ein Windhund und Taugenichts geblieben ... sag' rasch, was will er denn von uns?«
»Mein Bruder ist nie ein Taugenichts gewesen, auch nicht geworden, nein! Höre selbst, was er schreibt! Um ihn gerecht zu beurteilen, mußt du aber nicht vergessen, daß Jobst immer ganz anders als die meisten, ein Mensch von eigner Art und origineller Ausdrucksweise, zuweilen sogar ein Kauz, aber immer ein guter, braver Kerl, gewesen ist. Er schreibt: ›Ich bin durch viel Schaden und viel Schlechtigkeit der zweibeinigen Ebenbilder Gottes zwar nicht reicher, wohl aber bedeutend klüger, egoistischer und zugeknöpfter geworden. Einen Blaugrund mit Brillanten oder einen Goldklumpen fand ich nicht, aber auf meinen letzten Fahrten und Fährlichkeiten habe ich mir durch Geduld und Geiz einige tausend Rupien erobert, wie man hierzulande sagt, und an meinem Leibe wohl verwahrt, so daß kein weißer oder schwarzer Spitzbube meinen Geldschrank erbrechen wird. Wie ist es dir ergangen, meine liebste Schwester? Und was macht meine sonstige Sippschaft? Ich bin jetzt seit 29 bis 30 Jahren verschwunden, und keiner hat von meiner afrikanischen Odyssee, meinen Irrfahrten, Abenteuern, von meinen Witzen und Dummheiten irgend etwas vernommen; ich dagegen hörte durch frisch angekommene Offiziere und Kaufleute einiges, was die Meinen betraf. So erfuhr ich den Tod der teuren Mutter – Gott hab' sie selig! – das Ableben der guten Tanten. In Uganda, als wir just dinierten und eine Hippopotamusleber verspeisten, erzählte mir ein Hanseatenkrämerküken mit der inneren Ergriffenheit des echten Republikaners, daß du geadelt worden und eine Frau Amtsrichter von Erbenheim geworden seiest. Ich ziehe den Hut ab und gratuliere etwas verspätet nach 26 oder 27 Jahren. Ach, juvenes fuimus, wir sind jung gewesen, und nun sind wir alt, grau und grämlich geworden, und ein neues Geschlecht der Renner und derer von Erbenheim rennt mit der Zunge aus dem Halse dem Glücke nach. Hoffentlich sind alle Mitglieder unserer Sippe sehr nützliche Mitglieder der menschlichen, Gesellschaft, sehr ehrbare, wohlsituierte Menschen geworden. Sollte aber wider Erwarten irgendein Unband und Ausbund, wie ich es war, in der hochehrenwerten Familie, ein Entgleister oder Gescheiterter in der Verwandtschaft zu finden sein, so bitte ich, mir dieses enfant terrible mit wendender Post zu senden, damit ich ihn nach meiner Pädagogik erziehen und zu einem tüchtigen Afrikaner machen kann. Die Sorte nämlich, die zu Hause über die Stränge schlägt, ist kurioserweise hier meistens am besten zu gebrauchen. Es sind die Heißblütigen, die das Zeug und Blut zum Vollblutsmenschen haben. Solltet ihr ein enfant terrible mir senden, so werde ich selbiges, sofern es meinem Gustus entspricht, geziemend empfangen und mit den unerläßlichen, afrikanischen Utensilien und guten Ratschlägen ausrüsten. Der junge Mitteleuropäer soll keine unsinnigen Ideen, Meinungen von sich und Utopien, sondern nur eine kräftige Gesundheit, einen Sack voll Geduld und einige Pfund Chinin für den Anfang mitbringen. Für alles andere wird der alte Jobst Renner und der gute Herrgott Sorge tragen. Meine liebe Martha, du bist von jeher meine beste Schwester gewesen, darum schreibe ich dir zuerst, indem ich mein Inkognito zu lüften und mein Schweigen zu brechen beschlossen habe. Ich habe nämlich ausgerechnet, daß die scheußliche Geschichte von damals verjährt ist und ich meine Auferstehung von den Toten vollziehen kann, ohne Gefahr zu laufen, unter Polizeieskorte von Daressalam nach Deutschland gebracht zu werden ...‹«
Frau von Erbenheim hatte den Brief, auch die lustigen, drolligen Stellen, mit feierlicher Summe verlesen. Ihr Mann hatte mit großer Befriedigung zugehört, nickte heftig und fuhr ihr in die Vorlesung hinein. »Donnerwetter! Das kommt ja wie gerufen. Wir senden ihm unsren entehrten Sohn, der hier unmöglich und für uns verloren ist ... ein merkwürdiges Zusammentreffen, ein netter Witz des Zufalls ist dieser Brief.«
Die Frau richtete die großen, ernsten Augen auf ihren Gatten. »Ein Zufall? Nein, ein Wink des Himmels, ein Weg der Vorsehung, ein Werk Gottes. Es ist wunderbar ...«
Der Landgerichtsrat überlegte, während sie ergriffen die Hände faltete, und seine Lippen zuckten ironisch. »Dein Wunder läßt sich natürlich erklären, dein Bruder sagt ja, daß er über uns ziemlich orientiert gewesen sei, wird in Ostafrika von dem Brillantdiebstahl eines Herrn von Erbenheim – entsetzlich! – gehört haben, hat unsre Absicht, die Notwendigkeit, das enfant terrible zu deportieren, geahnt und seinen Wunsch, uns zu helfen, in eine sehr taktvolle Form gekleidet. Dieses Mirakel ist auch nichts weiter als eine ungewöhnliche Verkettung von Ursache und Wirkung. Ich bin meinem Schwager sehr dankbar.«
Vorwurfsvoll blickte die Mutter. »Deportieren? Deportieren willst du dein Kind?«
Der Herr Rat zuckte die Achseln. »Deportieren heißt verschicken. Willst du etwa deinen Erb hier behalten, oder willst du ihn nach Afrika zu deinem Bruder schicken? Gut, so mache deinem Sohn begreiflich, was er zu tun hat!«
»Meinem?«
Er guckte in die Akten und gab keine Antwort. – – –