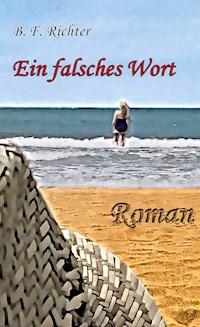
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Bei den Islings scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Daniel und Caroline sind seit 14 Jahren glücklich verheiratet, haben zwei wohlgeratene Kinder und beruflichen Erfolg. Doch als Daniel nach einem Unfall aus der Narkose erwacht, ist sein erstes Wort der Name einer fremden Frau. Wer ist diese Hannah, von der er noch nie zuvor gesprochen hat? Carolines Recherchen führen sie auf die Spur einer lange zurückliegenden Liebe, die bis in die Gegenwart nachwirkt - und zeigen, was ein einziges falsches Wort anrichten kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Den Sehnsüchtigen gewidmet
Romantische Liebe ist kein Nullsummenspiel. Wenn zwei Männer dieselbe Frau lieben, hängt, was diese für den einen empfindet, nicht von ihren Empfindungen für den anderen ab. Wenn sie sich für einen von beiden entscheidet, hätte der „Verlierer“ nicht haben können, was der „Gewinner“ bekommt.
Ayn Rand
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
I
Zehn gute Jahre hast du noch.
Caroline Isling hatte sich nach allen Regeln der Kunst hübsch gemacht und betrachtete sich kritisch im großen Wandspiegel ihres Schlafzimmers. Doch, sie war eine attraktive Enddreißigerin. Die wenigen grauen Haare konnten dem kraftvollen Gesamteindruck ihrer brünetten Mähne nichts anhaben. Ihre grünen Augen funkelten lebendig wie eh und je. Und die Spuren von Falten im Gesicht waren weniger dem fortschreitenden Alter geschuldet als Ausdruck eines erfüllten und glücklichen Lebens, in dem es viel zu lachen gegeben hatte. Was auch immer das beunruhigende Verhalten ihres Mannes in letzter Zeit erklären mochte, altersbedingt nachlassender Sexappeal war mit Sicherheit nicht der Grund.
Ihre Rundungen waren für Carolines Geschmack zwar nach wie vor zu üppig, aber gerade das hatte Daniel ja stets so anziehend an ihr gefunden. Diäten waren der einzige Bereich ihres Lebens, in dem sie sich nicht hundertprozentig auf die Unterstützung ihres Gatten verlassen konnte. Andere Männer ermutigten ihre Frauen zum Abnehmen oder trieben sie gar dazu an. Daniel dagegen betätigte sich als Saboteur. Wenn eine neue Kur begann, spielte er zunächst den wohlwollenden Beobachter. Sobald sich aber erste Erfolge einstellten und die Pfunde purzelten, ergriff er Gegenmaßnahmen. Dann wurde Caroline häufiger zum Essen eingeladen und bekam ein Stück Torte, ein Eis oder eine andere Kalorienbombe spendiert.
Tragischerweise ließ sie sich tatsächlich immer wieder verführen. Die Beschwerde „Hör‘ auf, mich zu mästen“ kam entweder zu spät oder verhallte wirkungslos. „Was soll ich denn machen“, fragte Daniel halb schuldbewusst, halb schelmisch, „ich liebe eben jedes Gramm an dir.“ Nach dem Scheitern einer Diät war er gerne mit Trost und Komplimenten zur Stelle. „Du siehst verdammt gut aus heute“ – wann immer dieser mit lüsternem Unterton vorgetragene Satz morgens im Bad fiel, wusste Caroline, dass sie gar nicht erst hoffnungsvoll auf die Waage zu steigen brauchte. Daniel besaß einen untrüglichen Blick dafür, ob sie auch nur ein Kilo zugenommen hatte.
Von solchen Kabbeleien abgesehen, führten die beiden seit vierzehn Jahren eine unverschämt glückliche Ehe. Nach einem etwas holprigen Start hatten sie rasch gemerkt, die große Liebe gefunden zu haben. Vier Jahre und einen romantischen Heiratsantrag später war Hochzeit gefeiert worden. Zwei Kinder, der inzwischen dreizehnjährige Niklas und die zehnjährige Tamara, waren aus der Verbindung hervorgegangen.
Auch beruflich lief alles bestens. Daniel war nach Studium und Promotion in den Rechtswissenschaften bei einer renommierten Frankfurter Wirtschaftskanzlei eingestiegen und hatte es dort vor kurzem zum Partner gebracht. Carolines Laufbahn war nicht so geradlinig, aber mittlerweile hatte sie ihre Bestimmung gefunden. Nach Abschluss eines Germanistik-Studiums und Gehversuchen in verschiedenen Jobs war ihr während der zweiten Babypause die Idee gekommen, eine Fortbildung zur Lebensberaterin – neudeutsch: „Personal Coach“ – zu absolvieren und sich selbstständig zu machen.
Mit der ihr eigenen Zähigkeit überwand Caroline sämtliche Startschwierigkeiten. Die Arbeit machte Spaß, und dank ihrer Empathie, ihres praktischen Verstandes und ihrer Kreativität war sie auch sehr gut darin. Sie hatte die seltene Gabe, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, ihre Beweggründe, Verhaltensweisen und Probleme zu verstehen und für letztere intelligente Lösungen zu finden. Das wussten mehr und mehr Klienten zu schätzen, so dass die Selbstständigkeit inzwischen vom kleinen Nebenverdienst zum zweiten Standbein der Familie geworden war.
Noch sechzehn Jahre, dann würde das hübsche kleine Häuschen am Rande der Mainmetropole, das die Islings erworben hatten, abgezahlt sein. Es war in der Nachkriegszeit erbaut und zuletzt von einer alleinstehenden alten Dame bewohnt worden, die es völlig hatte herunterkommen lassen. Nach ihrem Tod wollten die Erben so schnell wie möglich verkaufen und machten einen günstigen Preis. Während viele potenzielle Käufer vom schlechten Zustand des Anwesens abgeschreckt wurden, erkannten Daniel und Caroline die in der Austernschale verborgene Perle und schlugen zu.
Die aufwändige Renovierung zog sich über mehr als zwei Jahre hin, dann war das Gebäude für die Bedürfnisse der Familie optimiert. Die Kinder bekamen jeweils ein eigenes Schlafzimmer, ein gemeinsames Bad sowie den Dachboden zum Spielen. Caroline konnte sich am Flur gleich hinter dem Hauseingang ein Sprechzimmer für ihre Arbeit einrichten. Und Daniel erhielt einen Raum für seine umfangreiche Bibliothek historischer Fachbücher. Geschichte war sein Steckenpferd, und wann immer er Zeit dafür fand, las er Biografien berühmter Persönlichkeiten und andere Wälzer. Zuweilen besuchte er auch Museen oder alte Schlachtfelder und sah sich sogenannte Reenactments an, bei denen Gefechte aus längst vergangenen Zeiten simuliert werden.
Durchs Schlafzimmerfenster blickte Caroline in ihren mediterranen Garten hinaus und lächelte vor Glück. Alles ist gut, dachte sie sich. Du hast wirklich das große Los gezogen! Schau dir doch mal deine Freundinnen an: Marie ist immer noch Single, und Isabel hat gerade ihre Scheidung hinter sich. Wie bitter es klang, als sie sagte: „Ich bin halt schon einen Schritt weiter als du.“Dabei wusste Isabel genau, dass Caroline und Daniel unzertrennlich waren.
Es konnte nichts Schlimmes bedeuten, dass Daniel seiner Frau seit einigen Wochen verändert vorkam. Er schien schweigsamer geworden zu sein. Häufig wirkte er geistesabwesend und zog sich von der Familie zurück. Auch hatte das Paar weniger Sex als sonst. Stattdessen stürzte Daniel sich in die Arbeit und machte Unmengen an Überstunden, wobei ihn anscheinend das schlechte Gewissen plagte, denn er bedachte seine Gattin ungewöhnlich oft mit Blumen und anderen kleinen Aufmerksamkeiten. Aber musste das gleich heißen, dass er fremdging oder sonst ein düsteres Geheimnis hütete? Er war nicht der Typ für einen Seitensprung, und selbst wenn da etwas gewesen wäre, hätte er es seiner Frau bestimmt längst gebeichtet. Du siehst Gespenster, sagte sie sich. Wo ist dein Vertrauen?
Heute sollte nichts ihnen den schönen Abend verderben. Caroline hatte ihren Mann zu einem Candle-Light-Dinner eingeladen. Anschließend würden sie tanzen gehen und, wieder zuhause, Liebe machen. Alles war perfekt vorbereitet. Sie trug das blaue Glitzerkleid, das ihre Kurven betonte und sich wiederholt als Appetitanreger bewährt hatte. Es war Freitag, und Daniel hatte versprochen, früher in den Feierabend zu gehen. Die Kinder übernachteten bei den Großeltern. Herbert und Helga Isling wohnten in Heiligenwald bei Mainz und verstanden sich gut mit ihrer Schwiegertochter. Sie kümmerten sich rührend um die Enkel und brachten deren Eltern erhebliche Entlastung.
Die Melodie des Liedes „Good Times“ von Eric Burdon & The Animals, Carolines Handy-Klingelton, riss sie aus ihren Gedanken. Im Display erschien der Name „Danny“. Wieso rief er sie jetzt noch an? Er sollte doch längst hier sein! Mit bösen Vorahnungen ergriff Caroline das Mobiltelefon. „Na, Tiger, wo steckst du?“
Eine unheilvolle Pause trat ein. „Frau Isling?“ Das war nicht Daniels Stimme, sondern die eines unsicher klingenden jungen Mannes.
“Wer ist da?”
“Frau Isling, hier spricht Polizeimeister Schlich.”
Carolines Magen krampfte sich zusammen. Was auch immer das zu bedeuten hatte, es konnte nichts Gutes sein.
„Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie auf diese Weise kontaktiere“, fuhr der Anrufer in nervösem Tonfall fort. Offenbar war es ihm sehr unangenehm, dieses Telefonat führen zu müssen. „Ihr Mann hat uns gebeten, in seinem Handy nach Ihrer Nummer zu suchen und Sie sofort zu informieren.“
Obwohl es in diesem Augenblick völlig irrelevant war, musste Caroline daran denken, dass sie in Daniels Telefonbuch unter „Schmusi“ abgespeichert war. „Ja“, sagte sie tonlos, „aber was ist denn los?“
„Ich muss Ihnen leider mitteilen, Frau Isling, dass Ihr Mann einen Autounfall hatte.“
Carolines Beine drohten den Dienst zu verweigern. Sie machte rasch einen Schritt zur Seite und setzte sich aufs Bett.
„Er lebt und war bei Bewusstsein, als wir ihn antrafen“, versicherte der junge Polizist eilig, „aber über die Schwere der Verletzungen kann ich wirklich nichts sagen. Der Notarztwagen hat ihn in die Unfallklinik gebracht.“
Nun war es Caroline, die eine Pause eintreten ließ.
„Frau Isling, sind Sie noch da? Am Fahrzeug ist leider Totalschaden entstanden…“
„Das Auto interessiert mich einen Scheißdreck“, fauchte Caroline. Dann fasste sie sich. „Entschuldigen Sie, es ist ja nicht Ihre Schuld. Sie tun nur Ihre Pflicht. Ist – ist noch jemand anders zu Schaden gekommen?“
„Der Unfallgegner, ein älterer Herr, hat wohl ein Schleudertrauma erlitten. So wie es aussieht, hat er Ihrem Mann an einer Ampelkreuzung die Vorfahrt genommen. Den genauen Hergang müssen wir noch klären.“
„Danke. Ich fahre sofort zur Klinik.“
„Frau Isling, ich kann Ihnen immerhin mitteilen, dass der Airbag ausgelöst hat. Die Autos sind heutzutage ja sehr sicher. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Ihr Mann in Lebensgefahr schwebt. Das wird schon wieder werden.“
„Vielen Dank. Das ist sehr nett von Ihnen.“
„Haben Sie jemanden, der Sie fahren kann? Nicht, dass Ihnen auch noch etwas zustößt.“
„Ja, habe ich“, log Caroline, die ohne Verzögerung aufbrechen wollte.
Wie sie sicher zur Unfallklinik kam, wusste Caroline später selbst nicht mehr. Ihre Gedanken waren ganz bei Daniel. Selbst wenn er nicht in Lebensgefahr schwebte, konnte er doch schwer verletzt sein. Möglich war alles, und die menschliche Phantasie besitzt ihren größten Reichtum bei der Beschreibung der schlimmsten Szenarien. Würde sich ihr Leben jetzt grundlegend verändern? Man hörte ja immer wieder von Menschen, die Schicksalsschläge erlitten und sich nie ganz davon erholten. Eben noch war die Welt in Ordnung gewesen, und plötzlich…
Nachdem sie endlich einen Parkplatz gefunden hatte, eilte Caroline im Laufschritt zum Empfang des Krankenhauses. Sie hatte sich keine Zeit zum Umziehen genommen und erregte in ihrem Abendkleid die Aufmerksamkeit aller Umstehenden. Aber das war jetzt wirklich egal. Zum Glück stand niemand am Empfang an, so dass die Angestellte, eine pummelige junge Frau mit fettigem Haar und überdimensionierten Brillengläsern, sich gleich um sie kümmern konnte.
„Mein Mann ist vorhin mit dem Notarztwagen eingeliefert worden“, keuchte Caroline, „Dr. Daniel Isling.“
Die Empfangsdame griff ohne Umschweife zum Telefon. „Herr Dr. Isling ist schon operiert worden“, konnte sie nach kurzer Zeit vermelden. „Derzeit befindet er sich im Aufwachraum. Er hatte eine Vollnarkose. Bis er wieder zu sich kommt, wird es noch dauern. Sie können inzwischen mit dem behandelnden Arzt sprechen.“
„Ich möchte erst meinen Mann sehen.“
Die junge Frau räusperte sich. „Dr. Martin hat gleich Schichtende. Wenn sie ihn noch erwischen möchten, sollten sie ihn zuerst aufsuchen.“
„Also gut. Wo finde ich ihn?“
Dr. Johannes Martin war ein drahtiger kleiner Mann mit schütterem hellbraunem Haar und sanften Gesichtszügen. Er mochte Mitte Vierzig sein, sah jedoch so müde und abgespannt aus, dass er älter wirkte. Caroline fühlte sich durch sein Erscheinungsbild in ihrer Meinung bestätigt, dass Mediziner nicht der Traumberuf war, für den Viele ihn hielten.
Als sie das Arztzimmer betrat, blickte Dr. Martin nur kurz auf, wies ihr einen Stuhl zu und vertiefte sich dann wieder in seine Unterlagen. Dass er einer maximal aufgedonnerten Frau so wenig Aufmerksamkeit schenkte, hätte unter anderen Umständen verletzend wirken können. Doch der Doktor hatte offensichtlich eine harte Schicht hinter sich. Wer weiß, wie viele besorgte, aufgebrachte oder gar hysterische Gattinnen er heute schon hatte beruhigen – oder schockieren – müssen.
„Tja, Frau Isling, ihr Mann hat Glück im Unglück gehabt. Er ist mit ein paar Rippenbrüchen davongekommen. Größere Blutgefäße und Organe wurden nicht verletzt. Normalerweise nicht mal ein Grund zum Operieren, aber in diesem Fall haben wir es mit einer sogenannten Rippenserienfraktur zu tun: Vier Rippen derselben Brustkorbseite, der rechten, sind gebrochen. Wir mussten chirurgisch eingreifen, um die Brustkorbwand zu stabilisieren. Und da Rippenbrüche mit starken Schmerzen einhergehen, bekam Dr. Isling eine Vollnarkose. Ist er eigentlich ein Kollege von uns?“
„Nein, Jurist. Sagen Sie: Wird er wieder ganz gesund?“
„Nach sechs bis acht Wochen, ja.“
Caroline fiel ein Stein vom Herzen.
„Allerdings“, fuhr der Arzt fort, „wird er die nächste Zeit über Schmerzmittel einnehmen müssen. Patienten, die beim Luftholen Schmerzen haben, verfallen nämlich gerne in eine Schonatmung, die wiederum eine Lungenentzündung auslösen kann.“
„Muss er einen Gipsverband oder sowas tragen?“
„Nein, bei Rippenbrüchen wird für gewöhnlich nicht mal eine Bandage angelegt. Alles, was Ihr Mann jetzt braucht, sind Zeit, Ruhe und Pflege.“
„Daran soll es ihm nicht mangeln“, sagte Caroline und konnte zum ersten Mal seit dem großen Schrecken wieder lächeln. „Kann ich jetzt zu ihm?“
„Selbstverständlich. Er wird sich freuen, ein vertrautes Gesicht zu sehen, wenn er aufwacht.“
„Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Martin. Ich hoffe, Sie können bald Ihren wohlverdienten Feierabend genießen.“
„Sobald auch der unvermeidliche Papierkram erledigt ist“, stöhnte der Mediziner, der im Laufe des kurzen Gesprächs etwas aufgetaut war.
Caroline verließ das Arztzimmer und machte sich durch lange Korridore auf die Suche nach dem Aufwachraum. Überall roch es nach Desinfektionsmitteln. Personal, Patienten und Besucher wandelten laufend, gehend, humpelnd oder im Rollstuhl fahrend umher. Was für ein schauriger Ort so eine Klinik doch war! Da wollte sie Daniel so schnell wie möglich herausholen. Zuhause würde sie ihn dann so richtig verwöhnen. Wer weiß, vielleicht hatte dieser Unfall sogar sein Gutes, würden sie endlich mal wieder mehr Zeit miteinander verbringen können. Während bei anderen Paaren die Krise ausbrach, wenn man im Urlaub plötzlich miteinander alleine war, hatte den Islings die Zweisamkeit immer gutgetan.
Der Aufwachraum unterschied sich nur seiner Größe nach von einem gewöhnlichen Krankenzimmer. Insgesamt sieben Betten standen darin, von denen drei belegt waren. In einem lag eine alte Frau, in einem anderen ein vielleicht zehnjähriger Junge, links von seiner schmachtenden Mutter, rechts von seinem Zeitung lesenden Vater flankiert. Caroline nickte den beiden zu.
Daniels Bett befand sich am Ende des Zimmers gleich neben dem Fenster. Sie eilte zu ihm hin und ergriff seine Hand. Er schlief tief und fest. Das schüttere schwarze Haar, das zu den Schläfen hin grau wurde, stand unordentlich nach allen Richtungen ab. Bartstoppeln hatten das blasse Gesicht zu erobern begonnen. Daniel besaß einen kräftigen Bartwuchs – sehr zu seinem Leidwesen, denn er hasste es, sich zu rasieren. Mit Vollbart aber fühlte er sich auch nicht wohl, und so lief es, quasi als Kompromisslösung, auf einen Dreitagebart hinaus, wenn nicht berufliche Erfordernisse eine tägliche Rasur verlangten.
Caroline beugte sich über ihren Mann, küsste ihn und hauchte ein „Ich liebe dich“ in sein Ohr. Dann setzte sie sich in Höhe seiner Brust, die einen elastischen Verband trug, aufs Bett und streichelte sein Haar, was er sehr liebte und stundenlang hätte genießen können. Im Zimmer war es fast so ruhig, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Hin und wieder kam eine Schwester und sah nach dem Rechten. Draußen ging ein schöner Maitag zu Ende.
Nach einer Weile fiel Caroline ein, dass Daniels Eltern und die Kinder noch gar nicht verständigt waren. Sie verließ das Zimmer und zückte auf dem Flur ihr Handy. Es dauerte lange, bis Helga an den Apparat kam. „Caro? Seid ihr noch nicht beim Candle-Light-Dinner? Ich dachte, ihr wolltet heute Abend was losmachen.“
„Hallo Helga, schlafen die Kinder schon?“
„Wo denkst du hin? Sind putzmunter und sehen fern. Aber wir werden sie schon noch ins Bett kriegen. Stimmt was nicht?“
„Ja. Erschreck‘ nicht. Danny hatte einen Autounfall.“
„Was?“
„Keine Sorge, es ist wirklich halb so schlimm.“ Caroline berichtete ihrer Schwiegermutter und schloss mit den Worten: „Dabei ist Danny ein so sicherer Autofahrer. So etwas ist ihm noch nie passiert.“
„Er hatte schon mal einen Unfall“, korrigierte Helga nachdenklich, „lange vor eurer Zeit. Auch damals hat ihm jemand die Vorfahrt genommen. Er war mit seinem Roller unterwegs. Meine Güte, das muss jetzt über ein Vierteljahrhundert her sein.“
„Ach ja“, fiel Caroline ein. „die Narbe an seinem Handgelenk! Die habe ich mal entdeckt. Von sich aus hatte er gar nichts davon erzählt.“
„Hm“, brummte Helga. „Es ist irgendwie verrückt. Vor dem damaligen Unfall war er im Ausnahmezustand gewesen, und jetzt…“
„Was meinst du?“
„Na ja“, Helga wog ihre Worte sorgsam, „ich hatte zuletzt den Eindruck, dass er anders war als sonst. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Geistesabwesend? Unaufmerksam? Mit den Gedanken ganz woanders?“ Man merkte selbst durchs Telefon, dass sie verlegen lächelte.
Caroline verspürte ein Prickeln in der Magengegend. „Was meintest du mit ‚Ausnahmezustand‘?“
„Ach, Teenie-Probleme“, wiegelte Helga ab. „Nichts, was heute noch von Bedeutung wäre. Ist dir in letzter Zeit nichts Ungewöhnliches an ihm aufgefallen?“
„Er hatte in der Firma viel um die Ohren“, antwortete Caroline ausweichend. Sie war nicht in Stimmung für ein tiefgründiges Gespräch mit ihrer Schwiegermutter.
„Ja, das wird es wohl sein“, lenkte Helga ein. „Möchtest du, dass ich die Kinder informiere?“
„Oh, das wäre echt lieb. Mir ist im Moment überhaupt nicht danach. Du wirst schon die richtigen Worte finden. Sag‘ ihnen, Papa wird bald wieder auf dem Damm sein und gib ihnen einen Kuss von mir. Und schöne Grüße auch an Bert.“
Tief in Gedanken versunken ging Caroline ins Aufwachzimmer zurück. Ihrer Schwiegermutter war also auch etwas aufgefallen! Sie würde Daniel darauf ansprechen müssen. In ihrer Berufspraxis hatte sie schon viele Beziehungen scheitern sehen, weil die Partner zu lange an der schönen Illusion einer heilen Welt festgehalten hatten. Scheinbare Perfektion war gefährlich, weil sie die Veränderungsbereitschaft der Menschen einschläferte. Beziehungen aber müssen sich verändern, um bestehen zu können. Umstände ändern sich, und Menschen tun es auch. Was sich nicht anpasst, ist dem Untergang geweiht.
Gerade in der Liebe setzte sich diese Einsicht nur schwer durch. In jedem anderen Lebensbereich waren Carolines Klienten bereit, sich den Erfolg zu erarbeiten, Kompromisse einzugehen und auf Rückschläge mit Beharrlichkeit zu reagieren. In der Liebe dagegen sollte von Anfang an alles vollkommen sein.
Neulich hatte ein Mann ihre Praxis aufgesucht, dem die Damenwelt eigentlich hätte zu Füßen liegen müssen. Er war Anfang Dreißig, sah gut aus, hatte Manieren, eine solide Ausbildung und einen sicheren Job. Im Gespräch erwies er sich als intelligent, bescheiden und freundlich. Und dennoch hatte er noch nie in seinem Leben eine Freundin gehabt, obwohl keine homosexuelle Veranlagung vorlag. „Alle Frauen, die mir gefallen, sind entweder schon vergeben oder haben kein Interesse“, klagte er.
Caroline fragte, wie oft es denn vorkomme, dass ihm eine Frau begegne, die ihm zusage.
Der Klient überlegte. „Höchstens ein oder zwei Mal im Jahr.“
„Würden Sie sagen, dass Ihre Ansprüche hoch sind?“
„Das sind sie wohl. Wieso, ist das etwa falsch?“
„Nein, ich möchte auf etwas anderes hinaus. Tun Sie etwas dafür, um mehr Frauen zu treffen, die in Frage kommen könnten?“
„Zum Beispiel?“
„Wir leben im Zeitalter des Internets. Sie könnten sich bei einer Kontaktbörse anmelden. Wenn Sie statt zweien zwanzig interessante Frauen im Jahr kennenlernten, hätten Sie Ihre Chance, die Richtige zu finden, verzehnfacht.“
Das Gesicht des jungen Mannes nahm einen widerwilligen Ausdruck an. „So etwas lässt sich doch nicht berechnen! Ich finde es total unromantisch, sich über eine Kontaktbörse kennenzulernen, und wenn ich keine romantische Beziehung haben kann, dann lieber gar keine!“
„Es gibt viele Möglichkeiten, eine Partnerin zu finden. Sind Sie wirklich der Meinung, die Romantik einer Beziehung hänge davon ab, auf welchem Weg man sich kennengelernt hat? Oder anders gefragt: Was kennzeichnet Ihrer Meinung nach eine romantische Beziehung?“
Der Klient zögerte kurz. „Hm, ich denke an so etwas wie Liebe auf den ersten Blick. Man sieht jemanden und der Blitz schlägt ein – auf beiden Seiten. Man lernt sich kennen und es passt einfach. Sie wollen mir jetzt sicher einreden, so etwas gebe es nur in Liebesromanen und Filmen.“
„So etwas gibt es sicherlich auch in der Realität. Die Frage ist, wie oft es vorkommt und ob man gut beraten ist, darauf zu bauen und eine derart wichtige Angelegenheit dem Zufall zu überlassen. Vergleichen wir es doch einmal mit einer anderen Situation: Wie haben Sie es denn bei der Jobsuche angestellt? Haben Sie da auch gehofft, einem Arbeitgeber zu begegnen, bei dem ‚der Blitz einschlägt‘, wenn er Sie nur sieht? Oder haben Sie systematisch nach offenen Stellen gesucht, vielleicht sogar Initiativbewerbungen geschrieben? Haben Sie alle Hoffnung auf eine Bewerbung gesetzt oder doch besser möglichst viele abgeschickt?“
„Das ist doch etwas völlig anderes!“
„Es gibt Unterschiede; es gibt aber auch Gemeinsamkeiten. In beiden Fällen haben wir es mit einem Markt zu tun, in dem Angebot und Nachfrage darüber entscheiden, ob Sie bekommen, was Sie wollen.“
„Mir geht es um Liebe, nicht um Geschäftemacherei“, fuhr der Mann auf. „Ich sehne mich nach einer Partnerin, die mich um meiner selbst willen liebt und nicht, weil ich ihr irgendwelche Angebote gemacht habe!“
„Stellen Sie sich einmal vor“, wechselte Caroline den Ansatz, „Sie wären verheiratet und am zehnten Hochzeitstag fragte Ihre Frau Sie: ,Schatz, was liebst du eigentlich an mir?‘ Würden Sie dann wirklich antworten: ‚Ich liebe dich um deiner selbst willen‘? Würden Sie Ihr nicht vielmehr sagen, wie schön sie sei, wie anmutig sie sich bewege, dass Sie ihre Treue und Zuverlässigkeit schätzten, Ihren Humor oder das Interesse, das sie an Ihren Hobbys zeigt. Und wie würde Ihre Frau das aufnehmen? Würde sie sich ärgern und denken: ‚Der liebt mich ja gar nicht um meiner selbst willen, sondern nur, weil ich gut aussehe!‘ Oder würde sie sich über die Komplimente freuen, eben weil sie etwas hat, das sie Ihnen geben kann, das sie attraktiv und begehrenswert macht – weil sie, um es profan auszudrücken, einen hohen Marktwert hat?“
Der Klient kam ins Grübeln: „Ich muss zugeben, dass das einleuchtend klingt. Aber romantisch ist es nicht gerade. Demzufolge wäre Liebe ja etwas, das man kaufen kann wie einen Gebrauchsgegenstand im Supermarkt. Wo wäre da noch der Unterschied zur Prostitution? Und wie passt es zum Beispiel mit der Tatsache zusammen, dass es Menschen gibt, die ihren sterbenskranken Partner auch dann noch pflegen, wenn er ihnen nichts mehr geben kann?“
„Prostituierte lassen sich mit Geld bezahlen. Es gibt aber noch jede Menge andere Möglichkeiten, die Zuwendung eines Menschen zu gewinnen. Ein paar davon habe ich eben genannt: Schönheit, Anmut, Treue, Zuverlässigkeit, Humor, Anteilnahme. Sind die etwa unromantisch? Ebenso kann man jemanden lieben, weil man sich eine goldene Zukunft von ihm verspricht, oder aus Dankbarkeit für eine schöne Vergangenheit. ‚Bezahlt‘ wird jedoch immer irgendwie.“
„Ich weiß nicht, so recht gefallen will mir das nicht.“
„Die gute Nachricht ist, dass Sie Ihr Glück in die Hand nehmen können. Sie müssen nicht stillstehen und darauf hoffen, von Amors Pfeil getroffen zu werden. Überlegen Sie sich, was Sie zu bieten haben, und kommunizieren Sie es ohne falsche Bescheidenheit.“
Von Sitzung zu Sitzung wurde der junge Mann aufgeschlossener für neue Wege der Partnersuche. Gut vier Monate später rief er an, bedankte sich überschwänglich für die Beratung und erzählte, dass er kürzlich eine tolle Frau kennengelernt habe, schon mehrmals mit ihr ausgegangen und hinsichtlich der weiteren Entwicklung bester Dinge sei.
Caroline setzte sich wieder an das Krankenbett, in dem ihr Mann noch immer den Schlaf des Gerechten schlief. Auch die ältere Dame nebenan stand weiterhin unter Narkose, während der kleine Junge in der Zwischenzeit aufgewacht war und leise mit seinen Eltern sprach.
Caroline nahm Daniels Hand und atmete tief durch. Die Anspannung, die seit Polizeimeister Schlichs Anruf von ihr Besitz ergriffen hatte, fiel allmählich ab und machte Gefühlen der Erschöpfung und Erleichterung Platz. Kein Schicksalsschlag, keine grundlegende Veränderung ihres Lebens zum Schlechteren, nur ein kleiner Zwischenfall, der bald überwunden und vergessen sein würde. Alles wird wieder gut, beruhigte sie ihre überreizten Nerven, alles wird gut. Und als ob er die Gedanken seiner Frau unterstreichen wollte, begann Daniel Anzeichen des Erwachens zu zeigen. Er bewegte seinen Oberkörper ein wenig und stöhnte kaum hörbar auf.
Caroline ließ seine Hand los und strich ihm wieder zärtlich durchs Haar. Seine Augen blieben geschlossen, aber sein Gesicht verzog sich zu einem wunderschönen Lächeln, glückselig und irgendwie unschuldig, geradezu jungenhaft. Dann hauchten seine Lippen ein Wort – ein falsches Wort, das Caroline das Blut in den Adern gefrieren ließ: „Hannah.“
II
Daniel Isling war fünfzehn Jahre alt, als er sich vornahm, es allen zu zeigen. Das war kurz nachdem er einen Nackenschlag hatte einstecken müssen – nicht im übertragenen Sinne, sondern ganz buchstäblich: Ein Mitschüler hatte sich in der kurzen Pause zwischen zwei Unterrichtsstunden von hinten an ihn herangeschlichen und mit der flachen Hand überraschend zugehauen. Daniel verfolgte den Übeltäter unter dem Gejohle seiner „Klassenkameraden“ wütend durch den Saal, bis er von Klaus Bötscher, einem älteren Jungen, festgehalten wurde.
Solche Szenen gehörten in der Neunten zu seinem Alltag an der Clemens-Lochner-Realschule, von den Schülern treffend das „Loch“ genannt. Es war nicht immer so schlimm gewesen, aber wohlgefühlt hatte Daniel sich an dieser Bildungseinrichtung nie. Der Kontrast zu der idyllischen Dorfgrundschule in Heiligenwald, die er zuvor besucht hatte, war immens.
Das „Loch“, im Westen von Mainz gelegen, war ein riesiger Betonklotz im Siebziger-Jahre-Stil. Abgesehen von den blauen Fensterrahmen, die der Hässlichkeit des Gebäudes die Spitze nahmen, war alles daran grau, modern, hell, kalt und anonym. Rund tausend Schüler fanden in der Realschule Platz, und die Umgangsformen waren rau.
Daniel kam aus einer gut behüteten Welt. Ein verhätscheltes Einzelkind, war er selbstbewusst, extrovertiert und gesellig. Er hatte auf der Grundschule viele Freunde gehabt und war in seinen Kreisen durchaus tonangebend gewesen. Im „Loch“ änderte sich das alles schlagartig. Die Konfrontation mit dieser fremden Welt war ein Schock, der tiefgreifende Auswirkungen auf seinen Charakter haben sollte. Er verlor einen Großteil seiner Selbstsicherheit, wurde introvertiert und schüchtern.
Wie sein soziales Leben sich veränderte, zeigt eine Episode, die sich zu Beginn der siebten Klasse abspielte. Die Fünfte und Sechste hatten die Orientierungsstufe gebildet, in der sich entschied, ob ein Kind seine Schullaufbahn fortsetzte oder – bei Realschülern – aufs Gymnasium beziehungsweise die Hauptschule wechselte. Daniel war ein mittelmäßiger Schüler und sollte daher im „Loch“ bleiben, wohin wiederum andere von der Hauptschule auf- oder vom Gymnasium abstiegen.
Zu den „Absteigern“ gehörte Anna Peters aus Heiligenwald, die Daniel seit Kindergartentagen kannte und so etwas wie seine Sandkastenliebe gewesen war. Dadurch entstand eine heikle Situation, denn Kontakte zwischen Jungen und Mädchen waren in diesem Alter verpönt. Das schlug sich selbst in der inoffiziellen Sitzordnung nieder, welche die beiden Geschlechter fein säuberlich voneinander trennte. Wer gegen das ungeschriebene Fraternisierungsverbot verstieß, wurde erbarmungslos gehänselt. Deshalb gab es keinen Grund zur Freude, als Daniel auf einmal eine Freundin in der Klasse hatte, sondern Anlass zu schlimmsten Befürchtungen.
Um keine Angriffsfläche zu bieten, verabredeten die beiden Kinder, in der Schule so zu tun, als seien sie einander nie zuvor begegnet, während sie sich nachmittags weiterhin trafen oder miteinander telefonierten. Auf Dauer indessen hielt die Freundschaft dem äußeren Druck nicht stand und nach ein paar Monaten herrschte völlige Funkstille zwischen Daniel und Anna. Fortan besuchten sie dieselbe Klasse wie zwei Fremde, die zufällig im selben Zugabteil reisten.
Das Thema Mädchen gewann damals rasch an Bedeutung. Doch abgesehen von der sozialen Ächtung, der sich aussetzte, wer in der Klasse Interesse am anderen Geschlecht zeigte, hielten Daniels Altersgenossinnen ohnehin lieber nach älteren Jungen Ausschau. Manch eine von ihnen, darunter auch Anna Peters, fand bald ihren ersten Freund in einer der höheren Klassen. Daniel quittierte es mit einem Achselzucken. Viele ältere Jungen hatten eine Freundin. Es schien also lediglich eine Frage der Zeit zu sein, bis auch er eine abbekam. Man brauchte offenbar nichts weiter dafür zu tun als abzuwarten.
Da war es ein großer Schreck, als der Wirtschafts- und Sozialkundelehrer Herr Ahrens eines Tages im Unterricht erzählte, wie er seine heutige Frau in der Schule erobert habe. „Auch ihr solltet euch hier nach einem Partner umschauen “, appellierte der Pädagoge, „denn im späteren Leben werdet ihr kaum mehr Gelegenheit dazu haben.“
Daniel war entsetzt. Das „Loch“ als einzige Chance, um zarte Bande zu knüpfen? Das erschien absurd. Aber die Autorität des Lehrers verlieh der Aussage Glaubwürdigkeit. Erst viel später dämmerte Daniel, dass Herr Ahrens wohl nur das Liebesleben seiner Schützlinge ein wenig hatte ankurbeln wollen.
Die erste Gelegenheit zu intimem Kontakt mit dem anderen Geschlecht kam unverhofft und endete in einem Desaster. In der achten Klasse gab Herr Ostheimer den Biologieunterricht. „Osti“, wie die Schüler ihn nannten, war ein sonderbarer Kauz. Obwohl groß, massig und mit einer dicken Hornbrille ausgestattet, wie ältere Autoritätspersonen sie zu tragen pflegten, machte er einen sehr unsicheren Eindruck. Selbst bei kleinsten Vergehen der Schüler verhängte er drakonische Strafarbeiten, die jedoch nie konsequent eingefordert wurden, so dass bald keiner mehr seine Anweisungen ernst nahm. Wenn jemand eine Strafarbeit von fünf DIN-A4-Seiten nicht ablieferte, bekam er zehn Seiten aufgebrummt. Lieferte er daraufhin wieder nicht ab, wurden fünfzehn Seiten daraus, dann zwanzig, fünfundzwanzig und so weiter, ohne dass der ungehorsame Schüler jemals wirklich zur Rechenschaft gezogen worden wäre.
Besonders nervös war „Osti“ im Sexualkundeunterricht. Dann lief er sogar rot an, stotterte und schwitzte wie ein Schwein. Eines Tages, kurz vor der Biologiestunde, kamen die Rädelsführer der Klasse auf eine Idee, wie man dem allseits belächelten Lehrer einen Streich spielen könne. Dazu wurde die Geschlechtertrennung der Sitzordnung aufgehoben und die Mädchen überredet, sich jeweils neben einen Jungen zu setzen und auffällig mit ihm zu flirten.
Bettina Löffler, das nach allgemeiner Auffassung hübscheste Mädchen der Klasse, war mit dem ihr zugewiesenen Partner nicht einverstanden und beschwerte sich bei Markus Vogler, einem der Rädelsführer. „Dann setz‘ dich halt neben den Danny“, knurrte Vogler, und zu Daniels freudiger Erregung war Bettina dazu sofort bereit.
Die Klassenschönheit war schon lange Gegenstand seiner heimlichen Bewunderung und eigentlich wäre er ihr sehr gerne nähergekommen, aber diese Chance kam nun doch zu überraschend. Kaum hatte Bettina neben Daniel Platz genommen, da schlug seine Freude in Panik um. Was sollte er bloß mit ihr anfangen? In seiner Schüchternheit erstarrte er wie das Kaninchen vor der Schlange und konnte überhaupt nichts unternehmen
Bettina versuchte, den Gag zum Laufen zu bringen, indem sie mit ihrem Stuhl ein Stück auf Daniel zu rückte. Sofort stellte er die alte Distanz wieder her. Sie berührte seine Hand. Er zog sie zurück.
„Was ist denn mit dir los“, fragte sie.
„Ich, äh – meine Mutter würde das nicht gutheißen“, stammelte Daniel und hätte sich im selben Augenblick am liebsten auf die Zunge gebissen. Etwas Dämlicheres hätte ihm wirklich nicht einfallen können!
„Ach, und wir machen immer nur, was die Mama erlaubt“, spottete Bettina. Sie versuchte noch einmal ihr Glück, aber mit dem total verängstigten und verkrampften Jungen war nichts anzufangen. Verärgert und frustriert gab sie es schließlich auf.
Für Daniel war die Stunde eine einzige Tortur und er bekam nicht einmal mit, wie Herr Ostheimer auf den Streich reagierte. Schlimmer konnte es dem Lehrer jedenfalls auch nicht ergangen sein. Anstatt die große Chance zu nutzen, hatte Daniel sich bis auf die Knochen blamiert. Sich an Bettina Löffler heranzuwagen, daran war künftig erst recht nicht mehr zu denken. Der nächste Tiefpunkt im „Loch“ war erreicht – beileibe nicht der letzte.
Am Ende des achten Schuljahres wurden die Karten neu gemischt. Rund ein Drittel der Klasse blieb kleben, darunter mit Ausnahme seines Banknachbarn Thomas Muth sämtliche Mitschüler, mit denen Daniel sich gut verstanden hatte. Die gelichteten Reihen füllten ältere Sitzenbleiber aus den höheren Klassen. Das brachte den Verband völlig aus dem Gleichgewicht. Der älteste Schüler in der Neunten, Harry Weidenfeld, war bereits achtzehn Jahre alt, Daniel gerade einmal fünfzehn.
Dass die Pubertät in diesem Jahr die Hormone ausgelassener Samba tanzen ließ als jemals zuvor oder danach, machte die Verhältnisse noch chaotischer. Die Pickel sprossen, und diejenigen, die schon von Natur aus nicht gerade üppig mit Hirn gesegnet waren, führten sich nun auf, als habe man ihnen das bisschen auch noch amputiert.
Markus Vogler sah den Sturm als Erster aufziehen. Ein vierschrötiges, bauernschlaues Kartoffelgesicht, war er seit jeher einer der Rädelsführer der Klasse gewesen. Rasch begriff er, dass die destruktiven Energien, die sich am Horizont zusammenbrauten, auf ein Ziel gelenkt werden mussten, sollten sie nicht irgendwann ihn selbst treffen. Zu diesem Ziel erkor er Daniel Isling aus. Mit sechs Jahren eingeschult und niemals sitzengeblieben, war dieser der Benjamin der Klasse, außerdem ein Einzelgänger, der gar nicht erst isoliert zu werden brauchte.
Bald nach Beginn des neunten Schuljahres eröffnete Vogler eine regelrechte Hetzkampagne gegen Daniel. Dabei fand er in Klaus Bötscher und Leif Poelke, zwei Neuzugängen, willige Vollstrecker. „Bötsch“, wie er meist gerufen wurde, war siebzehn Jahre alt und der klassische Schlägertyp, der sich gerne zur Verfügung stellte, wann immer Vogler einen Mann fürs Grobe brauchte.
Bei Leif Poelke handelte es sich um eine einfach nur bizarr zu nennende Figur, die – wie Daniel fand – statt in der Schule besser in einer Irrenanstalt aufgehoben gewesen wäre. Er war klein, hatte wilde schwarze Haare und undurchsichtige dunkle Augen. Meist zurückgezogen und schweigsam, konnte er zu jeder Zeit, manchmal mitten im Unterricht, urplötzlich in ein völlig zusammenhangloses Selbstgespräch ausbrechen. In den ersten Wochen des neuen Schuljahres wurde er selbst ausgiebig gehänselt. Dann kam Vogler auf die geniale Idee, diesen Verrückten auf Daniel anzusetzen.
Die geistreiche Parole, mit der der Einpeitscher seinen neuen Schützling aussandte, lautete „Danny Deppert“. Eines Tages unvermittelt ausgesprochen, wurde sie zum Spitznamen, der Daniel fortan in der Klasse anhaftete. Poelke griff ihn begeistert auf. Es kam vor, dass er Daniel in den Pausen auf Schritt und Tritt verfolgte und immerzu „Danny Deppert, Danny Deppert, Danny Deppert…“ in sein Ohr rief. Ein vernünftiges Gespräch mit ihm war unmöglich, und der Versuch, ihn sich mit Gewalt vom Hals zu schaffen, führte lediglich dazu, dass der kräftige Bötscher zu seinen Gunsten intervenierte.
Poelke, „Bötsch“ und Vogler, dieses infernalische Trio machte Daniel das Leben zur Hölle. Ihm zu helfen, traute sich keiner. Auch Thomas Muth strafte seinen Nachnamen Lügen und erwies sich als Mitläufer, der sich bei „Bötsch“ einschleimte, um ein bisschen von dessen Macht abzubekommen.
Die Lehrer bemerkten nur die Spitze des Eisbergs und reagierten, wenn überhaupt, halbherzig. Autoritäre Pädagogen, die ihre Klasse im Griff hatten, waren Daniel am liebsten, denn in deren Unterrichtsstunden war man einigermaßen sicher. Die meisten Lehrer erwiesen sich jedoch als unfähig, für Ordnung zu sorgen. Dann wurde Daniel, der sich in der allerersten Stunde des neuen Schuljahres unklugerweise in die Mitte der ersten Reihe gesetzt hatte, sogar während des Unterrichts mit Gegenständen beworfen.
Herr Ostheimer war nicht der einzige Lehrer, der selbst zum Mobbingopfer wurde. Die junge Deutschreferendarin Frau Krause wurde von ihren Schülern so respektlos behandelt, dass sie eines Tages weinend aus der Klasse lief. Auf die Obrigkeit, diese lebenslange Lehre zog Daniel aus seiner Realschulzeit, war kein Verlass. Das waren auch nur Menschen, deren Fehlerquote sich nicht von der ihrer Untergebenen unterschied. Besser, man nahm die Dinge selbst in die Hand.
Von den Eltern Abhilfe zu erbitten, kam ebenfalls nicht in Frage. In der Orientierungsstufe mochte es noch angegangen sein, dass Herbert Isling ab und an in die Schule kam und den Peinigern seines Sohnes die Leviten las. Aber ein Fünfzehnjähriger musste seine Probleme selbst in den Griff bekommen. Daniel verbot es sich, mit seinem Vater über das Ausmaß seines Martyriums zu reden. Sich als Loser der Klasse zu outen, wäre allzu peinlich gewesen.
Ob Herbert seinen Sprössling verstanden hätte, war ohnehin zweifelhaft. Sein Verhalten gab nicht gerade Anlass zur Hoffnung. Wie viele Männer seiner Generation war Herbert Isling ein Autonarr. In seiner Jugend waren nur wenige Automobile unterwegs gewesen, und sie symbolisierten alles, wovon ein Junge so träumte: Wohlstand, Status und Sexappeal. Die Fahrzeuge aus der Nachkriegszeit hatten es Herbert besonders angetan. Stets war er im Besitz irgendeines Oldtimers, in dem er gerne Spazierfahrten unternahm.
Eine Gelegenheit, sich mit so einem Gefährt zu zeigen, bestand darin, den Sohn von der Schule abzuholen. Dabei hielt Herbert, um möglichst viel Aufsehen zu erregen, am liebsten mitten auf dem Busparkplatz, wo dann die halbe Schule beobachten konnte, wie Daniel in einen alten Citroën oder Mercedes einstieg. In den sechziger Jahren mochte es ja cool gewesen sein, mit so einem Schlitten vorzufahren, neuerdings wirkte es aber einfach nur großkotzig und machte den Beifahrer zum Gespött seiner Mitschüler.
Daniels inständige Bitten an den Vater, doch einen Häuserblock weiter unauffällig auf ihn zu warten, trafen auf völliges Unverständnis. Herbert war geradezu beleidigt, warf ihm Undankbarkeit und „Interesselosigkeit“ vor. „Du solltest froh sein, überhaupt abgeholt zu werden. Wenn es dir nicht passt, kannst du ja den Schulbus nehmen.“ Das wollte Daniel freilich auf keinen Fall. Es reichte wirklich, Vogler und Konsorten in der Schule erdulden zu müssen, da wollte er sie nicht auch noch im Bus um sich haben.
So blieb ihm nur, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und die Augen zu verdrehen, wenn sein Vater wieder einmal die Anekdote zum Besten gab, wie er bereits als junger Mann ein Auto besessen hatte und die Lehrer, die selbst noch mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhren, dumm aus der Wäsche guckten, als er damit an der Schule vorfuhr. Dass Herbert damals neunzehn Jahre alt gewesen war und die elfte Klasse des Gymnasiums besucht hatte, während der fünfzehnjährige Daniel in die neunte Klasse der Realschule ging, tat nichts zur Sache. Der Junge sollte es gefälligst zu schätzen wissen, mit einem Museumsstück abgeholt zu werden.
Andererseits hatte auch Herbert es nicht immer leicht, wusste nicht, warum sein Sohn regelmäßig mit schlechter Laune aus der Schule kam und diese an ihm ausließ. Zuhause schleuderte Daniel den Schulranzen in eine Ecke, warf sich aufs Bett und schnaufte erst einmal tief durch. Dann griff er nach dem Buch auf seinem Nachttisch und sein eigentliches Leben begann.
Gegen Ende der Orientierungsstufe hatte er seine Faszination für historische Stoffe entdeckt. Über eine Beilage der Fernsehzeitung konnte man Geschichtsbücher bestellen. Daniel erstand einen Band über den Afrika-Feldzug im Zweiten Weltkrieg und verschlang das Werk in einer einzigen langen Nacht. Damit war ein unstillbarer Hunger nach weiteren Informationen zu solchen Themen geweckt.
Bevorzugt las er Biografien großer Persönlichkeiten. Den Anfang machte Stefan Zweigs „Bildnis eines politischen Menschen“ über den französischen Polizeiminister Joseph Fouché. Staatsmänner, Feldherren, Religionsführer, auch Entdecker, Erfinder, Wissenschaftler und Unternehmer wurden zu Daniels ständigen Begleitern. Sie inspirierten ihn, gaben Zuversicht und Kraft. Wenn diese Männer (und auch Frauen) die Welt aus den Angeln gehoben hatten, dann würde es ihm doch wohl gelingen können, seine persönliche kleine Umgebung zufriedenstellend zu regeln! Glück war kein Zufallsprodukt. Es ließ sich erarbeiten und erkämpfen.
Daniel erwarb einen für sein Alter hohen, wenn auch einseitigen Bildungsstand bei gleichzeitiger Praxisferne in allen Bereichen, die für die meisten Heranwachsenden von großer Bedeutung waren. Er hatte keine engen Freunde mehr und dementsprechend keine Vorstellung davon, wie Gleichaltrige ihre Freizeit verbrachten. Sein Leben glich dem eines Mönchs, der in seiner Stube theologische Studien betreibt und nur zum Arbeiten und Beten nach draußen geht.
Die Isolation der Realschuljahre zeitigte eine sonderbare Mischung aus sozialem Minderwertigkeitskomplex und geistigem Überlegenheitsgefühl. Im Umgang mit anderen Menschen konnte Daniel nur mühsam seine Unsicherheit verbergen. Gleichzeitig hielt er sich für etwas Besseres und wollte es ihm wie Hohn vorkommen, dass Kreaturen wie Vogler & Co. ihn zu unterdrücken vermochten.
Aus der unüberbrückbaren Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit entstanden ein Hass auf und eine Verachtung für seine Peiniger, die von solcher Kälte waren, dass Daniel selbst darüber erschrak. Seine Rachegelüste blieben indessen auf das Reich der Phantasie beschränkt, denn im Grunde seines Herzens verabscheute er Gewalt. Es musste eine andere Möglichkeit geben, sich zu behaupten. Nachdem Daniel zum wiederholten Male einen Nackenschlag hatte einstecken müssen, kam ihm die Idee.
Seine Widersacher hatten eine gemeinsame Schwäche: Allesamt waren sie schlechte oder höchstens durchschnittliche Schüler. Wenn Daniel seine Gaben dafür einsetzte, gute Noten zu schreiben, würde er sie leicht überflügeln können. An dem Mobbing mochte das nichts ändern, es wahrscheinlich sogar noch verstärken, aber es würde sein Selbstwertgefühl heben und die eigentliche Hierarchie in der Klasse deutlich machen. „Ihr könnt mich verachten und quälen“, lautete die Devise, „das ändert nicht das Geringste daran, dass ich besser bin als ihr. Ihr seid hier die Deppen, nicht ich!“
Mitten im neunten Schuljahr begann Daniel, der sich bislang kaum für den Unterricht interessiert hatte, aufzupassen und mitzuarbeiten. Er machte jetzt regelmäßig seine Hausaufgaben, trug bevorstehende Klassenarbeiten in einen Kalender ein und lernte darauf. Das intellektuelle Niveau der Realschule war so niedrig, dass diese simplen Maßnahmen bereits ausreichten, aus einem unauffälligen einen herausragenden Schüler zu machen.
Daniels Beliebtheit erreichte dadurch den absoluten Tiefpunkt. Zu den üblichen Schmähungen kam nun der Ruf, eine „Strebersau“ zu sein. Allein es ließ ihn kalt. Er hatte sich einen dicken Schutzpanzer zugelegt, an dem die Anwürfe abprallten. Das ging so weit, Beleidigungen als Auszeichnung aufzufassen. Die Voglers dieser Welt waren Feinde. Wer von ihnen angegriffen wurde, musste auf der richtigen Seite stehen. Sein eigenes schlechtes Image erfüllte Daniel nun mit Stolz. Er fand bald einen perversen Spaß daran, gegen den Strom zu schwimmen. Andere wurden gehänselt, weil sie Streber waren. Daniel wurde zum Streber, weil er gehänselt wurde.
Die Logik dieser Einstellung wies aufs Gymnasium. Dazu bedurfte es einer Empfehlung des Lehrkörpers, die im Halbjahreszeugnis der zehnten Klasse stehen musste. Folgerichtig legte Daniel sich im ersten Halbjahr des neuen Schuljahres so richtig ins Zeug. Perfektionismus, Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, Willensstärke, Fleiß und eiserne Disziplin wurden ihm zur zweiten Natur. Seine Noten waren so gut wie nie zuvor, immer häufiger brach nun aber auch eine ätzende Überheblichkeit aus ihm hervor. Allzu gerne ließ er seine Mitschüler spüren, dass er sie für Hohlköpfe hielt.
Als die Ausgabe der entscheidenden Halbjahreszeugnisse nahte, gab es jedoch eine böse Überraschung. Die Klassenlehrerin Frau Schmitz trat eines Tages vor ihre Schüler und fragte, wer denn eine Empfehlung fürs Gymnasium haben wolle. Daniel war wie vom Donner gerührt. Was gab es da zu diskutieren? Wer hinreichende Leistungen erbracht hatte, sollte eine Empfehlung bekommen. Alle anderen gehörten aussortiert – ohne Pardon!
Wenig überraschend gingen die Hände einiger Schüler hoch, die Daniels Meinung nach schon auf der Realschule fehl am Platz waren. Dass Empfehlungen auf diese Weise vergeben werden sollten, war unter den Lehrern durchaus umstritten, und das Kollegium einigte sich nach einer Debatte darauf, zwei Kategorien zu schaffen. In den Zeugnissen der guten Schüler stand, der Übergang aufs Gymnasium werde „empfohlen“, bei den schlechteren war er lediglich „möglich“. Damit war jedoch ein Einfallstor für Beschwerden von Eltern geöffnet, deren Kinder „benachteiligt“ worden seien. Ein Sturm der Entrüstung brach los, vor dem die Lehrerschaft rasch kapitulierte, so dass letzten Endes tatsächlich jeder, der die Hand gehoben hatte, eine Empfehlung fürs Gymnasium erhielt.
Daniel war empört. Er fühlte sich um seine Leistung betrogen – sein neues Lebenselixier. Wo gab es in so einem korrupten System noch einen Anreiz, sich anzustrengen? Wie konnte man sich da noch auszeichnen? Von diesem Erlebnis an empfand er eine tiefe Abscheu gegen jede Form von Gleichmacherei. Wer friedlichen Wettbewerb torpedierte, tat den Menschen keinen Gefallen, sondern nahm ihnen die Chance, sich wirklich zu beweisen. Die Obrigkeit hatte erneut versagt.
Immerhin hatte in der Zwischenzeit das Mobbing nachgelassen. Vor dem Abschied vom „Loch“ sollte es indessen noch einen Tiefschlag setzen, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Kurz vor Ende des zehnten Schuljahres kam ein Fotograf, um sämtliche Abschlussklassen abzulichten. Bei schönem Wetter ging es in Shorts und T-Shirts in die „Raucherecke“ des großen Pausenhofes, wo Steinstufen eine praktische Kulisse für ein Gruppenbild abgaben.
Daniel saß wie immer in der ersten Reihe, und während der Fotograf noch ein paar andere Schüler arrangierte, hörte er zufällig, dass seine Klassenkameradin Natalie Schäffler, die weiter hinten Platz genommen hatte, zu einer Freundin sagte: „Der Danny hat aber hässliche Waden.“ Das war nicht für seine Ohren bestimmt gewesen, etwa um ihn zu ärgern. Ohnehin hatte die Schäffler ihm stets neutral gegenübergestanden. Ihr Urteil erschien als eine Art unabhängiges Sachverständigengutachten.
Dass die Unfreundlichkeit von unerwarteter Seite kam, verlieh ihr ungeahnte Durchschlagskraft. Und dass sie von einem Mädchen ausging, multiplizierte die Wirkung zusätzlich. Teenager reagieren auf die Urteile von Angehörigen des anderen Geschlechts viel empfindlicher als ältere Semester. Eine Frau hatte Daniel die Attraktivität abgesprochen! Das kränkte sein noch kaum entwickeltes männliches Ego zutiefst. Er war völlig geknickt. Dieser eine Satz traf ihn härter als all die Schmähungen der Voglers, Bötschers und Poelkes zusammengenommen.
Einzig und allein die Aussicht, dem „Loch“ nach sechs langen Jahren endlich zu entrinnen, konnte ihn wieder aufmuntern. Als die Klassenlehrerin Frau Schmitz für den Abend des letzten Schultages ein gemeinsames Essen in einer Pizzeria organisierte, wollte er erst gar nicht hingehen. Bloß keine Minute länger als unbedingt notwendig mit diesen Leuten verbringen! Doch dann überlegte er es sich anders. Es war ein freiwilliges Treffen und eine Gelegenheit zu beweisen, dass er keine Angst hatte.
Daniel ging also hin und stellte erstaunt fest, dass seine einstigen Peiniger sich lammfromm verhielten. Manch einer, der in den vergangenen Jahren eine große Klappe gehabt hatte, war mit einem Mal auffallend still geworden. Alle wussten oder ahnten wenigstens, dass in Zukunft andere Qualitäten gefordert sein würden. Viele hatten Angst vor dem neuen Lebensabschnitt. Daniel dagegen strotzte vor Optimismus und Vorfreude. Für ihn konnte es nur besser werden.





























