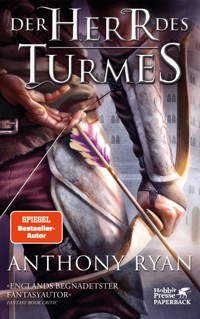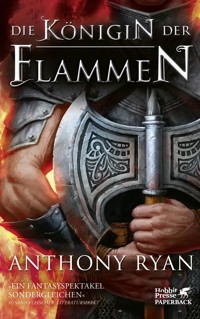9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer sich erinnert, muss sterben Sechs Menschen erwachen auf einem Schiff. Ohne jede Erinnerung. Der siebte ist tot. Was ist passiert? Warum nimmt das Schiff Kurs auf ein postapokalyptisches London? Und von welchem Grauen künden die Schreie im dichten Nebel? Eine Mission auf Leben und Tod beginnt, der sich niemand entziehen kann. Als Huxley zu sich kommt, weiß er nichts mehr. Nicht mal seinen Namen. »Huxley« ist ihm auf den Unterarm tätowiert. Offenbar befindet er sich an Bord eines fremdgesteuerten Militärschiffs auf der Themse. Und er ist nicht allein. Da gibt es noch fünf weitere Überlebende. Den sechsten findet er tot auf, Selbstmord. Sie alle sind nicht zufällig hier: Zusammen sind sie Polizist, Soldat, Ärztin, Physikerin, Historiker und Polarforscherin. Über ein Satellitentelefon erhalten sie von einer mysteriösen Stimme Anweisungen. Immer weiter steuern sie in ein zerstörtes und ausgestorbenes London hinein. Doch schließlich stellen sich ihnen nicht mehr nur Schiffswracks und Brückenruinen in den Weg. Immer lauter werden die Schreie in der Ferne. Im dichter werdenden Nebel lauert ein Grauen außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Mit jeder Seemeile wird deutlicher, dass ihre Reise ins Unbekannte ein schreckliches Geheimnis birgt. »Mit diesem spannungsgeladenen Thriller beweist Bestsellerautor Anthony Ryan, dass er weit mehr kann als Fantasy.« Publishers Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Anthony Ryan
Ein Fluss so rot und schwarz
Aus dem Englischen von Sara Riffel
Tropen
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Tropen
www.tropen.de
Die Originalausgabe erscheint 2023 unter dem Titel »Red River Seven« im Verlag Orbit, London
© 2023 by Anthony Ryan
All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form
Für die deutsche Ausgabe
© 2023, 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: © Zero-Media.net, München
Illustration: ©FinePic®, München
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-50258-9
E-Book ISBN 978-3-608-12196-4
Im Andenken an Nigel Kneale, Schöpfer von Quatermassund Meister der High-Concept-Apokalypse.
Man kann nicht zweimal in denselben Fluß steigen, denn alles fließt und nichts bleibt.
Heraklit
Eins
Eher war es der Schrei als der Schuss, der ihn weckte. Es war kein menschlicher Schrei.
Dass ein Schuss gefallen war, wusste er. Als er den Kopf hob, dröhnte ihm noch der schwindende, aber vertraute Nachhall in den Ohren. Er blinzelte, seine Augen brannten von Salz und Sprühregen.
Wieder ertönte der Schrei. Er drehte sich auf die Seite und presste die Hände auf eisiges, mit Gummi überzogenes Metall, drückte sich von einer Oberfläche hoch, die schwankend auf und nieder wogte. Er drehte sich in die Richtung, aus der der Schrei gekommen war, so schrill und durchdringend, dass ihm Schmerzen durch den Schädel blitzten. Nach mehrmaligem Blinzeln kam der Urheber des Schreis in Sicht, der tatsächlich kein Mensch war.
Die Möwe legte den Kopf schief. Eine steife Brise zerzauste ihr Gefieder, während sie an Deck auf und nieder wippte, als machte sie sich startbereit. Wollte sie sich auf ihn stürzen? Möwen konnten nämlich ziemlich fies sein. Aber das Tier riss nur den gelben Schnabel auf und stieß ein neuerliches Kreischen aus, bevor es seine beeindruckend großen Schwingen ausbreitete und sich in die Luft erhob. Er sah der davonfliegenden Möwe nach, die über aufgewühlte graue Wellen hinwegsegelte und schließlich in einem Dunstschleier verschwand.
»Meer …« Das Wort raspelte über eine trockene Zunge, bevor es ihm über die Lippen kam. »Ich bin auf dem Meer.« Aus unerfindlichem Grund kam ihm das witzig vor, und er lachte. Das Ausmaß seiner Belustigung überraschte ihn. Die lauten, atemlosen Lachsalven ließen ihn erneut aufs Deck sinken, und er krümmte sich zusammen. Deck, bemerkte er, als er sich wieder beruhigt hatte. Ich bin auf einem Boot oder Schiff.
Sofort wollte er wieder hochkommen und seine Umgebung genauer in Augenschein nehmen, doch aus genauso unerfindlichem Grund gab er dem Impuls nicht nach. Eine geschlagene Minute lag er zusammengerollt auf dem Deck, das Gesicht nur wenige Zentimeter von der Gummimatte entfernt. Sein Herz raste, und er suchte nach dem Grund für seine Lähmung. Ich habe Angst. Warum? Die Antwort dämmerte ihm so beschämend offensichtlich, dass er beinahe wieder losgelacht hätte. Der Schuss, du Idiot. Da war ein Schuss. Jetzt steh auf, bevor der nächste folgt.
Mit zusammengebissenen Zähnen stemmte er sich gegen das Deck und kam mühsam auf die Knie. Er drehte den Kopf auf der Suche nach Bedrohungen. Sein Blick schweifte über in Dunst gehüllte Wellen, das weißgraue Kielwasser des Bootes und ein kleines, mit einer Plane abgedecktes Schlauchboot, das an einer Leine ins Wasser hing. Kleines Boot, großes Boot, dachte er und musste wieder einen Lachanfall unterdrücken. Hysterie, korrigierte er sich. Er holte tief Luft.
Was er sah, als er nach rechts schaute, ließ jeden Rest Heiterkeit sofort verfliegen.
Ein Leichnam lehnte an einer Schottwand, deren Dunkelgrau von einer schwarz-roten Fontäne verunziert wurde, die vor Kurzem erst aus dem Schädel des Toten gespritzt sein musste. Der Mann trug einfache Militärkleidung und Stiefel, ohne Abzeichen oder Namensschild an der Jacke. Sein Kopf baumelte zur Seite, sein Gesicht war das eines Fremden. Eine durchs Kinn geschossene Kugel, die oben am Scheitel wieder austritt, kann die Züge eines Menschen aber auch ziemlich entstellen. Ein Arm hing schlaff herab, der andere ruhte im Schoß des Toten, in der Hand eine Pistole.
»M18, SIG Sauer«, murmelte er reflexartig. Die Waffe war ihm vertraut. Es handelte sich um eine klassische US-amerikanische Dienstpistole. Siebzehn Schuss Ladung. Reichweite fünfzig Meter. Noch wichtiger war in diesem Moment die Erkenntnis, dass er zwar die Pistole benennen konnte, seinen eigenen Namen aber kannte er nicht.
Ein Stöhnen entwich ihm, in dem heftige, fast schon schmerzhafte Verwirrung lag. Er schloss die Augen, sein Herz hämmerte noch schneller. Mein Name. Mein Name ist … Mein verdammter Name ist …!
Nichts. Nur stille Leere. Als würde er in einen Kasten ohne Inhalt greifen.
Kontext, sagte er sich, als Furcht in Panik umzuschlagen drohte. Du hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Ein Unfall oder so was. Das ist ein Traum oder eine Halluzination. Stell dir einen Kontext vor. Ein Zuhause. Einen Job. Dann fällt dir der Name schon ein.
Ächzend rang er um Konzentration. Aus den Augen rannen ihm Tränen, so fest presste er die Lider zusammen.
Ein Zuhause. Nichts.
Ein Job. Nichts.
Geliebte, Ehefrau. Nichts.
Mutter, Vater, Schwester, Bruder. Nichts.
In der Dunkelheit vor seinem geistigen Auge schimmerten Sterne, die sich zu nichts Vertrautem zusammenfügen wollten. Keine Gesichter und ganz sicher keine Namen.
Orte, dachte er. Inzwischen hatte ein fiebriges Zittern von ihm Besitz ergriffen. Benenne einen Ort. Irgendeinen … Poughkeepsie. Wie bitte? Warum ausgerechnet Poughkeepsie? Kannte er Poughkeepsie? Stammte er von dort?
Nein. Das war aus einem Film. Eine Dialogzeile von Gene Hackman. Aus dem Film mit der großen Verfolgungsjagd unter der West End … The French Connection. Ich kann mich an Dialogfetzen aus Filmen erinnern, aber nicht an meinen eigenen Namen?
Er klatschte sich mit den Händen gegen die Schläfen, um nachzuhelfen, und hielt inne, als er die rauen Stoppeln auf seiner Kopfhaut spürte. Geschoren, erkannte er. Mit den Fingern fuhr er über die von Gischtspritzern feuchte Haut. Kurzgeschoren … Seine Finger verharrten, als sie auf einen Bruch in der stachligen Oberfläche stießen, eine gewölbte Linie, die von seinem linken Auge am Schädel entlang bis hinauf zum Scheitel verlief. Narbe.
Wieder stiegen Gedanken an Unfälle und Verletzungen in ihm hoch, doch er unterdrückte sie. Die Gleichmäßigkeit der Narbe, der schnurgerade Verlauf machten offensichtlich, worum es sich handelte. Operation. Jemand hat mir den Schädel aufgeschnitten. Er ertastete keine Nähte, der Schnitt war also bereits verheilt. Die Narbe fühlte sich sauber, aber wulstig und geschwollen an. Der Eingriff, was immer es war, hatte vermutlich vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden.
Operiert und auf ein Boot verfrachtet, zusammen mit einer Leiche. Sein Blick ging wieder zu dem Toten, blieb mit morbidem Interesse an dem rot-schwarzen Fleck an der Schottwand hängen und wanderte weiter zu der Pistole. Nur, dass der Kerl vor ein paar Minuten noch lebendig war. Er kroch näher an ihn heran und kämpfte dabei gegen Übelkeit und einen instinktiven Ekel vor allem Toten an. Ihm fiel auf, dass der fremde Selbstmörder mit der Militärkleidung und der klassischen Dienstwaffe ebenfalls einen geschorenen Schädel hatte. Bei genauerer Betrachtung des Kopfes erkannte er eine dunkelviolette Narbe, die vermutlich identisch mit seiner eigenen war.
Und noch etwas bemerkte er, als er ein Stück zurückwich. Nachdem der Mann sich selbst erschossen hatte, war sein Handgelenk so in den Schoß gefallen, dass die Innenseite seines Unterarms sichtbar wurde. Der Ärmel war ein Stück hochgerutscht und ließ Teile eines Tattoos erkennen. Der Griff nach der Pistole erfolgte überraschend schnell und entschlossen, ebenso die Art, wie er sie sicherte und in den Hosenbund seines Militäranzugs steckte.
Muskelgedächtnis. Er griff nach dem Handgelenk des Toten und schob den Ärmel hoch, um das Tattoo zu betrachten. Es war ein einzelnes Wort, ein Name, in klaren, schnörkellosen Buchstaben: CONRAD.
Er wartete darauf, dass der Name in ihm etwas zum Klingen brachte, eine Ahnung erzeugte, aber er stieß nur wieder auf den leeren Kasten. »Narbe«, murmelte er laut. »Geschorener Kopf, Kleidung. Was haben wir noch gemeinsam, Kumpel?«
Die Knöpfe an den Ärmeln seiner eigenen Jacke waren geschlossen, und beim Öffnen stellte er sich weitaus ungeschickter an als beim Einstecken der Pistole des Toten – Conrad. Willst du deinen Namen nicht wissen? Er musste sich wieder ein Lachen verkneifen und zwang sich, präziser vorzugehen, bis die Manschettenknöpfe endlich gelöst waren und er die Ärmel hochkrempeln konnte. Das Tattoo befand sich auch bei ihm am rechten Arm, dieselben Buchstaben, anderer Name: HUXLEY.
»Huxley.« Er sprach leise, ein Flüstern, das er selbst kaum hörte. Dann, als er wieder nur den leeren Kasten vorfand, wiederholte er es lauter. »Huxley.« Nichts.
»Huxley!« Nichts.
»HUXLEY!«
Ein wütendes Knurren eher als ein Schrei, und doch regte sich keine Erinnerung. Dennoch tat sich etwas, wenn auch nicht bei ihm. Das Geräusch drang durch die offene Luke rechts neben Conrads Leichnam, ein dunkler Durchgang, den sein überforderter Verstand bislang gar nicht bemerkt hatte. Ein kurzes Rascheln, gefolgt von einem scharfen Ausatmen vielleicht, er war sich nicht sicher. Völlig sicher war dagegen, dass er und der arme Conrad nicht allein auf dem Boot waren.
Verstecken! Der Drang überkam ihn instinktiv. Vielleicht etwas, das ein Krimineller denken würde? Oder jemand, der schon öfter in Situationen gesteckt hatte, in denen es um Leben und Tod ging. Denn genau darum handelte es sich hier, das stand für ihn fest. Wirklich, Huxley? Wie wär’s denn mit einem Beispiel? Irgendeine konkrete Erinnerung wär jetzt nicht schlecht.
Huxley hatte dagegen wieder nur den leeren Kasten zu bieten.
Verstecken kommt nicht infrage. Nach allem, was er von dem Boot sehen konnte, war es nicht sonderlich groß und hielt entsprechend wenige Verstecke bereit. Außerdem hatte der Unbekannte hinter der Luke vielleicht eine Ahnung, wer er war. Er griff an seinen Hosenbund, ließ die Pistole aber stecken. Mit vorgehaltener Waffe machte man sich keine Freunde.
»Hallo!«, rief er durch die Luke. Seine Stimme klang zittrig und heiser und machte sicherlich kaum Eindruck. Er räusperte sich und versuchte es erneut, trat mit erhobenen Händen in die Kabine. »Ich komme jetzt rein, okay? Bin nicht bewaffnet oder so. Ich will nur …«
Die Frau kam hinter einigen gepolsterten Sitzen hoch, eine SIG Sauer mit beiden Händen umklammernd, die Mündung ein schwarzer Kreis, was hieß, dass sie direkt auf sein Gesicht gerichtet war.
»… Hallo sagen«, beendete er den Satz und lächelte schwach.
Die Frau starrte ihn schweigend an, lange genug, um ein paar entscheidende Erkenntnisse über sie zu erlangen. Erstens: Sie hatte einen geschorenen Kopf und eine Narbe, genau wie er und Conrad. Zweitens: Sie trug einen Militäranzug ohne Abzeichen, genau wie er und Conrad. Drittens: So wie ihre Hand zitterte und ihre Nasenflügel sich blähten, während sie hektische, adrenalingesteuerte Atemzüge nahm, war sie zu Tode verängstigt und nahm gerade ihren ganzen Mut zusammen, um ihn abzuknallen.
Wie genau es ihm gelang, in diesem Moment das Richtige zu sagen, wusste er nicht, aber die Worte kamen ihm leicht und ruhig über die Lippen, ohne jede Drohung, jedes Flehen oder sonst etwas, das sie hätte in Panik versetzen und veranlassen können, den Abzug zu drücken. »Du kennst deinen Namen nicht, oder?«, fragte er.
Sie runzelte die Stirn. Die fehlenden Haare und die Militärkleidung machten es schwierig, ihr Alter zu schätzen. Dreißig, vielleicht älter? In ihrem Gesicht sah er vorwiegend Angst, ihre Augen spiegelten aber auch eine scharfe Intelligenz, die gegen das bedenkliche Zittern ihrer Waffe jedoch nicht ankam.
»Wie ist dein Name?«, fragte sie, ihr Akzent amerikanisch, Ostküste. Boston vielleicht. Woher wusste er das?
»Keine Ahnung«, erwiderte er, drehte den erhobenen Arm und zeigte ihr das Tattoo. »Aber ich denke mal, du kannst Huxley zu mir sagen. Wie soll ich dich nennen?«
Ihr Stirnrunzeln vertiefte sich, wachsende Furcht ließ ihr Gesicht zucken, doch dann erschauerte sie und zwang sich zur Beherrschung. »Bleib da«, sagte die Frau und machte langsam einen Schritt zurück, dann zwei weitere. Unterdessen gestattete er sich, die Kabine genauer zu betrachten. Überall herrschte nüchterne militärische Funktionalität. Kabelkanäle verliefen über die Wände zum Deck. Zur Rechten noch eine Luke, mit einer Leiter, die nach unten führte. Hinter der Frau befand sich ein erhöhtes Deck. Drei leere gepolsterte Stühle standen vor einer Art Armaturenbrett mit zahlreichen Monitoren und Knöpfen, aber ohne Steuerrad.
Pinne, korrigierte er sich. Das Steuer eines Bootes heißt Pinne, du Holzkopf.
Bei den Monitoren handelte es sich um moderne Flatscreens, die mit robusten Plastikabdeckungen geschützt waren. Obwohl sich das Boot vorwärtsbewegte und wohl auch nicht steuerlos dahintrieb, blieben die Anzeigen jedoch schwarz und leer. Hinter dem Armaturenbrett waren durch drei Schrägfenster ein grauer Himmel und ein in Dunst gehülltes Meer zu sehen.
»Ich hab einen Schuss gehört«, sagte die Frau. Er wandte sich wieder ihr zu. Sie hielt die Pistole mit ausgestrecktem Arm auf ihn gerichtet und öffnete die Knöpfe an ihrem Ärmel.
»Da draußen ist noch jemand.« Er nickte über seine Schulter. »Ein toter Jemand. Hat sich wohl selbst erschossen. Sein Name ist Conrad, jedenfalls laut seinem Tattoo.«
Sie krempelte ihren Ärmel bis zum Ellbogen hoch und warf einen Blick auf den Namen darunter, dann nahm sie die Waffe in die andere Hand und zeigte ihm das Tattoo: RHYS.
»Sagt dir das was?«, fragte sie. In ihrer Stimme schwang verzweifelte Anklage mit. Offenbar war sie sich ziemlich sicher, wie seine Antwort lauten würde.
»Auch nicht mehr als das hier.« Er hielt wieder seine Tätowierung hoch. »Oder Conrad. Tut mir leid, Lady. Du bist für mich eine Fremde, so wie ich für dich ein Fremder bin und, tja, eigentlich auch für mich selbst. Zwei Leute ohne Gedächtnis auf einem Boot. Vielleicht ist es nicht so clever, uns gegenseitig mit Waffen zu bedrohen, wenn wir herausfinden wollen, was hier los ist.«
»Wie kann ich wissen, dass dieser Conrad sich wirklich selbst umgebracht hat?«, fragte sie mit funkelndem Blick.
»Kannst du nicht. Genauso wie ich nicht wissen kann, ob nicht du ihn erschossen hast und es nur wie Selbstmord aussehen lässt. Ich war schließlich nicht dabei.«
Ihr Blick ging zu seiner Narbe, und mit der freien Hand tastete sie nach ihrer eigenen.
»Operationsnarbe, oder?«, sagte er. »Sieht aus, als hätte da oben jemand drin rumgepfuscht.«
Ihre Hand mit der Waffe sank langsam nach unten, während sie mit den Fingern die Narbe entlangstrich. »Weniger als einen Monat alt.« Sie trat einen halben Schritt vor, um seine Narbe genauer zu betrachten. »Wie bei dir. Jedenfalls dem Heilungsgrad nach.«
»Kennst du dich damit aus? Bist du Ärztin? Chirurgin?«
Verwirrung zeichnete sich auf ihrem Gesicht ab, und die Angst kehrte zurück. »Ich weiß es nicht«, flüsterte sie verzweifelt.
Er wollte eine weitere Frage stellen, herausfinden, ob sie noch mehr medizinische Kenntnisse besaß, aber ein wütender Schrei aus Richtung der Leiter ließ ihn nach Conrads Pistole greifen.
»Nicht!« Rhys hob ihre eigene Waffe, beide Hände am Griff, ein Finger am Abzugsbügel. Eine routinierte Reaktion, genau wie bei ihm.
»Ganz ruhig, Lady«, sagte er.
»Nenn mich nicht so!« Ihr Finger zuckte. »Ich hasse das, verdammt noch mal!«
»Woher weißt du, dass du das hasst?«
Das ließ sie innehalten. Sie schloss den Mund und biss die Zähne aufeinander. Greift wohl selbst in einen leeren Kasten. Besser, er ließ ihr keine Zeit zum Nachdenken.
»Klingt, als hätten wir Gesellschaft.« Er nickte zur Leiter hinüber. »Vielleicht sollten wir uns vorstellen gehen.«
Sie zuckte zusammen, als von unten Stimmengewirr heraufdrang, lauter als zuvor. »Du gehst als Erster.« Sie senkte die Pistole, aber diesmal nicht ganz.
Die Leiter war steil und eindeutig dazu gedacht, sie rücklings hinunterzuklettern, was er aber nicht vorhatte. Er hielt sich mit einer Hand fest und setzte vorsichtig die Absätze auf die einzelnen Sprossen, mit Blick in den schrittweise zum Vorschein kommenden Raum, wobei ihm zum ersten Mal auffiel, dass er zerschrammte Kampfstiefel trug. Am liebsten hätte er die Pistole gezogen, aber wegen der verängstigten Frau hinter ihm widerstand er dem Drang. Hätte in der Kabine unten jemand das Bedürfnis gehabt, ihn abzuknallen, dann hätte er es kaum verhindern können. Zum Glück waren die Leute unten anderweitig beschäftigt.
»Spuck’s aus!«, knurrte ein hochgewachsener Kerl, der einen muskulösen Arm um den Hals eines kleineren Mannes geschlungen hatte. Der Riese hielt dem anderen eine SIG Sauer an die Schläfe und presste die Mündung an seine Haut. Wenig überraschend besaßen beide geschorene Köpfe und Operationsnarben. Genau wie die zwei Frauen, die starr und unentschlossen vor ein paar Schlafkojen standen. »Sag mir, wer du bist!« Der Hüne drückte die Mündung der Pistole noch fester gegen den Kopf seines Opfers, das erschrocken aufkeuchte.
»Er weiß es nicht.«
Alle Köpfe flogen zu Huxley herum, der die Leiter inzwischen halb hinuntergestiegen war. Die beiden Frauen wichen zurück, während der Riese erwartungsgemäß ein neues Ziel anvisierte.
»Verflucht noch mal, wer bist du?« Britischer Akzent, barsch und abgehackt. Seine harten Augen funkelten über dem Visier der Pistole, anders als bei Rhys zitterten weder Stimme noch Waffe.
Huxley lachte, während er die Leiter ganz hinabstieg. In dem schmalen Gang zwischen den Kojen stand ein niedriger Tisch. Er warf seine Waffe darauf und hielt sich an den Tischkanten fest, bis der Lachanfall abgeebbt war.
»Meine Damen und Herren«, sagte er und richtete sich mit erhobenen Händen auf. »Willkommen zu unserem brandneuen Samstagabend-Spektakel: Der ›Verflucht noch mal, wer bist du?‹-Show, mit mir, Ihrem Moderator, Huxley.« Er drehte seinen Unterarm, um den anderen das Tattoo zu zeigen. »So sieht’s jedenfalls aus. Wer von unseren Kandidaten am heutigen Abend gewinnt den großen Preis von einer Million Dollar? Sie müssen nur eine simple Frage beantworten. Erraten Sie, welche das ist?«
Er schaute den Riesen an, in dessen Gesicht zuckte und arbeitete es. Seine Miene spiegelte dieselbe schmerzhafte Verwirrung, die auch Huxley vor Kurzem noch empfunden hatte. Knurrend ließ der Kerl den kleineren Mann los und stieß ihn beiseite. »Hat versucht, mir die Waffe wegzunehmen«, murmelte der Hüne.
»Reine Vorsichtsmaßnahme.« Der kleinere Mann sprach mit leichtem Akzent, der auf eine europäische Herkunft hindeutete, allerdings war sein Englisch so fließend, dass es sich nicht genauer bestimmen ließ. »Immerhin bist du der Größte von uns.« Zögernd strich er sich über die Kopfhaut und öffnete die Knöpfe an seinem rechten Ärmel. Er krempelte ihn hoch, und auf seinem sehnigen Unterarm kam ein Name zum Vorschein: GOLDING.
»Plath«, sagte eine der Frauen und hob den Arm. Nach Huxleys Schätzung war sie die Jüngste in der Gruppe, wenn auch nur knapp. Ende zwanzig etwa.
»Dickinson«, sagte die andere Frau. Sie war die Älteste von ihnen, schlank, mit durchtrainierten Muskeln und kantigen Wangenknochen.
»Was sind wir doch für ein literarischer Haufen«, sagte der Hüne, streckte den Arm aus und zeigte ihnen seinen Namen: PYNCHON.
»Schriftsteller?«, fragte Golding und musterte sein Tattoo.
»Ja.« Pynchon fuhr mit dem Finger über die tätowierten Buchstaben. »Die Versteigerung von No. 49 ist ein tolles Buch. Das weiß ich, genauso wie ich weiß, dass der Himmel blau und Wasser nass ist. Aber ich kann euch nicht sagen, wo oder wann ich es gelesen habe.«
»Da fragt man sich, was wir sonst noch so wissen.« Huxley betrachtete die Pistole auf dem Tisch. Name und Beschreibung der Waffe waren ihm ohne Weiteres eingefallen. Er suchte nach anderen Beispielen, aber Rhys kam ihm zuvor.
»Das Lungenvolumen eines Erwachsenen beträgt im Durchschnitt sechs Liter«, sagte sie und trat neben Huxley. Das Gefühl von Kameradschaft, das durch die Geste hätte aufkommen können, verflog jedoch, als sie fest die Arme verschränkte und Muskeln und Adern unter ihrer Haut hervortraten. Wie Dickinson war auch sie durchtrainiert, aber weniger definiert: eher die Arbeit von Monaten als von Jahren. »Irgendwie … weiß ich das einfach«, fügte sie hinzu, während ihr Blick von einem zum anderen ging.
»Unter arktischen Bedingungen verbraucht ein Mensch mehr als dreitausendsechshundert Kalorien pro Tag«, sagte Dickinson. »Das Matterhorn hat eine Höhe von viertausendvierhundertachtundsiebzig Metern.«
Golding, dessen Akzent Huxley erneut irritierend fand, meldete sich als Nächster zu Wort: »Benjamin Harrison war der dreiundzwanzigste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.«
»Wer war der vierunddreißigste?«, fragte Huxley.
»Dwight D. Eisenhower.«
»Und der fünfundvierzigste?«, erkundigte sich Plath.
Golding verzog das Gesicht. »Über den schweigen wir lieber.«
Pynchon schnaubte leise und schaute sich in der Kabine um. Sein Blick verharrte bei einzelnen Dingen, während er sprach. »Das hier ist ein Mark-VI-Wright-Class-Patrouillenboot der US-Marine. Es besitzt einen Pumpjetantrieb, der aus zwei Dieselmotoren mit einer Leistung von fünftausendzweihundert PS besteht. Höchstgeschwindigkeit fünfundvierzig Knoten. Maximale Reichweite siebenhundertfünfzig Seemeilen.«
»Was die Frage aufwirft: Wer steuert es?«, sinnierte Plath und schaute zur Decke hoch.
»Niemand«, sagte Huxley. »Es gibt keine … Pinne. Aber es folgt definitiv einem Kurs.«
»Also, wo sind wir hier?«
»Mitten auf dem Ozean.« Huxley zuckte mit den Achseln. »Irgendein Ozean jedenfalls. Ich hab eine Möwe gesehen.«
»Also nicht weit vom Land entfernt«, sagte Golding.
»Das ist ein Mythos«, erwiderte Pynchon. »Möwen können hunderte, tausende Meilen weit aufs Meer hinausfliegen.«
»Wir wissen all diese Dinge«, sagte Dickinson bedächtig, »nur nicht unsere eigenen Namen. Wir verfügen eindeutig über Kenntnisse und Kompetenzen. Es ist also anzunehmen, dass wir aus einem bestimmten Grund auf diesem Boot sind.«
»Irgendein krankes Experiment«, vermutete Huxley. »Man hat uns das Gedächtnis rausoperiert und uns mit geladenen Waffen auf ein Boot verfrachtet, um zu schauen, was passiert.«
Dickinson schüttelte den Kopf. »Ich kann mir nicht vorstellen, wozu das gut sein sollte.«
»Außerdem ist es schlicht unmöglich, jemandem das Gedächtnis rauszuoperieren.« Rhys hob eine Hand an ihre Narbe und senkte sie wieder. »Es befindet sich nicht an einem bestimmten Ort im Gehirn. Ein operativer Eingriff, bei dem man seine Vergangenheit vergisst, sein Fachwissen und seine Fähigkeiten aber behält, also so was hab ich noch in keinem neurowissenschaftlichen Aufsatz gelesen.« Sie schloss die Augen und seufzte. »Denk ich jedenfalls. Momentan kann ich mich an keine einzige Untersuchung oder Sprechstunde erinnern, ich weiß aber, dass ich so was gemacht habe.«
»Vielleicht hat Conrad ja was geahnt«, sagte Huxley. »Muss ja einen Grund gehabt haben, es zu tun.«
»Und wer bitte ist Conrad?«, fragte Pynchon.
»Eintritts- und Austrittswunde sind genau da, wo sie sein sollten.« Rhys kauerte in der Hocke und musterte eingehend das ausgefranste Loch an der Unterseite von Conrads Kinn. »Kontaktverbrennungen auf der Lederhaut rund um die Wunde.« Sie lehnte sich zurück und neigte den Kopf in Huxleys Richtung. »Wenn es tatsächlich inszeniert ist, dann ziemlich überzeugend.«
»Mal angenommen, ich hätte ihn umgebracht«, sagte Huxley, »warum hätte ich ihn dann hier liegen lassen sollen, anstatt ihn einfach über Bord zu werfen?«
»Unter den Umständen ist ein gewisses Misstrauen angebracht.« Dickinson betrachtete den Leichnam mit ernster Miene. »Und soweit wir wissen, bist du als Erster aufgewacht.«
»Nein, er ist als Erster aufgewacht.« Huxley nickte zu Conrad hinüber. »Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am Anfang alle in den Kojen gelegen haben.« Er hielt die zweite Pistole hoch, die er in einer leeren Schlafkoje unter Deck gefunden hatte. »Ich denke, die hier war meine. Ich hab sie zurückgelassen, als ich aufgewacht bin. Ich bin hier rausgestolpert, vielleicht hinter Conrad her, vielleicht auch nicht. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich weiß nur, dass er hier lag, als ich zu mir kam.«
»Warum also?«, fragte Golding. Er stand in der Nähe des Schlauchboots, und Huxley fiel auf, dass er es eingehend musterte. Offenbar suchte er nach Anzeichen von Schäden. »Hat er sich umgebracht, weil er sich nicht erinnern konnte, wer er ist?«
»Vielleicht war seine Reaktion stärker als bei uns«, sagte Rhys. »Der Eingriff, der an uns vollzogen wurde, was immer es war, muss ziemlich radikal gewesen sein, vielleicht sogar experimentell. Da kann es natürlich zu unvorhergesehenen Nebenwirkungen kommen.«
»Oder …« Huxley musterte Conrads schlaffe, blutleere Züge und suchte nach einem Ausdruck darin, einem leichten Stirnrunzeln oder einem Zug um den Mund, der von Hoffnungslosigkeit zeugte. Vielleicht war aber auch das Gesicht eines Leichnams wie ein Rorschachtest, und er sah lediglich das, was er erwartete.
»Oder was?«, hakte Rhys nach.
»Oder er hat sich erinnert«, schloss Huxley. »Die Operation hat bei ihm nicht funktioniert, und er wusste genau, warum wir hier auf diesem Boot sind. Wenn es so war, dann scheint er sich auf die Reise nicht grad gefreut zu haben.«
»Das ist alles müßige Spekulation«, sagte Dickinson. »Wir können nur Entscheidungen auf Grundlage dessen treffen, was wir wissen. Vor allem sollten wir herausfinden, wo wir uns befinden und wohin wir unterwegs sind.« Sie wandte sich Pynchon zu. »Bislang hat nur einer von uns detaillierte Kenntnisse über dieses Boot an den Tag gelegt.«
Pynchon stand im Durchgang und hatte einen fleischigen Arm gegen den Türrahmen gelehnt. Er wirkte konzentriert. Er deutete auf den dunstigen Himmel und die Nebelwand, die sich jenseits der Reling erstreckte. »Kein Kompass, keine Karte. Wir könnten sonst wo sein.« Er hielt inne und schüttelte den Kopf. »Seltsam, dass sich der Nebel so hartnäckig hält«, murmelte er.
»Wenn ich die Sonne sehen könnte«, Dickinson spähte in den verhangenen Himmel, »dann könnte ich wahrscheinlich abschätzen, in welche Richtung wir unterwegs sind. Dem Lichteinfallswinkel nach würde ich vermuten, dass wir nach Westen fahren. Sollte sich der Nebel bei Nachteinbruch etwas lichten, könnten die Sterne einen Anhaltspunkt dafür liefern, wo auf der Welt wir uns befinden.«
Sie deutete auf die Kabine hinter Pynchon. »Was ist mit der Steuerung?«
»Kommt mit, ich zeig’s euch.« Sie folgten Pynchon zu den gepolsterten Sitzen. Er klopfte auf ein graues Stahlpaneel in der Mitte des Armaturenbretts. »Ein Patrouillenboot der Wright-Klasse wird mittels eines Joysticks und einiger Beschleunigungshebel gesteuert, die sich normalerweise an dieser Stelle hier befinden. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das Boot ist auf Autopilot.« Er tippte gegen die schwarzen Bildschirme. »Außerdem keine Anzeigen. Kein GPS. Kein Kompass. Nicht mal eine Uhr. Ich hab mich oben umgeschaut und einen Lidar-Sensor entdeckt, der vermutlich dem Autopiloten dabei hilft, Hindernisse zu umfahren und den Kurs zu halten, aber es gibt kein Radar und keine Funkantenne.«
»Wir sollen nicht wissen, wo wir uns befinden«, schloss Huxley.
Pynchon runzelte finster die Stirn. »Und es gibt keine Möglichkeit, den Kurs zu ändern.«
»Was ist mit dem Schlauchboot?«, fragte Golding.
»Kein Außenbordmotor«, erwiderte Huxley. »Das ist dir wohl nicht aufgefallen, als du nach Löchern gesucht hast. Ich wette, dass drinnen auch keine Ruder sind. Also, wenn du damit nicht hilflos auf dem Ozean treiben willst, bis du verdurstest, bietet es keine Fluchtmöglichkeit. Irgendjemandem ist sehr daran gelegen, uns auf diesem Boot festzuhalten.«
Eine Weile lang herrschte Schweigen, während sich alle ihrer Furcht oder ihren Grübeleien hingaben. Letzteres schien zu überwiegen, wie Huxley bemerkte. Nachdem die anfängliche überwältigende Ungewissheit nun vorbei war, zeigte sich, dass diese Leute nicht so leicht in Panik gerieten. Selbst Golding wirkte eher konzentriert als bestürzt, auch wenn er dem nutzlosen Schlauchboot noch ein paar enttäuschte Blicke zuwarf. Ausgewählt, schloss Huxley. Handverlesen. Wir alle. Wir sind nicht durch Zufall hier.
»Dickinson hat recht«, sagte er. »Wir sollten überlegen, was wir wissen. Nicht nur über das Boot, sondern auch über uns. Besonders, welche Fähigkeiten wir haben. Ich wette, darüber finden wir am ehesten heraus, aus welchem Grund wir hier sind.«
Zwei
Rhys war es, die die anderen Narben entdeckte, was wenig überraschte. Kurz nach ihrer gemeinsamen Inspektion des Ruderhauses, wie Pynchon es nannte, wurde es Nacht. Auf Vorder- und Achterdeck erwachten – vermutlich ausgelöst durch einen Sensor – flackernd einige Laternen zum Leben, die, nach Huxleys Empfinden, das Gefühl der Isolation eher noch verstärkten. Der Nebel hatte sich nicht gelichtet, sodass sie weder Sterne noch Mond erkennen konnten, und das Meer war jetzt ein tintenschwarzes Wogen, voll unermesslicher Bedrohlichkeit. Jenseits des Laternenscheins war nichts, so als trieben sie auf einem Lichtfunken in einer namenlosen, endlosen Leere dahin.
Alle stimmten Dickinsons Vorschlag zu, erst einmal gründlich das Boot abzusuchen, bevor sie ihre jeweiligen Fähigkeiten genauer erkundeten. Allerdings brach schon bald eine Diskussion darüber aus, was sie mit Conrad tun sollten. Die ursprüngliche Idee, ihn mit der Plane des Schlauchboots abzudecken, wurde schnell verworfen, stattdessen setzte sich der pragmatischere Vorschlag durch, ihn den Wellen zu überantworten.
»Ohne Kühlung wird er ruckzuck verwesen«, sagte Rhys. »Und wir haben keine Ahnung, wie lange wir auf diesem Kahn sein werden.«
Sie durchsuchten seine leeren Taschen, dann hoben Pynchon und Huxley den Leichnam hoch, hielten jedoch inne, als Conrads olivgrünes T-Shirt aus dem Hosenbund rutschte und Rhys etwas auffiel. »Halt, setzt ihn noch mal ab.«
Sie legten Conrad aufs Deck, und Rhys rollte ihn auf die Seite, zog sein Shirt hoch und enthüllte einige Narben an seinem Rücken. Es waren zwei, eine auf jeder Seite, wenige Zentimeter unter den Rippen.
»Noch mehr Operationsnarben«, sagte Huxley, woraufhin sich alle bedeutungsvoll ansahen und ihre Shirts hochzogen. Huxleys Narben fühlten sich beinahe genau so an wie die an seinem Kopf, wulstig, aber ohne Nähte. »Ist das nicht die Stelle, wo die Nieren sind?«, fragte er Rhys.
Sie tastete kurz ihre eigenen Narben ab, bevor sie seine untersuchte. »Nah dran. Patienten mit Nierentransplantat haben ähnliche Narben. Allerdings sind die hier etwas breiter als gewöhnlich. Außerdem sind doppelte Einschnitte bei Transplantationen selten.«
»Man hat uns die Nieren rausgenommen?« Golding riss die Augen auf, während er an seinem Rücken herumfummelte.
Rhys warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Nein. Sonst wären wir längst tot.«
»Etwas wurde rausgenommen oder reingetan«, sagte Huxley und erhielt ein nüchternes Nicken zur Antwort.
»Ohne Röntgenapparat lässt sich das unmöglich feststellen.«
»Was ist mit ihm hier?« Pynchon stieß Conrad mit der Stiefelspitze an. »Eine Autopsie wird ihn jedenfalls nicht mehr umbringen.«
Rhys’ Miene wirkte zunächst ablehnend, dann runzelte sie jedoch nachdenklich die Stirn. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine Pathologin bin. Wenn es sich bei dem Eingriff nicht um irgendwas … Offensichtliches handelt, würde ich wahrscheinlich nicht erkennen, was es war.«
»Trotzdem«, sagte Pynchon. »Einen Versuch ist es wert, oder?«
Rhys runzelte erneut die Stirn und verschränkte die Arme – offenbar ihre übliche Reaktion auf stressige Situationen. »Ich brauche ein Skalpell«, sagte sie. »Oder ein sehr scharfes Messer.«
In den militärisch anmutenden Rucksäcken, die Pynchon unter einem Gitterrost in der Mannschaftskabine zutage gefördert hatte, entdeckten sie ein Kampfmesser. Insgesamt gab es sieben Rucksäcke, alle mit identischem Inhalt: Messer, LED-Taschenlampe, Nachtsichtbrille, Feldflasche, randvoll mit Wasser, Trockenrationen für drei Tage, Erste-Hilfe-Set, drei Magazine für ihre Pistolen und fünf weitere für die M4-Karabiner-Gewehre, die neben den Rucksäcken lagen.
»Bei den Waffen waren sie nicht knausrig, was?«, stellte Huxley fest und hob einen der kurzläufigen Karabiner hoch. Wie bei der Pistole bewegten seine Hände sich mit automatischer Vertrautheit. Er zog den Bolzen zurück, um zu schauen, ob die Kammer leer war, bevor er das Magazin auswarf und wieder einsetzte. »Da fragt man sich, wofür die sein sollen.«
»Auf dem Vorderdeck steht eine Fünfundzwanzig-Millimeter-Kettenkanone«, sagte Pynchon. Seine Inspektion der Waffen war um einiges gründlicher gewesen. Er hatte sie auf dem Tisch ausgebreitet, in ihre Hauptbestandteile zerlegt und wieder zusammengebaut, und das alles innerhalb weniger Minuten. »Sie ist inaktiv, aber die Zielvorrichtung ist intakt. Radar und GPS hat man uns weggenommen, aber eine scheißgroße Waffe haben wir. Wahrscheinlich sollen wir die irgendwann benutzen.«
»Ist das ein Funkgerät?« Plath griff in das Fach und holte einen von zwei weiteren Gegenständen heraus. Er hatte etwa die Größe eines Smartphones und besaß ein schwarzlackiertes Stahlgehäuse. An einem Ende ragte eine kurze Antenne heraus. Außerdem befand sich an einer Seite eine kleine gewölbte Linse. Ihre Geschicklichkeit im Umgang mit dem Gerät und die Genauigkeit, mit der sie es untersuchte, ließen sie älter wirken, als Huxley zunächst vermutet hatte. Sie kannte sich eindeutig mit Technologie aus, auch wenn sie offenbar nicht wusste, worum es sich hierbei handelte.
»Das ist eine Funkbake zum Anvisieren«, sagte Pynchon. »Sendet zwei verschiedene Signalarten aus – Infrarot und Funk. Damit kann man Luftangriffe auf ein bestimmtes Ziel lenken.«
»Luftangriffe«, wiederholte Huxley leise, fand die Vorstellung jedoch wenig beruhigend.
Pynchon steckte beide Funkbaken in seinen Rucksack. »Gut zu wissen, dass wir vielleicht Luftunterstützung bekommen.«
Zum Inventar gehörten auch zwei Seile, die jeweils mit einem stählernen Wurfhaken mit einziehbaren Krallen ausgestattet waren. »Fünfzig Meter lang.« Dickinson drehte die Bündel fachmännisch hin und her. »Standard-Kletterseil. Traglast maximal tausendachthundert Kilo.« Sie warf einen Blick in das jetzt leere Fach und verzog das Gesicht. »Keine Sicherungen oder Karabinerhaken. Dann hoffen wir mal, dass wir nicht ernsthaft irgendwo klettern müssen, sonst sind wir aufgeschmissen.«
Sie fanden zwei weitere Gitterroste, die sich jedoch nicht öffnen ließen, egal wie sehr sie daran zerrten. »Da muss irgendwas drin sein.« Pynchon wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Warum ein leeres Fach verschließen?«
Huxley stampfte mit dem Stiefel auf den Gitterrand, der jedoch nicht im Geringsten nachgab. »Irgendwas, das wir nicht zu Gesicht kriegen sollen. Jedenfalls noch nicht.«
Als Rhys sich daranmachte, Conrad aufzuschneiden, zögerte sie nicht ansatzweise. Sie wusch sich nicht einmal vorher die Hände, wie Huxley erwartet hätte. Sie drehte die Leiche mit dem Gesicht nach unten, stach mit dem Messer ins untere Ende der rechten Narbe und schlitzte die Haut auf. Huxley hätte gedacht, dass Golding sich als Erster übergeben würde, aber überraschenderweise kam ihm Dickinson zuvor. Sie trat an die Reling und beugte sich weit vor, damit der Wind das Erbrochene wegtragen konnte. Golding leistete ihr kurz darauf Gesellschaft. Plath dagegen war zwar etwas blass um die Nase, blieb aber stehen und sah zu, ebenso wie Pynchon, der lediglich ein paarmal angewidert das Gesicht verzog. Neben Rhys war Huxley offenbar derjenige, dem die Sache am wenigsten ausmachte. Er verspürte nur ein leichtes Unbehagen, als das Messer die Haut zerteilte und zähflüssiges, halb geronnenes Blut hervorquoll.
Ich hab so was schon mal gesehen. Noch etwas, das er wusste, ohne zu ahnen, woher. Er war ganz sicher kein Arzt, und wahrscheinlich auch kein Pathologe, aber ohne Zweifel war dies nicht der erste Leichnam, der vor seinen Augen aufgeschnitten wurde.
»Keine offensichtlichen Anzeichen einer Erkrankung.« Rhys zerrte keuchend ein faustgroßes rotes Organ aus dem offenen Schnitt. Mithilfe der Feldflasche wusch sie es sauber und hielt es in den Strahl von Huxleys Taschenlampe. Als sie es herumdrehte, bildete sich eine Falte auf ihrer Stirn.
»Was entdeckt?«, erkundigte er sich.
»Das hier«, sie tippte mit der Messerklinge gegen etwas, das wie bleiches Knorpelgewebe an der Oberseite des Organs aussah, »ist die Nebenniere. Wirkt größer als normal, aber nur ein bisschen. Auf jeden Fall nicht genug, um den Verdacht auf eine Krankheit zu rechtfertigen.« Sie musterte das Organ noch einmal eingehend und warf es dann seufzend ins Meer. »Ohne richtige Ausrüstung kann ich nicht viel ausrichten. Was immer mit uns gemacht wurde, es hat keine eindeutigen Spuren hinterlassen.«
»Und was jetzt?«, fragte Golding.
Rhys stand auf, ließ ihr Messer aufs Deck fallen und wusch sich mit dem restlichen Wasser aus der Feldflasche die Hände. Dann warf sie einen letzten Blick auf Conrads schlaffen Leichnam. »Ein Begräbnis scheint angebracht.«
Niemand schlug vor, irgendwelche Abschiedsworte zu sagen. Huxley griff sich die Arme und Pynchon die Beine, und gemeinsam schwangen sie Conrad über die Reling. Ein Platschen ertönte, der Leichnam drehte sich herum und schaukelte kurz auf den Wellen, während er von der Strömung ins Kielwasser getragen wurde, wo er in der schaumig aufgewühlten Schwärze schnell verschwand. Das Fehlen jeglicher Gefühlsregung brachte Huxley ins Grübeln. War kaltherzige Gleichgültigkeit womöglich ein weiterer Charakterzug, dem sie ihre Anwesenheit auf diesem Boot verdankten?
»Also«, sagte Dickinson, deren Haltung ein wenig steif war. Möglicherweise erachtete sie ihren kranken Magen als Anzeichen von peinlicher Schwäche. Sie schien ein sehr beherrschter Mensch zu sein, der gern die Initiative ergriff. »Fähigkeiten.«
Pynchon war Soldat. So viel war klar. Er konnte einen Haufen Fachbegriffe über Waffen herunterrattern, ohne zu zögern oder auch nur einmal Luft zu holen. Jeder Hinweis darauf, wo er das gelernt hatte, war ihm jedoch – genau wie Name, Rang und Personenkennziffer – genommen worden. Zudem stellte sich heraus, dass das Tattoo auf seinem Unterarm nicht seine einzige Tätowierung war. Oberarme und Schultern zierten keltische und gotische Spiralmuster, unterbrochen von einigen kahlen Stellen, die nicht ins Gesamtbild zu passen schienen.
»Vielleicht die Abzeichen einer Einheit«, sagte Huxley. »Die weggelasert wurden. Die wollten uns wohl unbedingt im Dunkeln darüber lassen, wer wir sind.«
»Du sprichst immerzu von die«, warf Golding ein. Er wirkte wieder konzentriert, in seinen Augen hingegen spiegelte sich Argwohn. »Wer sind die?«
»Tja.« Huxley hob die Hände. »Treffer versenkt. Da hat mich wohl meine Arroganz verraten. Die sind eine global agierende geheime Sekte marsianischer Echsenwesen, die arische Kinder zum Frühstück verspeisen und uns auf dieses Boot verfrachtet haben, als Teil ihrer extrem undurchsichtigen Verschwörung.« Er sah Golding ruhig in die Augen. »Ich hab keinen blassen Schimmer, wer zum Teufel die sind. Also wie wär’s, wenn wir stattdessen rausfinden, wer wir sind?«
Erneut schien Goldings Wissen in eine historische Richtung zu gehen. »1848 blieben beide Schiffe der unglückseligen Franklin-Expedition auf der Suche nach der Nordwestpassage in der Victoria Strait im Eis stecken. Alle Versuche, sich zu Fuß in Sicherheit zu bringen, scheiterten, und die überlebenden Besatzungsmitglieder wurden am Ende sogar zu Kannibalen, bevor sie an Unterkühlung und Hunger starben.« Er lächelte reumütig. »Keine Ahnung, warum mir gerade das in den Kopf kommt.«
Ein paar aufs Geratewohl gestellte Fragen förderten einen enormen Faktenreichtum zutage, der von Trivialem bis hin zu vage relevanten Einzelheiten reichte. »Eines der frühesten Beispiele dafür, wie eine Hirnverletzung die Persönlichkeit verändern kann, ist die Geschichte von Phineas Gage. Eine radikale Veränderung seines Charakters wurde bei ihm durch einen Sprengstoffunfall bewirkt, dabei hatte sich eine Eisenstange durch sein Gehirn gebohrt …«
»Du bist Historiker«, unterbrach ihn Huxley. »Wahrscheinlich war man der Meinung, eine sprechende Enzyklopädie auf zwei Beinen könnte für uns nützlich sein.«
»Was die mit uns gemacht haben, wird dadurch nur noch beeindruckender«, meinte Rhys und strich sich über die Narbe. »So viel wegzunehmen und gleichzeitig so viel übrigzulassen.«