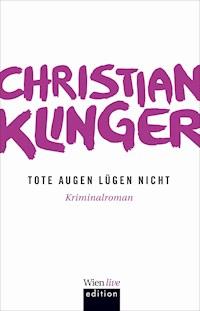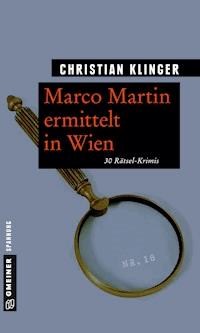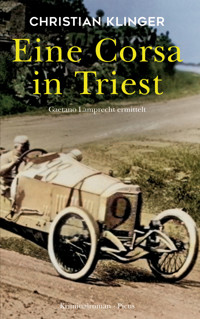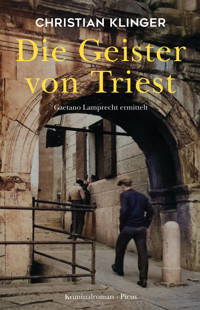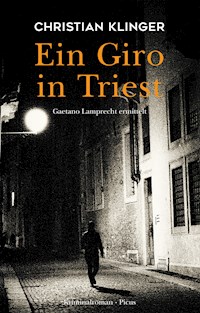
17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der erste Fall für Ispettor Gaetano Lamprecht: In Triest sind die Gemüter im Sommer 1914 erhitzt und Gaetano muss zwischen Monarchisten, Irredentisten und der italienisch-slawischen Unterwelt navigieren. Gaetano Lamprecht, Sohn eines Österreichers und einer Italienerin, ist als Ispettore bei der Triestiner Polizei tätig und begeisterter Radsportler. Nach der Ermordung des Thronfolgerpaars in Sarajevo drohen Nationalisten mit der Entführung der Särge und Gaetano wird mit der Wiederbeschaffung beauftragt. Die Ermittlungen führen den Ispettore in ein Netz aus Verschwörungen und korrupten Machenschaften, wobei er sich mehr als einmal in Lebensgefahr bringt, aus der ihn nur seine Sportlichkeit retten kann. Nebenbei beschäftigen Lamprecht private Probleme, denn er und seine Familie sind nicht aus freien Stücken von Wien nach Triest zurückgekehrt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Copyright © 2022 Picus Verlag Ges.m.b.H., WienAlle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, WienUmschlagabbildung: © Donald Jean/Arcangel Images
ISBN 978-3-7117-2116-7
eISBN 978-3-7117-5461-5
Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
Christian Klinger, 1966 in Wien geboren, Studium der Rechtswissenschaften. Seit 2017 Zweitwohnsitz in Triest. Er veröffentlichte zahlreiche Krimis und Beiträge in Anthologien, erhielt den Luitpolt-Stern-Förderungspreis und war auf der Auswahlliste des Agatha-Christie-Krimipreises (2011). Im Picus Verlag erschien 2020 sein Roman »Die Liebenden von der Piazza Oberdan«.
www.christian-klinger.at
CHRISTIAN KLINGER
Ein Giro in Triest
Gaetano Lamprecht ermittelt
Kriminalroman
PICUS VERLAG WIEN
Inhalt
Samstag, 27. Juni
Sonntag, 28. Juni
Montag, 29. Juni
Dienstag, 30. Juni
Mittwoch, 1. Juli
Donnerstag, 2. Juli
Freitag, 3. Juli
Samstag, 4. Juli
Sonntag, 5. Juli
Danksagung
Es war ein freundlicher Tag, der Lamprechts Leben zerstörte. Der Pistolenschuss hallte durch die menschenleere Au im Wiener Prater. Der Knall schreckte einige Krähen auf, die schwerfällig mit ihren Flügeln durch die Luft ruderten und davonflogen.
TRIEST, IM APRIL 1914
»Unsere Monarchie ist ein faules Ei. Die Couleurs der Habsburger aus Schwarz und Gelb schillern giftig wie der faulig gewordene Dotter. Der Staat ist von innen heraus verdorben und stinkt also gewaltig. Und Sie alle wissen, was man mit so einem faulen Ei zu machen hat.«
Der Redner hatte sich erhoben, die Arme auf der schweren Tischplatte abgestützt. Seine Augen wanderten über die Anwesenden, die kaum zu atmen wagten, wenn sie sein Blick traf. Die Männer saßen dicht gedrängt Schulter an Schulter in dem kleinen Extrazimmer. Der Kellner hatte zuvor die Getränke serviert, dann hatte man den Raum abgeschlossen. Niemand konnte rein, niemand konnte raus. Die Augen des Sprechers leuchteten zufrieden. Er zählte vierzehn Personen, mehr, als er erwartet hatte, sogar aus Pola waren einige angereist. Er hatte ja schwerlich offen zu diesem Treffen einladen können. Das hatte diskret erfolgen müssen, nur mit Andeutungen, und diese über Mittelsmänner überbracht. Doch die Botschaft war auf fruchtbaren Boden gefallen. Er dehnte die Pause bewusst aus. Darin eine zum Zerreißen gespannte Stille. Endlich beendete der Redner sein Schweigen und sprach weiter: »Manchmal muss man dem Schicksal auf die Sprünge helfen, und dann gilt es, Entscheidungen zu treffen. Meine Herren, ich lese in Ihren Gesichtern, dass wir uns einig sind. Das Zuwarten muss ein Ende haben. Geschichte will geformt werden, wie alles andere in unserem modernen Leben auch.«
»Wann wird es losgehen?«
»Bald schon, sehr bald.«
TRIEST, SOMMER 1914
SAMSTAG, 27. JUNI
1.
Die Sonne war hinter dem Monte Belvedere hervorgekommen und tauchte alles in ein weißes Licht. Mit in den Himmel geschnittenen Konturen hob sich das Wäldchen gegen den Horizont am Ende der Straße ab.
»Es ist …«, sprach er leise vor sich hin, dabei tief Luft holend, um sie danach gleich wieder kräftig auszublasen. »Es ist … unfair …«, wiederholte er keuchend, »dass gerade jetzt ein Einsatz hereinkommen muss.«
Er streckte sich durch, dachte daran, dass er heute gern früher Schluss gemacht hätte, und beobachtete seinen Schatten, der neben ihm über die Fahrbahn flitzte. Ein angenehmer Vormittag im Büro war dahin. Er keuchte weiter. Oben, nach der letzten Kurve, ragte der Obelisk wie ein aufgestellter Stachel in die Luft. Er steuerte das gleichnamige Hotel am rechten Straßenrand an. Sein Ziel lag hinter der nächsten Biegung.
Gaetano Lamprecht stieg aus dem Sattel und lehnte sein Fahrrad gegen eine Mauer. Die letzten Schritte legte er zu Fuß zurück. Sein Herz schlug heftig wie eine Dampfwalze. Er drückte die flache Hand gegen seinen erhitzten Brustkorb und atmete tief ein. Schloss kurz die Augen und zählte die Schläge unter seinen Rippen mit. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig …
Bedachten Schrittes querte er schließlich die Straße. Von hier oben hatte der Blick über den Golf einen besonderen Reiz. Vor seinen Augen erstreckte sich unter einem blassblauen Himmel das Meer zwischen dem Hafen und der istrischen Küste. Die Stadt wirkte wie von den Seestürmen an den Hügel von San Giusto gespült. Bunte Muscheln im Sand, aufgefädelt von den Wellen. Gaetano kam öfter an dieser Stelle vorbei, an der schon Napoleon sich der Aussicht erfreut haben soll. Als der junge Polizeiagent gänzlich zur Ruhe gefunden hatte, drehte er sich um. Er fuhr über die Spitzen seines schmalen Schnurrbarts und steuerte mit ernster Miene die beiden Polizisten an, die beim Fundort der Leiche wachten.
»Und?«, kam es knapp. Er war über die Entdeckung, von der die Wachleute in Opicina heute Morgen Meldung erstattet hatten, wenig erfreut. Ausgerechnet an einem Samstag, mehr oder weniger schon im Wochenende, hatte er gedacht, als er aus Triest geschickt worden war. Sicher war damit auch der Sonntag beim Teufel und er würde auf sein Training verzichten müssen. Also hatte er aus der Not eine Tugend gemacht und sich gleich auf den Weg hinauf zum Karst begeben. Allerdings hatte er in seinem dunklen Rock stark geschwitzt und ihm war immer noch unerträglich heiß. Normale Kleidung war für solche Touren völlig ungeeignet. Er tupfte Stirn und Nacken mit einem Taschentuch ab.
Die beiden Polizisten wirkten ratlos und warfen einander entsprechende Blicke zu. Lamprecht schaute sich um, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Zwei weitere Uniformierte hatten sich an der Straße postiert und verscheuchten einige Gaffer, die aus Neugier zum Schauplatz vordringen wollten. Handwerker, Mägde oder Tagelöhner, die sich das Geld für die Straßenbahn in die Stadt sparten und an diesem sonnigen Tag zu Fuß nach Triest aufbrachen. Murrend und mit zum Tatort verdrehten Hälsen zogen manche weiter, während andere an der nächsten Kurve in ausreichender Entfernung zu den Polizisten stehen blieben, um weiterhin gaffen zu können, beseelt davon herauszufinden, was da passierte, und vor allem was da passiert war.
Die zwei Polizisten bei Lamprecht waren seltsame Gestalten, die in ihrer Erscheinung kaum unterschiedlicher sein hätten können: Der eine war hager, hatte ein schmales Gesicht mit langer Nase und seine Jacke war ihm zu weit. Sie hing schlaff von seinen Schultern und wirkte, als hätte er sie gegen die seines großen Bruders getauscht. Dafür spannten dem anderen die Knöpfe um den Bauch. Obwohl er einen Kopf kürzer als der Lange war, waren sein Gesicht und sein Bauch doppelt so breit. Der Dicke sagte: »Eine alte Vettel hat ihn heute Morgen gefunden, als sie hier Holz sammeln wollte. Wir haben ihre Aussage, die uns aber nicht weiterbringen wird. Aber wir haben dieses Soldbuch bei ihm gefunden. Ein Ludwig Farnese, gebürtig aus Görz.«
Lamprecht nahm das Heft entgegen. Er hatte inzwischen seinen Rock abgelegt und war versucht, sich mit dem gereichten Beweisstück Luft zuzufächeln. Er trat an die hängende Leiche heran und betrachtete die hechtgraue Uniform. Die Hose zeigte im Schritt einen eingetrockneten Fleck, die Augen starrten in die Ferne. Der Bursche war nur wenig jünger als er selbst, aber mit den glatt rasierten Wangen wirkte er beinah knabenhaft.
Gaetano Lamprecht wusste, dass er hier richtig am Platz war. Wenn es einen aufklärungsbedürftigen Todesfall in Seiner Majestät k. u. k. Armee gab, musste ein richtiger Kriminalist her. Diese Dorfgendarmen, das sah er sofort, waren mit so einer delikaten Angelegenheit heillos überfordert.
»Aber ich glaube«, meldete sich einer der uniformierten Polizisten zu Wort, »Sie haben sich umsonst hierherbemüht.«
Lamprecht griff sich mit der rechten Hand an den Mund und zwirbelte seinen Schnurrbart. Er wusste, mit dieser Geste war am ehesten sein Missfallen zu unterstreichen, und nach einer künstlich gedehnten Pause fragte er: »Und was lässt Sie diesen Schluss ziehen?« Mit den zusätzlich verengten Augen erreichte er die gewünschte Wirkung. Der Polizist, der vorhin ungefragt seine Meinung geäußert hatte, stammelte: »Allora …, ich meinte nur, weil es sich offenbar um einen Selbstmord handelt.« Er deutete auf die an einem dicken Ast hängende Leiche.
Als ob sie zu Unrecht auf diese Weise angesprochen worden wäre, drehte sie sich bei diesen Worten weg. Eine leichte Brise wehte landeinwärts und bewegte den Leichnam an seinem Seil. Die Luft schmeckte sogar hier oben nach dem Salz, das der Wind unten den Wellen entriss, und der intensive Duft von trockenen Nadeln vom nahen Wald stieg Lamprecht in die Nase. Er fragte: »Warum nimmt den armen Kerl denn keiner ab?« Es lag allerdings eher eine Aufforderung in seinem Tonfall.
»Ich dachte, wir müssen auf den Doktor warten«, flüsterte der Dicke zum Dünnen. Dann quälte sich das ungleiche Duo, den toten Soldaten aus seiner auch für eine Leiche unschicklichen Lage zu befreien. Sie besprachen sich, wie sie vorgehen wollten, ehe der eine auf eine bereitgestellte Leiter stieg und den Knoten löste. Der andere umfasste den hängenden toten Körper, um ihn hernach zu Boden gleiten zu lassen. Doch das Seil gab die gehaltene Last allzu plötzlich frei und diese riss den Langen zu Boden, wo er halb unter dem Leichnam zu liegen kam wie sonst die Pärchen, die einen lauen Sommertag hier auf den Wiesen genossen.
Lamprecht wandte sich ab, weil er ein Grinsen nicht unterdrücken konnte. Doch dann begann er sogleich die nähere Umgebung abzusuchen. Die beiden Tollpatsche hatten in der Zwischenzeit wieder eine adäquate Position eingenommen. Auch der Dicke hielt sich mit weiteren Äußerungen zurück und beide warteten auf Anweisungen des Inspektors, der aus der Polizeidirektion in Triest hierhergeschickt worden war.
Der Erhängte lag mit dem Rücken auf dem Boden und Lamprecht trat an ihn heran. Er bückte sich hinunter und hob Jacke und Hemd des Toten etwas an. Er drehte den Körper unter den verwunderten und auch angewiderten Blicken der Umstehenden auf die Seite, schob die Kleidungsstücke ganz hinauf und besah den vom Waffenrock befreiten Rücken, bevor er ihn dann wieder in seine Ausgangsposition zurückfallen ließ. Als er sich aufrichtete, deutete er auf die Uniformjacke: »Hier fehlt ein Knopf.«
An einer Stelle war tatsächlich nur mehr ein Stück des Fadens zu erkennen, der einen der Messingknöpfe, die die Jacke zierten, gehalten haben musste.
Jetzt war es der Hagere, dem die unfreiwillige Intimität mit der Leiche frischen Wagemut gebracht haben musste, der sprach: »Den wird er wohl verloren haben, als er sich umgebracht hat. Er legt sich die Schlinge um den Hals, und als es dann so weit ist, beginnt er zu strampeln und dabei reißt er sich einen Knopf von der Jacke. So ungefähr.« Mit spastischen Zuckungen demonstrierte er den mutmaßlichen Todeskampf.
»Wenn das so wäre, dann müsste sich der Knopf hier finden. Tut er aber nicht«, konstatierte Lamprecht. »Wieso trägt er eigentlich einen Waffenrock?«, fragte er weiter.
»Keine Ahnung«, antwortete der runde Polizist. »Vielleicht wollte er sich noch in eine adrette Montur werfen, bevor er seinem Schöpfer gegenübertritt.«
Lamprecht beugte sich hinunter und schüttelte den Kopf. Mehr zu sich murmelte er: »Oder er war auf dem Weg zu einem Manöver …«
Dann schnellte er hoch, drehte sich zur Leiter hin und fragte: »War die schon da?«
Die zwei Wachmänner schauten einander fragend an, dann sagten sie: »Nein, die haben wir von einem Dachdecker geborgt.« Sie deuteten auf einen Karren an der Straße, auf den Dachschindeln geladen waren. Davor stand ein grauhaariger Mann mit unrasiertem Gesicht in einem staubigen Arbeitsanzug, der zu ihnen herüberwinkte.
»Gut, dann geben Sie dem Mann seine Leiter zurück und lassen Sie den Toten ins Ospedale Civile bringen«, erteilte Lamprecht die Order.
»Warum?«, kam es unisono aus beiden Mündern, Lamprecht verlor endgültig die Geduld mit den zwei Idioten.
»Weil die Leiter dem Mann da gehört«, erklärte er schroff.
»Das meinten wir nicht. Warum wollen Sie die Leiche noch ins Spital bringen? Es war doch Selbstmord, oder?«
»Und wie ist er dann auf den Ast gekommen? Geflogen? Buongiorno!«
Lamprecht drehte sich um und ließ die zwei stehen. Er hatte genug Zeit mit ihnen vergeudet, er wollte schnell wieder nach Triest und hoffte, dass er auf einen aufgeschlossenen Mediziner treffen würde, der ihm einige Fragen beantworten konnte. Die Kriminologie steckte als Wissenschaft noch in den Kinderschuhen, aber in Wien machten sie da schon einige erstaunliche Fortschritte. Vielleicht hatte er Glück und es fand sich auch in Triest ein Arzt, der mit den neuesten Erkenntnissen der Gerichtsmedizin vertraut war. Als er schon fast aus dem Sichtfeld der zwei Polizisten verschwunden war, rief ihm einer nach: »Zur Straßenbahn müssen Sie aber dort entlanggehen!«
»Ich bin nicht mit der Tram gekommen«, antwortete er über seine Schulter und holte hinter der Kurve sein Bianchi-Rennrad, das er erst letzten März aus Mailand erhalten hatte. Mit den festen Dunlop-Reifen war es optimal für die ruppigen Straßenverhältnisse geeignet. Dann schwang er sich auf den Ledersattel, klemmte seine Jacke an den geschwungenen Lenker und genoss schon nach wenigen Metern den kühlen Fahrtwind.
2.
Als Gaetano das Haus seiner Eltern am Colle di San Giusto erreichte, stand die Sonne bereits im Zenit. Die letzten Meter der Steigung nahm er im Stehen, bevor er unterhalb der Kathedrale vor den Stufen anhielt. Er hatte die obersten zwei Hemdknöpfe geöffnet und ließ seine Jacke an den Lenker geklemmt. Zum Glück spendeten die zu beiden Seiten der Straße gepflanzten Zürgelbäume etwas Schatten. Auf dem groben Steinpflaster dankte er im Geiste nochmals Edoardo Bianchi, dem Konstrukteur seines Rennrads, dafür, dass er dieses nicht nur mit gleich großen Laufrädern, sondern auch mit den neuartigen Luftkammerreifen ausgestattet hatte. Als er das Plateau vor dem Dom erreichte, atmete er tief ein. Die Luft roch nach Sommer, heiß und nach trockenem Gras.
Das Gebäude, in dem er mit der Familie ein Stockwerk bewohnte, war das erste der Häuser, die einen Ring unterhalb des befestigten Kastells bildeten. Schon die Römer hatten diesen Hügel bewohnt. Relikte aus der Zeit, als die Stadt Tergeste unter Octavian römische Provinz geworden war, fanden sich hier überall. Teile von Säulen, antike Steine oder Reliefstücke waren als Baumaterial für die Kirche und die umliegenden Häuser verwendet worden. Kaum eine Fassade oder Mauer, aus denen nicht ein paar derartige Stücke hervorstachen.
Gaetano stieg über die Querstange ab und trug sein Fahrrad die wenigen Stufen zum Hauseingang hinunter. Das dunkle Eichenholz des Portals war an einigen Stellen verwittert. Die Bora hatte im Winter weiter daran gekratzt. Die Familie wohnte im ersten Stock und Lamprecht ließ seinen Renner im Eingang unten stehen. Als er die Tür zur Wohnung aufsperrte, schlugen ihm Stimmen entgegen. Die tiefste ordnete er seinem Vater zu, die andern waren heller. Er erkannte die von seiner Mutter und die durchdringende Diskantstimme von Adina, seiner Schwester, und er fragte sich, warum heute alle zu Hause waren. Und dann war da noch eine Stimme. Kaum hatte er deren schrillen Klang vernommen, erstarrte er zur Salzsäule. Es war nicht die von den vielen Worten eines langen Lebens aufgeraute Stimme Luisas, der guten Seele des Haushalts, die seit vielen Jahren der Familie diente und eigentlich für ihre Arbeit schon zu alt war. Dieses Lachen, dessen Töne wie auf einer Hühnerleiter emporstiegen, gehörte Rosaria, der besten Freundin seiner Schwester, die sich ihm ständig anbot wie ein reifer Apfel, der geerntet werden wollte. Alle saßen in der Küche und redeten wild durcheinander. Sie scherzten und lachten und die Melodie der ungeordneten Worte erinnerte ihn an eine Opernarie. Gaetano atmete tief durch und richtete sich eine Haarsträhne, die an seiner Stirn klebte, bevor er die Türschnalle drückte.
Seine Mutter entdeckte und begrüßte ihn zuerst, da hatte er selbst noch kein Wort gesagt: »Gaetto! Schön, konntest du heute schon früher Schluss machen?«
Gaetano hasste diesen Kosenamen, der ihm seit der Kindheit anhaftete. Vor allem weil er sich aus dem Mund seiner Mutter wie »gatto«, also das italienische Wort für Katze anhörte. Wie viele Familien der italienischen Oberschicht des von Österreich-Ungarn verwalteten Triests sprachen die Lamprechts fließend Deutsch wie Italienisch, der Vater bestand jedoch darauf, dass zu Hause Deutsch gesprochen wurde. Er war es auch, der als gebürtiger Österreicher, der ursprünglich aus Graz stammte, noch am ehesten Unzulänglichkeiten im Italienischen zeigte.
Der schlanke Mittfünfziger mit Backenbart, den er in Form und Länge dem Vorbild des betagten Kaisers anzugleichen trachtete, wie das auch bei vielen Offizieren en vogue war, schenkte Gaetano einen Blick über den Rand seiner Zeitung. Dieser konnte nicht erkennen, ob er abfällig oder wohlmeinend war, neutral war er jedenfalls nie, das wusste Gaetano nur zu gut. Er antwortete seiner Mutter: »Nein, es tut mir leid, aber gerade heute ist mir noch ein Fall hereingekommen, ich muss gleich wieder weg.« Er spürte Rosarias schmachtenden Blick auf sich ruhen, während Adina ihn aus ihren großen schwarzen Augen anschaute, der Vater nochmals die Wiener Zeitung senkte, wodurch Gaetano jetzt sah, welchen geringschätzenden Blick ihm der Vater zudachte, auch wenn er damit mehr seine Arbeit als ihn selbst meinte.
»Das ist aber schade«, bedauerte seine Mutter unbeirrt von diesem Gewittersturm sich abwechselnd jagender Blicke. »Ich habe gleich fertig gekocht.« Aus ihrem olivfarbenen Gesicht, das für eine Dame der Gesellschaft ein wenig zu oft der Sonne ausgesetzt war, strahlten ihn ihre weißen Augen an.
»Ja«, antwortete Gaetano etwas verwirrt. »Wo ist denn Luisa heute? Sie ist doch hoffentlich nicht krank?«
»Auch Luisa braucht einmal einen Tag für sich«, erklärte die Mutter.
Gaetano fragte sich wieso. Die alte Haushälterin hatte keine Familie und war glücklich, sich weiterhin um die Geschicke der Lamprechts kümmern zu dürfen. Fände man sie ab und schickte sie in den Ruhestand, würde sie das wahrscheinlich keine Woche überleben. Er wollte sich umdrehen, als ihn seine Mutter zurückhielt und fragte: »Isst du wenigstens mit uns? Meine Gnocchi de’ susini sind mindestens so gut wie die von Luisa.«
»Nein, ich habe leider zu tun. Ich muss nochmals in die Via della Caserma.«
Ihm entging nicht, dass sowohl seine Schwester als auch deren Freundin enttäuscht seufzte. Es war Adina, die sich dann äußerte: »Und wir hatten gehofft, dass du uns ins Caffè degli Specchi begleitest. Dort wird heute Nachmittag zum Tanz aufgespielt. Das Orchester soll die neuesten Walzer aus Wien im Programm haben.« Rosaria untermalte diese Schilderung mit zum Tanz ausgebreiteten Armen. Gaetano lächelte gezwungen, legte der weit jüngeren Schwester seine Arme auf die Schulter und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Aus dem Augenwinkel bemerkte er den neidischen Blick Rosarias, die sich wohl sehnlich wünschte, an der Stelle der Freundin zu sein.
»Ich wusste gar nicht, dass man in Wien noch Walzer komponiert«, erwiderte Lamprecht, »ich habe gehört, dass es dort eine Reihe von neuen Komponisten gibt, die jedes harmonische Gefüge abzuschaffen versuchen. Die wollen alle Konventionen über den Haufen werfen. Das, was in der Malerei passiert ist, soll nun auch in der Musik passieren. Aber Schwesterchen, wenn du einmal in Wien Medizin studierst, dann kannst du dort jeden Abend zum Tanz gehen.«
»Es reicht«, zürnte der Vater offen. »Hör auf, Adina Flausen ins Hirn zu setzen. Genügt es dir nicht, dass wir deinetwegen in Triest vermodern werden? Wien, das war einmal.«
»Sie müssen es mir nicht verdeutlichen. Es ist mir bewusst. Deswegen bin ich hier bei der Polizei gelandet und muss nochmals zum Dienst. Darf ich mich jetzt umkleiden?«
»Jedes deiner Worte ist nur als Provokation gemeint«, brüllte Lamprecht senior lauter als nötig und zerknitterte dabei wütend die Zeitung auf seinem Schoß.
Die Mutter blickte die beiden Streithähne entsetzt an, da brachte ein hell klingendes Glöckchen, das kaum hörbar von draußen zu ihnen drang, die Auseinandersetzung zum Schweigen. Adinas Blick erhellte sich, sie sprang auf und stürmte hinaus. »Das muss eine Nachricht von Viola sein, komm, lass uns nachsehen«, forderte sie Rosaria auf, die ihr hinaus in den Garten folgte, wo Adinas Taubenschlag stand. Sie hielt sich Brieftauben, seit Viola, ihre ehemals beste Schulfreundin, mit ihrer Familie nach Umago gezogen war. Violas Vater, Signor Cressini, war Bauingenieur und hatte den Auftrag erhalten, dort eine neue Wasserleitung zu bauen. Da den beiden Mädchen die Briefausträger zu langsam waren, tauschten sie sich auf diesem Weg aus. Oft mehrmals täglich. Der Vater hasste die Tauben, weil sie ihre Exkremente nicht nur um den Taubenschlag, sondern auch auf dem restlichen Grundstück verteilten. Er murrte: »Andere gehen zur Post, geben ein Telegramm auf, aber meine Tochter hält sich eine eigene Taubenpost. Mir wären die Viecher ja gebraten weit willkommener.«
Er imitierte, wie er mit Messer und Gabel so einen gebratenen Vogel zu sich genommen hätte.
Gaetano war jedoch froh, dass sich seine kleine Schwester ein sinnvolles Hobby gesucht hatte und weiterhin Kontakt mit ihrer Freundin halten konnte. Auch darüber gab es oft Diskussionen in der Familie. Er wollte zu ihrer Verteidigung ansetzen, doch bevor er etwas erwidern konnte, hatte ihn der Blick seiner Mutter getroffen. Er schluckte den letzten Satz hinunter, den er dem Vater in Gedanken bereits an den Kopf geworfen hatte, nickte ihr stattdessen stumm zu und ging über den Flur in sein Zimmer. Die Tauben waren auch heute nur eine Nebenfront zwischen den beiden Männern. Wann immer es um »die Sache« ging, gerieten Vater und Sohn aneinander. Natürlich hatte sein alter Herr recht. Zumindest zum Teil. Aber ganz unschuldig war er selbst an der Situation auch nicht. Es war wohl genau dieser Anteil an schlechtem Gewissen in dieser Causa, der ihn meist schnell in die Luft gehen ließ wie einen überhitzten Kessel.
Gaetano warf die Tür hinter sich ins Schloss und verriegelte sie. Er war wütend, richtiggehend wütend. Der Zorn schlängelte sich wie ein giftiger Wurm durch seine Adern und ließ sein Herz heftig pochen. Warum der Vater immer wieder mit der Geschichte anfangen musste, fragte er sich. Natürlich saß die Sache wie ein Stachel im Fleisch der Familie und er wusste, dass er der Hauptschuldige war, derjenige, der das meiste zu verantworten hatte, aber eben nicht nur allein. Auch der Vater konnte seine Hände nicht in Unschuld waschen. Zum Glück war bislang nichts von den Vorfällen bis nach Triest vorgedrungen. Offiziell war man zurückgekehrt, weil die Mutter das Klima in Wien nicht vertrug. Bislang hatte das noch niemand infrage gestellt. Die Familie musste jedoch sehr achtsam sein, wann immer es sich um gesellschaftliche Verpflichtungen handelte. Auf dieses Parkett begab man sich nicht mehr als nötig. Die beiden Städte waren zu eng miteinander verflochten.
Gaetano riss ein Fenster auf, er brauchte Luft. Gierig sog er sie ein, atmete hektisch ein und aus, wie einer, der zu lange getaucht hatte. So verharrte er vor dem offenen Fenster, und es dauerte eine Weile, bis wieder Ruhe in ihn gekehrt war. Der Blick hinaus tröstete seinen verletzten Stolz.
Die Rückseite des Hauses sah auf einen Abhang und gab den Blick frei auf den Hafen und den Leuchtturm. Wie weiße Spitzen ragten einzelne Segel aus dem tiefblauen Wasser empor. Mit Neid dachte er an die Menschen, die jetzt mit Picknickkörben nach Barcola aufbrachen, um sich später im kühlen Nass zu erfrischen. Ihm war das heute nicht vergönnt, ihn rief die Pflicht. Er legte frische Kleidung an: ein weißes Hemd mit gestärktem Kragen und einen grauen Rock, der aus dünner Wolle gewebt war und ihn kühl halten würde. Er setzte den runden Hut auf und vergewisserte sich im Spiegel, dass alles gut saß.
Als er auf den Gang trat, hörte er aus dem verbotenen Zimmer ein leises Summen. Dort, wo der Onkel seit kurzer Zeit wohnte. Onkel Ladislaus, den der Vater aus Wien hatte holen müssen. Er hatte ihn im Schutz der Dunkelheit ins Haus geschmuggelt, darauf bedacht, dass keiner sie sehen konnte, als sie nächtens ankamen. Niemand durfte nach ihm fragen. Oder den Raum am Ende des Flurs betreten. Auf Geheiß des Vaters. Nicht einmal Luisa konnte dem Onkel das Essen bringen. Sie hatte es auf dem Tischchen davor abzustellen, eine kleine Glocke zu läuten und sich dann sofort zu entfernen. Nur einmal in der Woche sollte sie den Raum betreten, um sauber zu machen. Wo der Onkel dann war, wusste niemand. Vielleicht in dem kleinen Bad, das angeschlossen war. Aber wer machte das dann sauber?
Als er über den Flur in Richtung Eingangstür ging, hielt ihn die Mutter zurück. Sie hatte ihre langen Haare zusammengebunden und den Zopf auf dem Hinterkopf verknotet. Gaetano entging ihr Duft nicht, ein Geruch, der ihn an Kindheit und Geborgenheit erinnerte. Sie lächelte ihn an und erklärte mit ihrer sanften Stimme auf Italienisch, dass sie ihm eine Merenda, eine Jause, gerichtet habe, und Gaetano nahm die in Butterbrotpapier eingewickelten Panini an sich.
»Grazie, Mamma«, bedankte er sich und wollte das Haus verlassen, als ihn seine Schwester zurückhielt und ihm ins Ohr flüsterte, dass vorhin der Postbote da gewesen sei. »Offensichtlich war der Brief von, du weißt schon«, stichelte Adina und zwinkerte ihm zu. Gaetano bedankte sich. Er gab ihr einen Kuss auf die Wange und trat jetzt endlich aus dem Haustor.
Er ließ sein Fahrrad stehen und ging flotten Schrittes durch die Gässchen der Cittàvecchia, zuerst über die Via dell’Asilo und dann über die Scala di Montuzza, vorbei an den mittelalterlichen Ruinen der Tor Cucherna, bis er den Corso erreicht hatte. Durch die geöffneten Fenster hörte er die Familien, die ihren Mittagstisch hielten. Über seinem Kopf spannten sich Wäscheleinen, auf denen Hemden, Polsterbezüge und Tücher im lauen Wind flatterten. Nach wenigen Minuten hatte er die Polizeidirektion erreicht. Er musste seinem Vorgesetzten umgehend Bericht erstatten, was es mit der Leiche in Opicina auf sich hatte. Doch kaum dort angekommen, teilte man ihm mit, dass der Chef noch bei Tisch weilte.
Capo Ispettor Spetich empfing ihn ungnädig. Lamprecht hatte seinen Vorgesetzten im Caffè Tommaseo gefunden. Er war an den Tisch herangetreten, als Spetich gerade die Zeitung aufgefaltet und einen Caffè bestellt hatte. Der Oberinspektor bedachte den Untergebenen mit einer gehobenen Augenbraue über den Rand der Zeitung hinweg. Ein Kellner eilte geschäftig herbei und stellte den Nero vor den Gast und servierte den Teller mit den verbliebenen Muschelschalen ab. Sein Vorgesetzter hatte zwar seine Mahlzeit beendet, doch Lamprecht erkannte augenblicklich, dass es wohl nicht sonderlich klug gewesen war, ihn vor dem Verdauungskaffee und der Zeitungslektüre zu stören. Ungeduldig stieg Lamprecht von einem Bein auf das andere, wartete aber, bis er angesprochen wurde. Er betrachtete den Mann, der kaum zehn Jahre älter war als er selbst, der aber alles daransetzte, seiner Stellung und Position auch optisch zu entsprechen. Während Lamprecht als Jahrgang 1888 zu seiner Jugend stand und nur einen gestutzten Schnurrbart mit dezenten Spitzen trug, seine Wangen aber glatt rasierte, schmückte sich Spetich wie sein Vater und auch viele andere kaiserliche Beamte mit einem üppigen Backenbart, der dem obersten Dienstherrn zur Ehre gereichte.
Der Raum war nicht nur von dem Geruch nach Kaffee und Tabak, sondern auch von verschiedenen Unterhaltungen erfüllt und Lamprecht schnappte überwiegend deutsche Gesprächsfetzen auf. Offenbar hatte vor Kurzem der Dampfer aus Grado angelegt und vor allem österreichische Sommerfrischler in die Stadt gespült.
Spetich blätterte die Zeitung um, faltete schließlich das Papier missmutig zusammen und fragte: »Was ist denn so dringend, dass Sie mich hier stören müssen?«
Lamprecht formte die Lippen zum ersten Wort seiner Antwort, doch Spetich hörte wie viele Vorgesetzte am liebsten seine eigene Stimme und sprach sofort weiter: »Ich nehme an, Sie wollen mir mein Wochenende zerstören. Sie haben Nachricht, dass ich auf die wenigen ruhigen Stunden, die meiner Familie geweiht sind, werde verzichten müssen.«
»Am Morgen erreichte uns die Meldung aus Opicina …«
Erneut schnitt Spetich Lamprecht das Wort ab. »Ich weiß, heute wurde dort ein erhängter Soldat entdeckt, wahrscheinlich ein Selbstmörder.« Spetich bedeutete Lamprecht endlich, sich auf den zweiten Stuhl an seinem Tisch zu setzen.
Lamprecht folgte der Einladung und begann mit seinen Ausführungen: »Auf den ersten Blick mag es tatsächlich den Eindruck erwecken, aber …«
»… Sie haben Ihre Zweifel«, übernahm der Capo Ispettore den Gedanken seines Untergebenen. »Ich weiß, ich habe den Bericht der Wache in Opicina schon erhalten. Interessanterweise war der mit dem Boten knapp vor Ihnen da. Waren Sie wieder mit dem Fahrrad unterwegs? Und dann haben Sie sich umgezogen und gehofft, ich merke nicht, wenn Sie in der Dienstzeit anderen Dingen als Ihren Dienstpflichten nachkommen?«
Verlegen wich Lamprecht dem fragenden Blick des Vorgesetzten aus und steckte unbewusst die Hand in seine Tasche, wo er seine Rettung fand. Er holte den alten Fahrschein hervor: »Nein, ich bin mit der Trambahn gefahren«, versuchte er die berechtigten Zweifel seines Vorgesetzten zu zerstreuen.
Spetich grinste, weil er genau wusste, dass er mit seiner Vermutung richtiggelegen war. Er schüttelte den Kopf und sagte: »Lamprecht, Lamprecht. Sie Halunke. Aber der Giro ist für dieses Jahr vorbei, verwenden Sie Ihre Energie besser für Ihre Karriere. Sie sind ein kluger Bursche, Sie könnten es weit bringen. Was haben Sie also als Nächstes vor?«
»Ich werde mich in der Truppe bei seinen Kameraden umhören. Vielleicht ergibt sich dabei ja wirklich ein Motiv für einen Suizid, und vorher möchte ich noch ins Spital.«
»Sie lassen den armen Kerl obduzieren?«
»Nur um sicherzugehen.«
Spetich seufzte, dann nahm er die Zeitung wieder auf und sprach, ohne den geringsten Versuch zu unternehmen, den Grant in seiner Stimme zu verbergen, über die bewusst errichtete papierene Barriere weiter: »Ich wusste es ja. Das war es mit meinem Wochenende. Tun Sie, was Sie tun müssen. Sie finden mich am Nachmittag in meinem Büro. Wenn Sie mit dem Arzt gesprochen haben, entscheiden wir die weiteren Schritte.«
Lamprecht salutierte und verließ das Café. Er war froh, dass der Vorgesetzte nicht weiter auf seiner Art der Fortbewegung herumgeritten war. Er wusste, dass Edoardo Spetich seiner Leidenschaft mit einer gewissen Skepsis begegnete, wie ein Großteil der Bevölkerung auch. Man misstraute dem Fahrrad. Anders als das Automobil hatte es die breite Masse, und da auch die ärmeren Schichten, mobil gemacht. Zum Glück war es in Triest nie so weit gekommen wie in Mailand, wo man vor zwanzig Jahren jede Art der Benutzung von Zweirädern, Dreirädern oder Tandems verboten und Zuwiderhandelnde in den Kerker gesteckt hatte. Es hatte auch etwas Gutes, Teil der Habsburgermonarchie zu sein. Doch zu dem Gegenwind, der den Radsportlern wie die Bora ins Gesicht blies, hatte sich, sozusagen als Konterpart, in den letzten Jahren ein leichter Rückenwind gebildet: Es gab immer mehr Fans, die sich für den Profisport begeisterten, und auch die ersten Zeitungen hatten sich vor einiger Zeit des Themas angenommen. Von der Gazzetta dello Sport ganz zu schweigen. Die berichtete nicht mehr allein von den Fußballergebnissen, sondern auch von den Duellen zwischen Rossignoli und Gerbi, den sie wegen seiner Trikotfarbe auch den »roten Teufel« nannten. Die Fans drängten sich mittlerweile zu Tausenden um die Zieleinläufe, um die abgekämpften Sportler heftig zu bejubeln. Er ging über die Straße, doch seine Gedanken waren ganz woanders. Im Geist sah sich Lamprecht selbst auf seinem Rennrad sitzen, wie er die letzten Meter zu dem über dem Ziel gespannten Transparent heftig tretend zurücklegte, während immer mehr Menschen ihm hinterdreinliefen. Irgendjemand betätigte eine Klingel, die immer heftiger läutete, und einer der enthusiastischen Begleiter klopfte ihm anerkennend auf die Schulter, als ihn nur mehr wenige Pedaltritte vom Sieg trennten, da wurde er plötzlich festgehalten und das Bild des Triumphs schmolz sofort wie Wachs in einem Stahlofen.
Lamprecht wurde aus diesem Tagtraum an der Schulter zurückgerissen. Das Klingeln kam von einer Straßenbahn, die nur wenige Zentimeter an seinem Gesicht vorbeirauschte wie ein wütender Stier. »Immer schön langsam, piano, piano.«
Lamprecht war augenblicklich im Jetzt angekommen und erkannte die Stimme von Pietro. Pietro Pirona war sein Kollege und wie er Polizeiinspektor. Und noch mehr: Er war sein Freund und Trainingspartner. Pirona teilte Gaetanos Liebe zum Fahrrad, auch wenn er in dem Sport vor allem einen Ausgleich zur Tätigkeit am Schreibtisch sah. Die ärarische Bürokratie der Monarchie hatte trotz weitestgehender Autonomie der Stadt Eingang in die Amtsstuben gefunden. Pirona meinte: »Heb dir deinen Leichtsinn für unsere Abfahrt heute Nachmittag auf. Du weißt schon, bei den Kurven von Prosecco pfeift dir der Wind um die Ohren.«
Lamprecht drehte sich zu ihm um. Er besah den Freund, der nur wenig älter als er, aber schon verheiratet und Vater einer kleinen Tochter war. »Ich kann heute nicht, ich muss arbeiten, du wirst den Fahrtwind wohl alleine genießen müssen.«
Pirona grinste. Dabei bildeten sich Grübchen in den Wangen und die Spitzen seines Schnauzers hoben sich. In seinen Augen leuchtete ein schelmisches Blitzen auf, als er sagte: »Ich habe es schon gehört. Die Leiche oben beim Obelisken. Jeder spricht davon. Auch vom sturen Lamprecht, der das Gras wachsen hört. Aber wenn du schlau bist, dann lässt du die Version der Kollegen in Opicina gelten und kannst nach einem kurzen Bericht ins Wochenende. Ich jedenfalls mach bald Schluss und erwarte dich um drei.« Er boxte Lamprecht zum Abschied sanft gegen den Oberarm und verschwand im Bürogebäude.
Lamprecht hatte sich nicht einmal bei Pietro bedankt. Ohne sein Einschreiten wäre er wohl im Krankenhaus gelandet. Im besten Fall. Wie in Trance war er in seine Gedanken versunken gewesen und jetzt immer noch verwirrt. Was für ein komischer Tag, dachte er.
Triest war eine ruhige Stadt. Natürlich zog der Hafen allerlei Gesindel an und die Seeleute neigten dazu, sich im Suff die Schädel einzuschlagen, doch das waren alles keine großen Sachen. Die Übeltäter waren meist zu betrunken, um ihre Tat zu vertuschen oder abzuhauen, und wenn, dann war das auch kein Malheur. Dann wanderte der Vorfall zu den Akten. Doch ein toter Soldat? Noch dazu ein Selbstmörder? Das konnte Fragen aufwerfen, auf die man besser Antworten geben sollte, bevor sich jemand aus Graz oder Wien einschaltete. Dennoch spürte Lamprecht, wie der vom Freund in den Kopf gesetzte Teufel ihn versuchte und ihm einflüsterte: Mach es doch, wie Pietro gesagt hat. Lass dir vom Arzt den Selbstmord bestätigen und genieße dein Wochenende.
3.
Lamprecht musste ein wenig auf den Doktor warten. Er hatte sich telefonisch ins Spital verbinden lassen und dort sein Kommen angekündigt.
Jetzt befand er sich am Ende eines langen Ganges vor einer weißen Tür und schaute aus dem Fenster in einen Innenhof. Der Komplex erinnerte ihn an die Anlage des Allgemeinen Krankenhauses in Wien. Er hatte es während seiner Zeit dort leider kennenlernen müssen. Wenn diese Sache in Wien nicht gewesen wäre, dachte er, würde er jetzt bei diesem Wetter wohl nicht auf einen Arzt warten müssen, der ihm etwas erzählen würde, was er bereits wusste. Er betrachtete ein paar Patienten, die in Sandalen und Morgenmäntel gekleidet unter Bäumen und zwischen den blühenden Sträuchern spazieren gingen.
»Ispettor Lamprecht?«
Die Anrede riss ihn aus seinen Gedanken. Er drehte sich um und blickte einem schlanken, groß gewachsenen Mann von ungefähr vierzig Jahren in die Augen. Trotz einzelner grauer Haar- und Bartspitzen strahlte der Arzt, der unter seinem weißen Kittel Anzug, Hemd und Krawatte trug, eine enorme Vitalität aus. Lamprecht nickte und streckte ihm die Hand entgegen. »Und Sie sind?«, fragte er mit der Bestimmtheit des Polizisten, ohne es am nötigen Respekt dem Älteren gegenüber mangeln zu lassen. Der Mann kam ihm bekannt vor. Womöglich verkehrte er in den Kreisen seines Vaters, also war es besser, hier nicht zu sehr auf Autorität zu setzen. »Ich bin Dottor Luigi Tripcovich, aber ich muss Ihnen sagen, Sie kommen zu spät.«
Lamprecht griff sich an den Schnurrbart und musterte den Arzt mit finsterer Miene. Hatten die beiden Spaßvögel in Opicina gemeint, dass er umsonst gekommen war, meinte der jetzt, dass er zu spät gekommen war. Er sagte: »Jetzt bin ich ja da.«
»Aber die Leiche nicht mehr. Die wurde vorhin abgeholt.«
»Von wem?«, wollte Lamprecht wissen.
»Vom Militär. Es waren eben Soldaten da, die Order hatten, den Leichnam ins Militärspital zu überstellen. Sie haben mir ein Schreiben gezeigt, wonach die weitere Untersuchung der näheren Todesumstände in die Zuständigkeit der Armee fällt und dass die sich jetzt der Sache annimmt.«
Lamprecht ballte die Hand zu Faust. »Das ist doch unerhört!«, begann er zu fluchen, hielt dann aber sofort wieder seine Gefühle in Zaum. Er fragte: »Haben Sie die Leiche gesehen?«
Der Arzt zögerte einen Moment, dann bejahte er die Frage.
»Und?«
Der Doktor hielt ihm einen Zettel hin: »Hier ist mein Bericht, wenn er Sie interessiert.«
Neugierig nahm Lamprecht den Zettel an sich und überflog die wenigen Absätze. Dann schaute er langsam auf und fixierte den Arzt: »Haben Sie überhaupt Erfahrung in solchen Dingen? Ich meine, haben Sie schon öfter Leichen obduziert?«
Dottor Tripcovich klappte der Kiefer herunter. »Wollen Sie damit andeuten …, ich meine, wollen Sie meine Kompetenz in Zweifel ziehen? Ich habe in Wien bei von Hofmann am Institut für gerichtliche Medizin studiert, ich denke wohl, dass mir da einiger Sachverstand zukommt.«
»Dann sind Ihnen doch sicher die Leichenflecken am Rücken des Toten aufgefallen, Herr Doktor Tripcovich?«, fragte Lamprecht, dem dieses wichtige Detail bei der Beschau der Leiche sofort aufgefallen war, als er am Morgen den toten Körper gedreht hatte.
Der Arzt zögerte, ehe er darauf antwortete: »Ich weiß nicht, so genau habe ich den Körper vielleicht nicht in Augenschein genommen. Ich habe mein Hauptaugenmerk den Verletzungen am Hals gewidmet.«
»Die auch zu wenig ausgeprägt waren, als dass man davon ausgehen könnte, dass noch Leben in seinen Adern geflossen ist, als er den Strick um den Hals angelegt bekam.«
»Ich verstehe nicht ganz, Sie wollen doch nicht andeuten, dass der Mann …?«
»Genau das! Und ich will es nicht nur andeuten, ich werde es auch beweisen, ganz egal, was da steht.« Er hielt dem Arzt den Bericht unter die Nase. So knapp und so fordernd, dass er jeglichen Anstand vermissen ließ. Die Expertise des Pathologen sprach von Selbstmord und dass Fremdeinwirkung so gut wie ausgeschlossen werden könne.
Der Arzt öffnete die Tür, vor der die Diskussion bislang stattgefunden hatte, und schob Lamprecht an der Schulter hinein.
»Kommen Sie in mein Büro. Gehen Sie schon!«
Der Arzt hatte den Polizisten auf einer modernen Holzbank im Stil der Wiener Werkstätte Platz nehmen lassen, und Lamprecht betrachtete die geometrischen Muster im Stoff, der über die Sitzfläche gespannt war. Zwischen ihnen ein kleiner runder Tisch mit messingbeschlagenen Kanten und darauf zwei Gläser, in die der Mediziner Cognac einschenkte, ehe er sich selbst auf den Stuhl setzte. Er seufzte, dann stürzte er sein Glas in einem Satz hinunter. Lamprecht rührte seines nicht an und schob es stattdessen von sich weg. Tripcovich bedachte ihn mit einem gleichgültigen Blick, ehe er auch das zweite Glas an sich nahm und das Schweigen beendete: »Die Sache ist durch. Ihr Wort gegen meines. Das Wort eines verdienten Mediziners und Arztes gegen das eines jungen Hitzkopfs.«
Lamprecht riss kurz die Augen auf, erlangte aber sofort wieder die Kontrolle über seine Mimik. »Wie kommen Sie dazu …?«
»Ihr Ruf eilt Ihnen voraus«, erklärte Tripcovich lächelnd, wobei in diesem Lächeln noch ein Rest an Unsicherheit lag. Dann leerte er das zweite Glas. Die Fenster im Arztzimmer waren halb geöffnet, die Schlagläden zum Schutz gegen die Sonne jedoch geschlossen. Von draußen drang der Lärm der Straße in den Raum, in dem die beiden Männer im Halbdunkel saßen. Sie schwiegen für einen Moment, so als ob jeder vom anderen noch eine Reaktion erwartete. Lamprecht betrachtete den Arzt erneut eingehend und wurde in seinem Gefühl bestätigt, dass sie einander schon einmal begegnet waren. Er wusste aber nicht wo, da erhob sich Tripcovich und gab zu verstehen, dass er die Unterhaltung für beendet betrachtete: »Wenn sonst nichts ist. Ich muss mich jetzt wieder um meine Patienten kümmern.«
Lamprecht nickte und stand ebenfalls auf. »Wenn ich noch etwas benötige, dann …«
»Sie brauchen nichts, glauben Sie mir. Machen Sie bei dem Wetter doch lieber mit Ihrem schönen neuen Fahrrad einen Ausflug. Buona giornata!« Mit diesem gönnerhaften Rat verabschiedete sich der Arzt und Lamprecht stieß nicht mehr nach. Erst als er auf der Straße stand, war ihm klar, woher der Arzt das mit seinem neuen Fahrrad wusste und auch, woher er diesen kannte. Er war sicher, sich nicht getäuscht zu haben. Genauso sicher war er, das freie Wochenende seines Vorgesetzten tatsächlich zunichtemachen zu müssen, egal ob das nun klug war oder nicht.
4.
»Hätte das nicht bis Montag warten können?«, fragte Capo Ispettor Spetich, als Lamprecht seinen Bericht vortrug. Der Chef saß im Hemd an seinem Schreibtisch und paffte an einer Zigarre, sein Blick wanderte demonstrativ auf die Uhr an der Wand. Der ausgestoßene Rauch umspielte seinen Bart und tanzte dann um seinen Kopf wie das Wasser um die Klippen in Grignano, bevor er von einem Luftzug aus dem geöffneten Fenster gerissen wurde. Der Inspektor stand stramm vor dem Tisch des Vorgesetzten, der seiner Aufmachung nach bereits mehr im Wochenende als im Dienst war. Der Rock hing am Kleiderständer neben dem Türstock und seine dunkle Weste hatte er über die Sessellehne gehängt. Spetich hatte zudem die Krawatte gelockert und die Ärmel seines weißen Hemdes aufgekrempelt. Die Zigarre war zur Hälfte geraucht. Lamprecht kannte die tägliche Zeremonie seines Chefs: Kurz vor Dienstende machte er es sich bequem und gönnte sich den Genuss des schweren Tabaks, und sobald er den fetten Stummel im wuchtigen Aschenbecher ausgedämpft hatte, verabschiedete er sich und verließ die Amtsstube.
Lamprecht erwiderte: »Nun, ich denke, je schneller wir die Ermittlungen vorantreiben, desto eher haben wir eine Chance, die wahren Umstände dieses Todes zu klären.«
Spetich lehnte sich zurück, sein Hemd war nachlässig in die Hose gesteckt und Lamprecht entging nicht, dass sein Chef am Bauch zugelegt hatte. Spetich machte immer noch kein Hehl daraus, was er von Lamprechts Einschätzung hielt, und fragte skeptisch: »Die für Sie auf Fremdeinwirkung hindeuten?«
»Natürlich! Der Befund des Arztes ist falsch, Farnese war schon tot, als man ihn am Strick aufhängte. Überall auf dem Rücken hatten sich Totenflecken ausgebildet. Die können nur entstehen, wenn er mehrere Stunden als Leiche auf dem Boden gelegen ist.«
»Sagen Sie. Der Arzt sagt etwas anderes. Und denken Sie einmal nach, wem das Gericht wohl eher glauben würde. Und jetzt denken Sie auch einmal nach, wem ich wohl eher Glauben schenken möchte? Außerdem, die Zuständigkeiten sind hier klar geregelt.«
»Aber irgendetwas stinkt hier! Oder finden Sie es nicht auch sonderbar, dass das Militär hier offenbar jegliche Aufklärung verhindern will?«
Spetich nahm die Zigarre, drehte sie im Aschenbecher hin und her und streifte die Asche ab, bevor er wieder daran zog. Mit einem seufzenden Unterton legte er seine Sicht der Dinge dar: »Die Armee …, Sie wissen ja, wir sind die Polizei und die sind das Militär. Es ist besser, wenn man sich nicht in die Quere kommt. Wer weiß, was da dahintersteckt. Denken Sie an diesen Oberst Redl, der sich letztes Jahr in Wien erschossen hat. Wenn die versuchen, diesen Tod nicht an die große Glocke zu hängen, dann werden sie schon ihre Gründe haben und wir tun gut daran, hier nicht aus der Deckung zu kommen.«
»Meinen Sie damit, ich soll hier …?«, fragte Lamprecht ungläubig und runzelte die Stirn, ohne die Frage klar auszusprechen. Auch das hatte er gelernt, wenn er auch immer noch mit höheren Dienstgraden aneckte. Lamprecht hatte nicht ohne Grund den Ruf eines Heißsporns, der sich wenig um Hierarchie scherte und klare Befehlswege oft hinterfragte, um nicht zu sagen missachtete. In der verhältnismäßig kurzen Zeit bei der Polizeidirektion in Triest hatte er nicht nur einmal ungefragt Eigeninitiative gezeigt oder die eine oder andere Weisung von oben »überhört«.
»Gar nichts meine ich«, entgegnete Spetich ungehalten, »ich weiß, dass Sie in dieser Stadt hier einen Protektor haben, mit dem ich mich sicher nicht anlegen werde. Tun Sie, was Sie glauben tun zu müssen. Aber warum setzen Sie sich nicht auf Ihr Fahrrad? Müssen Sie nicht für irgendein Rennen trainieren?« Die Zigarre war fast zu Ende geraucht, doch Spetich schien es schwerzufallen, sich von ihr zu trennen. Womöglich war sie in diesem Moment die einzige Insigne seiner Macht. Dann erhellte sich sein Blick und er sinnierte: »Ich glaube, das liegt daran, dass Sie noch immer Junggeselle sind. Ihnen fehlt eine Frau. Passen Sie auf, dass Sie nicht als Hagestolz enden. Oder halten Sie es gar am Ende wie unser Di Paese?« Sein Blick war wieder ernst geworden. Er fixierte Lamprecht mit gerunzelter Stirn und dieser hätte jetzt gerne gewusst, was der Vorgesetzte dachte, aber nicht aussprach. Der junge Inspektor trat von einem Fuß auf den anderen und wartete, bis das Wort wieder an ihn gerichtet wurde. Nach kurzer Pause schließlich fragte Spetich: »Also, was gedenken Sie jetzt zu tun?«
»Das, was zu tun ist.« Lamprecht deutete auf das Soldbuch, das auf dem Tisch seines Vorgesetzten lag. Er nahm es an sich und erläuterte sein Vorhaben: »Ich werde zur Kaserne gehen und mich dort über Farnese umhören. Ich werde seinen Vorgesetzten befragen und auch seine Kameraden. Und wenn ich auch nur einen Grund dafür finde, warum der arme Kerl sich hätte aufhängen sollen, dann will ich es gut sein lassen.«
»Sie wissen aber schon, dass hier die Militärbehörde das letzte Wort hat?«
Lamprecht nickte stumm wie ein Ministrant, der vom Pfarrer beim heimlichen Kosten vom Messwein erwischt worden ist, dann salutierte er und verließ den Raum. Seine Entscheidung stand trotz der Mahnung seines Vorgesetzten fest, was dieser wohl auch instinktiv spürte. Aus dem Augenwinkel heraus konnte Lamprecht erkennen, wie Spetich die Zigarre malträtierte, um die Glut zu töten, und er konnte sich ausmalen, dass Spetich jetzt lieber ihn töten würde. Als er schließlich die Dienststelle verließ und einige Polizisten dabei grüßte, dachte er daran, dass die meisten seiner Kollegen tatsächlich verheiratet waren und auch schon fast alle Kinder hatten. Nur Di Paese war so wie er noch ledig, und der war schon fast vierzig, aber man sagte ihm nach, dass er es nicht so mit den Frauen habe.
Lamprecht hatte die Kaserne am gleichnamigen Platz nach wenigen Minuten erreicht. Auch für diesen Weg hatte er vom Büro aus telefoniert und sein Erscheinen angemeldet.
Die Wache am Eingang zeigte sich wenig von seiner Kokarde beeindruckt und wollte partout den Eingang ins Gebäude nicht freigeben. Erst als nach wenigen Minuten eine höhere Charge erschien, wich der dienstbeflissene Infanterist stumm und steif wie eine beim Spielzug bewegte Schachfigur zur Seite.
»Sie sind Ispettor Lamprecht, nehme ich an. Wir haben vorhin telefoniert«, hielt der Feldwebel fest, der sich dem Polizisten als Hector Szabo vorgestellt hatte. »Ich bringe Sie gleich zum diensthabenden Offizier, Leutnant Jahn.« Der junge Mann in der himmelblauen ungarischen Uniform durchmaß in zügigen Schritten den Kasernenhof, bis sie ein Tor am anderen Ende des Komplexes erreichten, das zu einem Stiegenaufgang führte. Sie mussten ins obere Stockwerk, wo am Ende des Ganges eine Tür angelehnt war, durch die man jemanden laut reden hörte.
»Nein, keine Ahnung, was er hier will. Aber uns geht das nichts an, das werde ich ihm schnell klargemacht haben.«
Szabo bedeutete Lamprecht, vor der Tür zu warten, dann nahm der Soldat Haltung an und klopfte gegen die angelehnte Tür, bevor er eintrat und auf Ungarisch Lamprechts Besuch anmeldete.
»Lassen Sie ihn eintreten«, tönte es von innen auf Deutsch und Lamprecht wurde hereingewinkt. Beim Eintreten nahm er den Hut vom Kopf. Der Offizier erhob sich hinter seinem Schreibtisch und reichte Lamprecht über die Tischplatte die Hand, der etwas enttäuscht war, dass ihn nur ein Leutnant empfing. Sie setzten sich beide und Lamprecht stellte fest: »Der Herr Oberst hat keine Zeit für mich?«
Der Leutnant lachte heiser auf, während er sich eine Zigarette anzündete und Szabo mit einer Geste aus dem Raum schickte. »Der Herr Kommandant macht wohl mit seiner Familie eine Landpartie. Sie werden mit mir vorliebnehmen müssen.« Leutnant Jahn entsprach der landläufigen Vorstellung des tugendhaften Offiziers Seiner Majestät Armee: Er trug wie Lamprecht einen Oberlippenbart, doch der des Offiziers war noch akkurater gestutzt als jener des Polizisten. Zwei dünne Striche, die wie mit Stift gezeichnet zwischen Oberlippe und Nase lagen. Die Uniformjacke saß passgenau am schlanken Oberkörper und die glatten Haare waren an den Schläfen so kurz geschnitten, dass die Kopfhaut unter dem Flaum hervorblitzte. Eine lange Duellnarbe prangte an der linken Wange. Ein unebener, fleischiger Wulst zeigte, dass sie schon lange verheilt war. Es musste sich um eine Jugendsünde gehandelt haben, dachte Lamprecht, als er in das Gesicht des einige Jahre älteren Mannes blickte, der ein Lächeln nur mit den Mundwinkeln, nicht aber mit den Augen zustande brachte.
Lamprecht holte das Soldbuch des toten Farnese hervor und reichte es über den Schreibtisch. »Ich nehme an, Sie haben schon Kunde von dem getöteten Soldaten, der heute Morgen in Opicina entdeckt wurde?«
Jahn nahm das Büchlein entgegen und klemmte sich ein Monokel ins rechte Auge, bevor er darin zu blättern begann. Doch im nächsten Moment klappte er es zu und gab es dem Polizisten zurück. Sein Lächeln blieb kalt. »Es tut mir leid, aber hier verschwenden Sie Ihre Zeit«, urteilte Jahn und Lamprecht