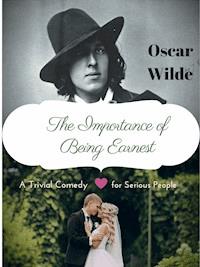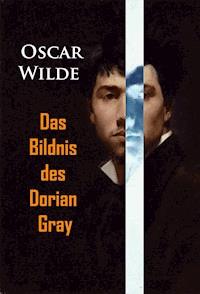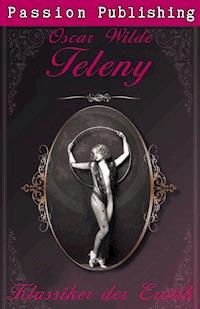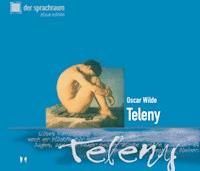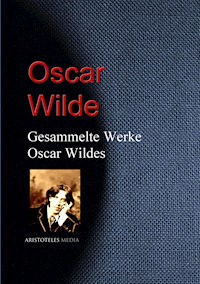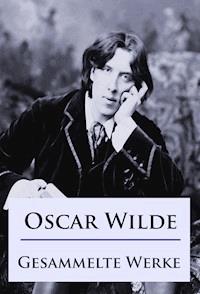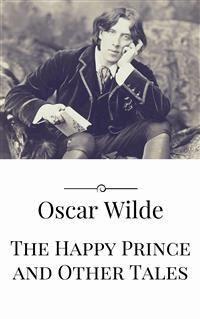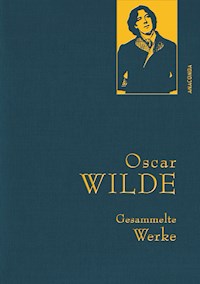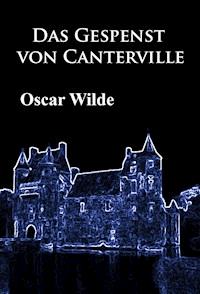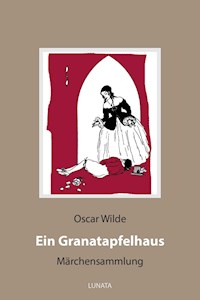
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Prosasammlung enthält moderne Märchen von Oscar Wilde: Der junge König, Der Geburtstag der Infantin, Der Fischer und seine Seele, Das Sternenkind. ›Der junge König‹ ist ein sozialkritisches Märchen, in dem der junge König, der unter Schäfern aufwuchs, seines Reichtums überdrüssig wird und zu einer Christus gleichen Figur stilisiert wird. ›Der Geburtstag der Infantin‹ handelt von einem kleinwüchsigen Hofnarren des spanischen Hofes, der am Konflikt zwischen seiner Selbstwahrnehmung als Künstler und der Außensicht als lächerlicher Figur zerbricht. In ›Der Fischer und seine Seele‹ entledigt sich ein Fischer seiner Seele, um unter Wasser mit einer Meerjungfrau zu leben. ›Das Sternenkind‹ ist die Geschichte eines schönen, aber grausamen Findelkindes, das in der Sklaverei geläutert und zum König gekrönt wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LUNATA
Ein Granatapfelhaus
Märchensammlung
Oscar Wilde
Ein Granatapfelhaus
Märchensammlung
© 1891 by Oscar Wilde
Originaltitel A House of Pomegranates
Aus dem Englischen von Wilhelm Cremer
Illustrationen von Heinrich Vogler
Umschlagbild Lucian Zabel
© Lunata Berlin 2020
Inhalt
Der junge König
Der Geburtstag der Infantin
Der Fischer und seine Seele
Das Sternenkind
Der junge König
Es war am Vorabend seines Krönungstages, und der junge König saß allein in seinem schönen Gemach. Seine Höflinge hatten sich alle von ihm verabschiedet, indem sie nach der feierlichen Sitte des Tages ihre Köpfe bis zur Erde verneigten, und waren jetzt in dem großen Saal des Palastes versammelt, um von dem Professor des feinen Anstands ein paar letzte Anweisungen zu erhalten. Denn es gab unter ihnen einige, die noch ein ganz natürliches Benehmen zeigten, was bei einem Höfling, man braucht das kaum zu erwähnen, ein sehr schwerer Verstoß ist.
Der Jüngling – denn er war nur ein Jüngling, da er erst sechzehn Jahre zählte – grämte sich nicht über ihr Fortgehen. Mit einem tiefen Seufzer der Befreiung hatte er sich auf die weichen Kissen seines bestickten Lagers zurückgeworfen und lag da mit wilden Augen und offenem Munde, wie ein brauner Waldfaun oder ein junges Tier aus dem Forst, das um ein Haar in die Schlingen der Jäger geraten war.
Und es waren ja auch wirklich Jäger, die ihn gefunden hatten, die fast durch Zufall auf ihn gestoßen waren, als er barfüßig, eine Flöte in der Hand, der Herde des armen Ziegenhirten folgte, der ihn aufgezogen, und für dessen Sohn er sich immer gehalten hatte. Er stammte aber aus einer heimlichen Ehe der einzigen Tochter des alten Königs mit einem Manne, der weit unter ihr stand – einem Fremden, wie einige sagten, der durch den wundervollen Zauber seines Lautenspiels der jungen Prinzessin Liebe erobert hatte, während andere von einem Künstler aus Rimini sprachen, dem die Prinzessin viel, vielleicht zu viel Ehre erwiesen hatte, und der plötzlich aus der Stadt verschwunden war, ohne sein Werk im Dom vollendet zu haben. Das Kind stahl man, als es kaum eine Woche alt war, von der Seite seiner schlafenden Mutter weg und gab es einem einfachen Landmann und seiner Frau, die selbst keine Kinder hatten und im entlegensten Teil des Waldes, mehr als einen Tagesritt von der Stadt entfernt, lebten. Kummer oder die Pest, wie der Hofarzt feststellte, oder, wie manche glaubten, ein schnelles italienisches Gift, das in einem Becher gewürzten Weins gereicht wurde, tötete innerhalb einer Stunde nach seinem Erwachen das zarte Mädchen, das ihn geboren hatte, und als der treue Bote, der das Kind auf seinem Sattelbogen trug, von seinem müden Pferd herabstieg und an die grobe Tür der Hütte des Ziegenhirten klopfte, wurde die Leiche der Prinzessin in ein offenes Grab hinabgelassen, das auf einem verlassenen Kirchhof jenseits der Stadtmauern gegraben war, in ein Grab, von dem es hieß, daß in ihm schon eine andere Leiche lag, die eines jungen Mannes von wunderbarer und fremdländischer Schönheit, dem man die Hände mit verschlungenen Stricken auf dem Rücken zusammengebunden hatte, und dessen Brust viele rote Stichwunden zeigte.
So wenigstens lautete die Geschichte, die sich die Menschen zuflüsterten. Und sicher war es, daß der alte König, als er auf dem Sterbebett lag, entweder aus Reue über seine große Sünde oder einfach, weil er nicht wünschte, daß das Königtum an eine andere Linie fallen sollte, den Jüngling holen ließ und ihn in Gegenwart seines Staatsrats als Erben anerkannte.
Und es scheint, daß er von dem ersten Augenblick seiner Anerkennung an Merkmale jener seltsamen Leidenschaft für Schönheit gezeigt hatte, die bestimmt war, einen so großen Einfluß über sein Leben zu haben. Diejenigen, die ihn nach der Zimmerflucht begleiteten, die man zu seiner Benutzung ausgewählt hatte, sprachen oft von dem Freudenschrei, der von seinen Lippen brach, als er das feine Gewand und die reichen Juwelen sah, die man für ihn bereithielt, und die fast wilde Lust, mit der er den groben Lederrock und den rauen Schaffellmantel von sich schleuderte. Er vermißte zwar manchmal die schöne Freiheit seines Waldlebens und war stets geneigt, sich über die langweiligen Hofzeremonien zu ärgern, die ihm soviel von jedem Tag fortnahmen, aber der wundervolle Palast – den freudenreichen nannte man ihn – in dessen Besitz er sich jetzt wußte, erschien ihm wie eine neue Welt, die zu seinem Entzücken eigens geschaffen war. Und sobald er der Ratsversammlung oder dem Audienzzimmer entfliehen konnte, lief er die große Treppe mit ihren Löwen aus vergoldeter Bronze und ihren Stufen aus schimmerndem Porphyr hinab und wanderte von Zimmer zu Zimmer und von Flur zu Flur, wie jemand, der im Schönen ein Heilmittel gegen den Schmerz, eine Gesundung aus dem Siechtum sucht.
Auf diesen Entdeckungsfahrten, wie er sie wohl nannte – und sie waren ja für ihn wirkliche Reisen durch ein wunderbares Land, wurde er oft von den schlanken, blondhaarigen Hofpagen begleitet mit ihren wehenden Mänteln und den lustig flatternden Bändern. Aber noch viel öfter war er allein, denn mit einem schnellen, sicheren Instinkt, der fast eine Offenbarung war, fühlte er, daß die Geheimnisse der Kunst nur im Geheimen gelernt werden können, und daß Schönheit, wie Weisheit, den einsamen Verehrer liebt.
Viele seltsame Geschichten wurden um diese Zeit über ihn berichtet. Man erzählte, daß ein würdiger Bürgermeister, der gekommen war, für die Bürger der Stadt eine mit blühenden Phrasen geschmückte Denkschrift zu überreichen, gesehen hatte, wie er in wirklicher Anbetung vor einem großen Gemälde kniete, das man gerade aus Venedig gebracht hatte, und das den Dienst irgendwelcher neuen Götter zu verkünden schien. Ein andermal wurde er mehrere Stunden vermißt und nach langem Suchen fand man ihn in einer kleinen Kammer in einem der Nordtürme des Palastes, wie er ganz verzaubert auf eine griechische Gemme starrte, in die die Figur des Adonis eingeschnitten war. Man hatte ferner beobachtet, wie er seine warmen Lippen auf die marmorne Stirn einer antiken Statue drückte, die man beim Bau einer Steinbrücke im Flußbett gefunden hatte, und die den Namen eines bithynischen Sklaven Hadrians trug. Und eine ganze Nacht verbrachte er damit, den Eindruck zu beobachten, den das Mondlicht auf eine silberne Statue des Endymion machte.
Alle seltenen und kostbaren Gegenstände übten jedenfalls einen starken Zauber auf ihn aus, und in seinem Verlangen, sie sich zu verschaffen, hatte er viele Kaufleute ausgesandt, einige, um von dem rauen Fischervolk der Nordsee Meerschaum einzuhandeln, andere, um in Ägypten nach jenen merkwürdigen grünen Türkisen zu suchen, die man nur in den Gräbern der Könige findet, und von denen man sagt, daß sie magische Eigenschaften besitzen. Noch andere mußten nach Persien reisen für seidene Teppiche und bemalte Töpferwaren, oder nach Indien, um Florgewebe zu kaufen und buntes Elfenbein, Mondsteine und Armbänder aus Achat, Sandelholz und blaues Emaille und Halstücher aus weicher Wolle.
Aber, was ihn am meisten beschäftigt hatte, war das Gewand, das er bei seiner Krönung tragen sollte, das Kleid aus gewebtem Gold, die rubinengeschmückte Krone und das Zepter mit seinen Kränzen und Reihen von Perlen. Und auch an diesem Abend dachte er daran, als er auf seinem kostbaren Lager lag, und den großen Block von Tannenholz betrachtete, der langsam in dem offenen Kamin verglühte. Die Entwürfe aus den Händen der berühmtesten Künstler waren ihm schon vor vielen Monaten vorgelegt worden, und er hatte Befehl gegeben, daß die Handwerker Tag und Nacht arbeiten sollten, um sie auszuführen, und daß man die ganze Welt nach Juwelen durchsuchen sollte, die dieser Arbeit würdig waren. In Gedanken sah er sich schon in dem strahlenden Gewand eines Königs vor dem Hochaltar des Domes stehen, und ein Lächeln umspielte seine jungen Lippen und entfachte strahlenden Glanz in seinen dunklen Waldaugen.
Nach einiger Zeit erhob er sich von seinem Lager, lehnte sich gegen den geschnitzten Vorbau des Kamins und sah sich in dem matterleuchteten Raum um. Die Wände waren mit reichen Gobelins behangen, die den Triumph der Schönheit darstellten. Ein großer, mit Achat und Lapislazuli ausgelegter Schrank nahm die eine Ecke ein, und dem Fenster gegenüber stand ein seltsam gearbeiteter Juwelenschrank mit Lacktäfelung aus gepulvertem und in Mosaik ausgelegtem Gold, auf dem einige kostbare Humpen aus venetianischem Glas standen und ein Becher aus dunkelgeädertem Onyx. Die seidene Bettdecke war mit bleichen Mohnblumen bestickt, als seien sie der müden Hand des Schlafes entfallen, und schlankes Ried aus gerilltem Elfenbein trug den samtenen Betthimmel, von dem große Büschel von Straußenfedern wie ein weißer Schaum zu dem bleichen Silber der gegitterten Decke emporsprangen. Ein lachender Narziß in grüner Bronze hielt einen polierten Spiegel über seinen Kopf. Auf dem Tisch stand eine flache Schüssel aus Amethyst.
Draußen konnte er den hohen Bau des Domes sehen, der wie ein Scheingebilde über den schattenversunkenen Häusern emporragte, und die müden Schildwachen, die auf der nebligen Terrasse am Fluß auf und ab gingen. Weit entfernt sang eine Nachtigall in einem Obstgarten. Ein leiser Jasminduft kam durch das offne Fenster. Er strich seine braunen Locken aus der Stirn, nahm eine Laute und ließ seine Finger über die Saiten gleiten. Seine schweren Augenlider sanken, und eine seltsame Erschlaffung überkam ihn. Noch nie hatte er bisher so eindringlich oder mit einer solchen köstlichen Freude den Zauber und das Geheimnis schöner Dinge empfunden.
Als es von dem Glockenturm Mitternacht schlug, klingelte er, und seine Pagen traten ein und entkleideten ihn mit großer Feierlichkeit, indem sie Rosenwasser über seine Hände gossen und Blumen auf sein Kissen streuten. Wenige Minuten, nachdem sie das Zimmer verlassen hatten, schlief er ein.
Und als er schlief, träumte er einen Traum, und dieses war sein Traum:
Er glaubte, er stände in einer langen, niedrigen Dachstube inmitten des Schwirrens und Rasselns vieler Webstühle. Ein dürftiges Tageslicht drang durch die vergitterten Fenster und zeigte ihm die mageren Gestalten der Weber, die sich über ihre Gehäuse beugten. Bleiche, krank aussehende Kinder krochen über die schweren Querbalken. Wenn die Weberschiffchen durch die Kette schossen, dann hoben sie die schweren Laden hoch, und wenn die Schiffchen hielten, dann ließen sie die Laden fallen und preßten die Fäden zusammen. Ihre Gesichter waren eingefallen vom Nahrungsmangel, und ihre dünnen Hände bebten und zitterten. Einige abgehärmte Frauen saßen an einem Tisch und nähten. Ein schrecklicher Geruch erfüllte den Raum. Die Luft war verdorben und drückend, und die Wände tropften und strömten von Feuchtigkeit.
Der junge König trat zu einem der Weber hin, blieb bei ihm stehen und beobachtete ihn.
Aber der Weber blickte ihn ärgerlich an und sagte: »Warum beobachtest du mich? Bist du ein Spion, den unser Meister über uns gesetzt hat?«
»Wer ist dein Meister?« fragte der junge König.
»Unser Meister?« rief der Weber bitter. »Er ist ein Mann, wie ich auch. Es gibt tatsächlich nur einen Unterschied zwischen uns, nämlich, daß er feine Kleider trägt, und ich in Lumpen gehe, und daß, während ich elend vor Hunger bin, er nicht wenig durch zu reichliches Essen leidet!«
»Das Land ist frei,« sagte der junge König, »und du bist keines Mannes Sklave.«
»Im Kriege«, antwortete der Weber, »macht der Starke den Schwachen zum Sklaven, und im Frieden macht der Reiche den Armen zum Sklaven. Wir müssen arbeiten, um zu leben, und sie geben uns so niedrige Löhne, daß wir sterben. Den ganzen Tag über quälen wir uns für sie ab, und sie sammeln das Gold in ihren Schatzkammern. Unsere Kinder siechen vor der Zeit dahin, und die Gesichter derer, die wir lieben, werden hart und häßlich. Wir keltern die Trauben, und die andern trinken den Wein. Wir säen das Korn, und unser eigener Tisch ist leer. Wir tragen Ketten, wenn auch keiner sie sieht, und sind Sklaven, obgleich die Menschen uns frei nennen.«
»Ist das so mit allen?« fragte er.
»Es ist so mit allen,« antwortete der Weber, »mit den Jungen sowohl wie mit den Alten, mit den Frauen sowohl wie mit den Männern, mit den kleinen Kindern sowohl wie mit denen, die hochbejahrt sind. Die Kaufleute schinden uns, und wir müssen aus Not ihren Befehlen gehorchen. Der Priester fährt vorüber und betet seinen Rosenkranz, und niemand kümmert sich um uns. Durch unsere lichtlosen Gassen kriecht die Armut mit ihren hungrigen Augen, und das Laster mit seinem geschwollenen Gesicht folgt ihr auf dem Fuße. Elend weckt uns auf am Morgen, und Schande sitzt bei uns am Abend. Aber was sind diese Dinge für dich? Du bist keiner von uns. Dein Gesicht ist zu glücklich.« Und er wandte sich finster von ihm ab und warf das Schiffchen in den Webstuhl, und der König sah, daß es mit goldenen Fäden gefüllt war.
Da überkam ihn ein großer Schrecken, und er fragte den Weber: »Was ist das für ein Kleid, das du webst?«
»Es ist das Krönungskleid des jungen Königs,« antwortete er; »was kümmert das dich?«
Und der junge König stieß einen lauten Schrei aus und erwachte, und siehe, er befand sich in seinem eigenen Zimmer, und durch das Fenster sah er den großen honigfarbenen Mond am dunklen Himmel hängen.
Und er schlief wieder ein und träumte, und dies war sein Traum:
Er glaubte, er läge auf dem Verdeck einer riesigen Galeere, die von hundert Sklaven gerudert wurde. Auf einem Teppich neben ihm saß der Herr der Galeere. Er war schwarz wie Ebenholz, und sein Turban war von roter Seide. Große silberne Ohrringe zogen die dicken Ohrläppchen herab, und in seiner Hand hatte er eine elfenbeinerne Wage.
Die Sklaven waren nackt bis auf ein zerfetztes Lendentuch, und jedermann war mit seinem Nachbar zusammengekettet. Die heiße Sonne brannte grell auf sie herab, und die Neger liefen den Gang hinauf und hinunter und schlugen sie mit Lederpeitschen. Die Sklaven streckten ihre mageren Arme aus und zogen die schweren Ruder durch das Wasser. Der salzige Schaum floß von den Schaufeln.
Schließlich erreichten sie eine kleine Bucht und begannen zu loten. Ein leichter Wind wehte vom Ufer und überzog das Verdeck und das große Lateinsegel mit seinem roten Staub. Drei Araber, die auf wilden Eseln saßen, ritten hervor und warfen Speere nach ihnen. Der Herr der Galeere nahm einen bemalten Bogen in seine Hand und schoß einen von ihnen in die Kehle. Er fiel schwer in die Brandung, und seine Gefährten galoppierten davon. Eine in einen gelben Schleier gehüllte Frau folgte langsam auf einem Kamel und sah sich dann und wann nach dem Toten um.
Sobald sie Anker geworfen und das Segel eingezogen hatten, gingen die Neger unter Deck und zogen eine lange Strickleiter herauf, die schwer mit Blei belastet war. Der Herr der Galeere warf sie über Bord und befestigte die Enden an zwei eisernen Pfosten. Dann ergriffen die Neger den jüngsten der Sklaven, schlugen seine Fesseln ab, füllten seine Nasenlöcher und seine Ohren mit Wachs und befestigten einen schweren Stein an seinem Leib. Müde kroch er die Leiter hinab und verschwand in der See. Ein paar Blasen stiegen auf, wo er versank. Einige von den andern Sklaven blickten neugierig über die Bordseite. Am Bug der Galeere saß ein Haifischbeschwörer und schlug einförmig auf eine Trommel. Nach einiger Zeit kam der Taucher aus dem Wasser empor und hing keuchend an der Leiter mit einer Perle in seiner rechten Hand. Die Neger entrissen sie ihm und stießen ihn wieder hinab. Die Sklaven schliefen an ihren Rudern ein.
Wieder und wieder tauchte er auf, und jedesmal brachte er eine schöne Perle empor. Der Herr der Galeere wog sie und steckte sie in eine kleine Tasche aus grünem Leder.
Der junge König versuchte zu sprechen, aber seine Zunge schien ihm am Gaumen zu kleben, und seine Lippen verweigerten den Dienst. Die Neger schwatzten miteinander und begannen über eine Schnur glänzender Perlen zu streiten. Zwei Kraniche flogen im Kreise um das Schiff.
Dann kam der Taucher zum letzten Mal empor, und die Perle, die er mitbrachte, war schöner als alle Perlen des Ormuzd, denn sie war geformt wie der Vollmond und weißer als der Morgenstern. Aber des Sklaven Gesicht war seltsam bleich, und als er auf das Verdeck fiel, strömte ihm Blut aus Nase und Ohren. Er bebte noch eine Weile, dann war er still. Die Neger zuckten ihre Achseln und warfen die Leiche über Bord.
Aber der Herr der Galeere lachte. Er streckte seine Hand aus, nahm die Perle, und als er sie sah, drückte er sie gegen seine Stirn und verneigte sich. »Sie soll für das Zepter des jungen Königs sein,« sagte er und gab den Negern ein Zeichen, den Anker zu lichten.
Doch als der junge König dies hörte, stieß er einen lauten Schrei aus und erwachte. Und durch das Fenster sah er die langen, grauen Finger der Dämmerung nach den verschwindenden Sternen greifen.
Und er schlief wieder ein und träumte, und dies war sein Traum:
Er glaubte, er wanderte durch ein dunkles Gehölz, das mit seltsamen Früchten und mit schönen giftigen Blumen behangen war. Die Nattern zischten ihn an, als er vorüber kam, und die farbigen Papageien flogen schreiend von Zweig zu Zweig. Riesige Schildkröten lagen schlafend auf dem heißen Schlamm. Die Bäume waren voll von Affen und Pfauen.
Weiter und weiter ging er durch das Gehölz, bis er den Rand erreichte, und da sah er eine unendliche Menschenmenge im Bett eines ausgetrockneten Flusses arbeiten. Sie schwärmten die Klippen herauf wie Ameisen. Sie gruben tiefe Löcher in den Grund und stiegen in sie hinab. Einige zerschlugen die Felsen mit schweren Hacken, andere tappten im Sand umher. Sie rissen den Kaktus mit den Wurzeln heraus und zertraten seine scharlachroten Blüten. Sie eilten umher, riefen sich zu, und keiner war müßig.
Aus dem Dunkel einer Höhle beobachteten sie der Tod und die Habgier, und der Tod sagte: »Ich bin müde; gib mir ein Drittel von ihnen und laß mich weitergehen.«
Aber die Habgier schüttelte ihren Kopf. »Sie sind meine Diener,« antwortete sie.
Und der Tod fragte sie: »Was hast du in deiner Hand?« »Ich habe drei Getreidekörner,« sagte sie; »was ist das für dich?«
»Gib mir eins davon,« rief der Tod, »ich will es in meinen Garten pflanzen; nur eins, und ich werde weggehen.«
»Ich will dir gar nichts geben,« sagte die Habgier und steckte ihre Hand in die Falten ihres Gewandes.
Aber der Tod lachte. Er nahm einen Becher, tauchte ihn in eine Wasserpfütze, und aus dem Becher entstieg Schüttelfrost. Der schritt durch die große Menge, und ein Drittel lag tot da. Ein kalter Nebel folgte ihm, und die Wasserschlangen liefen ihm zur Seite.
Als nun die Habgier sah, daß ein Drittel der Menge tot war, schlug sie sich an die Brust und weinte. Sie schlug ihren dürren Busen und schrie laut. »Ein Drittel meiner Diener hast du erschlagen,« rief sie, »mach dich fort. Es ist Krieg in den Bergen der Tatarei und die Könige beider Lager rufen nach dir. Die Afghanen haben den schwarzen Stier geschlachtet und marschieren in die Schlacht. Sie haben mit ihren Speeren auf die Schilder geschlagen und ihre eisernen Helme aufgesetzt. Was kann dir mein Tal sein, daß du dich darin aufhältst? Geh deiner Wege und komm nie wieder hierher.«
»Nein,« sagte der Tod, »solange du mir kein Samenkorn gegeben hast, werde ich nicht fortgehen.«