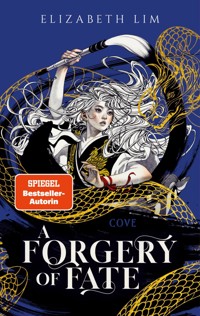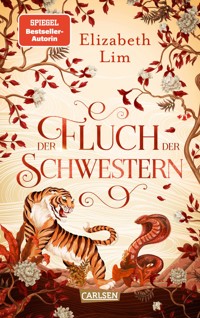Ein Kleid aus Seide und Sternen: Beide High-Fantasy-Liebesromane im Sammelband! (Ein Kleid aus Seide und Sternen) E-Book
Elizabeth Lim
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine atmosphärische Fantasy-Welt und eine umwerfende Liebesgeschichte. Mulan trifft auf Project Runway! Maia Tamarin träumt davon, die beste Schneiderin des Reiches zu werden. Sie lernt diese Kunst von ihrem Vater und ist sehr begabt, aber als Mädchen ist ihr die Ausübung dieses Berufes untersagt. Als der Kaiser einen Wettbewerb um den Posten des Hofschneiders ausruft, fasst sie einen gewagten Plan: Verkleidet als Junge reist sie unter dem Namen ihres Bruders an den Hof, um für ihren Traum zu kämpfen. Unter den zwölf Schneidern, die sich bewerben, herrscht hohe Konkurrenz, das Leben am Hof ist von Intrigen bestimmt – und keiner darf Maias Geheimnis erfahren, denn dann erwartet sie der Tod. Doch schon bald zieht sie die Aufmerksamkeit des geheimnisvollen Magiers Edan auf sich: Er scheint ihre Verkleidung zu durchschauen ... Schließlich schafft es Maia, alle Aufgaben zu bewältigen: Sie näht drei magische Kleider aus dem Blut der Sterne, dem Lachen der Sonne und den Tränen des Mondes. Doch der Preis dafür ist hoch: Der Dämon Bandur bekommt immer mehr Gewalt über sie, und schleichend verwandelt sich auch Maia in einen Dämon. Zuerst versucht sie, ihren Geliebten zu schützen und hält es vor ihm geheim. Doch wenn sie seine Hilfe annimmt, kann sie vielleicht den bösen Mächten noch entkommen … Ein Wettkampf, eine gefährliche Reise, zauberhafte Kleider – und eine große Liebe. Elizabeth Lim entführt ihre Leserinnen und Leser in diesem Zweiteiler in eine Welt voller Magie und Abenteuer, die an das alte China erinnert! »Der gnadenlose Konkurrenzkampf einer Modelshow, kombiniert mit den aufregenden Ereignissen einer epischen Queste – hier wird eine umwerfend abenteuerliche Atmosphäre erschaffen!« The Washington Post »Was für ein umwerfender Roman! Immer, wenn ich dachte, ich wüsste, was als nächstes kommt, war ich im Irrtum. Eine atemlose Lektüre.« Tamora Pierce, New-York-Times-Bestseller-Autorin »Ein magisches Abenteuer, das süchtig macht!« School Library Journal
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1039
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Elisabeth Lim
Ein Kleid aus Seide und Sternen: Die Dilogie
Aus dem Englischen von Barbara Imgrund
Ein Mädchen namens Maia, das vom Beruf des kaiserlichen Hofschneiders träumt, obwohl dieser nur Männern vorbehalten ist. Drei magische Kleider, die aus dem Blut der Sterne, dem Lachen der Sonne und den Tränen des Mondes gewirkt sind. Und der geheimnisvoller Magier Edan, der Maia unendlich fasziniert … Entdecke eine neue, atmosphärische Fantasy-Welt, die an das alte China und Japan erinnert, und eine umwerfende Liebesgeschichte!
Diese E-Box enthält beide Bände der New-York-Times- und Spiegel-Bestseller-Serie EIN KLEID AUS SEIDE UND STERNEN:Band 1: Ein Kleid aus Seide und SternenBand 2: Bestickt mit den Tränen des Mondes
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Band 1: Ein Kleid aus Seide und Sternen
Band 2: Bestickt mit den Tränen des Mondes
Viten
Für Adrian,
der mein Leben
auf die bestmögliche aller Arten
verändert hat
Bittet mich, das feinste Garn, den feinsten Faden zu spinnen, und ich tue es schneller als jeder andere – selbst mit geschlossenen Augen. Doch bittet mich, eine Lüge zu erzählen, und ich werde stammeln und ins Stocken geraten, wenn ich sie mir ausdenken muss.
Ich hatte nie ein Talent, Geschichten zu spinnen.
Mein Bruder Keton weiß das besser als jeder andere. Er glaubt mir, auch wenn er ein paarmal seine Augenbrauen hochzieht, während ich ihm alles erzähle – von den drei nahezu unlösbaren Aufgaben, die mir gestellt wurden, von dem Dämon und den Geistern, denen ich auf meiner Reise begegnet bin, und von dem Zauber, der unseren Kaiser umgab.
Baba, mein Vater, glaubt mir nicht. Er sieht durch die Schatten, hinter denen ich mich verstecke, sieht, dass meine Augen trotz des Lächelns, das ich Keton schenke, rot und entzündet sind. Geschwollen vom stunden-, ja tagelangen Weinen. Was Baba nicht sehen kann: Mein Herz ist verhärtet, obwohl noch die Tränen auf meinen Wangen trocknen.
Ich fürchte mich davor, zum Ende meiner Geschichte zu kommen, denn es ist voller Knoten, die abzuschneiden ich nicht den Mut hatte. Ferne Trommeln dröhnen. Sie werden mit jeder Sekunde lauter, eine irritierende Erinnerung, wie wenig Zeit mir bleibt, um meine Wahl zu treffen.
Wenn ich zurückgehe, lasse ich hinter mir, wer ich war. Ich werde meine Familie nie wiedersehen, nie mehr mein Gesicht im Spiegel betrachten und nie mehr wird jemand meinen Namen rufen.
Aber ich würde die Sonne und den Mond und die Sterne aufgeben, wenn ich ihn dadurch retten könnte.
Ihn – den Jungen ohne Namen, der tausend Namen hat. Den Jungen, der das Blut der Sterne getrunken hat.
Den Jungen, den ich liebe.
TEIL EINSDIE PRÜFUNG
KAPITEL EINS
Ich hatte einmal drei Brüder.
Finlei war der älteste – der mutige. Nichts machte ihm Angst, weder Spinnen noch Nadeln noch eine Tracht Prügel mit Babas Spazierstock. Er war der Schnellste von uns vier Geschwistern, flink genug, um eine Fliege nur mit dem Daumen und einem Fingerhut zu fangen. Doch mit seiner Unerschrockenheit ging die Sehnsucht nach Abenteuern einher. Er verabscheute es, in unserer Werkstatt zu arbeiten, das kostbare Tageslicht mit dem Nähen von Kleidern und Ausbessern von Hemden vergeuden zu müssen. Und er ging achtlos mit der Nadel um, hatte aufgrund kleiner Stichwunden ständig die Finger verpflastert, und seine Nähte waren unregelmäßig. Ich trennte sie immer wieder auf und setzte sie neu, um Finlei vor Babas Standpauken zu bewahren.
Finlei besaß nicht die Geduld, um ein Schneider wie Baba zu werden.
Sendo besaß Geduld, aber nicht fürs Nähen. Mein zweiter Bruder war der Poet in der Familie, und das einzige Spinnen, das er liebte, war das Spinnen von Geschichten, besonders über das Meer. Er erzählte in solch vortrefflichen Einzelheiten von den schönen Gewändern, die Baba nähen konnte, dass alle Damen in der Stadt lautstark danach verlangten – nur um zu erfahren, dass sie gar nicht existierten.
Zur Strafe hieß Baba ihn auf dem Pier hinter unserer Werkstatt Fäden aus den Kokons der Seidenraupen zupfen. Oft stahl ich mich hinaus, um mich zu ihm zu setzen und seinen Geschichten über all das zu lauschen, was hinter diesem endlosen Horizont aus Wasser lag.
»Welche Farbe hat das Meer?«, fragte Sendo mich dann.
»Es ist blau, Dummkopf, was sonst?«
»Wie willst du die beste Schneiderin in A’landi werden, wenn du keine Farben unterscheiden kannst?« Sendo schüttelte den Kopf und wies auf das Wasser. »Schau noch einmal hin. Schau in die Tiefe.«
»Saphir«, sagte ich, während ich die Wellenberge und -täler des Ozeans ins Auge fasste. Das Wasser funkelte. »Saphir, wie die Steine, die Lady Tainak um den Hals trägt. Aber es ist auch ein Hauch von Grün dabei … Jadegrün. Und die Schaumkronen sind wie Perlen.«
Sendo lächelte. »Schon besser.« Er legte mir den Arm um die Schultern und zog mich an sich. »Eines Tages werden wir zur See fahren, du und ich. Und du wirst das Blau der ganzen Welt sehen.«
Um Sendos willen wurde Blau meine Lieblingsfarbe. Es bemalte jeden Morgen das Weiß meiner Wände, wenn ich mein Fenster öffnete und das Meer im Sonnenlicht glitzern sah. In Saphir- oder Himmelblau. Azurblau. Indigo. Sendo schulte meine Augen darin, die Schattierungen der Farben zu erkennen, sie vom dunkelsten Braun bis zum hellsten Rosa schätzen zu lernen. Zu entdecken, dass Licht etwas tausendfach brechen und zu etwas anderem machen konnte.
Sendos Herz war für die See gemacht, nicht dafür, ein Schneider wie Baba zu werden.
Keton war mein dritter Bruder, und er stand mir vom Alter her am nächsten. Seine Lieder und Witze brachten alle zum Lachen, gleichgültig, in welcher Stimmung wir waren. Er bekam immer Schwierigkeiten, weil er unsere Seide grün statt purpurn färbte, weil er achtlos mit schmutzigen Sandalen auf frisch gestärkte Kleider stieg, weil er vergaß, die Maulbeerbäume zu gießen, und weil er nie ein Garn spann, das fein genug war, dass Baba es zu einem Pullover hätte verstricken können. Geld rann ihm wie Wasser durch die Finger. Aber Baba liebte ihn am meisten – obwohl Keton nicht diszipliniert genug war, um Schneider zu werden.
Dann war da noch ich – Maia. Die folgsame Tochter. Meine früheste Erinnerung ist, dass ich stillvergnügt bei Mama saß, die am Spinnrad arbeitete, und Finlei, Sendo und Keton lauschte, die draußen spielten, während Baba mir beibrachte, Mamas Garn aufzurollen, damit es sich nicht verknotete.
Mein Herz schlug tatsächlich fürs Schneidern: Ich war imstande, mit Nadel und Faden umzugehen, bevor ich gehen, und eine Naht aus perfekten Stichen zu setzen, bevor ich sprechen konnte. Ich liebte das Nähen und freute mich, Babas Handwerk zu erlernen, anstatt mit meinen Brüdern nach draußen zu gehen. Außerdem verfehlte ich immer mein Ziel, wenn Finlei mir das Boxen und den Umgang mit Pfeil und Bogen beibringen wollte. Auch wenn ich Sendos Märchen und Geistergeschichten regelrecht aufsaugte, hatte ich selbst nie etwas zu erzählen. Und ich fiel immer auf Ketons Streiche herein, egal, wie oft meine älteren Brüder mich davor warnten.
Baba sagte stolz, ich sei mit einer Nadel in der einen Hand und einer Schere in der anderen zur Welt gekommen. Und dass ich, wenn ich nicht als Mädchen geboren worden wäre, vielleicht der größte Schneider von A’landi geworden wäre, zu dem die Kaufleute von einer Küste des Kontinents zur anderen strömten.
»Der Wert eines Schneiders bemisst sich nicht nach seinem Ruhm, sondern nach dem Glück, das er beschert«, sagte Mama, als sie merkte, wie enttäuscht ich über Babas Worte war. »Du wirst die Nähte unserer Familie zusammenhalten, Maia. Kein anderer Schneider auf der Welt kann das.«
Ich erinnere mich, dass ich sie anstrahlte. Damals war alles, was ich mir wünschte, dass meine Familie glücklich war und beisammenblieb – für immer.
Aber dann starb Mama, und alles änderte sich.
Wir lebten damals in Gangsun, einer bedeutenden Stadt an der Großen Gewürzstraße, und unser Laden erstreckte sich über einen halben Block. Baba war ein angesehener Schneider und im südlichen A’landi bekannt für seine schönen Kleider. Doch es kamen schlechte Zeiten und der Tod meiner Mutter war eine erste heftige Erschütterung von Babas starkem Willen.
Er begann zu trinken – um seinen Kummer zu ersäufen, wie er sagte. Das hielt nicht lange an – in all seiner Trauer verschlechterte sich Babas Gesundheitszustand, bis er den Branntwein nicht mehr vertrug. Er kehrte zu seiner Arbeit im Laden zurück, doch er wurde nie wieder der Alte.
Die Kunden bemerkten, dass Babas Fingerfertigkeit nachließ, und sprachen meine Brüder darauf an. Finlei und Sendo sagten es ihm nie; sie hatten nicht das Herz dazu. Aber einige Jahre vor dem Fünfwinterkrieg, als ich zehn Jahre alt war, überredete Finlei Baba dazu, Gangsun zu verlassen und in ein Haus mit Ladengeschäft nach Port Kamalan zu ziehen, einer kleinen Küstenstadt am Rande der Handelsstraße. Die frische Seeluft würde Baba guttun, behauptete er steif und fest.
Unser neues Zuhause lag an der Ecke der Yanamer- und der Tonga-Straße, gegenüber einem Laden, der so lange handgezogene Nudeln herstellte, dass man sich an einer allein satt essen konnte, und einer Bäckerei, die die besten gedämpften Teigtaschen und Milchbrötchen der Welt buk – so schmeckten sie jedenfalls für mich und meine Brüder, wenn wir Hunger hatten, und das hatten wir oft. Aber was ich am meisten liebte, war der herrliche Ausblick aufs Meer. Manchmal, wenn ich zusah, wie sich die Wellen an den Piers brachen, betete ich insgeheim, dass die See Babas gebrochenes Herz heilen möge – so wie sie langsam meines heilte.
Das Geschäft lief am besten im Sommer und Winter, wenn all die Karawanen, die auf der Großen Gewürzstraße gen Osten und Westen unterwegs waren, in Port Kamalan haltmachten, um sich unseres gemäßigten Klimas zu erfreuen. Der kleine Laden meines Vaters war angewiesen auf einen stetigen Nachschub an Indigo, Safran, Ocker zum Färben der Stoffe. Es war eine Kleinstadt, wir schneiderten also nicht nur Kleidung, sondern verkauften auch Stoffe und Garne. Es war schon lange her, dass mein Vater eine Robe genäht hatte, die einer edlen Dame würdig war, und als der Krieg begann, war ohnehin wenig auf Bestellung zu schneidern.
Das Unglück folgte uns in unser neues Zuhause. Port Kamalan war so weit von der Hauptstadt entfernt, dass ich dachte, meine Brüder würden niemals in den Bürgerkrieg, der A’landi verheerte, einberufen werden. Doch die Feindseligkeiten zwischen dem jungen Kaiser Khanujin und dem Shansen, dem mächtigsten Kriegsherrn des Landes, wurden keineswegs beigelegt, und so brauchte der Kaiser noch mehr Männer, die in seiner Armee kämpfen sollten.
Finlei und Sendo waren volljährig, daher wurden sie als Erste eingezogen. Ich war damals jung genug, um die Vorstellung, in den Krieg zu ziehen, romantisch zu finden. Zwei Brüder zu haben, die Soldat wurden, fühlte sich ehrenvoll an.
Einen Tag bevor sie uns verließen, war ich draußen und bemalte eine Bahn weißer Baumwolle. Wegen der Pfirsichblüten, die an der Yanamer-Straße wuchsen, musste ich niesen, und dabei verschüttete ich den letzten Rest von Babas teurem Indigo über meinen Rock.
Finlei lachte und wischte mir ein paar kleine Farbspritzer von der Nase.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte er, während ich verzweifelt möglichst viel von der Farbe zu retten versuchte.
»Sie kostet achtzig Jen pro Unze! Und wer weiß schon, wann die Farbhändler wiederkommen?«, murmelte ich und rieb weiter an meinem Rock herum. »Es wird allmählich zu heiß, um auf der Gewürzstraße zu reisen.«
»Dann besorge ich dir unterwegs welchen«, erwiderte Finlei. Mit den Fingerspitzen drehte er mein Kinn zu sich. »Ich werde ganz A’landi sehen, wenn ich Soldat bin. Vielleicht kehre ich ja als General zurück.«
»Ich hoffe doch, dass du nicht so lange wegbleibst!«, rief ich.
Finleis Gesicht wurde ernst. Seine Augen wirkten jetzt schwarz, und er schob mir eine Strähne meines windzerzausten Haars aus dem Gesicht. »Pass auf dich auf, Schwester«, sagte er, und in seiner Stimme schwang sowohl Humor als auch Traurigkeit mit. »Arbeite nicht so hart, damit du …«
»… nicht der Drachen wirst, der niemals fliegt«, vollendete ich den Satz für ihn. »Ich weiß.«
Finlei berührte meine Wange. »Pass auch auf Keton auf. Sorge dafür, dass er nicht in Schwierigkeiten gerät.«
»Und achte auf Baba«, ergänzte Sendo, der hinter mir auftauchte. Er hatte eine Blüte von einem der Bäume vor unserem Laden gepflückt und steckte sie mir hinters Ohr. »Und übe dich in Kalligrafie. Ich komme bald wieder, um zu sehen, ob sich deine Handschrift verbessert hat.« Sendo fuhr mir durchs Haar. »Du bist jetzt die Herrin des Hauses.«
Ich beugte pflichtbewusst den Kopf. »Ja, Brüder.«
»Ihr tut ja so, als wäre ich vollkommen nutzlos«, mischte sich plötzlich Keton ein. Da schrie Baba, er solle seine Haushaltsarbeiten zu Ende bringen, und Keton zuckte zusammen.
Ein Lächeln breitete sich über Finleis ernstes Gesicht aus. »Kannst du uns das Gegenteil beweisen?«
Keton stemmte empört die Hände in die Hüften, und wir lachten alle.
»Wir werden mit der Armee an ferne Orte kommen«, sagte Sendo und legte mir die Hand auf die Schulter. »Was soll ich dir mitbringen? Vielleicht Farben aus West-Gangseng? Oder Perlen aus dem Hoheitlichen Hafen?«
»Nein, nein«, antwortete ich. »Kommt einfach nur wohlbehalten wieder heim. Ihr beide.« Doch dann zögerte ich.
Sendo stupste mich an. »Was ist, Maia?«
Meine Wangen brannten. Ich schlug die Augen nieder und blickte auf meine Hände. »Wenn ihr Kaiser Khanujin sehen solltet«, begann ich langsam, »dann zeichnet sein Porträt für mich, in Ordnung?«
Finleis Schultern bebten vor Heiterkeit. »Also hast du von den Mädchen im Ort gehört, wie gut er aussieht? Jede von ihnen hat nichts anderes im Sinn, als eine der kaiserlichen Konkubinen zu werden.«
Ich war so verlegen, dass ich ihn nicht ansehen konnte. »Ich habe kein Interesse daran, eine Konkubine zu werden.«
»Du willst nicht in einem seiner vier Paläste leben?«, fragte Keton verächtlich. »Ich habe gehört, dass er einen für jede Jahreszeit hat.«
»Keton, das reicht«, tadelte ihn Sendo.
»Mir sind seine Paläste egal«, erwiderte ich und wandte mich von meinem jüngsten Bruder zu Sendo. Seine Augen glänzten vor Sanftmut – er war immer mein Lieblingsbruder gewesen, und ich wusste, dass er es verstehen würde. »Ich will wissen, wie er aussieht, sodass ich eines Tages seine Schneiderin werden kann. Eine kaiserliche Schneiderin.«
Keton verdrehte die Augen. »Das ist genauso wahrscheinlich, wie seine Konkubine zu werden!«
Finlei und Sendo funkelten ihn finster an.
»Also gut«, versprach Sendo und tippte auf die Sommersprossen auf meiner Wange. Er und ich hatten als Einzige in der Familie Sommersprossen – das Ergebnis stundenlangen Tagträumens an der Sonne. »Ein Porträt des Kaisers für meine begabte Schwester Maia.«
Ich umarmte ihn, obwohl ich wusste, dass meine Bitte sehr albern war. Und doch hoffte ich.
Wenn ich gewusst hätte, dass dies unser allerletztes Beisammensein war, hätte ich um gar nichts gebeten.
Zwei Jahre später erhielt Baba die Nachricht, dass Finlei im Kampf gefallen war. Das kaiserliche Emblem unten auf dem Brief war so rot wie frisch vergossenes Blut und so eilig gestempelt, dass der Schriftzug von Kaiser Khanujins Namen verwischt war. Noch Monate später musste ich allein bei dem Gedanken daran weinen.
Dann, eines Nachts und ohne Vorankündigung, lief Keton weg, um sich der Armee anzuschließen. Alles, was er hinterließ, war ein rasch hingekritzelter Zettel, den er auf meine frische Wäsche gelegt hatte – er wusste, dass es das Erste wäre, was ich am Morgen nach dem Aufwachen sehen würde.
Ich bin schon zu lange nutzlos gewesen. Ich werde Sendo finden und ihn heimbringen. Kümmere Dich um Baba.
Tränen traten mir in die Augen, und ich zerknüllte das Papier in der Faust.
Was wusste Keton vom Kämpfen? Wie ich war er so spindeldürr wie Schilfrohr, kaum stark genug, sich gegen den Wind zu stemmen. Er konnte keinen Reis auf dem Markt kaufen, ohne sich betrügen zu lassen, und er versuchte immer, sich aus einem Kampf herauszureden. Wie sollte er einen Krieg überleben?
Ich war aber auch wütend – weil ich nicht mit ihm gehen konnte. Wenn Keton sich selbst für nutzlos hielt, was sollte ich erst sagen? Ich konnte nicht in der Armee kämpfen. Und trotz all der Abertausend Stunden, in denen ich mir neue Nähstiche ausdachte und Entwürfe zeichnete, um sie zu verkaufen, würde ich niemals Meisterschneider werden. Ich konnte niemals Babas Laden übernehmen. Ich war ein Mädchen. Das Beste, worauf ich hoffen konnte, war eine gute Heirat.
Baba sprach nie von Ketons Rückkehr, wollte monatelang überhaupt nicht von meinem jüngsten Bruder sprechen. Aber ich sah, dass seine Finger steif wurden – er konnte sie nicht einmal mehr weit genug spreizen, um eine Schere zu halten. Er starrte tagelang aufs Meer, während ich unseren schlecht laufenden Laden weiterführte. Es blieb mir überlassen, Aufträge an Land zu ziehen, um dafür zu sorgen, dass meine Brüder noch ein Zuhause hatten, in das sie heimkehren konnten.
Niemand hatte Bedarf an Seide und Satin, nicht, während unser Land sich von innen heraus selbst zerfleischte. Deshalb fertigte ich Hemden aus Hanf für unsere einheimischen Fischer und Leinenkleider für ihre Frauen an, und ich verspann Flachs zu Wolle und flickte die Mäntel der Soldaten, die auf der Durchreise waren. Die Fischer gaben mir Fischköpfe und Säcke voll Reis für meine Arbeit. Den Soldaten etwas zu berechnen, erschien mir nicht richtig.
Gegen Ende jedes Monats half ich den Frauen bei der Vorbereitung der Gaben für die Toten – Papierkleider, die knifflig zu nähen waren –, um sie zu Ehren der Ahnen vor den Gebetsschreinen zu verbrennen. Ich nähte Papier in die Schuhe von durchziehenden Händlern und Schnüre mit Münzen in ihre Gürtel, damit die Taschendiebe das Nachsehen hatten. Ich reparierte sogar Amulette für Reisende, die mich darum baten, obwohl ich nicht an Magie glaubte. Damals noch nicht.
An Tagen, an denen es keine Aufträge gab und unsere Vorräte an Weizen und Reis bedrohlich zur Neige gingen, holte ich meinen Rattankorb heraus und gab ein paar Garnspulen, eine Bahn Musselin und eine Nadel hinein. Ich streifte durch die Straßen, ging von Tür zu Tür und fragte, ob jemand etwas auszubessern hatte.
Doch nur wenige Schiffe legten im Hafen an. Staub und Schatten fegten durch die leeren Straßen.
Die fehlenden Aufträge machten mir nicht so sehr zu schaffen wie die peinlichen Begegnungen, die ich auf dem Heimweg über mich ergehen lassen musste. Früher war ich sehr gern in die Bäckerei gegenüber unserer Werkstatt gegangen, doch das änderte sich während des Krieges. Denn jetzt wartete Calu, der Sohn des Bäckers, auf mich, wenn ich in die Yanamer-Straße zurückkehrte.
Ich mochte Calu nicht. Nicht, weil er nicht im Heer diente – er konnte das gar nicht, denn er war durch die kaiserliche Gesundheitsprüfung gefallen. Ich mochte ihn nicht, weil er es sich, seitdem ich sechzehn geworden war, in den Kopf gesetzt hatte, dass ich seine Frau werden würde.
»Ich sehe es gar nicht gern, dass du so um Arbeit bettelst«, sagte Calu eines Tages. Er winkte mich in die Bäckerei seines Vaters. Der Duft der Brote und Kuchen waberte aus der Tür. Mir lief das Wasser im Mund zusammen beim Geruch von Hefe, fermentiertem Reismehl und gerösteten Erdnüssen und Sesam.
»Es ist besser, als zu verhungern.«
Er wischte sich roten Bohnenbrei von den Händen. Schweiß tropfte von seinen Schläfen in die Teigschüssel auf seinem Arbeitstisch. Normalerweise hätte ich darüber die Nase gerümpft – wenn Calus Vater gesehen hätte, wie nachlässig er war, hätte er ihm eine Strafpredigt gehalten –, aber jetzt war ich zu hungrig, als dass es mir etwas ausgemacht hätte.
»Wenn du mich heiraten würdest, müsstest du nie mehr Hunger leiden.«
Seine Dreistigkeit war mir unangenehm, und ich dachte mit Schrecken daran, wie es wäre, wenn Calu mich anfasste, wenn ich seine Kinder bekäme, wenn meine Stickrahmen verstaubten und meine Kleider klebrig von Zucker würden. Ich unterdrückte einen Schauder.
»Du hättest immer eine Menge zu essen – dein Baba auch«, versuchte es Calu noch einmal und leckte sich über die Lippen. Er lächelte; seine Zähne waren so gelb wie Butter. »Ich weiß, wie sehr du das Blätterteiggebäck meines Vaters liebst, seine gedämpften Teigtaschen mit Lotusfüllung, seine Kokosbrötchen.«
Mein Magen knurrte, aber ich wollte nicht zulassen, dass mein Hunger mein Herz überstimmte. »Bitte hör auf, mich zu fragen. Meine Antwort wird sich nicht ändern.«
Da wurde Calu zornig. »Du bist dir zu fein für mich, oder?«
»Ich muss den Laden meines Vaters führen«, versuchte ich einzulenken. »Er braucht mich.«
»Ein Mädchen führt keinen Laden«, hielt er dagegen. Dabei öffnete er den Dämpfkorb und entnahm ihm einen frischen Stapel Teigtaschen. Für gewöhnlich gab er Baba und mir einige, aber ich wusste, dass er das heute nicht tun würde. »Du magst eine gute Näherin sein – die beste im Ort –, aber wäre es nicht jetzt, da deine Brüder fort sind und für den Kaiser kämpfen, an der Zeit, vernünftig zu werden und eine Familie zu gründen?« Er griff nach meiner Hand. Seine Finger waren mehlbestäubt und feucht. »Denk an das Wohlergehen deines Vaters, Maia. Du bist selbstsüchtig. Du könntest ihm ein besseres Leben bieten.«
Getroffen machte ich mich von ihm los. »Mein Vater würde seinen Laden niemals aufgeben.«
Calu schnaubte. »Das wird er müssen, denn du kannst ihn allein nicht am Laufen halten. Du bist dünn geworden, Maia. Denk nicht, es wäre mir nicht aufgefallen.« Meine Zurückweisung machte ihn grausam, er lächelte höhnisch. »Gib mir einen Kuss, und du kriegst ein Brötchen.«
Ich reckte das Kinn. »Ich bin kein Hund.«
»Ach, jetzt bist du zu stolz zum Betteln, was? Du willst deinen Vater hungern lassen, weil du so hochnäsig …«
Ich hatte genug davon, ihm weiter zuzuhören. Ich floh aus der Bäckerei und stürmte über die Straße. Mein Magen knurrte noch immer, als ich Babas Ladentür hinter mir zuknallte. Das Schlimmste war: Ich wusste, dass ich selbstsüchtig war. Ich sollte Calu wirklich heiraten. Aber ich wollte meine Familie aus eigener Kraft retten – wie Mama es gesagt hatte.
Ich sackte gegen die Tür. Aber was, wenn ich es nicht schaffte?
Baba fand mich dort lautlos schluchzend.
»Was ist denn los, Maia?«
Ich wischte mir die Tränen ab und stand auf. »Nichts, Baba.«
»Hat Calu dich schon wieder gefragt, ob du ihn heiraten willst?«
»Wir haben nichts zu tun«, sagte ich ausweichend. »Wir …«
»Calu ist ein guter Junge«, gab Baba zurück. »Aber er ist eben nur das – ein Junge. Und deiner nicht würdig.« Er beugte sich über meinen Stickrahmen und begutachtete den Drachen, den ich gestickt hatte. Es war schwer, auf Baumwolle statt auf Seide zu arbeiten, aber ich hatte mich bemüht, jede Einzelheit herauszuarbeiten: die karpfenähnlichen Schuppen, die scharfen Klauen und dämonischen Augen. Ich sah, dass Baba beeindruckt war. »Du bist zu Höherem berufen, Maia.«
Ich wandte mich ab. »Wie könnte ich das sein? Ich bin kein Mann.«
»Wenn du es wärest, hätte man dich in den Krieg geschickt. Die Götter schützen dich.«
Ich glaubte ihm nicht, aber um seinetwillen nickte ich und trocknete meine Tränen.
Einige Wochen vor meinem achtzehnten Geburtstag erreichten uns gute Neuigkeiten: Der Kaiser kündigte einen Waffenstillstand mit dem Shansen an. Der Fünfwinterkrieg war vorüber, zumindest vorläufig.
Aber unsere Freude darüber verwandelte sich schnell in Trauer, denn eine weitere Nachricht traf ein. Eine mit einem blutroten Siegel.
Sendo war im Kampf in den Bergen gefallen, nur zwei Tage vor dem Waffenstillstand.
Baba war wie vernichtet. Er kniete eine ganze Nacht vor unserem Schrein, in den Armen die Schuhe, die Mama für Finlei und Sendo angefertigt hatte, als sie noch ganz klein waren. Ich betete nicht mit ihm. Ich war zu zornig. Wenn die Götter nur weitere zwei Tage über Sendo gewacht hätten!
Weitere zwei Tage.
»Wenigstens hat mir der Krieg nicht alle meine Söhne genommen«, sagte Baba gedrückt und klopfte mir auf die Schulter. »Wir müssen für Keton stark bleiben.«
Ja, es gab immer noch Keton. Mein jüngster Bruder kehrte einen Monat nach dem Waffenstillstand zurück. Er kam in einem Fuhrwerk an, die Beine ausgestreckt, während die Räder über die schmutzige Straße ächzten. Sein Haar war gestutzt, und er hatte so viel Gewicht verloren, dass ich ihn kaum erkannte. Aber was mich am meisten erschreckte, waren die Gespenster in seinen Augen – denselben Augen, die früher vor Witz und Schalk gefunkelt hatten.
»Keton!«, rief ich.
Ich lief mit offenen Armen auf ihn zu, und Tränen des Glücks strömten über meine Wangen. Bis mir klar wurde, warum er so dasaß, an Reis- und Mehlsäcke gelehnt.
Vor Trauer schnürte es mir die Kehle zu. Mein Bruder konnte nicht mehr gehen.
Ich kletterte auf das Fuhrwerk und schlang meine Arme um ihn. Er umarmte mich, aber die Leere in seinen Augen war nicht zu übersehen.
Der Krieg hatte uns viel genommen. Zu viel. Ich hatte gedacht, dass mein Herz nach Finleis, dann nach Sendos Tod abgehärtet wäre – um stark zu sein für Baba. Aber ein Teil von mir zerbrach an dem Tag, als Keton heimkehrte.
Ich floh auf mein Zimmer und kauerte mich an die Wand. Ich nähte, bis meine Finger bluteten, bis das Schluchzen, das mich schüttelte, im Schmerz unterging. Doch bis zum nächsten Morgen hatte ich mich wieder zusammengeflickt. Ich musste für Baba sorgen. Und jetzt auch für Keton.
Fünf Winter, und ich war erwachsen geworden, ohne es zu wissen. Ich war nun so groß wie Keton und mein Haar so glatt und schwarz wie das meiner Mutter. Andere Familien mit Mädchen meines Alters heuerten Kupplerinnen an, die Ehemänner für sie suchen sollten. Meine Familie hätte das auch getan, wäre Mama am Leben gewesen und Baba noch ein erfolgreicher Schneider. Aber diese Tage waren lange vorbei.
Als der Frühling kam, ließ der Kaiser verkünden, dass er die Tochter des Shansen, Lady Sarnai, zur Frau nehmen werde. A’landis blutigster Krieg würde mit einer Hochzeit zwischen Kaiser Khanujin und der Tochter seines Feindes zu Ende gehen. Baba und ich brachten es nicht übers Herz zu feiern.
Dennoch war es eine gute Nachricht. Der Frieden hing von der Harmonie zwischen dem Kaiser und dem Shansen ab. Ich hoffte, eine königliche Hochzeit würde das Zerwürfnis zwischen ihnen aus der Welt schaffen, was dann sicher wieder mehr Reisende auf die Große Gewürzstraße locken würde.
An diesem Tag bestellte ich die größte Menge Seide, die wir uns leisten konnten. Es war ein riskanter Kauf, aber ich hatte Hoffnung – bevor der Winter kam, mussten die Geschäfte einfach besser werden.
Mein Traum, Schneiderin des Kaisers zu werden, verblasste zu einer fernen Erinnerung. Unsere einzige Einkommensquelle war nun mein Geschick im Umgang mit Nadel und Faden. Ich nahm es hin, dass ich für immer in Port Kamalan bleiben würde, schicksalsergeben zurückgezogen in meine Ecke von Babas Laden.
Ich sollte unrecht behalten.
KAPITEL ZWEI
Ein Flickenteppich aus dichten grauen Wolken trieb über den Himmel. Sie waren so eng aneinandergenäht, dass ich kaum das Licht dahinter sehen konnte. Es war ein trüber Tag – sonderbar zu Beginn des Sommers –, aber es fiel kein Regen, deshalb fuhr ich in meinen morgendlichen Verrichtungen fort.
Ich trug eine Leiter unter dem Arm, die ich erklomm, um jeden einzelnen der Maulbeerbäume in unserem kleinen Garten zu inspizieren. Dünne weiße Seidenraupen fraßen an den Blättern, aber heute gab es keine Kokons, die ich hätte sammeln können. Meine kleinen Seidenraupen produzierten nicht viel im Sommer, daher war ich nicht allzu besorgt darüber, dass mein Korb leer blieb.
Im Krieg war es zu teuer gewesen, Seide zu kaufen, und unser Laden produzierte selbst zu wenig, um sie veräußern zu können, weshalb wir das meiste Geld mit Leinen und Hanf verdienten. Die Arbeit mit den rauen Stoffen hatte meine Finger- und Kunstfertigkeit weiter verfeinert. Aber jetzt, da der Krieg vorüber war, würden wir wieder mehr Seidenkleider schneidern müssen. Ich hoffte, dass meine Bestellung bald eintraf.
»Baba«, rief ich. »Ich gehe auf den Markt. Willst du irgendetwas?«
Keine Antwort. Er schlief wahrscheinlich noch. Er war lange aufgeblieben, um am Familienschrein zu beten, zum Dank für Ketons Rückkehr.
Auf unserem kleinen Markt herrschte reges Treiben, und die Krämer wollten sich nicht herunterhandeln lassen. Ich ließ mir Zeit, weil ich dachte, so könnte ich es vermeiden, einer bestimmten Person auf dem Heimweg zu begegnen. Aber wie ich befürchtet hatte, war Calu gleich zur Stelle.
»Lass mich dir helfen«, sagte er und streckte die Hand nach meinem Korb aus.
»Ich brauche keine Hilfe.«
Calu packte den Henkel und zog daran. »Würdest du bitte aufhören, so stur zu sein, Maia?«
»Vorsicht! Du wirst noch alles auf den Boden werfen.«
Sobald Calu seinen Griff lockerte, entriss ich ihm den Korb und hastete in unseren Laden. Ich schloss die Tür und begann, die Waren, die ich erstanden hatte, auszupacken: Bündel aus Leinen und Musselin, kleine Notizbücher für die Entwürfe, eine Handvoll Orangen, einen Beutel mit gelb-rosa Pfirsichen, die mir unsere Nachbarn geschenkt hatten, Lachsaugen (Babas Leibspeise), Thunfischlaich und einen kleinen Sack Reis.
Ich war so beschäftigt damit gewesen, Calu zu vertreiben, dass ich erst jetzt die Kutsche entdeckte, die auf der anderen Straßenseite stand – und den Mann, der in unserem Laden wartete.
Er war füllig und warf einen breiten Schatten. Ich ließ meinen Blick über ihn gleiten; dabei fiel mir auf, dass in der Reihe von Messingknöpfen an seinem hellblauen Seidenmantel einer fehlte. Ich neigte dazu, der Kleidung der Leute mehr Beachtung zu schenken als ihren Gesichtern.
Ich straffte die Schultern. »Guten Tag, mein Herr«, sagte ich, aber der Mann hatte es offenbar nicht eilig, mich zu begrüßen. Er war viel zu sehr darin vertieft, den Laden voller Geringschätzung in Augenschein zu nehmen. Vor Scham wurden meine Wangen heiß und kribbelten.
Auf dem Boden hinter der Ladentheke lagen Stoffe herum, und eine Bahn Baumwolle, die darauf wartete, bemalt zu werden, hing schief über dem Färbegestell. Wir hatten schon vor Jahren alle Angestellten entlassen und besaßen kein Geld, um Putzkräfte zu bezahlen. Also hatte ich einfach aufgehört, die Spinnweben in den Ecken und die Pfirsichblüten zu bemerken, die der Wind zur Tür hereingeweht und im ganzen Raum verteilt hatte.
Der Blick des Mannes kehrte endlich zu mir zurück. Ich strich mir das Haar aus den Augen und warf in dem Bemühen, vorzeigbarer zu wirken, meinen Zopf nach hinten. Dann verbeugte ich mich, als könnte mein gutes Benehmen die Unzulänglichkeiten unseres Ladens wettmachen. »Guten Tag, mein Herr«, sagte ich noch einmal. »Wie kann ich Euch helfen?«
Endlich trat der Mann auf den Tresen zu. Ein großer Jadeanhänger in der Form eines Fächers baumelte von seiner Schärpe. Dort hing auch eine gewaltige rote Troddel aus verknoteten Seidenschnüren.
Ein kaiserlicher Beamter. Doch er trug nicht den typischen graublauen Kaftan, an dem die meisten Diener des Kaisers zu erkennen waren. Nein, er war ein Eunuch.
Was suchte ein Eunuch Seiner Majestät hier bei uns?
Ich sah an ihm hoch und ließ seine hervortretenden Augen und den säuberlich gestutzten Bart, der den verächtlichen Zug um seine Lippen nicht kaschieren konnte, auf mich wirken.
Er reckte das Kinn. »Du bist die Tochter von Kalsang Tamarin.«
Ich nickte. Meine Schläfen waren noch verschwitzt vom Markt, und der Duft der gekauften Orangen reizte meinen Magen. Er knurrte. Laut.
Der Eunuch rümpfte die Nase und sagte: »Seine Kaiserliche Majestät, Kaiser Khanujin, verlangt, dass dein Vater sich im Sommerpalast einfindet.«
Verblüfft ließ ich den Korb zu Boden fallen. »Mein … mein Vater fühlt sich geehrt. Was wünscht Seine Kaiserliche Majestät von ihm?«
Der Beamte des Kaisers räusperte sich. »Deine Familie hat viele Generationen lang als Hofschneider gedient. Wir bedürfen der Dienste deines Vaters. Lord Tainak hat ihn aufs Wärmste empfohlen.«
Mein Herz hämmerte, während ich mir fieberhaft die Robe ins Gedächtnis zu rufen versuchte, die ich für Lady Tainak genäht hatte. Ach ja, es waren eine Jacke und ein Rock aus feinster Seide gewesen, mit handgemalten Kranichen und Magnolien. Die Bestellung im vergangenen Winter war ein Segen gewesen, und ich hatte den Lohn dafür gewissenhaft eingeteilt, sodass er uns wochenlang ernähren konnte.
Ich musste keine Einzelheiten wissen, um mir sicher zu sein, dass dieser Auftrag meine Familie retten würde. Mein Traum, für den Kaiser zu nähen, den ich so lange hintangestellt hatte, erwachte zu neuem Leben.
»Ah, Lady Tainaks Robe«, sagte ich und biss mir auf die Zunge, um nicht zu verraten, dass ich sie genäht hatte, nicht Baba. Ich konnte meine Aufregung und Neugier nicht zügeln. »Wozu könnte Seine Majestät wohl der Dienste meines Vaters bedürfen?«
Der Eunuch runzelte die Stirn über meine Kühnheit. »Wo ist er?«
»Herr, mein Vater ist unpässlich, aber ich werde ihm sehr gern die Anweisungen Seiner Majestät …«
»Dann will ich mit deinem Bruder sprechen.«
Ich beschloss, die Beleidigung zu ignorieren. »Mein Bruder ist erst kürzlich aus dem Fünfwinterkrieg zurückgekehrt. Er erholt sich noch.«
Der Eunuch stemmte die Hände in die Hüften. »Sag deinem Vater, dass er kommen soll, Mädchen, bevor ich die Geduld verliere und berichte, er hätte frech die Aufforderung des Kaisers missachtet.«
Ich presste die Lippen zusammen und verbeugte mich rasch. Dann lief ich davon, um Baba zu holen.
Wie üblich kniete er vor dem kleinen Schrein neben unserem Küchenherd; in der Hand hielt er einige dünne Räucherstäbchen. Er verbeugte sich dreimal, einmal vor jeder der drei Skulpturen der Muttergöttin Amana.
Mama hatte die Amana-Statuen bemalt, als ich noch klein gewesen war. Ich hatte ihr geholfen, die Kleider der Göttinnenstatuen zu entwerfen: ein Sonnen-, ein Mond- und ein Sternenkleid. Diese Statuen gehörten zu den wenigen Dingen, die uns aus Mamas Besitz geblieben waren, und Baba betete jeden Tag bis spät in die Nacht hinein zu ihnen. Er sprach nie von Mama, aber ich wusste, dass er sie schrecklich vermisste.
Ich wollte sein Gebet nicht stören, doch ich hatte keine Wahl. »Baba«, sagte ich und rüttelte an seinen mageren Schultern. »Ein kaiserlicher Beamter ist hier, der dich sehen will.«
Ich begleitete meinen Vater in den Verkaufsraum. Er war so schwach, dass er sich auf meinen Arm stützte. Er weigerte sich, einen Gehstock zu benutzen – schließlich seien es nicht seine Beine, die gebrochen seien, so sagte er.
»Meister Tamarin«, sagte der Eunuch steif. Babas Erscheinungsbild beeindruckte ihn nicht, und das zeigte er auch. »Seine Majestät bedarf der Dienste eines Schneiders. Mir wurde befohlen, Euch in den Sommerpalast zu bringen.«
Ich versuchte, nicht auf meiner Lippe zu kauen, und starrte zu Boden. Baba würde die Reise zum Sommerpalast keinesfalls schaffen, nicht in seiner Verfassung. Ich zappelte herum, weil ich schon ahnte, was Baba sagen würde, bevor er es selbst ahnte.
»Sosehr mich Eure Gegenwart auch ehrt, ich kann nicht.«
Der Eunuch rümpfte die Nase über Baba. In seiner Miene lag eine Mischung aus Ungläubigkeit und Verachtung. Ich versuchte, mir eine Bemerkung zu verkneifen, da ich doch wusste, dass ich mich nicht einmischen sollte. Doch meine Aufregung wuchs. Wir brauchten diese Chance.
»Aber ich kann«, platzte ich schließlich heraus, gerade als der Beamte des Kaisers etwas sagen wollte. »Ich verstehe mich auf das Handwerk meines Vaters. Ich war es, die Lady Tainaks Robe angefertigt hat.«
Baba drehte sich zu mir um. »Maia!«
»Ich kann nähen«, beharrte ich. »Besser als jeder andere.« Ich machte einen Schritt auf das Färbegestell zu. Im Regal darüber lagen reich bestickte Stoffbahnen, an denen ich Wochen und Monate gesessen hatte. »Seht Euch nur meine Arbeiten an …«
Baba schüttelte warnend den Kopf.
»Die Anweisungen seiner Kaiserlichen Majestät waren eindeutig«, erwiderte der Eunuch mit einem Schnauben. »Ich soll den Meisterschneider der Tamarin-Familie in den Sommerpalast bringen. Ein Mädchen kann kein Meister werden.«
Neben mir ballte Baba die Hände zu Fäusten. Er sagte in dem bestimmtesten Ton, den ich seit Monaten an ihm gehört hatte: »Und wer seid Ihr, dass Ihr mir sagen wollt, wer ein Meister meines Handwerks ist?«
Der Eunuch warf sich in die Brust. »Ich bin Minister Lorsa vom Kulturministerium Seiner Kaiserlichen Majestät.«
»Seit wann übernehmen Minister Botendienste?«
»Ihr habt eine zu hohe Meinung von Euch, Meister Tamarin«, erwiderte Lorsa kalt. »Ich bin nur zu Euch gekommen, weil Meister Dingmar in Gangsun krank ist. Eure Arbeiten mögen einst in hohem Ansehen gestanden haben, doch die Jahre, die Ihr an den Branntwein verschleudert habt, haben den guten Namen Eurer Familie beschmutzt. Wenn Lord Tainak Euch nicht empfohlen hätte, wäre ich gar nicht hier.«
Ich hielt es nicht mehr aus. »Ihr habt kein Recht, so mit meinem Vater zu sprechen.«
»Maia, Maia.« Baba legte mir eine Hand auf die Schulter. »Es sind hinten noch Kleider auszubessern.«
Das war seine Art, mich wegzuschicken. Ich knirschte mit den Zähnen und wandte mich zum Gehen, funkelte jedoch den Boten des Kaisers dabei finster an und entfernte mich so langsam wie möglich.
»Meine Kutsche wird draußen an der Yanamer-Straße warten«, sagte Lorsa. »Wenn Ihr oder Euer Sohn sich nicht bis morgen früh dort einfindet, sehe ich mich gezwungen, jemand anderem dieses großzügige Angebot zu unterbreiten. Ich habe meine Zweifel, dass Euer bescheidener Laden die Schande überleben wird, unseren Kaiser enttäuscht zu haben.«
Dann machte er auf dem Absatz kehrt und ging.
»Baba«, sagte ich und eilte zu ihm, sobald sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte. »Du kannst nicht reisen.«
»Ich kann den Befehl des Kaisers nicht ignorieren.«
»Es ist eine Aufforderung«, hielt ich dagegen. »Kein Befehl.«
»So nennen sie es. Aber ich weiß, was passieren wird, wenn wir ihr nicht Folge leisten.« Baba seufzte. »Das Gerücht wird sich verbreiten, dass wir dem Ruf des Kaisers nicht gefolgt sind. Niemand wird mehr zu uns kommen, und wir werden alles verlieren.«
Er hatte recht. Es ging nicht nur um das Geld oder die Ehre – es war eine verpflichtende Aufforderung. Wie die Musterung für den Fünfwinterkrieg.
»Jetzt, da der Krieg vorüber ist«, sagte Baba, »muss der Kaiser dem Rest der Welt zeigen, dass A’landi groß ist. Er wird das tun, indem er die Besten der Besten in seine Dienste nimmt: Musiker, Schneider und Maler. Er wird keine Ausgaben scheuen. Es ist eine Ehre, eingeladen zu werden. Eine, die ich nicht ablehnen kann.«
Ich entgegnete nichts. Baba war nicht in der Verfassung, zum Palast zu reisen, geschweige denn der neue Schneider des Kaisers zu werden. Und Keton … Keton beherrschte nicht einmal die Grundstiche, weshalb er auch keine Kleider für den kaiserlichen Hof schneidern konnte.
Aber ich? Ich wusste, dass ich es schaffen konnte. Ich wollte kaiserliche Schneiderin werden.
Ich ging in mein Zimmer und rieb mit dem Ärmel über den Spiegel, damit ich mich gut sehen konnte. So, wie ich war.
Baba sagte immer, ich käme nach Mama, nicht nach ihm. Ich hatte ihm nie geglaubt. Ich blickte auf meine gerade Nase, die großen runden Augen und vollen Lippen – ja, all das hatte ich von Mama. Aber Mama war die schönste Frau gewesen, die ich je gesehen hatte, während ich … Ich war in einem Haus voller Männer aufgewachsen und wusste nicht einmal, wie sich ein Mädchen verhielt.
Finlei hatte mich früher immer damit aufgezogen, dass ich von hinten wie Keton aussähe – dünn wie ein Junge. Die Sommersprossen in meinem Gesicht und auf den Armen machten es auch nicht besser. Mädchen sollten zierlich und blass sein. Aber vielleicht, vielleicht würde mir all das jetzt zugutekommen.
Ich konnte weder singen noch Gedichte rezitieren. Ich konnte nicht tanzen. Ich war nicht anmutig oder charmant oder raffiniert. Aber ich konnte nähen. Himmel, ich konnte nähen.
Ich musste die sein, die zum Kaiser reiste.
Als Baba zu seinen Gebeten zurückkehrte, schwärzte ich meine Finger mit Kohle aus dem Kamin und verteilte das Schwarz auf meinen Augenbrauen. Auf meinem Werktisch lag eine Schere. Ich nahm sie, zögerte aber. Meine Hände zitterten nie, wenn sie Stoff zuschnitten – ich konnte im Schlaf eine gerade Linie schneiden –, also warum zitterten sie jetzt?
Ich berührte die Spitzen meines Haars, das mir, selbst wenn es geflochten war, bis über die Hüfte reichte. Ich öffnete die Haarbänder und löste meinen Zopf. In Wellen fiel mein Haar meinen Rücken hinab und kitzelte mich.
Was ich vorhatte, war verrückt. Ich musste vernünftig sein, musste die Folgen bedenken. Aber ich hörte immerzu Minister Lorsas Worte, der zu mir sagte, ich könne nicht zum Kaiser reisen. Und die von Baba, der zu mir sagte, ich könne nicht zum Kaiser reisen.
Mein ganzes Leben lang hatte man mir gesagt, was ich nicht tun konnte, weil ich ein Mädchen war. Nun, dies war die Gelegenheit. Das Einzige, was ich tun konnte, war, sie beim Schopfe zu ergreifen.
Ich lockerte meinen Griff um die Schenkel der Schere und drückte die Klingen an meinen Nacken. Mit einer einzigen zügigen Bewegung schnitt ich mir auf Höhe der Schultern das Haar ab. Die Strähnen segelten meinen Rücken hinunter und landeten zu meinen Füßen in einem Haufen aus schwarzem Satin, der in einem Luftzug vom offenen Fenster federleicht auseinanderstob.
Meine Hände hörten zu zittern auf, und ich band mein Haar auf dieselbe Art zurück wie Keton und alle Jungen seines Alters. Eine seltsame Ruhe überkam mich, als hätte ich zusammen mit meinem Haar auch alle Ängste abgeschnitten. Ich wusste, dass das nicht stimmte, aber es war zu spät für Panik. Jetzt brauchte ich Kleider, die dazu passten.
Ich brachte Keton ein Tablett mit einer einfachen Wachskürbissuppe und gedünstetem Fisch ans Bett. Früher hatte er das Zimmer mit Finlei und Sendo geteilt. Damals war uns unser Haus klein vorgekommen. Jetzt kam es uns zu groß vor. Die Hälfte meines Zimmers war ein Lager für Stoffe und Perlen und Färbemittel … und nun hatte Keton einen ganzen Raum für sich allein.
Mein Bruder schlief. Seine Lippen waren zu einer Grimasse verzerrt, während er schnarchte. Er hatte uns gesagt, dass er keine Schmerzen habe, obwohl seine Beine gebrochen waren.
»Wie kann ich Schmerz fühlen, wenn ich meine Beine nicht mal spüren kann?«, hatte er zu scherzen versucht.
Ich stellte das Tablett ab und zog ihm die Decke bis zu den Schultern hoch. Dann griff ich in seine Schublade und nahm eine seiner Hosen heraus. Ich legte sie mir über den Arm und schickte mich an, auf Zehenspitzen hinauszuschleichen.
»Maia.« Keton regte sich.
Ich wirbelte herum. »Ich dachte, du schläfst.«
»Falsch gedacht.« Keton ließ den Kopf zurück ins Kissen sinken.
Ich setzte mich zu ihm auf die Bettkante. »Hast du Hunger? Ich habe dir Essen gebracht.«
»Du stiehlst meine Kleider«, stellte er fest und wies mit dem Kinn auf die Hose, die ich über dem Arm trug. »Was soll das?«
Ich hielt mich im Dunkel, damit er mein Haar nicht sehen konnte, und presste die Lippen aufeinander. »Vorhin war ein Beamter im Laden. Er will, dass Baba zum Sommerpalast reist, um für Kaiser Khanujin Kleider zu nähen.«
Keton schloss die Augen. Der Krieg hatte meinem jüngsten Bruder die Aufsässigkeit ausgetrieben, und er sah jetzt Jahrzehnte älter aus als seine neunzehn Jahre. »Baba hat seit Jahren nicht mehr genäht. Er kann nicht hinfahren.«
»Das wird er auch nicht«, bestätigte ich. »Ich fahre.«
Keton stemmte sich mit den Handflächen hoch. »Pest und Dämonen, Maia! Bist du verrückt? Du kannst doch nicht …«
»Ich will das nicht hören.«
Mein Bruder wurde laut. »Du kannst nicht gehen«, beharrte er. »Du bist ein Mädchen.«
»Nicht mehr.« Ich tastete nach meinem Haar. »Ich habe es satt, mir sagen zu lassen, dass ich nicht genauso viel wert bin wie ihr«, sagte ich zähneknirschend.
»Es geht nicht nur darum, gleich viel wert zu sein«, widersprach Keton und hustete in seinen Ärmel. »Es ist eine Sache der Tradition. Außerdem wäre es nicht gern gesehen, wenn ein Mädchen die Maße des Kaisers nehmen würde.«
Ich wurde gegen meinen Willen rot. »Ich werde als du hinfahren, Keton Tamarin.«
»Baba wäre nie damit einverstanden.«
»Baba muss es nicht wissen.«
Keton schüttelte den Kopf. »Und ich dachte immer, dass du die Folgsame von uns bist.« Er lehnte sich mit einem resignierten Seufzen zurück. »Es ist gefährlich.«
»Keton, bitte. Ich muss das tun. Für uns. Für …«
»Und genau deshalb solltest du es nicht tun«, unterbrach mich mein Bruder. »Hör auf, mich überzeugen zu wollen. Wenn du ein Junge sein willst, darfst du nicht wie ein Mädchen denken. Schau nicht so oft auf den Boden. Sieh deinem Gegenüber beim Sprechen in die Augen und gerate nie ins Stocken.«
Ich hob rasch den Blick. »Ich versuche doch gar nicht, dich zu überzeugen! Und ich gerate nicht immer ins Stocken.« Dann sah ich wieder zu Boden.
Keton stöhnte.
»Tut mir leid! Ich kann es nicht ändern. Das ist Gewohnheit.«
»Du wirst niemals als Junge durchgehen«, sagte er. »Du beißt dir auf die Lippen und starrst auf den Boden. Und wenn du nicht auf den Boden starrst, dann starrst du in den Himmel.«
Ich sah entrüstet auf. »Das tue ich nicht!«
»Weiter!«, sagte Keton. »Du musst lauter werden. Jungen sind wütend und anmaßend. Sie sind gern in allem der Beste.«
»Ich glaube, das ist nur bei dir so, Keton.«
»Wenn ich nur Zeit hätte, dich anzulernen.«
»Ich bin mit euch dreien aufgewachsen. Ich weiß, wie Jungen sind.«
»Wirklich?« Keton runzelte die Stirn. »Du bist ein Mädchen aus einer Kleinstadt, Maia. Du weißt nicht, wie es draußen in der Welt zugeht. Du hast dein Leben damit zugebracht, in einer Ecke unseres Ladens zu sitzen und zu nähen.«
»Und jetzt werde ich meine Tage damit verbringen, in einer Ecke des Palastes zu sitzen und zu nähen.«
Er machte ein Gesicht, als würde das beweisen, dass er recht hatte. »Versuch einfach, nicht zu viel zu reden. Errege keine Aufmerksamkeit.« Er verschränkte die Arme hinter dem Kopf. »Die Leute werden sehen, was sie sehen wollen.«
Die traurige Weisheit in seiner Stimme erinnerte mich an Baba. »Was meinst du damit?«
»Genau das«, erwiderte er. »Du nähst besser als jeder andere auf dieser Welt. Konzentriere dich darauf, nicht auf die Frage, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist.« Er stützte sich auf einem Ellbogen ab und musterte mich. »Finlei hatte recht. Von hinten siehst du wirklich wie ein Junge aus. Und dank deiner Sommersprossen bist du nicht so blass wie die meisten Mädchen … Baba lässt dich zu lange draußen in der Sonne herumlaufen …«
»Jemand muss doch die Seidenraupen einsammeln«, sagte ich gereizt.
»Außerdem hast du nicht so viele Rundungen.« Keton sah mich mit zusammengekniffenen Augen an. »Und deine Stimme ist nicht sehr melodiös. Du warst nie sehr musikalisch.«
Für diese Beleidigung hätte ich ihm beinahe seine Hose ins Gesicht geworfen. »Ich habe nicht vor, eine Konkubine zu werden.«
Keton schnalzte mit der Zunge. »Rümpf deine Nase nicht so oft und versuch, nicht zu lächeln.«
»Etwa so?«, fragte ich. Ich äffte die Grimasse nach, die er im Schlaf gemacht hatte.
»Besser.« Er lehnte sich wieder zurück, ein kleines Lächeln auf den Lippen. Aber es schwand so rasch, wie es gekommen war. »Bist du sicher, dass du das tun willst? Wenn der Kaiser es herausfindet … oder irgendjemand anders …«
»Dann werde ich getötet«, beendete ich den Satz für ihn. »Ich weiß.«
Aber es war die beste Möglichkeit, für meine Familie zu sorgen. Meine Chance, selbst Schneider zu werden, der beste Schneider in ganz A’landi.
»Es wird gutes Geld sein«, sagte ich fest. »Ich werde alles zu euch nach Hause schicken. Außerdem …« Ich brachte ein Lächeln zustande. »Ich habe mir schon die Haare abgeschnitten.«
Keton seufzte. »Ich kann nicht glauben, dass gerade ich dir das sage, aber: Du musst vorsichtig sein.«
»Das werde ich.«
»Ich erwarte jede Menge Geschichten über die Damen am Hof, wenn du zurückkommst«, sagte mein Bruder leichthin. »Und über Kaiser Khanujin.« Er wirkte plötzlich angespannt. »Vielleicht wirst du sogar den Shansen sehen.«
»Versprochen«, antwortete ich leise. »Ich kehre mit lauter Geschichten zurück.«
Mein Blick fiel auf den Gehstock, den ich für Keton gekauft hatte, als er vor einem Monat heimgekehrt war. Er hatte ihn nie angerührt – wieso auch, wenn er kaum seine Beine bewegen konnte?
»Nimm ihn«, sagte er, da er mich beobachtet hatte.
Das Holz war rau und kratzte in meiner Handfläche. Gut – ein kleiner Schmerz würde mich daran erinnern, wachsam zu bleiben.
»Versprichst du mir, dass du Gehen übst?«, fragte ich. »Jeden Tag ein bisschen?«
»Ich mache einen Schritt für jeden Tag, den du fort bist.«
Das genügte, meine Entscheidung stand fest. Ich küsste meinen Bruder auf die Stirn. »Dann hoffe ich, dass ich lange fort bin.«
Während Baba schlief, drillte mich Keton darauf, mich wie ein Junge zu verhalten. Tief aus dem Bauch heraus zu lachen, nach einer guten Mahlzeit zufrieden zu grunzen, nach einem Glas schweren Weins das Gesicht zu verziehen. Er brachte mir bei, mich nicht fürs Rülpsen zu entschuldigen, es nicht zu verbergen, wenn ich furzen musste, und auszuspucken, wann immer jemand es wagte, meine Ehre in Zweifel zu ziehen.
Dann endlich, als er zu erschöpft war, um den Unterricht fortzusetzen, kehrte ich in mein Zimmer zurück. Dort lief ich auf und ab und ging im Geiste alles durch, was fehlschlagen konnte.
Wenn man mich erwischt, werde ich getötet.
Aber ich muss es tun, für Keton und Baba.
Insgeheim wusste ich, dass ich es auch für mich tun musste. Wenn ich hier blieb, würde ich Calus Frau werden – die Frau eines Bäckers –, und meine Finger würden vergessen, wie man nähte.
Ohne noch länger zu zögern, machte ich mich also daran, alles zusammenzupacken, was ich vielleicht brauchen würde. Kleider von Keton zum Wechseln, meine besten Garne, Seiden, Ahlen und Nadeln, meine Stickbänder und Nadelkissen, Kreide, Pinsel, Farbtöpfe, Skizzenbücher und Stifte.
Die Sonne hatte es eilig damit, wieder aufzugehen, zumindest fühlte es sich so an. Im Licht verblich das sternenbestickte Himmelszelt über mir. Ich sah zu, wie der Morgen über dem Meer heraufzog, bis er in unserer Straße und an unserem Haus angekommen war.
Ich war bereit. Ich hatte meine Habseligkeiten sorgfältig in ein Bündel eingeschlagen, das ich mir über die Schulter schlang. Auf dem Weg zur Haustür war mein Gang selbstbewusst – so wie der von Keton früher –, und ich vergaß auch nicht zu humpeln und mich auf den Gehstock zu stützen.
»Warte«, krächzte Baba hinter mir. »Warte.«
Vor Schuldgefühlen schnürte es mir die Brust zusammen. »Es tut mir leid, Baba.«
Baba schüttelte den Kopf. »Ich habe damit gerechnet. Du warst immer die Starke von uns.«
»Nein«, sagte ich ruhig. »Finlei und Sendo waren die Starken von uns.«
»Finlei war tapfer. Und Sendo auch, auf seine Weise. Aber du, Maia, du bist stark. Wie deine Mutter. Du hältst uns alle zusammen.«
Meine Knie wurden weich. »Baba …«
Er hielt sich seitlich an der Tür fest. In der anderen Hand hatte er etwas, das wie ein zerknülltes Stück Stoff aussah. Er streckte es mir entgegen. »Nimm das.«
Das kleine Bündel war aus so feiner Seide, dass ich schon dachte, sie würde unter meiner Berührung schmelzen. Ich löste die goldene Kordel. Darin lag …
Eine Schere.
Ich sah meinen Vater verwirrt an.
»Sie hat deiner Großmutter gehört«, sagte Baba, während er die Schere wieder in die Seide einschlug, als würde ihr Anblick ihn schmerzen. »Sie hat nie zu mir gesprochen. Sie hat auf dich gewartet.«
»Was kann sie …«
Baba bedeutete mir zu schweigen. »Du wirst es wissen, wenn du sie brauchst.«
Ich öffnete den Mund und wollte schon sagen, dass er auf Keton und sich selbst aufpassen solle. Aber Finlei und Sendo waren mit ebendiesen Worten auf den Lippen von uns geschieden und nie zurückgekehrt. Also schwieg ich und nickte nur.
»Maia«, ergriff Baba noch einmal das Wort und legte mir die Hand auf die Schulter. In seinen Augen war ein Licht, das ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. »Sei vorsichtig. Der Palast … es wird gefährlich werden.«
»Ich werde vorsichtig sein, Baba. Versprochen.«
»Dann geh jetzt. Zeig ihnen, was du kannst.«
Ich beugte mich über meinen Gehstock, und während ich auf die Kutsche zuhinkte, zog ich das rechte Bein ein wenig nach.
Die Sonne schien bereits taghell, doch ich hatte keine Hand frei, um mein Gesicht zu beschirmen. Ich schnitt eine Grimasse, und Lorsa knurrte, als er mich sah.
»Keton Tamarin?«, fragte er und musterte mich vom Scheitel bis zur Sohle. »Ihr und Eure Schwester seid Euch sehr ähnlich.«
Mein ganzer Körper schien zusammenzuschnurren und mein Magen verkrampfte sich. Ich zwang mich zu einem männlichen Lachen, das aber eher nach Husten klang. »Ich hoffe, das ist auch schon alles, was wir gemeinsam haben. Schließlich kann sie nicht nähen, und ich kann es.«
Der Eunuch brummte zustimmend, dann warf er Baba einen Sack voller Jen hin.
»Steigt ein«, sagte er zu mir.
Keton hatte recht. Die Menschen sahen nur, was sie sehen wollten.
Ein letzter Blick zu Baba und hinauf zu Ketons Fenster. Dann kletterte ich in die Kutsche, ohne zu ahnen, was mich erwartete. Nur, dass es gelingen musste – um jeden Preis.
KAPITEL DREI
Es war eine fünftägige Kutschfahrt von Port Kamalan zum Sommerpalast. Ich war enttäuscht, dass es nicht nötig war hinzusegeln, denn obwohl ich die letzten acht Jahre in einer Hafenstadt verbracht hatte, hatte ich noch nie einen Fuß an Bord eines Schiffes gesetzt. Ich war auch noch nie in einer Kutsche gefahren – zumindest nicht auf einer so langen Reise. Meine Beine und mein Rücken schmerzten vom Sitzen, aber ich wagte es nicht, mich zu beklagen. Ich war zu aufgeregt. Und besorgt.
Würde ich gut genug sein, um Kleider für den Kaiserhof zu nähen? Und würde ich Kaiser Khanujin im Sommerpalast sehen? Aber das musste ich wohl, wenn ich sein Schneider werden sollte. Ich war mir nicht sicher, wie ich das finden sollte.
Ich wusste nicht viel über meinen Herrscher. Er war im Drachenjahr geboren, wie Finlei, was bedeutete, dass er dreiundzwanzig Jahre alt war. Man erzählte sich Geschichten darüber, dass er im Fünfwinterkrieg ein grimmiger Kämpfer gewesen war, dass er die Loyalität eines Mannes mit lediglich einem Nicken gewinnen konnte, dass er blendend genug aussah, um selbst die Sonne erbleichen zu lassen. Dass jeder, der seiner ansichtig wurde, ihn liebte.
Aber ich fragte mich, ob all das nur Geschichten waren.
Wenn der Kaiser wirklich so wunderbar war, hätte er A’landi nicht in den Krieg geführt – gerade um das Land vor der Spaltung zu bewahren. Gerade um den Thron vor dem verräterischen Shansen zu retten.
Ein guter Kaiser hätte mir meine Brüder nicht genommen.
Ich presste meine Finger im Schoß gegeneinander, so fest, dass mich ein jäher Schmerz durchfuhr. Er schützte mich davor, innerlich zusammenzubrechen, wie ich es immer tun wollte, wenn mir einfiel, was der Krieg meine Familie gekostet hatte.
Jungen weinen nicht, schalt ich mich. Ich drehte mich zum Fenster und fuhr mir mit dem Handrücken über die Nase.
Ich versuchte, an andere Dinge zu denken. Untätig herumzusitzen hatte mich schon immer nervös gemacht, deshalb suchte ich mir eine Beschäftigung und strickte einen Pullover. Ich arbeitete schnell, und als ich fertig war, zog ich ihn wieder auf und strickte einen zweiten, und dann übte ich Sticken auf einem Baumwollfetzen.
Minister Lorsa antwortete niemals auf die wenigen Fragen, die ich zu stellen wagte, und er unterhielt sich auch nicht mit mir. Er schlief so lange wie ein Bär und roch doppelt so übel. Nach allem, was er aß, stieß er auf, deshalb hielt ich die meiste Zeit der Reise über den Kopf aus der Fensteröffnung der Kutsche und nahm beim Stricken die unterschiedlichen Düfte von A’landi in mich auf.
Am fünften Tag erspähte ich den Sommerpalast in der Ferne. Von dort aus gesehen, wo sich unsere Kutsche gerade befand, war er so groß wie mein Daumennagel und lag in ein breites Tal zwischen den Singenden Bergen geschmiegt, durch das der Jingan floss. Ich hatte Geschichten über die schiere Pracht des Palastes gehört – über seine geschwungenen Golddächer, seine zinnoberroten Säulen und seine Wände aus Elfenbein – und zitterte vor Aufregung. Ich starrte darauf, während er allmählich größer und realer für mich wurde.
Über uns erhob sich ein Habicht in die Lüfte. Er war schwarz bis auf die Flügelspitzen, sodass er aussah wie mit Schnee bestäubt. Etwas Goldenes glitzerte an seinen Klauen – ein Ring oder eine Marke.
»Was für ein sonderbarer Vogel«, grübelte ich. »Gehört er dem Kaiser? So muss es sein … mit dieser Manschette. Was macht er hier, fernab der Wälder?«
Meine Stimme weckte den schlafenden Lorsa, und er sah mich finster an.
»Schaut«, sagte ich und deutete aus dem Fenster. »Ein Habicht.«
»Ein Ärgernis«, murmelte er, als der Habicht einen Schrei ausstieß. »Verfluchter Vogel.«
Der Habicht stürzte sich in die Tiefe. Er breitete seine Schwingen aus, als er neben die Kutsche herabschoss und aus vollem Flug in der Fensteröffnung der Kutsche landete. Seine Augen glühten gelb und wirkten blitzgescheit – sie schauten mich unverwandt an, als würde mich der Vogel mustern und abschätzen.
Ich starrte zurück. Der Ausdruck des Habichts war fast menschlich.
Fasziniert streckte ich die Hand aus, um ihm die Kehle zu streicheln. Mit einem plötzlichen Ruck stieß sich der Habicht ab und flog davon. Er schraubte sich wieder gen Himmel empor und verschwand hinter einem Baum auf dem Palastgelände.
Die Kutsche setzte uns am Fuße eines Hügels ab. Glyzinienranken schaukelten in der sanften Brise; ihr Duft hing in der Luft rund um die achtundachtzig Stufen hinauf zum Eingang für die Dienerschaft. Dieser Anstieg sollte uns, wie ich später erfuhr, vor Augen führen, wo unser Platz war, und uns daran erinnern, wie weit unter Kaiser Khanujin, dem Sohn des Himmels, wir standen.
Ich streckte meine Beine und stöhnte leise, als ich nach dem langen Sitzen die Steifheit in meinen Waden spürte.
»Es ist niemand da, der Euch die Stufen hinauftragen könnte«, sagte Lorsa mit einem spöttischen Lächeln.
Ich verstand nicht, was er meinte, bis mir einfiel, dass ich ja Ketons Gehstock in der Hand hielt. »Oh. Macht Euch keine Sorgen um mich.«
Was Lorsa natürlich nicht tat. Er rauschte die Treppe hinauf und ließ mich stehen.
Ich eilte ihm nach. Obwohl meine Schultern vom Gewicht meiner Habseligkeiten schmerzten und ich über meine Beine stolperte, weil ich nicht wusste, wie mit Ketons Stock umzugehen war, blieb ich nicht stehen, um mich auszuruhen.
Hier würde es also beginnen. Hier würde ich die Familienehre wiederherstellen. Hier würde ich beweisen, dass ein Mädchen tatsächlich der beste Schneider von A’landi werden konnte.
Der Sommerpalast war ein Labyrinth aus Pavillons mit goldenen Dächern, gewundenen Pflasterwegen und herrlich gestalteten Gärten. Überall blühten Blumen in jeder erdenklichen Schattierung von Rosa und Violett, und Schmetterlinge gaukelten umher.
Wohin ich auch blickte, waren Männer in graublauen Kaftanen und mit langen, dünnen schwarzen Bärten zu sehen. Es waren Diener und niedere Beamte, und sie gingen ein wenig vornübergeneigt, als wären sie allzeit bereit, sich zu verbeugen. Im Gegensatz dazu hielten sich die Eunuchen in ihrem hellen Blau kerzengerade; die Fächer in ihren Händen waren geschlossen. Einige von ihnen grüßten mich mit freundlichem Lächeln, bis Lorsa sie anfunkelte. Aber es genügte schon, um mich freier atmen zu lassen. Vielleicht waren nicht alle im Palast so unangenehm wie Lorsa.
Eine Magd ging an uns vorbei. Sie trug ein Tablett mit Mandelplätzchen und dampfenden Kastanienkuchen. Mein Magen knurrte, während ich Lorsa auf dem schmalen Pfad weiter folgte. Die Gebäude rückten enger zusammen, die Bäume und Sträucher waren weniger akkurat gestutzt. Wir hatten die Unterkünfte der Diener erreicht.
Lorsa wirkte ungeduldig, als ich ihn endlich vor einem breiten, offenen Torbogen einholte. Er verkündete: »Dies ist der Saal des Höchsten Fleißes, wo Ihr arbeiten werdet.«
Ich humpelte hinein. Lebensgroße Statuen der Drei Großen Weisen, A’landis legendärer Gelehrter, begrüßten mich am Eingang. Der Boden des Saals war so kühl wie Porzellan, an den Wänden hingen bemalte Schriftrollen: Auf den meisten prangten die Lieblingsaphorismen Seiner Kaiserlichen Majestät, auf anderen Pfingstrosen, Welse und Kraniche.
Durch die vergitterten Fensteröffnungen drang das Gezwitscher der Vögel herein. Jede Menge Lerchen und Drosseln sangen da, selbst noch, als der Abend anbrach.
Es war der gewaltigste Raum, den ich jemals betreten hatte – mindestens zehnmal größer als die Küche von Calus Vater und dreimal so groß wie der Tempel von Port Kamalan. In einer Ecke standen Spinnräder und zwölf Tische, von denen jeder einzelne mit einem Webstuhl ausgestattet war, einem Stickrahmen und einem Korb voller Garn, Näh- und Stecknadeln. Die Arbeitsplätze waren durch hölzerne Wandschirme voneinander abgetrennt, an denen Haken angebracht waren, um Stoffe aufzuhängen und zu drapieren.
Elf Schneider saßen bereits an ihren Plätzen, und sie flüsterten miteinander und starrten mich an.
Ich wollte schon den Blick senken, reckte stattdessen jedoch das Kinn und runzelte die Stirn.
»Sind das auch kaiserliche Schneider?«, fragte ich Lorsa, während ich so rasch wie möglich hinter ihm herhumpelte.
»Es wird nur einen geben.« Der Eunuch ging weiter, ans andere Ende des Saals, wohin weniger Sonnenlicht gelangte. Er wies auf einen Tisch. »Dies wird Euer Platz sein, bis Ihr wieder entlassen seid.«
Entlassen? »Tut mir leid, Herr. Ich bin verwirrt.«
Lorsa sah mich scharf an. »Ihr dachtet doch nicht, dass Ihr der einzige Schneider seid, der die Aufmerksamkeit Seiner Majestät auf sich gezogen hat, oder?«
»N-natürlich nicht«, stammelte ich.
»Sicherlich habt Ihr nicht angenommen, dass Seine Majestät einen Schneider ernennen würde, ohne ihn vorher auf die Probe zu stellen?«