
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj TB
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
»Er ist die Sonne und ich bin der Mond.«
SIE ist die mächtigste aller Dschinnys. ER ist ein gewitzter Dieb. Gemeinsam sind sie unschlagbar. Doch zunächst sind sie ein Dreamteam wider Willen, denn ER möchte alles aus seinen drei Wünschen rausholen, SIE schnellstmöglich ihre Freiheit zurückgewinnen. Aber nach und nach erkennen die beiden, dass alles Glück dieser Welt bereits an ihrer Seite ist. Doch wenn eine Dschinny und ein Mensch sich verlieben, erwartet sie beide der Tod. Also müssen die beiden, um ihr Glück UND die Freiheit zu gewinnen, alle Regeln brechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
DIE AUTORIN
© Susan Yang
Jessica Khoury ist syrisch-schottischer Abstammung und wollte schon als kleines Mädchen nichts lieber, als mal Autorin zu werden. Inzwischen hat sie ihr Ziel erreicht und widmet sich ausschließlich dem Schreiben. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Hunden umgeben von massenhaft Büchern und schönen Schuhen in South Carolina.
Mehr zu cbj auf Instagram www.instagram.com/hey_reader/
Jessica Khoury
Aus dem Amerikanischenvon Gabriele Haefs
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Für Papa J. K.
1. Auflage
Erstmals als cbj Taschenbuch August 2017
© 2017 der deutschsprachigen Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2016 Jessica Khoury
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »The Forbidden Wish«
bei Razorbill, einem Imprint der Verlagsgruppe Penguin Random House, US
Übersetzung: Gabriele Haefs
Umschlaggestaltung: semper smile, München
unter Verwendung eines Fotos von © Arcangel Images (Rekha Garton)
MP · Herstellung: UK
Satz: Uhl & Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-19959-3V001
www.cbj-verlag.de
Kapitel Eins
Ich spüre den Jungen in dem Moment, in dem er einen Fuß in die Höhle setzt.
Zum ersten Mal seit Jahrhunderten bewege ich mich.
Ich bin Rauch in der Lampe, und ich rolle mich zusammen, strecke mich, schüttele die Lethargie von fünf Jahrhunderten ab. Ich komme mir vor wie halb versteinert. Das Geräusch seiner Schritte rüttelt mich auf wie ein Donnerschlag, und ich fahre hellwach hoch.
Ich stoße gegen die Seiten der Lampe und rufe nach ihm, aber natürlich bringt das nichts. Er kann den Ruf der Dschinny nicht hören, den Ruf des Lampengeistes, der Wunscherfüllerin.
Der Junge ist allein, und ich spüre seine behutsamen Schritte, als er über die Schwelle zur verborgenen Höhle tritt. Ich strecke meinen sechsten Sinn nach ihm aus, folge ihm, als er die enge, in den Sandstein gehauene Treppe hinuntersteigt und seine Finger über eine uralte Wand streifen lässt. In diese Wand sind Symbole eingeritzt, deren Bedeutung im Laufe der Zeiten längst verloren gegangen ist. Es ist so seltsam, Habiba, nach meiner langen Einsamkeit seine Anwesenheit hier zu spüren: wie ein Licht auf dem Boden der dunklen, dunklen See.
Ich strecke mich so weit ich kann, ich spüre seinen leisen Atem, sein hämmerndes Herz. Wer ist er? Wie hat er hergefunden? Er ist nur ein Knabe, ein flüchtiger Augenblick. Ich habe tausendundeinen wie ihn gekannt. Ich werde noch tausendundeinen kennen. Er ist nichts. Das sage ich mir, damit ich keine Hoffnungen auf ihn setze. Mir ist es verboten zu wünschen. Und deshalb will ich nicht an die Welt dort oben denken, den offenen Himmel, die frische Luft und das Licht des Tages. Ich werde nicht zeigen, wie wahnsinnig, zutiefst verzweifelt ich will, dass der Knabe meine Lampe aus dieser verfluchten Finsternis trägt. Stattdessen krümme ich mich zusammen, dehne mich dann, ich wirbele und drehe mich, und ich warte mit angehaltenem Atem. Mein sechster Sinn ist verschwommen, als ob ich Fischen zusähe, die durch einen Teich mit wogendem Wasser schwimmen. Ich muss mich gewaltig konzentrieren, um ihn überhaupt zu sehen.
Er hält eine kleine Fackel in der Hand, und die hebt er, als er in die Höhle starrt, die eigentlich gar keine Höhle ist, sondern eine riesige Halle voller Echos. Früher einmal ein großer Palast, der aber längst Zeit und Krieg zum Opfer gefallen ist. Jetzt liegt er tief, tief in der Wüste, eine Ruine unter vielen, begraben unter Tausenden Schichten aus Sand und Erinnerungen.
Säulen ragen über meinem furchtlosen Besucher auf und tragen eine sich in den Schatten verlierende Decke. Geschnitzte Bilder winden sich die Säulen hinauf: gähnende Löwen, geflügelte Pferde, feuerspeiende Drachen. Die in ihre Augen eingelassenen Edelsteine leuchten sanft, als ob sie den Jungen mit stummer Bosheit beobachteten, so, wie sie einst die strahlenden und farbenfrohen Menschen beobachtet haben, die vor Jahrhunderten hier lebten, ehe ihre Stadt im Sand versank. Dieser Ort ist von Geistern besessen, und ich bin einer davon.
»Bei allen Göttern«, murmelt der Junge, und seine leisen Wörter schweben unter dem gewaltigen Gewölbe dahin. Er hebt seine Fackel und Licht strömt wie eine goldene Lache von ihm aus.
Seine Ehrfurcht ist nur gut und richtig. Das hier ist keine normale Halle, einst war sie ein Heiligtum tief im nerubischen Königspalast, wo vor langer Zeit eine schöne junge Königin nach einem unvergleichlichen Garten verlangte, in dem sie sich ausruhen und meditieren könnte.
Das war einer der besseren Wünsche, die ich erfüllt habe.
Der Boden ist bedeckt von zarten Grashalmen, und jeder von ihnen ist aus lauterstem Smaragd geschnitzt. Niedrige Bäume breiten ihre Zweige aus, und die Blätter aus Jade funkeln unter einem hohen Deckengewölbe, das mit leuchtenden Diamanten besetzt ist, wie von Sternen am Nachthimmel. An den Bäumen hängen Früchte: Rubinäpfel, goldene Zitronen, Amethystpflaumen, Saphirbeeren. Die funkeln und leuchten, Millionen von Edelsteinen, geschliffen mit einer Präzision, der keine sterbliche Kunst gleichkommt. Man muss sehr genau hinschauen, ehe man begreift, dass es keine echten Bäume oder wirkliche Blumen sind, sondern allesamt unschätzbare Steine.
Der Junge geht weiter wie im Traum, ohne zu blinzeln, ohne zu atmen. Keine einzige lebende Pflanze ist zu sehen, und doch scheint der Garten lebendiger zu sein als irgendein Garten in der Welt dort oben. In den vergangenen Jahrhunderten waren diese Juwelenfrüchte meine ständigen und einzigen Begleiterinnen. Der größte Schatz der Welt, so wenig tröstlich wie Licht für die Blinden.
Der Junge verweilt zu lange.
Die Luft ist geladen mit altem Dschinnzauber, ein Rest des großen Krieges, der vor vielen Jahrhunderten hier ausgefochten wurde. Die Magie klebt an den Wänden, tropft von der Decke, bildet Lachen zwischen den goldenen Wurzeln der Juwelenbäume. Er füllt die leeren, schon halb in der Wüste versunkenen Ruinen, die langen zerfallenden Gänge, die sich wie Wurzeln verzweigen und Türme und Hallen und Lagerräume verbinden. Die Stadt ist nur einen Atemhauch vom vollständen Einsturz entfernt. Seit fünfhundert Jahren wogt und wirbelt diese Magie in ihren Kammern, staut sich wie Gas unter der Erde und wartet auf den zündenden Funken.
Der Junge ist dieser Funke. Er wird eine Falle zuschnappen lassen, die vor langer Zeit eingerichtet worden ist, und wird eine Explosion dieser aufgestauten Magie auslösen, und die Wüste wird uns beide unter sich begraben. Ich werde verloren sein, eine Sage, ein Traum. Für immer mit mir selbst gefangen in diesem Kerker aus Sand und Magie. Ich kann mir kein entsetzlicheres Schicksal vorstellen. Ich hatte geglaubt, mich längst damit abgefunden zu haben, während es aussah, als ob niemand mich jemals finden würde. Jetzt weiß ich, dass dies nicht stimmt und dass tief in mir Hoffnung pulsiert hat, wie ein schlafendes Samenkorn, um dann bei der ersten Möglichkeit zum Entkommen aufzublühen.
Aber nun klingt die Magie auf wie die Saiten einer Laute und meine zarte Hoffnung stirbt. Ein Wind erhebt sich aus der Dunkelheit, bewegt die steinernen Blätter, bis ihr Klirren in der ganzen Höhle widerhallt. Die Falle ist zugeschnappt.
Als ob er es spürt, läuft der Junge los, vorbei an den schönen Bäumen und Blumen, er springt über einen Bach, in dem Gold- und Silberklumpen glitzern. Die Halle verengt sich, während die Edelsteine oben heller strahlen. Ihr Licht ist grell, es blendet. Der Garten mit seinen vielen Edelsteinen glitzert mit rasierklingenscharfen Ecken und Kanten schön, aber tödlich. Der Junge weicht Blättern aus, die die Luft wie Messer zerschneiden, und es zischt, als eins seinen Handrücken ritzt.
Und endlich erreicht er den Hügel am Ende des verzauberten Gartens, und dort bleibt er stehen zwischen den weiten Zweigen einer aus Kupfer gehauenen Weide, von denen Smaragdblätter herunterrieseln. Er dreht einen Ring am Finger, und seine Augen weiten sich, als sein Blick auf die Lampe fällt.
Sie steht auf einem thronähnlichen Sessel aus Eisen und Rubinen, wobei das Eisen verschmiedet worden ist, sodass es Rosenranken ähnelt. Einst saß die Königin dieser Stadt hier stundenlang, sie las und meditierte, aber das ist sehr lange her. Jetzt gibt es nur die Lampe, die im Licht der Diamanten funkelt. In der Lampe weite ich mich aus, fülle jeden Fingerbreit des engen Raumes mit meinem glitzernden Rauch und flehe den Jungen an, sich zu beeilen. Ich pulsiere vor nervöser Ungeduld und habe Angst, diese Fluchtmöglichkeit könnte mir durch die Finger rinnen. Nie ist mir meine Lampe kleiner vorgekommen.
Der Junge steigt zu mir hinauf, ringt um Atem, stößt einen leisen Seufzer aus, als er den Thron erreicht. Einen Moment lang bleibt er dort stehen und wischt sich den Sand von den Händen. Seine Augen sind auf die Lampe gerichtet.
Die Höhle bebt. Sand rieselt an den Wänden herab, bringt die Stapel aus goldenen Münzen zum Klirren. Die Magie summt und die Edelsteine an den Bäumen fangen an zu klirren. Der Junge scheint das nicht zu bemerken. Er ist wie gebannt von der Lampe.
»Das ist sie also«, sagt er atemlos.
Er streckt die Hand aus, und vor Erregung verwandele ich mich von Rauch zu Feuer. Als seine Finger die bronzenen Seiten der Lampe berühren, durchfährt mich eine knisternde Energie. Ich kann seinen Herzschlag durch seine Fingerspitzen spüren, wild und stark.
»Was bist du?«, flüstert er. »Warum hast du mich gerufen?«
Wie betäubt lässt er seine Finger über die Bronze fahren, seine Handfläche folgt der Biegung der Tülle, und unter seiner Berührung jagt menschliche Hitze durch die Wände.
Ich siede und wachse. Ich reiße mich zusammen, mache mich bereit, und roter Rauch wird golden.
Der Junge reibt die Lampe.
Und ich antworte.
Ich schieße aufwärts durch den langen dunklen Tunnel der Tülle. Ich bin ein Trichter aus Rauch, ein Wirbelwind aus Feuer. Ich öffne mich und werde zu vielen, ich wachse zu einer riesigen Wolke über dem Kopf des Jungen heran. Ich presse mit tausendundeiner rauchigen Hand gegen die steinerne Decke der Höhle. Ich verdrehe tausendundein feuriges Auge und strecke tausendundein glitzerndes Bein aus. Ich öffne und öffne und öffne mich. Was ist es für ein wunderbares Gefühl, draußen zu sein! Ich knistere vor Energie und Erregung, mein Blut wird zu Blitzen und mein Atem zum Donner.
Ich könnte mich stundenlang strecken und den Raum um mich herum genießen. Aber weil nicht viel Zeit bleibt, schrumpfe ich und werde manifest, ziehe meine unternehmungslustigen Fühler ein. Zum ersten Mal seit fünfhundert Jahren nehme ich jene Gestalt an, die mir die liebste ist.
Deine Gestalt, Roshana, meine Habiba. Schwester meines Herzens. Du mit dem reinen Herzen und dem fröhlichen Lachen, die mich Freude gelehrt und mich Freundin genannt hat. Eine Prinzessin unter den Menschen und eine Königin ihres Volkes.
Ich bekleide mich mit deiner Gestalt. Ich nehme deine Haare, lang und schwarz, wie der Fluss der Nacht. Ich nehme deine Augen, groß und scharf und funkelnd. Ich nehme dein Gesicht, schmal und stark. Dein wunderschöner Körper gehört mir. Deine Hände, flink und geschickt, und deine Füße, elegant und schnell. Ich trage dein Gesicht und gebe vor, auch dein Herz gehöre mir.
Und endlich verzieht sich der Rauch, und ich stehe in dem Garten, den ich für dich geschaffen habe. Für das Auge menschlich, bin ich innerlich doch nur Rauch und Kraft. Ich strecke mich und seufze, und langsam, langsam lächele ich den Jungen an.
Er liegt auf dem Rücken, die Augen weit aufgerissen, den Mund auch. Einmal, zweimal, dreimal öffnet und schließt sich dieser Mund, dann würgt er endlich heraus: »Grausame Götter!«
Dieser Amule ist jung, vielleicht siebzehn Sommer. Seine armselige, fadenscheinige Kleidung verrät, dass es an seinem Körper nicht ein Gramm Fett gibt. Er ist Knochen und Blut und glatte, harte Muskel, ein Jüngling, der für sein Überleben gestohlen hat, von den Obstverkäufern und Kameltreibern und aus der Gosse. Der weiß, dass jeder Tag kein Geschenk ist, sondern ein Preis, den man erringen muss. »Du bist ein … du bist eine …«
Nun sag es schon, Knabe! Dämonin des Feuers. Ungeheuer aus Rauch. Teufelin aus Sand und Asche. Dienerin des Nardukha, Tochter Ambadyens, des Namenlosen, des Gesichtslosen, des Grenzenlosen. Sklavin der Lampe. Dschinny.
»… ein Mädchen!«, endet er.
Eine Sekunde lang kann ich ihn nur anstarren, aber rasch fasse ich mich wieder.
»Zittere, Sterblicher!«, erkläre ich und lasse meine Stimme in der Höhle widerhallen. »Ich bin die Sklavin der Lampe, die mächtige Dschinny von Ambadyen. Mein ist die Macht, dir der Wünsche drei zu gewähren. Befiehl, und ich, deine Sklavin, werde gehorchen, Sohn der Menschen, denn so will es das Gesetz des Nardukha.«
Ach, Nardukha, mächtiger König der Dschinn. Mein Herr der Herren. Verdammt seien seine Rauch-und-Feuer-Knochen.
»Eine Dschinny«, murmelt der Junge. »Jetzt ergibt das alles einen Sinn.«
Er verstummt, als ein Sandbächlein von oben her auf seine Schulter rieselt. Er wischt es weg und tritt zur Seite, doch nun regnet es überall um ihn herum Sand. Der Boden schlingert, Edelsteine klirren und kullern umher. Der Junge stolpert.
»Was ist los?«, fragt er atemlos, als er wieder auf die Füße kommt.
»Diese Ruinen sind alt. Die Magie, die sie füllt, ist noch älter, und sehr bald wird sie dich töten.« Es hat keinen Zweck, die Wahrheit zu beschönigen. »Aber wenn du dir das Leben wünschst, werde ich dich retten.«
Er grinst, frech wie eine Krähe. »Warum wünschen, wenn ich rennen kann? Kannst du mit mir Schritt halten, Dschinny?«
Darüber kann ich nur lachen, und im Handumdrehen binde ich mich an die Gestalt eines Habichts und fliege über die Edelsteinwipfel. Die Zweige wogen und knacken in dem Sturm, der durch die Halle fegt. Juwelenobst prasselt auf den Boden. Die Luft ist erfüllt vom Geräusch von zerbrechendem Glas und tosendem Wind.
Der Junge rutscht den Hügel hinab und rennt durch das Gras. Zweige strecken sich nach ihm aus, versuchen, sich um seine Arme und seinen Hals zu wickeln, aber ich reiße sie fort. Schattenhände greifen aus dem Rauch nach seinen Knöcheln, aber ich schlage sie mit meinen Flügeln weg.
Der Junge ist schnell, aber ist er schnell genug? Ich führe ihn über die Schatzhaufen und um sie herum, durch Bögen aus glitzerndem, zerfallendem Sand. Das muss ich meinem jungen Herrn lassen: Er ist flink und gibt sich nicht so leicht geschlagen.
Der Ausgang ist jetzt nicht mehr weit. Sand fällt wie Regenschauer, so fest, dass der Junge zu Boden und auf die Knie geworfen wird. Er würgt und hustet, sein Mund füllt sich mit Sand. Aber er kämpft sich immer weiter voran, seine Beine geben sich alle Mühe, ihn wieder zu tragen. Er müht sich mit geschlossenen Augen weiter, seine Hände tasten wie die eines Blinden.
Mit einem Rauchwirbel verwandele ich mich aus einem Habicht in ein Mädchen und lasse mich neben ihn auf den Boden fallen. Ich nehme seine Hand und ziehe ihn weiter, versuche, nicht auf die Wärme seiner Berührung zu achten. Ich habe keinen Menschen mehr angefasst, seit … ach, seit so langer Zeit, Habiba. Seine Finger schließen sich um meine, seine Handfläche ist trocken und kratzig vor Sand, seine Adern pulsieren vor Leben. Wie immer, wenn ich einen Menschen berühre, werde ich von seinem Herzschlag überwältigt. Der hämmert in meinen Ohren und hallt spöttisch in der Leere meiner Brust wider, wo es nur Rauch gibt und kein Herz.
Da! Ein offener, halb im Sand versunkener Durchgang, der einst in deinen Thronsaal geführt hat, Habiba, aber der jetzt zu einem dunklen Wüstenhimmel voller heller Sterne führt. Die Teakholztür ist längst verfault, und die Steine sind rissig und trübe, aber nach fünfhundert Jahren einsamer Dunkelheit ist es das Schönste, was ich jemals gesehen habe.
Die Magie macht einen letzten Versuch, uns aufzuhalten, und diese Falle ist die gefährlichste von allen. Sand verwandelt sich in Flammen, und die Flammen springen hungrig aus dem Bauch der riesigen Kammer auf uns zu. Aber ich kann die süße Nachtluft wahrnehmen und verdoppele meine Bemühungen, den Jungen lebend herauszubringen. Wenn ich versage, dann weiß ich, dass ich keine neue Fluchtmöglichkeit erhalten werde.
»Schneller!«, dränge ich, und der Junge schaut sich zu dem Feuer um, dann rennt er verzweifelt weiter. Er bewegt sich so schnell, dass er mich überholt, und jetzt bin ich es, die weitergezerrt wird. Das Feuer züngelt an meinen Fersen. Ich verwandele mich in Rauch, und die Finger des Jungen schließen sich um den leeren Raum, wo eben noch meine Hand war.
»Was machst du da?«, schreit er.
»Lauf!« Ich dehne mich aus und ändere abermals meine Gestalt, werde zu einer wogenden Wand aus Wasser, presse mich gegen den Ansturm der Flammen, halte sie in Schach. Wind und Feuer und Wasser und Sand – und Himmel Himmel Himmel!
Der Junge ist als Erster draußen. Er springt durch die Türöffnung und rollt sich über den Boden, wobei er meine Lampe gegen seinen Bauch presst. Ich werde zu Rauch, sowie ich den freien Himmel erreicht habe, zu einer riesigen violetten, geblähten Rauchwolke. Flammen werden über den Sand gespien wie tausend Dämonenhände, die die Erde zerfurchen und in der Welt nach einem festen Halt suchen. Feurige Krallen zerfetzen die Wüste und reißen den Himmel auf.
Der Junge wimmert und hebt eine Hand, als ein heißer Wind über ihn hinwegjagt. Rauchfäden kräuseln sich an seinen Haarspitzen, wo sie vom Feuer versengt werden. Einen entsetzlichen Augenblick lang sind wir von Flammen eingeschlossen, und ich umschließe den Jungen, ersticke ihn mit meinem Rauch, rette aber seinen Leib vor dem Flammenmeer.
Und dann bricht die Magie endlich zusammen, ein Feuer, dem die Kraft ausgegangen ist. Sinkt zurück in den Sand, aus dem sie gekommen ist, und fällt wie ein glitzernder weißer Nebel in sich zusammen. Die Wüste wirbelt um die Tür und ergießt sich hinein, bis endlich die Öffnung im Sand ertrunken ist.
Um uns herum erheben sich die Ruinen von Neruby, das einst eine riesige, geschäftige Stadt war. Im Laufe der Jahrhunderte ist sie zerfallen und sieht aus wie das Skelett eines längst verstorbenen wilden Tieres. Jetzt beginnen diese Ruinen zu dröhnen und zu beben. Gewaltige Steine fallen von einstürzenden Türmen und Mauern zerbersten zu Brocken. Die Wüste wogt wie das Meer und verschlingt die Ruinen Stein für Stein, Dünen werden hin und her geweht. Langsam, geräuschvoll versinkt die Stadt in der Wüste, und knisternd lodert der letzte Rest des alten Dschinnzaubers auf und vergeht.
Als ich die Stadt zuletzt gesehen habe, erhob sie sich stolz unter einem mit schwarzem Rauch gefüllten Himmel, und die Luft hallte wider vom Lärm des Gefechts und von den Schreien der Sterbenden, der Menschen wie der Dschinn. An jenem letzten Tag sind viele gestorben. Ich hätte dazugehören müssen.
Jetzt versinkt die Stadt ein für alle Mal und nimmt die Toten mit.
Auf den Knien sieht der Junge allem mit weit aufgerissenen Augen zu und ich wirbele über ihm. Bald hat die Erde die letzte Spitze des letzten Turmes verschlungen, und die Stadt – einst die größte Stadt der Welt, die Stadt der Könige und der Eroberer – ist nicht mehr.
Die Wüste kräuselt sich und wirft den Jungen auf den Rücken. Ich nehme menschliche Gestalt an und stehe neben ihm, starre den Boden an, der mich jahrhundertelang gefangen gehalten hat. Als der Staub sich verzieht, gibt es nur noch eine glitzernde blaue Weite aus Sand, rein und jungfräulich, durchzogen von Windrillen. Der einzige Hinweis darauf, dass es jemals einen Garten der Wunder gegeben hat, das einzige Zeugnis der großen, unter dem Sand verlorenen Stadt, ist eine bleiche Münze, die auf der Oberfläche liegt und dem Mond zuzwinkert.
Und natürlich bin auch ich noch da.
Eins Der Dieb
Nach der Schlacht betraten die Königin und ihre Kriegerinnen den Thronsaal der besiegten Akbaniden, wo sie auf marmornen Sockeln die gewaltigen Schätze jenes Königreiches vorfanden. Doch die Königin, die sich kaum für die Juwelen und das Gold interessierte, schritt an allem vorbei, bis sie endlich in der Mitte des Raumes angekommen war. Und dort, auf einem Seidentuch, stand eine Lampe von bescheidenem Äußeren, aus Bronze getrieben und ohne einen einzigen Tropfen Öl.
In tiefer Ehrfurcht hob die Königin die Lampe auf, und bei dieser Berührung stieg in einer glitzernden Rauchwolke eine furchterregende Dschinny auf. Und alle, die sie erblickten, zitterten und zagten, nur die Königin stand hoch erhobenen Hauptes da und wankte nicht. Doch in ihren Augen lag ein Ausdruck des Staunens.
»Ich bin die Dschinny dieser Lampe«, verkündete die Dschinny. »Drei Wünsche seien dir gewährt. Sprich sie aus, und sie werden erfüllt werden, wohlan, selbst das tiefste Verlangen deines Herzens. Begehrst du Schätze? Sie seien dein.«
Und die Königin erwiderte: »Silber und Gold habe ich.«
»Begehrst du Königreiche und Menschen, über die du herrschen kannst?«, fragte die Dschinny. »Frag danach, und sie seien dein.«
Und die Königin entgegnete: »Auch diese habe ich.«
»Begehrst du ewige Jugend, niemals zu altern, niemals krank zu werden?«, fragte die Dschinny. »Sag es, und es sei dein.«
»Sagt nicht der Dichter, graues Haar sei wertvoller denn Silber, und in der Jugend liege Torheit?«
Die Dschinny machte vor der Königin eine tiefe Verbeugung. »Ich sehe, du bist weise, oh Königin, und lässt dich nicht leicht in die Irre führen. Aber was verlangst du nun von mir, denn ich bin deine Sklavin.«
»Reich mir deine Hand«, sagte die Königin, »und lass uns Freundinnen sein. Denn sagt nicht der Dichter, ein Freund mit ehrlichem Herzen sei mehr wert als tausend mit Gold beladenen Kamele?«
Darüber sann die Dschinny nach, ehe sie erwiderte: »Der Dichter sagt auch, wehe dem Menschen, der sich mit den Dschinn anfreundet, denn er schüttelt die Hand des Todes.«
Aus: Das Lied vom Sturz der Roshana, der letzten Königin von Neruby, von Parys zai Moura, Wächterin und Schreiberin von Königin Roshana
Kapitel Zwei
Wir treiben über ein Meer aus mondhellem Sand, und die Stille ist so endlos wie der Raum zwischen den Sternen. Die Nacht ist ruhig und friedlich, die Stadt, die eben noch hier stand, ist nur mehr eine Erinnerung.
Innerlich winde ich mich vor Angst und Entsetzen. Werden die Dschinn wissen, dass ich entkommen bin? Wie lange, bis sie angestürmt kommen? Ihre feurigen Hände können jeden Augenblick nach mir greifen, ihre zornroten Augen mich anstarren. Ich warte darauf, dass sie mich abermals nach unten schleifen und in der Finsternis anketten, aber sie kommen nicht.
Ich hebe den Kopf und atme langsam aus.
Keine Dschinn jagen über den Himmel. Keine Alarmglocken dröhnen durch die Wüste. Und in diesem Moment begreife ich es erst richtig: Ich bin entkommen. Ich bin wirklich und wahrhaftig entkommen.
Wir sind umgeben vom Sand der großen Mahaliwüste, endloser Sand, Sand in Hügeln und Haufen und Tälern, vom Mond bleichblau gefleckt. Die pure Unendlichkeit aus leerem Raum verwirrt mich nach meiner langen Haft. Während der Junge wieder zu Atem kommt, drehe ich einen Kreis und atme die Wüstennacht ein. Ich hatte schon vor langer Zeit die Hoffnung aufgegeben, dass ich den Himmel jemals wiedersehen würde. Und was für einen Himmel! Sterne wie Staub, Sterne in allen Farben – blau, weiß, rot –, die Edelsteine der Götter, auf schwarzer Seide verteilt.
Ich möchte mich ausstrecken, als Rauch über diesen prachtvollen mondblauen Sand kriechen, mich wie Wasser ausbreiten, eine Hand an jedem Horizont. Und dann hoch, hoch, zu den Sternen, um mein Gesicht gegen den Himmel zu pressen und den kühlen Kuss des Mondes zu spüren.
Ich merke, dass der Junge mich anstarrt, und ich drehe mich zu ihm um. Er liegt noch immer im Sand, stützt sich auf einen Arm, starrt mich an wie ein Fischer, dem zu seiner Überraschung ein Hai ins Netz gegangen ist.
Ich erwidere seinen Blick ebenso freimütig und mache mir ein Bild von ihm. Sein Kinn mit dem Bartflaum ist kräftig und gerade, seine kupferfarbenen Augen sind groß und ausdrucksvoll, seine Lippen voll. Ein kleiner billiger Ring hängt an seinem rechten Ohrläppchen. Ein hübscher Junge, der in den Leib eines Mannes hineinwächst, schon jetzt ist er kraftvoll gebaut. Wenn er ein Fürst oder ein berühmter Krieger wäre, hätte er jetzt schon ganze Harems, die um seine Aufmerksamkeit wetteifern. Aber so ist seine raue Schönheit in seiner armseligen und schlecht sitzenden Kleidung verborgen. Ich sehe die Narben auf seinen Händen und an den Beinen. Die Götter haben diesen Jungen vernachlässigt.
Seufzend sage ich: »Du siehst aus, als ob dich ein Pferd getreten hätte. Komm, steh auf.«
Ich halte ihm meine Hand hin, aber er weicht zurück, mit großen, misstrauischen Augen.
Einen Moment lang mustern er und ich uns gegenseitig unter den pulsierenden Sternen. Sein keuchender Atem spricht von Erschöpfung, aber er ist so angespannt wie eine in die Ecke getriebene Katze, bereit zur Flucht wartet er ab, was ich tun werde. In meinem Kopf dreht sich noch immer alles, nachdem sich die Ereignisse überstürzt haben: der erste Mensch, den ich seit fünfhundert Jahren gesehen habe, die wahnsinnige Flucht aus den einstürzenden Ruinen, die gewaltige Wüste, nachdem ich so viele Jahrhunderte in meine Lampe eingesperrt war. Ich schwanke ein wenig und brauche einen Moment, um Erde und Himmel unterscheiden zu können.
»Ich kann dir nichts tun«, sage ich. Meine Hände ballen sich an meinen Seiten zu Fäusten, und ich zwinge meine Finger, sich entwaffnend zu öffnen. »Die Magie, die uns aneinander bindet, hindert mich daran, dir etwas zu tun. Hab keine Angst.«
»Ich habe keine Angst.«
»Hast du noch nie einen Dschinn gesehen?«
Der Junge räuspert sich, starrt mir noch immer in die Augen. »Nein, aber ich habe Geschichten darüber gehört.«
Ich drehe ihm den Rücken zu und schaue zu den Sternen hoch. »Natürlich hast du das. Geschichten über Ghule, nehme ich an, die Seelen verschlingen und sich in die Haut ihrer Beute kleiden. Über Ifrite, nur Feuer und Flamme und keine Spur von Gehirn. Oder vielleicht meinst du die Mariden, klein und süß, bis sie dich in ihren Pfützen ertränken.«
Er nickt langsam und richtet sich auf, wischt sich Sand von den Handflächen. »Und den Scheitan, den Mächtigsten von allen.«
Mir läuft es eiskalt den Rücken hinunter. »Ja, natürlich.«
»Sie stimmen also? Diese Geschichten?«
Als ich mich zu ihm umdrehe, warte ich einen Moment, ehe ich antworte: »Wie die Dichter sagen: Geschichten sind durch Lügen erzählte Wahrheit.«
»Du wirst also meine Seele verschlingen?«, fragt er, als sei das eine Herausforderung. »Oder mich ertränken? Was für eine Sorte Dschinn bist du denn eigentlich?«
Mit einem Rauchwirbel verwandele ich mich in einen weißen Tiger und kauere vor ihm, während mein Schwanz hin und her peitscht. Er sieht staunend zu und weicht ein bisschen zurück, als er meine ausgefahrenen Krallen und meine goldenen Augen sieht.
»Was bist du?«, flüstert er.
Sollte ich ihm sagen, was – wer – ich wirklich bin? Dass noch jetzt Legionen aus wütenden Dschinn – Ghule, Mariden, ein Dutzend anderer Schreckensgestalten – auf uns zugestürmt kommen könnten? Wenn er auch nur einen Funken Verstand hat, wird er meine Lampe aufgeben und so viele Meilen zwischen uns legen, wie er nur kann … aber ich wäre dann vollkommen hilflos. Solange er die Lampe in den Händen hält, habe ich wenigstens eine Chance und kann kämpfen.
»Wie hast du mich gefunden?«, frage ich. So viele Jahrhunderte, und dann ist dieser glücklose junge Mann der Einzige, der mein Gefängnis entdeckt hat. Nach dem letzten Gefecht, nachdem du gefallen warst, Habiba, hat meine Sippe mich in den Garten geworfen, den ich für dich geschaffen hatte. Hier kannst du in der Finsternis verrotten, Verräterin, sagten sie. Und so viele Jahre lang war ich sicher, dass dies mein Schicksal sein würde. Aber dann, gegen jegliche Hoffnung, tauchte dieser Knabe auf.
»Ich bin aus Parthenien.« Als er mein verständnisloses Gesicht sieht, fügt er hinzu: »Zwei Wochen im Sattel, im Westen. An der Küste. Und wie ich dich gefunden habe? Ich wurde hergeführt. Hiervon.«
Von seinem Finger zieht er den Ring, den er vorhin umgedreht hat. Er legt ihn auf seine Handfläche, und nach kurzem Zögern hebe ich ihn auf. Ein Prickeln in meinen Fingern sagt mir, dass der Ring aus Magie geschmiedet wurde. Er kommt mir bekannt vor, und doch bin ich sicher, dass ich ihn noch nie gesehen habe. Es ist ein schlichter Goldreif, aber in die Innenseite sind Symbole eingeritzt, Symbole, die von Zeit und Feuer verwischt wurden.
»Und du sagst, der hat dich zu mir geführt?« Ich richte mich auf und starre ihn an.
Er nimmt den Ring von meiner Handfläche. »Als ich … äh, ihn gefunden habe, fing er an, mir zuzuflüstern. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich konnte ihn nicht zum Schweigen bringen. Selbst, wenn ich ihn abgenommen habe und wegwerfen wollte, habe ich ihn immer weiter gehört. Also dachte ich, da kann ich doch mal nachsehen, was er eigentlich will.«
»Was hat er gesagt?«
»Es waren eigentlich keine Wörter …« Er schließt die Hand um den Ring und sieht jetzt wie gehetzt aus. »Ich wusste nur, er wollte, dass ich ihm folge und er mich zu etwas Wichtigem führen wollte. Ich wusste nicht, was das war. Nur, dass ich es in Erfahrung bringen müsste, als ob er mich verzaubert hätte oder so etwas. Als ich deine Lampe gefunden habe, ist er zum ersten Mal seit Wochen verstummt, und also vermute ich … er hat mich zu dir geführt.«
Ich frage mich, ob er wirklich so naiv ist, wie er tut. Vielleicht ist er ja ein einfacher Bettler, der über einen uralten und mächtigen Talisman gestolpert ist, ohne dessen wahren Wert zu begreifen. Der Ring ist verzaubert und soll seinen Träger zu mir bringen. Aber wer hat ihn erschaffen? Er ist sehr alt, vermutlich wurde er zu der Zeit geschmiedet, als ich von meinem Stamm in den Juwelengarten verbannt wurde. Warum wird er erst jetzt benutzt, und warum von einem dermaßen ungeeigneten Wesen?
»Du bist also aus purer Neugier einem verwunschenen Ring den ganzen Weg bis nach Neruby gefolgt?«
»Na ja«, sagt er mürrisch und schaut zur Seite. »So einfach ist das nicht. Sagen wir, ich bin nicht der Einzige, der sich für den Ring interessiert. Ich wusste, er könnte zu etwas Wertvollem führen, und wertvolle Dinge zu finden, ist zufällig mein …« Er unterbricht sich und macht große Augen. »Moment mal. Was hast du gesagt?«
Ich runzele die Stirn. »Ich habe gesagt, es ist seltsam, dass pure Neugier …«
»Nein, das nicht. Du hast gesagt, dass diese Stadt hier Neruby genannt wird.«
»Natürlich«, erwidere ich.
Er atmet tief durch, tritt einen halben Schritt zurück und mustert mich von Kopf bis Fuß, als ob er mich zum ersten Mal sähe. Als er dann wieder etwas sagt, ist seine Stimme gepresst, erregt, atemlos.
»Ich weiß, wer du bist«, sagt er.
Etwas an seinem Tonfall lässt mein Rauchherz flattern, und ich gehe in Verteidigungsstellung. »Ach? Und wer, oh Knabe aus Parthenien, bin ich also?«
Er nickt vor sich hin und seine Augen leuchten. »Du bist sie! Du bist diese Dschinny! Oh, ihr Götter. Oh ihr großen grausamen Götter! Du bist es, die den Krieg ausgelöst hat!«
»Entschuldige?«
»Du bist die Dschinny, die diese berühmte Königin verraten hat – wie hieß sie doch noch gleich? Roshana? Sie versuchte, zwischen Dschinn und Menschen Frieden zu stiften, aber du hast dich gegen sie gewandt und die Fünfhundert Kriege ausgelöst.«
Mir wird kalt. Ich will, dass er aufhört, aber den Gefallen tut er mir nicht.
»Ich habe die Geschichten gehört«, sagt er. »Ich habe die Lieder gehört. Du wirst die Holde Verräterin genannt, die Menschen verzaubert hat, mit ihrer …« Er unterbricht sich und schluckt. »Deine Schönheit. Du hast ihnen alles versprochen, und dann hast du sie ins Verderben gestürzt.«
Tausendundeine Antwort drängt sich auf meiner Zunge, aber ich schlucke sie alle hinunter, vergrabe sie tief, tief unten in meinem Herzen aus Rauch. War es zu viel gehofft, Habiba, dass fünfhundert Jahre ausreichen würden, um die Vergangenheit zu begraben? Sie singen Lieder über uns, alte Freundin. Dieser Knabe, in seinen Lumpen und seiner Armut, weiß, wer ich bin, weiß, wer du bist, weiß, was ich dir angetan habe. Und wie kann ich es abstreiten? Unter unseren Füßen liegen die Ruinen deiner Stadt. Er hat sie mit seinen eigenen Augen gesehen. Und warum sollte ich verhehlen, wer ich wirklich bin? Die Holde Verräterin. Ein passender Name. Ich füge ihn zu der langen Liste anderer Namen hinzu, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe, wie Treibholz in meinen Fußspuren, und viele davon sind viel weniger schmeichelhaft.
Ich atme langsam aus und zucke mit einer Schulter. »Und was jetzt? Willst du mich wegwerfen? Mich wieder begraben?«
Er lacht, ein kaltes, scharfes Geräusch. »Dich wegwerfen? Wo du mir drei Wünsche gewähren kannst? Würde ich einen Beutel voll Gold wegwerfen, nur weil ich ihn in einem Misthaufen gefunden habe?« Er zuckt zurück. »So war das nicht gemeint. Es ist nur alles so … Ich muss nachdenken.«
Ich sehe zu, wie er in einem engen Kreis umherläuft und sich immer wieder mit den Händen durch die Haare fährt, bis die fast aufrecht stehen. Als er endlich stehen bleibt, ist mir vom bloßen Zusehen schon fast schwindlig. Ich hatte fast vergessen, wie leicht ihr Menschen in Panik geratet, wie ihr immer hin und her springt, wie von Nektar trunkene Bienen. Und dieser Junge ist wilder als die meisten anderen Menschen, seine Energie strahlt aus ihm und wärmt die Luft, die ihn umgibt.
Er scheint endlich zu einem Schluss zu kommen, denn er läuft nicht mehr hektisch im Kreis, sondern sieht mir ins Gesicht und presst entschlossen die Zähne zusammen Ich muss den Kopf ein wenig in den Nacken legen, um seinen Blick erwidern zu können.
»Also. Drei Wünsche. Egal, was?«
»Alles auf dieser Welt, wenn du bereit bist, den Preis zu zahlen.«
Er kneift die Augen zusammen. »Erzähl mir von diesem Preis.«
Seufzend hole ich eine kleine Flamme in meine Hand und lasse sie über meine Finger tanzen wie die Münze eines Scharlatans. »Jeder Wunsch hat seinen Preis, oh mein Gebieter. Du – oder ich – erfahren meistens erst, was dieser Preis ist, wenn er bereits bezahlt worden ist. Vielleicht wünschst du dir großen Reichtum und musst dann feststellen, dass er von Dieben gestohlen worden ist. Vielleicht wünschst du dir einen mächtigen Drachen, der dich durch die Luft trägt, und dann verschlingt er dich, sowie ihr gelandet seid. Wünsche neigen dazu, sich selbst zu verzerren, und nichts ist gefährlicher, als wenn deine Herzenswünsche erfüllt werden. Die Frage ist, bist du bereit zu diesem Glücksspiel? Wie viel bist du bereit zu verlieren? Wofür würdest du alles aufs Spiel setzen?«
Nun werden seine Augen hart, und ich sehe, dass er genau weiß, was er will. Er dreht sich um und geht los, seine Schritte gleiten im Sand aus. Ich folge ihm und starre seinen zerlumpten Mantel an, der sich im über die Dünen peitschenden Wind bewegt. Während ich auf seine Antwort warte, lasse ich meine kleine Flamme von einer Hand in die andere wandern.
»Du hast einst ein Königreich zerstört«, sagt er nach einem Augenblick, und seine Stimme ist leise und drohend, eine düstere Strömung tief unten im Meer. »Du sollst mir helfen, das noch einmal zu tun.«
Ich schließe die Finger und meine Flamme verschwindet in einem Rauchwölkchen. »Ach. Du bist also eine Art Revolutionär?«
Wieder dieses kurze, bittere Lachen. Er geht weiter, und der Wind trägt seine Worte über seine Schulter. »Eine Einmannrevolution, das bin ich.«
»Sehr gut.« Ich überhole ihn, drehe mich um und gehe dann rückwärts, um ihm in die Augen schauen zu können. »Was ist dein erster Wunsch, mein Gebieter?«
»Also, erst mal, nenn mich nicht immer Gebieter, als ob ich ein gottloser Sklavenhändler wäre. Ich habe einen Namen.«
Namen sind gefährlich. Sie sind persönlich. Und als ich zuletzt persönliche Beziehungen zu einem Menschen hatte, ist alles tödlich geendet. Die Beweise dafür sind nur wenige Handbreit unter meinen Füßen vergraben.
»Den will ich nicht wissen.« Es ist besser so.
»Wenn ich dir meinen Namen nenne«, sagt er, »dann musst du mir deinen sagen.«
Ich bleibe stehen. »Ich habe keinen Namen.«
Er hält neben mir an und sieht mir in die Augen, den Kopf ein wenig schräg gelegt, wie ein Schachspieler, der auf meinen Zug wartet. »Das glaube ich dir nicht.«
Wie kann jemand, der so sterblich ist, zugleich dermaßen irritierend sein? »Wird in euren Liedern mein Name nicht erwähnt?«
Seine Lippen verziehen sich zu einem halben Grinsen, und er geht weiter, während der Wind ihm die Haare ins Gesicht bläst. »Keinen, den du gern hören würdest, stelle ich mir vor.«
Er führt an und ich folge, ein Knabe und eine Dschinny, die durch die mondblauen Dünen schreiten. Unter unseren Füßen bewegt sich der Sand auf trügerische Weise. Auf halber Höhe an einem besonders steilen Hang gibt der Boden plötzlich nach, und ich schreie auf, als ich rückwärts rutsche.
Aber plötzlich packt eine Hand meine, hält mich fest, obwohl ich mich schon halb in Rauch verwandelt habe, um mich zu fangen.
»Vorsicht, Rauchwölkchen«, sagt der Junge und zieht mich auf den Dünenkamm. »Du hast mir meine Wünsche noch nicht gewährt. Da kann ich nicht zulassen, dass du schon wieder verschwindest.«
»Ich heiße nicht Rauchwölkchen.« Ich reiße meine Hand zurück. Seine Berührung brennt noch immer, das Echo seines Herzschlags hallt in mir wider. Ich schaue weg und schüttele Sand aus meinen Gewändern. Ich habe meine Kleidung aus reicher Seide in weiße Baumwolle verwandelt, um mit der Wüste zu verschmelzen.
»Doch, solange du mir keinen besseren Namen nennst.«
»Wohin gehen wir?«
»Wohin? Langweilst du dich schon? Ich hätte gedacht, du würdest dir gern mal die Beine vertreten, nachdem du in dieser Höhle – wie lange hast du da überhaupt gelegen?«
»Seit Ende des Krieges. Seit fünfhundert Jahren.«
Er stößt einen Pfiff aus und gleitet auf der anderen Seite der Düne hinunter, und ich verwandele mich in eine kleine silberne Katze und springe hinter ihm her, um unten dann wieder zu einem Mädchen zu werden.
Er bleibt für einen Moment stehen und sieht mir zu. Er hat die Lampe an seinem Gürtel befestigt, und seine Hand streicht zerstreut darüber. Es ist eine Angewohnheit, die viele Lampenbesitzer entwickeln, und auch er hat sie schon übernommen.
»Wie alt bist du?«, fragt er.
Ein kühler Wind weht durch die Dünen, weht mir die Haare übers Gesicht und lässt seinen geflickten Mantel rascheln.
»Dreitausend Jahre und eintausend dazu.«
»Große Götter«, sagt er leise. »Aber du siehst nicht älter aus als ich.«
»Aussehen trügt.« Ich sage ihm nicht, dass dieses Gesicht, das ich trage, gestohlen ist, und seine Besitzerin seit fünfhundert Jahren tot. Natürlich habe ich ein eigenes Gesicht, eines, das ein wenig jünger ist als deins. Ich war sechzehn an dem Tag, an dem ich zum ersten Mal in die Lampe gebannt wurde, und damals hörte ich auf zu altern und wurde zu der zeitlosen Sklavin, die ich jetzt bin. Ich habe kaum das Verlangen, dieses Gesicht noch einmal zu benutzen. Es ist das Gesicht, das dich verraten und deinen Tod verursacht hat, Habiba. Das Gesicht eines Ungeheuers.
Manchmal fühle ich mich so alt wie die Sterne, aber meistens fühle ich mich nur so wie an jenem Tag – verloren, klein und ängstlich. Doch das behalte ich für mich. Ich schiebe mein Kinn vor und erwidere herausfordernd seinen Blick.
»Seltsam«, murmelt er.
»Was ist seltsam?«
»Es ist bloß …«, er schiebt seine Haare nach hinten. »Du bist gar nicht wie die Dschinny aus den Geschichten und Liedern. Diese Dschinny war ein Ungeheuer. Du kommst mir … anders vor.«
Dann dreht er sich um und beginnt, die nächste Düne hochzustapfen, und er wickelt seinen Mantel fest um sich zusammen, damit der Wind nicht daran reißt.
Ich bleibe noch einen Moment stehen und sehe ihn an. »Zahra.«
Er hält inne und blickt sich über seine Schulter um. »Was?«
»Mein Name«, stammele ich. »Ich meine … einer davon. Du kannst mich Zahra nennen.«
Er dreht sich vollständig um und sein Grinsen ist breit und hell wie der Mond. »Ich bin Aladdin.«
Kapitel Drei
Wir wandern zwei Stunden weiter, dann sagt Aladdin endlich: »Da sind wir.«
Er fällt auf alle viere und kriecht langsam eine Düne hoch, und als wir oben angekommen sind, legt er sich flach hin und winkt mir, es ihm gleichzutun. Langsam, vorsichtig schaut er über den Kamm aus vom Wind verwehtem Sand, und seine Miene verdüstert sich.
»Da«, murmelt er.
Ich schaue hinüber und sehe ein kleines Lager, das im Windschutz einer kleinen Senke aufgeschlagen worden ist. Mehrere Soldaten sitzen um ein Feuerchen aus Pferdeäpfeln, ihre Reittiere sind in der Nähe angebunden. Ein gut gekleideter junger Mann steht allein zwischen zwei Zelten und studiert mit hochgezogenen Schultern im Feuerschein eine Landkarte.
»Das ist er. Darian rai Aruxa, der Prinz von Parthenien.«
»Ein Freund von dir?«
Aladdin schnaubt und lässt sich ein Stück nach unten gleiten, bis der Dünenkamm den Blick auf das Lager versperrt. »Er verfolgt mich seit zwei Wochen, seit ich Parthenien verlassen habe. Ich kann ihm da auch eigentlich keinen Vorwurf machen. Er will den hier haben.« Aladdin wirft den Ring in die Luft und fängt ihn mit einer Hand wieder auf.
Ich hebe eine Augenbraue. »Du hast ihm den Ring gestohlen.«
Seine Augen sind hart wie Diamanten und funkeln im Sternenlicht. Seine Miene verändert sich, und plötzlich sieht er älter, härter, wütender aus. Wie eine Wolke, die sich vor die Sonne schiebt, so schnell geht diese Veränderung, dass ich sie fast nicht bemerkt hätte, aber sie lässt mich frieren.
»Zahra, wenn ich jemandem den Tod wünschte, könntest du dafür sorgen?«
Äußerlich bin ich Stein, aber innerlich bebe ich wie eine stürmische See. Ich hasse diesen Wunsch mehr als jeden anderen. Es ist grausam und feige, und ich ändere meine Ansicht über diesen jungen Dieb. In ihm gibt es eine Düsternis, die ich noch nicht gesehen hatte. »Ich könnte schon, aber der Preis wäre hoch.«
Er schluckt, seine Augen sind tief und gejagt. »Was ist der Preis?«
»Ich weiß es nicht. Aber du würdest es bald genug erfahren, glaube ich. Wünschst du dir den Tod dieses Darian?«
»Er hat ihn verdient«, flüstert Aladdin.
»Worauf wartest du dann? Los, mein Gebieter. Sprich die Worte. Verwünsche das Leben eines Menschen.«
Er wendet seinen Blick ab. »Du kannst das auch anders ausdrücken.«
»Ist es nicht die Wahrheit?« Ich stehe auf und gehe auf den Kamm der Düne, worauf ein Fluss aus Sand an der Seite hinunterströmt. Aladdin gerät in Panik und winkt mir, mich zu ducken.
Ich soll für ihn also einen Todeswunsch ausführen, ja? Soll seine Drecksarbeit erledigen, seine Feinde ausschalten, während er im Schatten sitzt? Nicht, wenn ich auch noch ein Wort mitzureden habe. Ich stehe so, dass ich vom Lager her deutlich zu sehen bin, und sage laut: »Hier sind wir, Aladdin. Das ist deine Chance. Sag die Worte – es ist nicht schwer. Ich wünsche, ich wünsche …«
»Zahra! Runter!«
Aber es ist zu spät. Ich bin entdeckt worden. Die Männer unten schreien los, und ihr Stahl singt, als sie ihre Schwerter ziehen. Sie rufen, ich solle aufhören.
Aladdin rennt auf den Dünenkamm, klemmt sich seinen Mantel unter einen Arm, um nicht darüber zu stolpern. Mit seiner anderen Hand zieht er die Lampe von seinem Gürtel.
»Du wahnsinniges Wesen!« Er kommt rutschend zum Stillstand, und flucht, als er die Männer sieht, die eilig in den Sattel springen. »Und dabei hätte ich fast angefangen, dich zu mögen!«
Ich bewege die Hand durch die Luft. »Da ist er. Dein Todfeind. Also los. Sprich den Wunsch.«
»Ich …« Er erwidert meinen Blick und alle Farbe strömt aus seinem Gesicht.
»Worauf wartest du noch?«
Unter uns wenden die Männer ihre Pferde in unsere Richtung. Der Prinz führt sie an und schwenkt seinen Krummsäbel.
»Aladdin! Sie haben uns fast erreicht! Entscheide dich endlich!«
Er sieht die Soldaten und dann mich an, sein Mund öffnet sich, aber auf seiner Zunge liegt kein Wunsch. Ich achte nicht auf die Männer, die auf uns zu galoppieren, packe Aladdin am Mantel und ziehe ihn zu mir. Sein verängstigter Blick haftet an meinem.
»Entscheide dich«, sage ich. »Entscheide dich jetzt. Was bist du denn für ein Mann? Bist du wirklich einer, der seinen Feinden aus dem Schatten heraus den Tod an den Hals wünscht?«
»Ich wünsche …« Er verstummt und fährt sich mit der Zunge über die Unterlippe.
»Zahra, runter!«
Aladdin wirft sich über mich, und ein Pfeil, der auf mein Herz zugejagt ist, trifft ihn in der Schulter. Er schreit auf, stürzt, rutscht die Düne hinunter und verliert die Lampe aus dem Griff.
Sofort habe ich die Kontrolle über meinen Körper verloren. Mein Fleisch verwandelt sich in Rauch, und ich werde durch die Luft und in die Tülle der Lampe und nach unten gesaugt. Dort wirbele ich immer wieder herum, scharlachroter Rauch, und richte meinen sechsten Sinn so weit aus, wie ich nur kann.
Meine Lampe ist zum Fuß der Düne gekullert und liegt in Aladdins Nähe. Er läuft auf mich zu, und ich spüre den Schmerz in seiner Schulter, der in heißen, wütenden Wellen von ihm ausstrahlt. Aber ehe er mich erreicht hat, sind sie da. Mit hämmernden Hufen schwärmen die Reiter um uns herum aus, ihre Pferde bäumen sich auf und wiehern grell. Sie sind vage Umrisse, die um mich herum aufragen, eher gespürt denn gesehen, während ich mich so anstrenge, wie es überhaupt nur möglich ist, um den sich jetzt überstürzenden Ereignissen zu folgen.
Die Reiter umkreisen uns und rufen sich gegenseitig aufgeregt zu, sie bleiben in einer gewissen Entfernung zur Lampe und treiben Aladdin davon fort. Er verwünscht die Männer, und ich spüre, dass er schwankt, weil seine verletzte Schulter so entsetzlich wehtut.
»Still!«, donnert eine Stimme.
Die Männer bringen ihre Pferde zum Stehen und verstummen, als einer der Reiter absteigt. Ich kann seine Erscheinung nicht spüren, fühle aber das Vibrieren seiner Schritte. Als er etwas sagt, ist seine Stimme jung und melodisch. »Das muss ich dir lassen, du Abschaum. Du bist schlüpfrig wie ein Schatten. Ich würde dich vielleicht sogar in meine Dienste nehmen, wenn ich nicht dabei wäre, dir die Kehle aufzuschlitzen.«
»Darian.« Aladdins Stimme klingt angespannt und doch auf spöttische Weise höflich. »Hast ganz schön lang gebraucht, um mich einzuholen.«
»Prinz Darian heißt das, du Dieb.«
»Was hat dein Vater gesagt, als er gemerkt hat, dass ich deinen kostbaren Zauberring gestohlen habe? Einfach so von deinem Finger, als du geschlafen hast! He, Jungs, habt ihr gewusst, dass euer Prinz schnarcht wie ein altes Weib?«
Selbst durch meine Bronzewände höre ich den lauten Schlag, mit dem Darian Aladdin zu Boden schickt. Ich fühle eine auflodernde Hitze, als meine Lampe aus dem Sand aufgehoben wird. Neugierige Finger erforschen die bronzene Oberfläche, folgen der sinnlichen Kurve der langen spitzen Tülle.
Darian schnaubt und seine Finger schließen sich um die Lampe. Sein Puls hämmert mir entgegen und hallt in meinem engen Gefängnis wider. Ich kauere vor der Wand und halte mir die Ohren zu. »Dafür, dass sie so mächtig und unbezahlbar ist, ist sie ganz schön schäbig, was?«
»Sie ist wertlos«, sagt Aladdin. »Nur ein altes Erinnerungsstück.«
»Sie hat dir so wenig genutzt, dass du fast recht haben könntest. Mal sehen … die Geschichten sagen immer …« Darian fängt an, die Lampe zu reiben, und so einfach, als ob ich ausatmete, verwandele ich mich in Rauch und ströme zum zweiten Mal in dieser Nacht hinaus.
Mein neuer Gebieter seufzt lange und zufrieden, als ich in die Luft wirbele, es ist eine viel zahmere Vorstellung, als ich sie vorhin für Aladdin gegeben habe. Ich bin ein wenig enttäuscht von dem Straßenjungen, der mich so schnell verloren hat.
Ich verdichte mich zu einem Tiger, der so weiß ist wie der Mond, und der sich vor Darian in den Sand hockt. Darian ist nicht viel älter als Aladdin, aber sein Gesicht, auch wenn er gut aussieht, ist runder und weicher.
Aladdin liegt vor ihm auf einem Knie und presst sich mit der Hand den Mantel gegen die Schulter. Er hat den Pfeil herausgerissen, und der liegt neben ihm im Sand. Aladdins Gesicht ist bleich, aber seine Augen brennen. Er sieht mich schweigend an.
»Zittere, Sterblicher«, sage ich mit rauer Tigerstimme, während meine Blicke zwischen meinem alten Gebieter und dem neuen hin und her huschen. »Denn ich bin die Dschinny der Lampe und …«
Mit einem wilden Schrei springt Aladdin plötzlich auf und unternimmt einen verzweifelten Versuch, die Lampe an sich zu reißen. Ehe er sie erreichen kann, schwenkt einer der anderen Reiter – der Schütze – seinen Bogen, trifft Aladdin am Ohr und wirft ihn wieder zu Boden.
Schlangenschnell steht Darian über ihm, tritt ihn in den Bauch und trampelt dann auf Aladdins verletzter Schulter herum.
Aladdin zischt und scheint einer Ohnmacht nahe, aber er klammert sich an der Lampe fest und versucht, mit der anderen Hand Darians Knöchel zu fassen.
Der Prinz lacht über diese ohnmächtigen Bemühungen und tritt ihn wieder, diesmal gegen die Brust. Grunzend rollt sich Aladdin zusammen und spuckt Blut in den Sand.
Ich sehe zu wie eine Statue, sage mir, dass nichts hier von Bedeutung ist, nichts hier eine Rolle spielt, ich ja doch nichts unternehmen kann. Und warum sollte dieser Junge mir leidtun? Ich kenne ihn nicht. Er dürfte für mich keine Rolle spielen.
Aber ich zucke zusammen, als Darian ihn aus purer Gemeinheit ein letztes Mal tritt.
Er hat den Wunsch nicht ausgesprochen.
Sie könnten ihn umbringen, aber er würde den Todeswunsch trotzdem nicht aussprechen.
Dann steht der Prinz über Aladdin, und er keucht, während seine Blicke zwischen mir und dem verletzten Jungen hin und her wandern. Er beugt sich vor, zieht den Ring von Aladdins Finger. Er wirft ihn hoch in die Luft, dann fängt er ihn auf und lässt ihn in seine Tasche gleiten, danach spuckt er Aladdin an.
»Ich habe ihn mir zurückgeholt, du mieser, dreckiger Dieb.« Er packt Aladdin vorn am Kittel und zieht ihn auf die Knie. Aladdins Kopf pendelt hin und her, aber er kann den Prinzen doch wütend anstarren.
»Wer hat dir von dem Ring erzählt?«, will Darian wissen. »Warum funktioniert er bei dir und nicht bei mir?«
Aladdin lacht nur, auch wenn es erstickt klingt. Das Feuer weicht nicht aus seinen Augen. Darian zieht einen Krummdolch aus seiner Schärpe und presst die Schneide gegen Aladdins Kehle.
»Mach schon«, sagt Aladdin durch zusammengebissene Zähne, und aus seinen Augen lodert der Trotz. »Tu es. Mach dir ein einziges Mal die Hände schmutzig. Aber sei vorsichtig. Dein Vater ist nicht hier, um hinter dir sauber zu machen.«
»Du bist nicht eine einzige weitere Minute meiner Zeit wert. Du kannst dich glücklich schätzen, Abschaum. Niemand bestiehlt mich und kommt so billig davon.« Er bohrt die Klinge in Aladdins Hals, Blut quillt hervor, und ich erstarre und wende mich ab.
Ich habe Tausende von Männern sterben sehen, Habiba, aber bei einem Mord fühle ich mich immer kalt und hohl. Wie grausam die Menschen sein können. Ich trauere um diesen Dieb. Sein Geist ist stark und wild, aber offenbar ist er verloren.
Das muss nicht sein.
Dieser Gedanke kommt fast von nirgendwo, er klingt so sehr wie du, dass ich fast glaube, dein Geist stehe hinter mir. Ich schaue mich zu dem Dieb um, der sich gegen die Klinge des Prinzen wehrt.
In ihm ist etwas von dir, Habiba. Eine gewisse Art von unbeugsamem Stahl. Er hat für mich einen Pfeil abgefangen!
Und du weißt, ich konnte noch nie einer Möglichkeit widerstehen, Ärger zu machen.
Ich erhebe mich auf alle vier Pfoten und mache mich stark, während meine Gedanken schon widersprechen. Was machst du denn da, du törichte, törichte Dschinny? Das hast du doch alles schon einmal erlebt – du weißt, es wird mit einer Katastrophe enden! Erinnerst du dich an Roshana? Erinnerst du dich an den Krieg?
Aber ich kann jetzt nicht mehr zurück. Ich brülle den Prinzen wütend an und verwirre ihn damit dermaßen, dass er Aladdin loslässt, ehe er die Schlagader des Prinzen aufschlitzen kann. Blitzschnell wirft sich Aladdin zurück und schleudert Darian Sand in die Augen. Der Prinz schreit auf und stolpert, schlägt blind mit seinem Dolch um sich. Seine Männer brüllen los und springen vor, aber schon hat Aladdin Darian die Lampe entrissen und weicht der vom Prinz geschwungenen Klinge aus.
Ich spüre, wie die Macht des Besitzes vom Prinzen auf den Dieb überspringt, und mir wird schwindlig. So schnell meinen Gebieter zu wechseln stürzt mich in Verwirrung, während meine Dienstpflicht umgekehrt wird und die Verbindung zwischen Gebieter und Dschinny zusammenbricht und neu entsteht und Aladdin und ich abermals aneinander gebunden sind.
Als ein halbes Dutzend Schwerter auf seinen Kopf zielt, ruft Aladdin: »Ich wünsche, jetzt sofort zu Hause zu sein.«
Kapitel Vier
Für einen Moment ist alles erstarrt: Das Mondlicht, das die auf Aladdins Hals gerichteten Schwerter glitzern lässt. Der Wutschrei des Prinzen. Die endlose, kühne Hoffnung in Aladdins Augen.
In dieser Ewigkeit zwischen zwei Herzschlägen überlege ich.
Ich träume.
Ich erschaffe.
Die Zeit setzt sich wieder in Bewegung, und ich werde aus einem Tiger zum Mädchen, gewandet in karminrote Seide, mein Gesicht verschleiert. Die Klingen werden von einem dünnen Vorhang abgewehrt, gleiten ab und bringen die Männer aus dem Gleichgewicht. Ich gehe nahtlos über in die nächste Bewegung. Der Wille des jungen Diebes fließt in goldenen Strömen dahin. Er ist der Faden, mit dem ich webe, die Farbe, mit der ich male, das Element, mit dem ich erschaffe.
Sand erhebt sich vom Boden. Er wogt und wirbelt und lässt Aladdins Gewänder flattern. Ich rufe den Wind und verzaubere ihn, lasse ihn meinen verdutzten Gebieter von Windspiralen einhüllen. In der Luft webe ich die uralten Lieder der Menschen von Ghedda, die jetzt unter der kalten Asche des Wisperberges begraben liegen.
Die Kraft des wirbelnden Windes schleudert die Männer zurück und sie landen auf dem Boden. Darian fällt auf die Knie und versucht verzweifelt, auf die Beine zu kommen. Er hält sich eine Hand vors Gesicht und faucht vor Wut.
Ich gleite in den Wirbelwind und trete Aladdin gegenüber, der mich aus Augen wie Zwillingsmonde anschaut. Er ist halb betäubt und presst die Lampe an sich. Blut läuft aus seinem Mundwinkel und über seinen Hals.
Wünsche werden im Willen von Männern und Frauen geboren, und sie sind der wahre und reine Quell der Macht, die alle Menschen besitzen. Nur wenige wissen, dass es diese Macht überhaupt gibt. Ich erinnere mich an deinen Willen, Habiba. Du leuchtetest wie der Mond, ein listiges Funkeln an einem dunklen Himmel, geheimnisvoll und unbeherrscht. Aladdin brennt wie die Sonne, vertreibt jeden Schatten und wärmt den Sand. Ich ziehe seinen Willen zu mir, halte ihn in der Dunkelheit hoch wie eine Flamme, beleuchte den Weg. Ich schließe die Augen und folge mit meinem geistigen Blick dem Weg seiner Gedanken.
Ich sehe eine dunkle Straße, Pfützen aus Mondlicht auf den Pflastersteinen. Der Geruch von Salz und Rauch, leinene Vordächer, die sich im Mitternachtswind leise bewegen. Weniger ein Punkt auf einer Landkarte und mehr ein Bereich in der Seele, aber es ist ein Pfad, dem ich folgen kann.
Ich öffne die Augen und klatsche abermals in die Hände.
Die Wüste zieht sich zurück, der Horizont nähert sich, und beim nächsten Herzschlag verschwinden Darian und seine Soldaten, bleiben zurück, als Aladdin und ich den unendlichen Raum durchqueren. Ich ziehe das Land hoch, wie Stoff, den ich zwischen den Fingerspitzen halte, und ich führe Aladdin und mich hindurch wie eine scharfe Nadel. Aladdins Blick haftet die ganze Zeit in meinem, während eine Haare und sein Mantel im Wind wehen. Winzige Sandkörner hängen in seinen Wimpern. Er hält den Atem an, sein Körper ist starr und seine Hände halten die Lampe umklammert.
Ohne uns zu bewegen, durchqueren wir Wüste und Himmel, Sand und Stein, einen Berg, der sich gespensterhaft in der Dunkelheit erhebt. Der Berg Tissia. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, vor einem halben Jahrtausend, war er ins Blutlicht der Morgendämmerung getunkt. Du und ich standen auf seinem Gipfel, Habiba, und sahen die riesigen Armeen der Dschinn, als sie aufzogen, um uns zu vernichten.
Dann schrumpft der Berg hinter uns und eine Stadt taucht auf, ein Blinken aus sanftem Licht am Rande des riesigen Maridionischen Meeres. Aladdins Parthenien. Die Stadt ist etwa eiförmig, von groben Mauern in Bezirke unterteilt und von einem Fluss in der Mitte durchschnitten, einem Fluss, der von Nordwesten her auf den großen Strom Qo und die dahinterliegenden Königreiche zueilt.
Mit einem leisen Ausatmen lasse ich die wenige Magie frei, die mir noch bleibt, und die Welt kommt zum Stillstand. Wind und Sand verschwinden, und Aladdin und ich stehen da, als hätten wir uns überhaupt nicht bewegt. Wir haben in Sekundenschnelle eine wochenlange Reise hinter uns gebracht.
Ich habe uns auf einer kleinen steinigen Böschung am Flussufer landen lassen, im Norden der Stadt. Von hier aus können wir auf Parthenien hinunterblicken. Die Stadt funkelt in der Nacht, und ich kann die Bewegungen der Fackeln sehen, die von den Wächtern über die Mauern getragen werden. Im Osten, hinter dem Meer, bricht langsam der Morgen an, und der Horizont ist eine rosig goldene Linie.
Aladdin bewegt sich jetzt, schnappt nach Luft, als ob er soeben aus tiefem Wasser aufgetaucht wäre.
»Das war …«, beginnt er, aber dann versagt seine Stimme. Er schaut auf die Lampe hinunter, und ich sehe, dass ihm gerade erst aufgegangen ist, wie unendlich deren Macht ist.
Ich zeige auf seine verwundete Schulter und den Schnitt an seinem Hals. »Wenn du dir das wünschst, kann ich dich heilen.«
»Diese Kratzer?«, erwidert er verächtlich. »Die brauchen nur kurz gesäubert zu werden. Aber was jetzt? Muss ich nicht irgendeinen Preis bezahlen?«
»Warte nur ab«, sage ich, schlage die Arme übereinander und sehe ihn an.
Er runzelt die Stirn und will antworten, aber dann würgt er und seine Haut wird aschgrau.
»Da haben wir’s«, sage ich und seufze. »So eine plötzliche Bewegung von einem Ort zum anderen führt fast immer dazu, dass man seine letzte Mahlzeit wieder hergeben muss. Kein schlechter Preis, im Vergleich zu manchen, die ich gesehen habe. Es wird bald vorübergehen.«
»Ich habe keine Mahlzeit zu mir genommen, die ich hergeben könnte«, stöhnt er.
Er macht einen Schritt auf den Fluss zu, dann aber stolpert er, und ich springe neben ihn und lege den Arm um ihn. Er erstarrt bei dieser Berührung und zieht sich fast zurück, ist aber zu schwach. Ich helfe ihm ans Wasser, und mit einem Jammerlaut lässt er sich daneben sinken und beugt sich vor, um aus seinen zusammengelegten Handflächen zu trinken. Er zittert zu sehr und vergießt das Wasser.
»Verdammt«, murmelt er, dann lacht er heiser. »Das ist so peinlich …«
Er verliert das Bewusstsein, seine Hand fällt ins Wasser, seine Wange liegt auf dem nassen Sand. Seine Haut ist noch immer aschgrau und fühlt sich heiß an.
Seufzend halte ich Ausschau in der leeren Landschaft. Die Dünen der Mahali liegen weit hinter uns, hier ist das Gelände steinig, und versprengt wachsen wilde Olivenbäume und verkrümmte Zedern. Irgendwo im Unterholz bellt ein Schakal zweimal auf. Mondlicht sickert durch die Bäume und verwandelt den Bach in flüssiges Silber.
Die Lampe hängt noch immer an Aladdins Gürtel – welch ein Glück. Wenn er sie verloren hätte, als er in Ohnmacht gefallen ist, wäre ich hineingesogen worden, bis er aufgewacht wäre, oder bis jemand anders sie gefunden und mich abermals herausgelassen hätte. Solange sie an Aladdins Körper hängt und solange er am Leben ist, bin ich in den unsichtbaren Umkreis der Lampe gebannt. Einhundertneunundvierzig Schritte. Ich habe sie oft und oft gezählt.
Ich drehe Aladdin auf den Rücken und reiße ihm Kittel und Mantel vom Leib, danach trägt er nur noch eine weite Hose und Lederstiefel. Seine Schulter ist von Blut verkrustet und die Haut um seine Wunde klebt. Ich tunke seinen Mantel in das Wasser und betupfe behutsam seine Haut, während meine Blicke über seinen Bauch und seine Brust wandern und nach weiteren Verletzungen suchen.
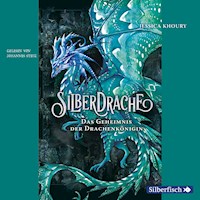




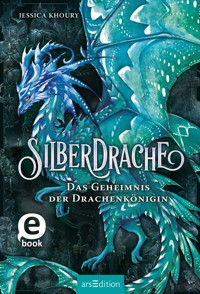













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









