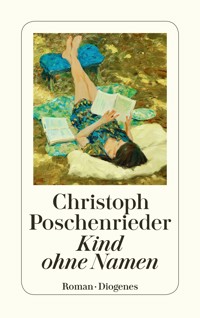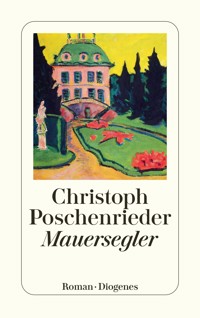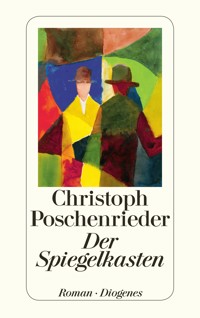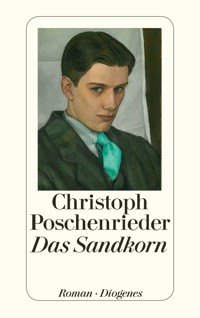11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie kennen sich seit der Kindheit und beginnen gerade, ihre eigenen Wege zu gehen, als plötzlich einer von ihnen als Mörder festgenommen wird. Er soll seinen Onkel aus Habgier erschlagen haben. In einem schier endlosen Indizienprozess wird das Unterste zuoberst gekehrt. Die Freunde kämpfen für den Angeklagten, denn er kann, er darf kein Mörder sein. Doch als 15 Jahre nach dem Urteil eine Journalistin sich der Sache noch mal annimmt, stellt sich die Frage der Loyalität wieder neu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Christoph Poschenrieder
Ein Leben lang
Roman
Diogenes
Das, was von einem Menschen gesagt wird, ist nichts; es kommt darauf an, wer es sagt. Der höchste Augenblick eines Menschen – daran hege ich nicht den mindesten Zweifel – ist der, wenn er im Staube niederkniet, sich an die Brust schlägt und alle Sünden seines Lebens bekennt.
Oscar Wilde, De Profundis
I.Aufwärts
Kontakt
Am besten: alle Gespräche, mitgeschrieben und Transkripte von Aufnahmen, die Mails, die Memos, das alles ausdrucken, die bekritzelten Zettel, Servietten, Zeitungsausrisse dazu und in Reihenfolge bringen.
Alles auf dem Teppich ausbreiten, Stapel machen, gelbe Klebezettel drauf.
Struktur, Struktur, Struktur.
Lass sie miteinander reden, lass sie übereinander reden.
Ordnen und sortieren.
Anfang, Mitte, Ende.
So wird eine Geschichte daraus.
Woher haben Sie meine Nummer?
Wer? –
Okay, das hätte ich mir denken können.
Das ist alles schon so lange her. Schlafende Hunde soll man nicht wecken.
Natürlich haben wir für ihn gekämpft, und wie. Er ist doch unser Freund. Oder war es. Das ist jetzt alles nicht mehr so sicher. Haben Sie denn keine Freunde?
Dann müssten Sie das kennen.
Warum sollte ich mit Ihnen reden? Sie drehen mir doch nur das Wort im Mund herum. Das war damals so, beim Prozess, das wird heute auch nicht anders sein. Ihr habt so einen Unsinn geschrieben. Und am Ende kommt heraus, dass ich nie an seine Unschuld geglaubt habe.
Nein, nein. Wissen Sie was: Rufen Sie mich nicht mehr an. Ich habe mit der Sache abgeschlossen. Soll er doch in seiner Zelle – fast hätte ich gesagt: verrotten.
Liebe _,
sehr gerne können wir uns einmal auf einen Kaffee treffen. Ich hätte diese Woche am Mittwoch und Donnerstagnachmittag Zeit.
Ich deutete es bereits in unserem Telefonat an, und seitdem ist es mir erst richtig bewusst geworden: Ich habe über die Sache viel nachgedacht, besonders in den letzten Jahren, aber auch viel verdrängt. Vielleicht ist es gut, einmal darüber zu sprechen. Manchmal glaube ich, wir alle zusammen waren … in einer Art Gefangenschaft. »In unsichtbaren Ketten.« Und es ist Zeit, sich davon zu befreien. Das klingt ein bisschen melodramatisch! Das kann ich Ihnen dann bei unserem Treffen erklären. Bis dahin behalten Sie bitte alles für sich. Es wäre mir sehr unangenehm, wenn die anderen wüssten, dass ich mit Ihnen rede. Über die Jahre ist das Misstrauen unter uns doch größer geworden.
Mein Gesprächsangebot ist allerdings (noch) keine Zusage, bei Ihrem Projekt mitzumachen.
Mit den besten Grüßen,
…
PS: Ich bin froh, dass Sie eine Frau sind, und auch wenn das ein Vorurteil ist, glaube ich, Sie werden sich besser in uns, unsere Gruppe, und was uns so bewegte, einfühlen können.
Sehr geehrte Frau _,
erlauben Sie mir, dass ich Ihnen schriftlich auf Ihre kürzliche telefonische Anfrage antworte. So habe ich mehr Zeit nachzudenken, die richtige Formulierung zu wählen, und Sie erhalten eine solide Grundlage, falls Sie mich zitieren wollen.
Was Sie vorhaben, finde ich sehr interessant, und ich werde versuchen, Sie dabei zu unterstützen – solange Sie mich nicht fragen, ob er diesen Mord begangen hat, denn darauf habe ich keine Antwort zu geben. Selbst wenn inzwischen an die 15 Jahre vergangen sind.
Als die Sache damals passierte, war ich Berufsanfänger in einer Rechtsanwaltskanzlei, weswegen ich immer auch einen professionellen Blick darauf hatte. Anders als meine Freundinnen und Freunde habe ich stets versucht, mich in die Rolle des Staatsanwalts und des Richters, des Anwalts sowieso, hineinzuversetzen. Ein wenig jedenfalls, denn wir waren ja alle so felsenfest überzeugt, Zeugen eines grandiosen und schändlichen Justizirrtums zu sein. Präziser: manche mehr, manche weniger.
Wie Sie aus unserem Vorgespräch wissen, arbeite ich jetzt in einer Wirtschaftskanzlei. Früher, während meiner Zeit als Staatsanwalt in einer mittelgroßen Stadt in Niederbayern, hatte ich ein Babyfoto auf meinem Schreibtisch stehen. Es stammte offenkundig aus einer früheren Zeit und alle möglichen Besucher meines Büros – Kollegen, Polizeibeamte und andere – fragten, ob das ein Bild meiner Oma sei, oder so ähnlich.
Ich sagte dann: Das ist Adolf Hitler als Baby.
Die meisten hielten das für einen Scherz, aber es stimmte.
Und ich glaube, die meisten verstanden auch meine Erklärung dafür: Jeder ist alles, und aus jedem kann alles werden. Machen wir uns doch nichts vor. Ein treuherziger Blick, die perfekte Kleidung, der sorgfältige Haarschnitt und die manikürten Fingernägel, ein fein komponierter Gesichtsausdruck: alles Fassade. Genauso, wie eine raue Erscheinung natürlich, die keineswegs auf verwerflichen Lebenswandel verweist. So wenig, wie zusammengewachsene Augenbrauen den Werwolf verraten.
Mir diente dieses Foto als Ermahnung, dass man sich von Äußerlichkeiten niemals leiten lassen darf. Niemals. Das gilt nach wie vor und erst recht in meiner Wirtschaftssozietät; das Hitlerfoto allerdings brauche ich dazu nicht mehr. Meine Mandanten finden so etwas nicht lustig.
Zum Freundeskreis halte ich lockeren Kontakt; es gab zwar noch eine Weile nach dem Urteil diese jährlichen Treffen in der Hütte am See, aber inzwischen ist es mir lieber, mal den einen oder die andere in der Stadt zu treffen als das ganze Rudel. Denn da trinken wir zu viel, da werden wir sentimental, wir singen und lamentieren, und es wird viel Unsinn erzählt, es werden großartige Pläne gemacht, um unseren Freund aus dem Gefängnis zu bekommen, aber eine Woche später kann sich niemand mehr daran erinnern, der Elan ist verpufft, wir tun, was wir alle Tage tun, und unser Freund sitzt weiter da ein, wo er eben einsitzt, seit dieser Sache.
Ohne diese ganze Sache – Mord, Prozess, spätere Verfahren – würden wir alle heute getrennte Wege gehen. Ich frage mich, ob unsere Freundschaft noch existieren würde.
Dabei ist die Frage ohnehin: Gibt es sie noch? Und: Was hält eine Freundschaft aus? Und wozu ist sie überhaupt gut? Falls Sie solchen Fragen überhaupt nachgehen möchten.
Da mein Arbeitstag eng getaktet ist, verlasse ich zwischendrin ungern das Büro, aber wir könnten uns im Konferenzraum unserer Kanzlei zusammensetzen und das Weitere besprechen.
Interviewen wollen Sie mich?
Und was soll dann daraus werden? Ein Buch, ein Artikel, ein Hörspiel? Oder was fürs Fernsehen?
Wissen Sie, damit kriegen wir ihn auch nicht raus aus dem Gefängnis. Und das wäre der einzige Grund, aus dem ich mit Ihnen sprechen würde. Und ich würde nur über die sogenannten Indizien und dieses Schandurteil dieser sogenannten Justiz reden. Aber nicht über uns, also uns Freunde, das bringt doch nichts.
Natürlich stehe ich nach wie vor zu ihm, was glauben Sie denn? Wir alle. Na, die meisten. Was sollte sich daran geändert haben? Und warum? Solange der wahre Täter – oder meinetwegen auch die wahre Täterin – noch frei herumläuft, ist der Fall nicht erledigt, jedenfalls nicht für mich.
Also: eher nein. Eher gar nicht.
Aber lassen Sie mich zumindest ein paar Nächte drüber schlafen.
Ganz bestimmt nicht.
Nein wirklich nicht. Da können Sie machen, was Sie wollen. Entschuldigung, aber das ist ein Fall von »entweder du bist für uns, oder du bist gegen uns«. Was glauben Sie, wie viele Anfragen ich da schon bekommen habe. Das ist eine Riesenstory. Ganz klar.
Aber probieren Sie es mal bei Sabine. Wenn die mitspielt, dann überleg ich mir’s noch mal. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
Das wird zäher als gedacht. Drei von den wenigstens fünf, die dabei sein sollten, haben zugesagt. Jedenfalls nicht abgesagt. Die verhandeln, warten ab. Kann man ja verstehen. Aber reden wollen sie doch alle, sonst hätten sie ja sagen können: Danke, aber nein danke und Tschüss.
Der Einzige, der sich überhaupt nicht ziert, ist der Anwalt. Dreht man an dem Wasserhahn, kommt’s herausgesprudelt. Mal sehen.
Okay.
Ich habe mit Benjamin gesprochen. Sieht wohl so aus, als wäre er dabei – aber machen Sie sich da auf einige Korrekturen und Richtigstellungen gefasst. Der ist ein Pingeliger, immer ganz genau. Wenn er meint, dass es was bringt – bitte. Und wegen Sabine: Sie sagen mir schon, was die so erzählt, oder?
Da müssen Sie nämlich aufpassen. Die hat eine ganz eigene Auffassung von der Angelegenheit. – Ich will Sie nur warnen.
Wenn Benjamin mitmacht, wie Sie sagen, dann … Dann ist es wohl in Ordnung. Der ist immer schon sehr bedacht gewesen. Nicht wie Till oder Sebastian.
Na ja, die zwei sind, die sind impulsiv. Die kennen Schwarz oder Weiß, aber kein Grau.
Beim ersten Treffen im Café trinkt Emilia heiße Schokolade und besteht danach darauf, selbst zu bezahlen, obwohl sie natürlich eingeladen ist. So viel gibt der Verlagsvorschuss gerade noch her, aber schön. Spricht leise, damit man sie am Nachbartisch nicht verstehen kann. Wie bei guten Lehrern üblich, die werden dann richtig gefährlich, wenn sie flüstern. Kann aber auch laut – als der Kellner sie wiederholt ignoriert; das geht offenbar gar nicht. War zu früh da und hatte begonnen, Aufsatzhefte zu korrigieren. Wodurch sie leicht zu erkennen ist, obwohl eher unauffällig. Sie stellt viele Fragen: »Damit ich nachher keine mehr stellen muss.«
Ich will das alles von A bis Z durchlesen, bevor Sie es veröffentlichen, in welcher Form auch immer, okay? Und wenn es mir nicht passt, dann kann ich jedes einzelne Wort von mir wieder löschen, ja? Als hätten Sie niemals mit mir gesprochen, ja? Ich will Ihre Garantie, und zwar schriftlich.
Was Sie schreiben, ist mir letztlich egal. Da sind, ich sag mal, eine Milliarde Wörter aus einer durchgedrehten Popcornmaschine, ich sag mal, gequollen, und am Ende hat doch bloß eines gezählt: »schuldig«. Und ich sage: unschuldig. Und das gilt heute genauso wie damals.
Gesetzt den Fall, dass überhaupt – wo wollen Sie denn anfangen? – Am Anfang? Wo soll das denn sein? Auf eigene Gefahr:
Willkommen im Irrgarten. Eines kann ich Ihnen versprechen: Hinein kommen Sie ganz einfach. Aber wie und ob Sie herauskommen … Ist aber auch nicht mein Problem.
Vorort
Mit der großen Gesprächsrunde, wie geplant, wird das wohl nichts. Haben die alle abgelehnt. Also jeder und jede für sich, aber umso besser: Fünf Blickwinkel, fünf Mal Vergessen, fünf Mal Erinnern, fünf Mal das Gleiche und am Ende doch nicht dasselbe. Das dürfte interessante Wirkungen ergeben, wenn der eine mit den Aussagen des anderen konfrontiert wird.
Wie das bei uns war? So war das bei uns. Alles nicht so schlimm, wie die ach so tollen Stadtleute glauben. Vorstadt eben und frische Luft, flaches Land, Umgehungsstraßen und Hochspannungsleitungen und S-Bahn-Bereich und Regiobus. Nicht »drinnen«, aber auch nicht total am Arsch. Ein Haufen Kinder in unserem Alter. Wir konnten auf der Straße Völkerball spielen, und die Autos warteten mal eine Minute, bis wir den Weg frei gemacht hatten. Aber auch nicht länger, weil Autos, die hatten eben Vorfahrt, ganz klar. Es gab Regeln, da hast du dich dran gehalten.
Wie soll ich das erklären …
Das muss man sich vielleicht so vorstellen: Ihr seid ein knappes Dutzend Freunde. Ihr kennt euch seit dem Kindergarten, seit der Grundschule. Ein paar gehen verloren, weil sie wegziehen, oder weil sie es nicht aufs Gymnasium schaffen. Leider Pech gehabt, das ist die soziale Auslese, so war das eben. Es blieben ja genug übrig.
Ihr habt auf der Straße Ball gespielt, in der Freinacht Wäscheklammern von den Wäscheleinen geklaut, Mülltonnen umgekippt und Briefkästen mit Rasierschaum aufgefüllt. Ihr habt füreinander gelogen und füreinander geschworen. Die Jungs sind Blutsbrüder, wofür die rostige Klinge eines Taschenmessers gebraucht wurde und es zwei Wochen Angst vor einer Blutvergiftung gab, die aber nicht kam. Wir Mädchen haben dabei nicht mitgemacht, nicht mitmachen dürfen, weil die Buben sagten, es gebe keine »Blutsschwesternschaft«. Aber unsere Freundschaft ist deswegen nicht weniger wert, und ehrlich gesagt, das war eh bloß ein doofes und abstoßendes Ritual.
Wir waren eine richtige Clique. Ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt: Clique. Klicke. Heute heißt das vielleicht »gang«. Damals aber nicht virtuell, sondern wir waren eine echte Gruppe mit einem echten Platz, an dem wir uns trafen, nachmittags, nach den Hausaufgaben. Das war anfangs ein Spielplatz in der Siedlung, bevor uns die kleinen Kinder dort auf die Nerven gingen. Dann ein paar Sitzbänke in der Mini-Pseudo-Fußgängerzone des Ortes, beim Eiscafé, vor dem Schleckermarkt, wo man uns als öffentliches Ärgernis ab und zu verscheuchte. Was uns natürlich gefallen hat. Deswegen fing ich ja an zu rauchen: Damit irgendeine alte Oma aus der Nachbarschaft das sah, vor sich hin meckernd vorbeitrottete und mich bei passender Gelegenheit über den Gartenzaun bei meiner Mutter anschwärzte. Ich bin dann auch wieder vernünftig geworden und habe damit aufgehört.
Wir hatten viel Zeit für uns, denn unsere Eltern mussten viel arbeiten, um die Häuser und die Autos abzuzahlen.
Ich wurde eine Zeit lang zum Gitarrenunterricht gezwungen, aber da konnte ich zu Fuß hingehen. Eine von uns fing das Reiten an, und zu dem Pferdestall musste sie eine halbe Stunde über die Feldwege radeln. Bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit. Keine Chauffeurdienste, das war nicht üblich und mangels Zweitwagen oft auch nicht möglich. Der Einzige, der einen Fahrer (und viele Autos) hatte, das war eben dieser sagenhafte, steinreiche Onkel von unserem Freund, der in der großen Stadt wohnte, in märchenhaftem Luxus …
Wir praktizierten so eine Art seriellen Partnertausch in der Clique. Über die Jahre. Das war okay – aber jemand anderem in der Gruppe schöne Augen machen, wenn du noch mit Soundso zusammen warst, das war tabu. Du warst in A verliebt, sie aber in C. Und B war in dich verliebt, und D deswegen verzweifelt. Bäumchen wechsle dich.
Wir sind immer unter uns geblieben. Andere hatten kaum eine Chance, wenn sie nicht von Anfang an dabei waren. Ich bin da wohl eine Ausnahme.
So erinnere ich mich an das alles, früher.
Wenn ich ihn charakterisieren sollte … echt, da habe ich nicht so die Worte dafür. Das ist eher was für Sabine oder Sebastian oder Emilia. Ich kann nur sagen, wie er ist. Und was er tut und nicht. Anekdoten. Oder bilden Sie einfach den Durchschnitt aus uns fünf, dann kommt schon das Richtige raus. Na ja, nicht so ein Zupacker wie Sebastian, umgänglicher als Sabine, aber nicht so ausgeglichen wie Emilia und bestimmt kein sportlicher Typ, aber mit einer künstlerischen Ader, so wie ich, aber ich bin Musiker, und etwas von Benjamin, was auch immer … könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ist schwierig.
Jetzt fällt mir etwas ein, das könnte interessant sein:
Ich habe ihn eigentlich über die Musikschule kennengelernt. Rund um den Spielplatz konnte ich wenig mit ihm anfangen, der war schüchtern und nicht so … robust wie ich. Okay, wir sind uns bei dem ziemlich entwürdigenden Blockflöten-Unterricht begegnet. Unsere Eltern hatten uns da angemeldet, weiß Gott, warum.
Doch, ich weiß schon, warum: Das Instrument war billig und den Platz für einen Flügel hätten wir zu Hause sowieso nicht gehabt. Auch nicht die Kohle.
Wir beide fanden Blockflöte dermaßen peinlich, dass wir uns geschworen haben, die Sache geheim zu halten. Ich hätte lieber Trommeln oder Elektrogitarre gelernt und er – lieber gar nichts. Musikalisch ist er wirklich nicht; das hätte nicht einmal für eine Blockflöte mit halber Lochzahl gereicht.
Ein gutes Jahr haben wir uns gegenseitig für jeden Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr, sozusagen ein Alibi gegeben. Mal war ich bei ihm zum »Hausaufgabenmachen«, mal er bei mir, und mal erzählten wir den anderen, wir hätten ein Fahrrad zu reparieren oder den Rasen zu mähen oder sonst irgendetwas, während wir in Wirklichkeit ziemlich erbärmlich auf den Holzröhren herumpfiffen. So lange bis die Lehrerin eines lang ersehnten Tages meine Eltern anrief und ihnen erklärte, dass das keinen Sinn hätte. Und ähnlich bei ihm. Er hat es dann gelassen, und ich habe zur Gitarre gewechselt. Die mochte ich.
Aber das war unser Jahr. Das Jahr der geteilten Geheimnisse. Von damals stammt meine Anhänglichkeit zu ihm. Fragen Sie die anderen: Dass wir Blockflöte lernen sollten, das weiß keiner von denen, darauf wette ich. Oder fragen Sie besser nicht, ist mir immer noch peinlich.
Da gibt es nichts weiter zu erklären, ich bin ja kein Psychologe. Und denen würde dazu wohl auch wenig einfallen. Es ist eben Vertrauen, und das besteht, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist. –
Also, dazu eine kleine Geschichte, wenn Sie darauf bestehen. Fast schon eine Fabel, und Achtung: mit Moral.
Irgendwann ist das bei uns in Mode gekommen. Ich glaube, nach dem Türkeiurlaub von Emilia. Wenn wir abhingen, draußen oder meinetwegen im Partykeller von Tills Eltern, brachte jemand eine Tüte Pistazien vom türkischen Gemüseladen am S-Bahnhof mit. Diese gerösteten und gesalzenen in der Schale. Den Test mache ich noch heute. Ich setze den Leuten eine Schüssel Pistazien vor und schaue zu, unauffällig, aber genau. Da gibt es welche, die nur nach den weit geöffneten Schalen greifen, da, wo man leicht an die Pistazie kommt. Oder herausfingern, was sowieso schon aus der Schale gefallen ist. Und die anderen, die sich die Fingernägel an den schwierigen Fällen abbrechen. Die kriegen auch nur die Hälfte von dem ab, was die anderen so fix und mühelos ernten. Kavaliere, die wissen, was das für die manikürten Nägel der Mädchen bedeutet. Oder Helden, die die geschlossenen Schalen beiseitelegen und dann mit einem Werkzeug bearbeiten.
Soll ich Ihnen was sagen, so leid mir das auch tut? Die, die meinen Pistazientest bestanden haben, die sind noch heute meine Freunde. Oder fort, zerstreut in alle Winde, aber in guter Erinnerung. Die anderen sind – wo auch immer. Oder im Knast.
Reihenhaus, Reihenmittelhaus, Reihenendhaus, Doppelhaushälfte, so sieht das bei uns in der Siedlung aus, in der Buchenstraße, der Lindenstraße, im Erlenweg. Einfachgarage, Doppelgarage. Vorgarten, Mülltonnenhäuschen. Mit Gartenzwerg, ohne Gartenzwerg. Sichtschutzhecken, wo es nichts zu verbergen gibt. Der Geruch von gemähtem Gras am Samstag. Sonntags nie, wer sonntags mäht, begeht sozialen Selbstmord.
Halbhohe Gardinen, damit Mutti durchs Küchenfenster sieht, ob der Postbote kommt, die Müllabfuhr, die Avon-Beraterin, der Scherenschleifer oder die Kinder von der Schule zurück sind und sie die Fischstäbchen in die Pfanne schmeißen muss.
Und eine Reihe Bungalows, da wohnen die besseren Leute, die unter Doppelgarage gar nicht erst anfangen. Das ist die Eichenstraße, aber Eichen gibt es da genauso wenig wie Buchen in der Buchenstraße.
Baumsiedlung heißt unsere Siedlung. Im Ort gibt es auch eine Dichtersiedlung – Schiller, Goethe und so weiter – und die Typen aus dem Chemie- und Physikunterricht, die Bosch, Benz und Bunsen, was weiß ich.
Eigentlich müssten sie eine Straße nach ihm benennen, denn er ist das Größte, was das elende Kaff je hervorgebracht hat. Was die Bekanntheit betrifft jedenfalls. Oder wer fällt Ihnen ein, wenn ich Braunau sage? Sehen Sie.
Das dürfte eine ganz gut zutreffende Beschreibung sein, die Sie da von Sebastian bekommen haben. Ob das mit dem Straßennamen klappt, bezweifle ich denn doch, auch wenn er im Ort noch viele Sympathisanten hat.
War eh nur ein Scherz, natürlich, klar.
Was soll man sagen. Ich wohne nicht mehr dort. Ich habe Eigentum in der Stadt erworben, auch als Wertanlage. Ich glaube, Sabine müsste man schon chloroformieren, aber ich, ich habe kein Problem mit dem Ort, ich fahre da immer noch ganz gern raus, wenn ich muss. Da bin ich aufgewachsen. Mir hat es da an nichts gefehlt, und ich hatte auch keine Wahl. Wir können nicht alle in Hawaii auf die Welt kommen und nach der Schule zum Surfen gehen. Kein Problem. Es hätte schlimmer kommen können.
Herkunft, Herkunft. Das wird überschätzt, im Guten wie im Schlechten.
Benjamin, der Anwalt: Sieht mechanisch jede Minute auf die Uhr. Wird wohl hoffentlich keine minutengenaue Honorarnote geben – das gibt der Verlagsvorschuss nicht her. Vor jedem Statement, vor jeder Antwort: Blick an die Decke und lange Pause. Kommt nicht rüber wie der schnieke Anwalt, mehr als ein guter besorgter Berater. Wenn Benjamin wirklich der beste Freund des Verurteilten war, wie muss der dann sein? »Gleich und gleich gesellt sich gern.« Vorsicht, sagt Benjamin, der logische Schluss ist nur so gut wie seine Prämissen. Das Gespräch dauert genau 90 Minuten – so lang wie vereinbart. Austausch der Visitenkarten mit handschriftlich ergänzten Privatnummern, freundliche Verabschiedung. Das muss wohl als Erfolg verbucht werden.
Ich bin froh, dass ich das alles hinter mir gelassen habe.
Nein, so schlecht war es nicht. Aber halt zum Vergessen. Das versuch ich seit Jahren, und jetzt rühren Sie alles wieder auf.
Scheiße! Aber vielleicht ist es Zeit. –
Zeit, dass wir auch das andere hinter uns lassen. Höchste Zeit, wenn ich es genau bedenke.
Diese Sabine hat wohl noch eine Rechnung offen. Distanziert und dann wieder ganz direkt. Kann sich vielleicht nicht entscheiden. Die macht beruflich irgendwas mit »Sonne, Mond und Sternen«, laut Emilia. Und Sebastian, eher abschätzig: »Nicht von dieser Erde.« Astronomie? Raumfahrt? Horoskope wohl kaum. Die ist komplett no nonsense, no bullshit.
Ich war elf, als wir in den Ort gezogen sind. Da kannten sich die anderen schon seit Jahren. Wenn sie mich in der Schule nicht neben Sabine gesetzt hätten, wäre ich nie in die Gruppe gekommen. Jeder wollte bei denen dabei sein, ich auch, »die Neue«. Noch dazu eine aus dem Osten. Ich kam zwar aus einer großen, alten Stadt, und das da, das war ein besseres Dorf, in dem wir uns niederließen.
Sabine hat mich einige Zeit ignoriert, bis sie gemerkt hat, dass man bei mir ganz gut abschreiben kann und das besser geht, wenn ich mein Federmäppchen nicht hochkant zwischen uns aufstelle. Dann ging’s, dann hat sie mich angeschaut und mitgenommen, von da an war ich ihre gute Freundin, und die anderen haben gar nicht nachgefragt, warum ich in Sabines Schlepptau an ihren Treffpunkten aufkreuzte.
Eher toleriert als integriert, würde ich sagen. Dass ich die Zugereiste bin, lassen sie mich heute noch manchmal spüren. Die meisten von denen sprechen Dialekt, jedenfalls können sie es.
Gut, ich auch, aber halt den falschen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mir die eine Aussprache ab- und die andere antrainiert hatte. Wenn ich aufgeregt bin, fall ich sowieso wieder zurück ins … in den alten Slang. Haben Sie es nicht durchgehört?
Ich hab mich also reingekauft, und im Rückblick betrachtet war es billig. Sabine hab ich abschreiben lassen. Ihr brachte das vielleicht einen Dreier statt einem Vierer, meiner gewohnten Zwei oder Eins hat es nicht geschadet. Meine Mutter hat immer Unmengen an Kuchen und süßem Zeugs gebacken: Das hab ich am Spielplatz verteilt. Und mein Taschengeld habe ich in Zehnerl-Eis investiert, dieses grell gefärbte Wassereis im Plastikschlauch.
So ist das halt. Wenn du in eine fremde Kultur kommst und Freunde brauchst, dann bringst du Glasperlen und anderen Tand mit. Irgendwann haben sie sich an dich gewöhnt, du bekommst deinen Platz in der Gruppe zugewiesen.
Der Platz, der war … eher unten? Ja schon, aber, Herrgott, ich wollte unbedingt dabei sein. Dafür hätte ich mehr als nur Taschengeld geopfert. Das Lustige, oder Traurige, ist: Eigentlich gerätst du nur von einer Abhängigkeit in die andere. Denn erst bist du besessen von dem Gedanken, da reinzukommen. Wenn du drin bist, nimmst du alles auf dich, um nur ja drin zu bleiben. Die anderen verteidigst du, so wie du hoffst, dass sie auch dich verteidigen werden, wenn es einmal darauf ankommt.
Damals war’s das Tollste überhaupt. Ich weiß noch, wie ich heimgekommen bin und, vor Stolz fast platzend, am Esstisch verkündet habe: Ich bin jetzt in einer »Clique«. Als wäre ich in den Adelsstand erhoben worden. Mama und Papa machten bestürzte Gesichter, dachten sich irgendwas Schlimmes, und gerade daran erkannte ich, dass es gut und richtig war.
Und natürlich sind wir immer noch Freunde, trotz allem, was passiert ist, und nach der langen Zeit. Wenn wir uns morgen wieder treffen würden, ich glaube fest, dass nach einer halben Stunde Aufwärmzeit das alte Vertrauen zurück ist, die alten Bindungen wieder binden. So wie du ein zerlegtes Uhrwerk wieder zusammenbaust. Ein Tröpfchen Öl – und …
Jetzt kommt also das Persönliche. Versteh schon, von wegen »Emotionen« und »uns besser kennenlernen«. Fürs Protokoll: Ich mag das überhaupt nicht. Wir sollten doch bei der Sache bleiben. Weil es darum geht.
Die anderen können sich entblößen, wie sie wollen, das ist mir völlig egal.
Ich sage Ihnen so viel: Nach einer kaufmännischen Ausbildung im Brennstoffgroßhandel bin ich schon lange Pressesprecher bei einem großen städtischen Versorger. Als Leiter Unternehmenskommunikation führe ich sechs Mitarbeiter und könnte locker noch viel mehr führen. Pardon: Mitarbeitende. Versorger heißt: Wasser, Gas, Strom. Entsorger ist was anderes, das wäre nichts für mich. Ich verantworte die Texte, in denen »Anpassung« steht, wenn wir »Erhöhung« meinen. Ich oder die Mitarbeitenden schreiben die Artikel für unser buntes Magazin, die einen neuen »Service« anpreisen, aber mehr Eigenarbeit für die Kunden bedeuten, worauf wir ein paar Sachbearbeiter »freisetzen« können, denn auch wir müssen wettbewerbsfähig bleiben, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung. Dessen Reden ich verfasse, klar, das ist nichts für die Mitarbeitenden.
Also, ich wähle, blähe und verdrehe die Wörter, und wenn ich nicht so viel Wert auf geregelte Arbeitszeiten und freie Wochenenden legen würde, dann hätte ich auch Journalist werden können, wie Sie. Und ein ganz guter noch dazu, glaube ich. Wenn Sie in meine Schreibtischschublade schauen könnten, dann sähen Sie da vielleicht sogar einen Romanentwurf, wer weiß. Mit Leuten wie Ihnen habe ich oft zu tun. Wenn man ihnen die Dinge gut und geduldig erklärt, kommt meistens auch was Brauchbares in die Zeitung.
Sonst: verheiratet, ein Kind, Alter und Geschlecht gehen niemanden etwas an, Kombifahrzeug der oberen Mittelklasse, deutscher Hersteller natürlich, vor dem Monitor brauche ich eine Brille, und wenn ich in die Sonne gehe, muss ich auch oben auf dem Schädel Sonnencreme auftragen. In dem Vorort wohne ich immer noch, zum Job fahre ich mit den Öffentlichen, das Jahresticket bezahlt mein Arbeitgeber, der lässt ja auch die Busse und Bahnen rollen.
Na, stehe ich jetzt quasi leibhaftig vor Ihnen? Bin ich Ihnen sympathisch? Gut, vielleicht treffen wir uns demnächst persönlich. Wenn das hier etwas werden soll, dann könnten auch Sie etwas mehr als eine Stimme am Telefon und eine E-Mail-Adresse werden, finde ich.
Damals, zum Zeitpunkt der Tat, war ich noch im Brennstoffsektor, ein paar Jahre zuvor irgendwie da reingerutscht, das sucht man sich nicht aus.
Tatort
Falls der Verurteilte vorzeitig entlassen werden sollte, dann muss das Buch da sein. Denn dann gibt es so viel unbezahlte (= unbezahlbare) Publicity, die müsse man mitnehmen, meint der Verlag.
Vorzeitige Entlassung ist zwar unwahrscheinlich, wenn nicht sogar unmöglich. – Aber egal.
Es muss unheimlich gewesen sein, dort oben zu wohnen. Nach Geschäftsschluss war da kein Mensch mehr, nur ab und an einer aus dem Viertel, der dort einen Parkplatz gemietet hatte. Man musste über das Parkdeck gehen, wenn man vom Aufzug kam. Im Treppenhaus, da roch es oft nach, na ja, Urin. Nachts wäre ich niemals, niemals über diese Treppe gegangen, am Tag lieber auch nicht. Manchmal haben sich dort die Penner schlafen gelegt. Tut mir leid, das sind arme Leute, aber das ging für mich gar nicht.
Benzin- und Ölgeruch, massive Betonsäulen, hinter denen sich ganze Räuberbanden hätten verstecken können. Und so ein fahles, grünliches Neonlicht. Die flüchtenden Männlein auf den beleuchteten Notausgangsschildern machten einen – mich auf jeden Fall – nervös. Die Tür zu dem Apartment unterschied sich kaum von denen der Notausgänge: dasselbe abgestoßene grau lackierte Metall, daneben nur ein kleiner Klingelknopf mit Sprechstelle und ein schon ewig nicht mehr poliertes Messingschild; zwei Initialen eingraviert.
Vermutlich haben schon viele Besucher des Einkaufszentrums an dem Türknauf gezerrt, in der Hoffnung, nach unten, zu den Geschäften zu gelangen. Und keine Ahnung gehabt, dass dahinter ein 300-Quadratmeter-Penthouse mit Marmorböden und vergoldeten Wasserhähnen liegt.
Till sagt, dass er »eigentlich« ein Künstler ist, Musiker, aber weil auch er »Geld zum Leben« braucht, arbeitet er in einem Musikgeschäft. Beim ersten Treffen in der Innenstadt schleppt er wie zum Beweis einen mit tausend Aufklebern verzierten Gitarrenkoffer an, der aber ziemlich neu aussieht. Rechts lange Fingernägel, Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Etwas mehr Bizeps, als man zum Saitenzupfen braucht: Krafttraining, sagt er, und dass er sich dieser Tage auf seinen ersten Triathlon vorbereitet.
Nope, in dem Einkaufszentrum war ich nie. Nicht vorher, nicht nachher. Warum auch? Da gab es keine Geschäfte, die für uns interessant gewesen wären, und außerdem war es für uns Vorstadtkinder weit weg von daheim.
Ich wusste natürlich, dass es diesen Onkel gab, alle wussten wir das. Er redete oft von ihm. Hat mit ihm angegeben, ehrlich gesagt. Dass der Onkel so unendlich reich wäre und für seine vielen Autos ein Teil der Parkgarage reserviert wäre. Meistens nannte er ihn »Erbonkel«.
Die Schwester von unserem Freund arbeitete auch eine Zeit in der Immobilienverwaltung des Onkels, ein bisschen als »Mädchen für alles«, von den anderen Angestellten nur deswegen geduldet, weil sie eben die Nichte des Chefs war. Eine passende Ausbildung hatte sie nicht.
Genau wie unser Freund, der auch da jobbte, aber sie war eben eine Frau und deswegen in der Erbfolge wohl die Nummer zwei, denk ich. Aber auch ein zurückhaltender Typ, ohne Ambitionen.
Sie hatte ihr Studium abgebrochen, aber ihr nahm das der Onkel seltsamerweise nicht übel. Der hätte, glaub ich, selber gerne studiert und hat deshalb genau aufgepasst, was unser Freund an der Uni so machte. Oder was der ihm so auftischte, über »Fortschritte« und bestandene Prüfungen. Uns erzählte er einmal, so halb im Spaß, er wolle sich auf Erbrecht spezialisieren.
Hätte sich mal auf Strafrecht spezialisieren sollen.
Ob er glaubte, dass er – und seine Schwester – einmal alles erben würden? Oh, ganz bestimmt. Der Alte hat vielleicht gemeckert, aber der hat an das Prinzip »Familie« schon geglaubt, »den Stab weitergeben« und all so was. Da hätte er nur warten müssen, Geduld, Geduld. Deswegen war ich mir ja so sicher damals: Er ist es nicht gewesen. So dumm ist er nicht, dachte ich.
Aber ein bisschen jähzornig, das schon.
Dieser Onkel war stinkreich, verwitwet und suchte sich seine Gesellschaft in den überdekorierten glitzernden und blinkenden Kneipen der Innenstadt, die »Bei Dings« oder »Bei Bums« heißen, wo jeden Abend die verblichenen B- und C-Promis aufkreuzen und wo die reichen Einsamen und die einsamen Reichen ihre Schoßhündchen in Handtäschchen anschleppen und so tun, als hätten sie die anderen Einsamen und Reichen und Ex-Promis überhaupt nicht nötig.
Sie tun großzügig, aber den Geiz, der sie reich gemacht hat, können sie nicht unterdrücken: Jedes Mal, wenn sie eine Flasche spendieren, gibt’s ein Memo: Ah, der und die, die haben mitgetrunken, selbst aber seit x Wochen nichts springen lassen. Ihre Köter wuseln herum, kacken dem Wirt auf die Dielen, aber hahaha, so ist sie eben, die liebe süße Shirley, und die Hundekacke und ihre umgehende Entfernung durch den Slavko oder die Aissata sind eingepreist im 89er Dom Sowieso.
Der Molch vom Boulevardblatt – früher nannte man den »Gesellschaftsreporter«, aber so was gibt es nicht mehr –, der da zwischen den Popanzen herumtippelt, notiert die Busserl, vermerkt die glatt gespachtelten Wangen, zählt die transplantierten Haare, die aufgeblasenen Lippen und ausgestopften Brüste, überhört keinen ploppenden Korken und übersieht niemals einen in zweiter Reihe parkenden Ferrari, Porsche und Maserati, verschweigt jedoch vornehm die gewöhnlichen SUVs der halbseidenen Prominenz, die aus der Vorstadt kommt und wie die Spießer ihre Münzen in die Parkautomaten wirft, und erwähnt die schon gar nicht, die zu Fuß aus ihren Mansarden daherkommen, die sie »Penthouse« nennen. Ausgenommen den Onkel, denn der wohnt wirklich um die Ecke von diesen Promikneipen, und dass er ein paar schöne Autos im privaten Teil seiner Garage stehen hat, das weiß jeder, der die wirklich wichtigen Rubriken der Blätter liest.
Unseren Freund hat das nie interessiert. Aber ich glaube schon, dass er in diesen Etablissements direkt oder indirekt immer mal wieder im Gespräch war.
Unser Spätentwickler. Ich hab ihn ein paarmal so genannt, im Scherz. Hat ihm nicht gefallen.
Als die ganze Scheiße passierte, waren wir um die 30, da ist man entweder mit dem Studium fertig oder hat schon längst einen Beruf. Nur er halt nicht. Nicht einmal einen Abschluss. Der hing irgendwie immer ein bisschen in der Luft. Und das hat ihn einerseits gewurmt, andererseits war er ja der »Chef in spe«. Der designierte Erbe. Okay, mit seiner Schwester muss er teilen, trotzdem Erbe, von keiner Kleinigkeit. Da fragt dann keiner mehr nach einem Abschluss und Noten, oder? Ich jedenfalls nicht.
Ich kannte den Onkel deswegen besser als die anderen, weil ich einmal ein paar Wochen bei ihm gearbeitet habe. Bei ihm, in seiner Wohnung, dieser fürchterlich eingerichteten Behausung über dem Einkaufszentrum. Der hatte sogar noch diese Videokassettenhüllen aus Plastik im Regal stehen, die aussahen, als wären sie alte Bücher. Das war ein paar Jahre vor seinem Tod, und ich habe noch studiert – Geschichte und Deutsch auf Lehramt.
Der Onkel wollte seinen Stammbaum erforschen. Er war ein Bussi-Promi, schon ein Arrivierter, mindestens einmal die Woche in den Klatschspalten, aber ich glaube, das hat ihm nicht gereicht. Ich sollte für ihn den adligen Urururopa finden, oder wenigstens einen Großbauern. Ein Wappen, das hätte er gern gehabt, kann man im Internet kaufen, klar, aber wenigstens ein bisschen seriös sollte es schon sein.
Unser Freund vermittelte mich wegen meiner Geschichtskenntnisse. Ich erinnere mich, dass der Onkel das toll fand, der hatte eine Hochachtung für alle »Studierten«. Aber bloß für diejenigen, die ihre Sache schnell und diszipliniert durchzogen. »Bummelstudent«, das war für ihn ein Ausdruck tiefster Verachtung. Mich fragte er gleich: Und, wie