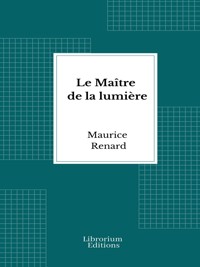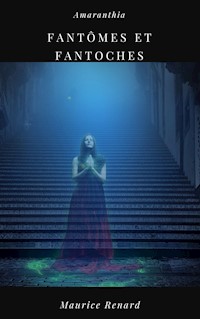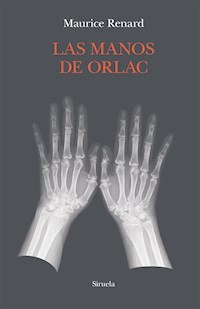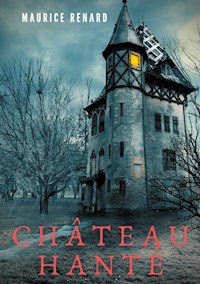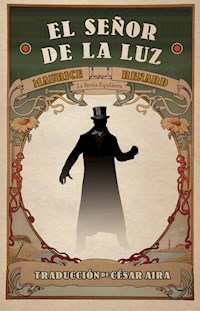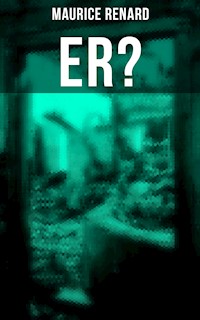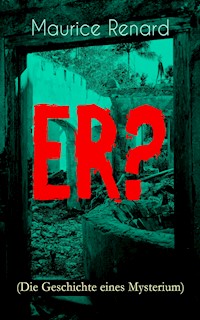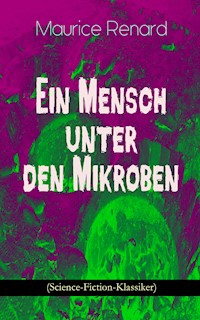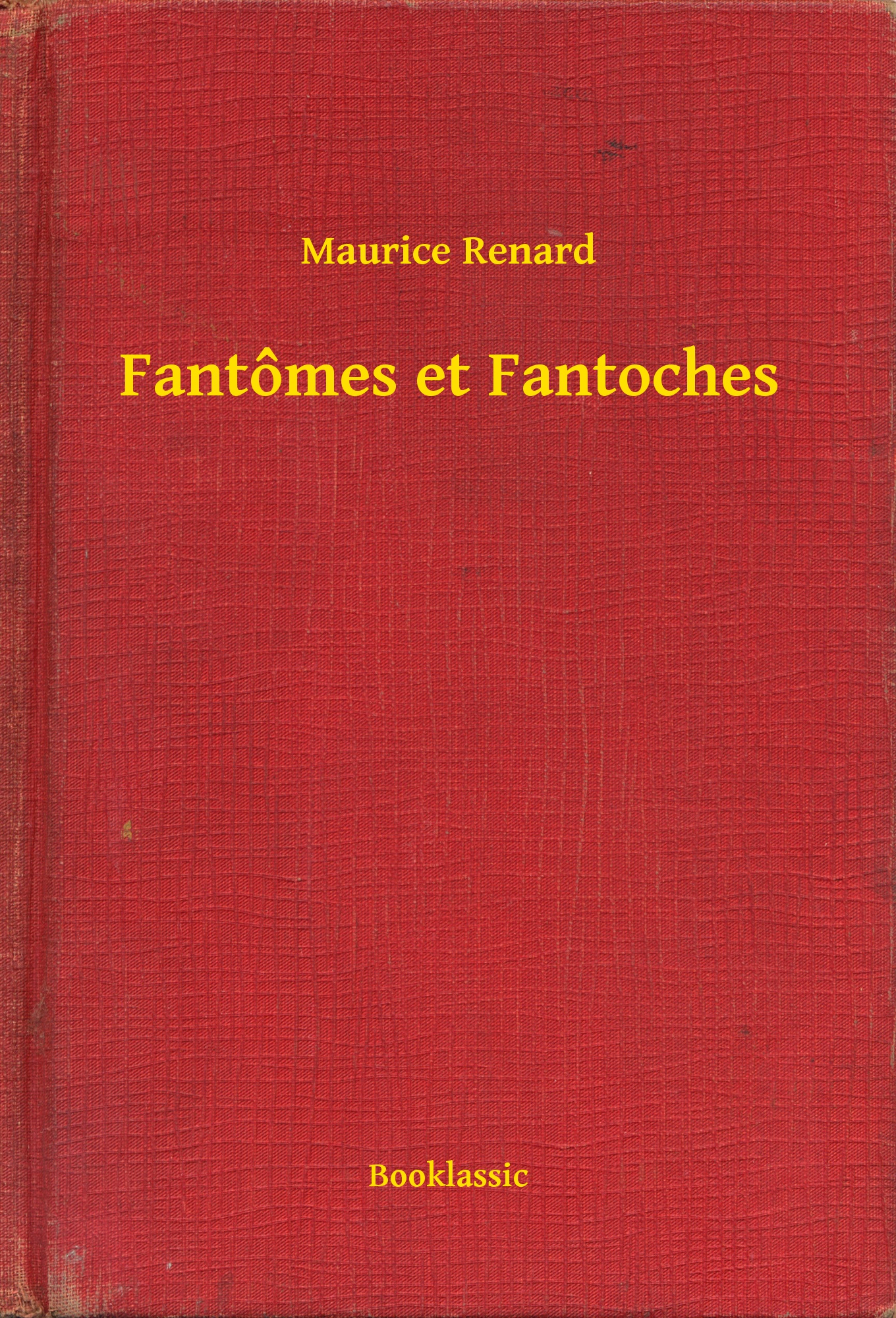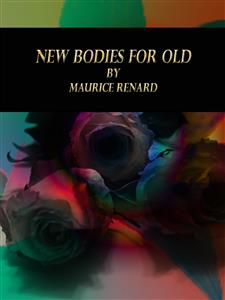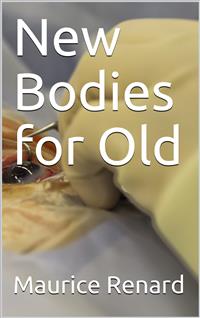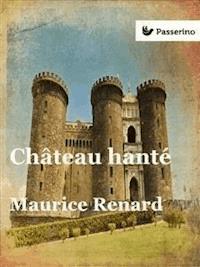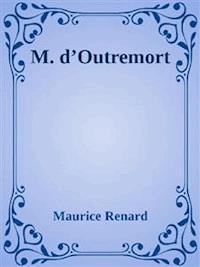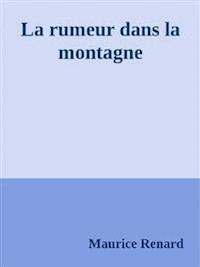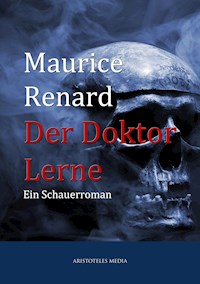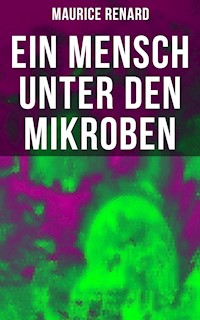
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In 'Ein Mensch unter den Mikroben' von Maurice Renard wird die fesselnde Geschichte eines Mannes erzählt, der auf mysteriöse Weise in die Welt der Mikroben eintaucht. Renard präsentiert mitreißendes Erzählen in einem wissenschaftlichen Kontext, der den Leser in die faszinierende Welt der Mikrobiologie einführt. Sein literarischer Stil zeichnet sich durch präzise Sprache und detaillierte Beschreibungen aus, die es dem Leser ermöglichen, sich in die Welt der Mikroben hineinzuversetzen. Das Werk von Renard ist ein Meisterwerk der Science-Fiction-Literatur, das bis heute fasziniert und Leser aller Altersgruppen anspricht. Maurice Renard, ein bekannter französischer Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunderts, war ein Pionier der Science-Fiction-Literatur. Seine Hingabe an wissenschaftliche Themen und seine Fähigkeit, komplexe Ideen verständlich zu vermitteln, spiegeln sich in 'Ein Mensch unter den Mikroben' wider. Renard's Interesse an der wissenschaftlichen Forschung und seine Leidenschaft für das Erzählen von Geschichten machen ihn zu einem einzigartigen Autor in der Literaturgeschichte. Für Liebhaber von Science-Fiction und wissenschaftlicher Literatur ist 'Ein Mensch unter den Mikroben' von Maurice Renard ein Muss. Dieses Buch bietet nicht nur Spannung und Unterhaltung, sondern ermöglicht es dem Leser auch, eine neue Perspektive auf die Welt der Mikrobiologie zu gewinnen. Renard's Meisterwerk wird Leser begeistern und sie auf eine fesselnde Reise in die unbekannte Welt der Mikroben mitnehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ein Mensch unter den Mikroben
Kinematographisches Vorwort
Der Saal ist in das blau-silberne Licht einer Vollmond-Beleuchtung getaucht. Fauteuils von unvergleichlicher Üppigkeit nehmen einen mit liebevoller Fürsorge auf. Alles steckt in Festkleidung. Im Einklang damit stehen auch die Preise der Plätze, die nach dem Smoking schreien. Mädchen von bestrickender Schönheit nehmen sich unserer mit abwesendem Blicke an: die Logenschließerinnen.
Drei Schläge ertönen, die üblichen Zeichen, und dennoch fühlt man sich überrascht und gehoben. Drei Schläge, von denen man faktisch nicht weiß, woher sie kommen. Glockenzeichen wie Aveläuten. Daran denkt aber zum Kuckuck niemand. Das nach Bayreuther Vorbild unsichtbare Orchester fällt übrigens plötzlich mit einem Tusch von Dissonanzen ein, deren bunte Zusammensetzung einen sprachlos macht. Und gleichzeitig – Bim – verblaßt das Licht um eine Schattierung.
Ein zweites Zeichen – Bam – und es herrscht Halbdunkel.
Finsternis? Nein. Die Leinwand, ein viereckiger Mond, ein leeres leuchtendes Parallelogramm.
Doch jetzt füllt es sich und wird bewohnt.
Der Herr Prologus bewegt sich darin.
(Und das Orchester stürzt sich fessellos in ein heiteres, phantastisches Tonstück, kräftig unterstützt vom neckischen Fagott und von den Klapphorn- und Saxophonbläsern.)
Der Herr Prologus ist eine altehrwürdige Persönlichkeit, sowohl des Dramas als der Posse. Eine allbekannte Gestalt. Seit es Schauspieler gibt, trägt er die Toga, wallende Gewänder und die verschiedensten Masken. Heute legte er den Gehrock an, mimt einen Sonderling von altem Gelehrten und nennt sich »Dr. Prologus«.
Er arbeitet in einem sechseckigen Zimmer, an dessen Wänden von unten bis oben nichts als Bücher, Bücher und wieder Bücher zu sehen sind.
Auf Griffweite stehen rechts und links neben ihm zwei drehbare Bibliothekständer, und ein dritter befindet sich hinter ihm. Diesen kann er erreichen, indem er seinen Mahagonisessel um einen Mittelzapfen sich drehen läßt.
Auch der Tisch ist sechseckig und drehbar.
Bedeckt mit alten Schmökern, Zettelkatalogschachteln und bunt durcheinanderliegenden Notizen, dreht sich der Tisch, wie Herr von Lamartine gesagt hätte, »unter dem Impulse des Gelehrten ganz unwillkürlich« und präsentiert ihm so auf das bequemste den Schmöker, den Zettel oder die Notiz, die er einzusehen wünscht. (Man kannte derartige Einrichtungen bereits im Mittelalter.)
Dr. Prologus' Antlitz strahlt vor Freude, und diese Freude ist sicherlich wohlbegründet, denn er sieht ungeheuer klug aus, wahrlich, ungeheuer klug!
Seine Freude ist denn auch restlos gerechtfertigt.
Seit zwanzig Jahren arbeitet unser Mann rastlos an einem Werke, das auf ewige Zeiten dem Verfasser, seinem Vaterlande und der ganzen Menschheit zum Ruhme gereichen wird.
Titel: »Physiologie der Sinne«.
Nun aber bitte ich, zur Kenntnis zu nehmen, daß Dr. Prologus gerade bei der letzten Seite seiner Abhandlung angelangt ist. Welches Datum?! Welche Stunde?!
Einen Moment lang sieht man ihn in der Vollarbeit seines Genies. Die Buchdrehständer wirbeln wie Kreisel um ihre Mittelachse herum, der Doktor selbst beginnt, hingerissen von seiner Begeisterung, auf seinem Mahagoniesessel zu kreisen, ohne im Studium des Lexikons, das er ergriffen, innezuhalten. Wird er zum Stillstande kommen?
Während eine »Großaufnahme« seine Theaterglatze und sein Komödiantenauge, dem er einen tiefwissenschaftlichen Ausdruck zu verleihen trachtet, in das grellste Licht rückt, flucht er innerlich über diese verdammten Merkurlampen, die wie nichts anderes die Sehkraft zu verderben imstande sind.
Dann erblickt man eine große Hand, die mit einem Riesengriffel nachstehenden, sozusagen unsterblichen Satz hinschreibt:
»Nach dem heutigen Stande der physiologischen Wissenschaft und, wohlverstanden, unter Berücksichtigung der Diathesen und Idiosynkrasien, glauben wir keinerlei andere Schlußfolgerungen ziehen zu können.«
Und darunter, groß geschrieben, das magische Wort, das zugleich »Sieg« und »So!« bedeutet:
Ende.
Jetzt muß man sich betrachten, wie Dr. Prologus zufrieden ist! Er erhebt sich. Dankerfüllt blickt er zu Gott in die Luft empor, und damit das Publikum auch alles richtig kapiert, nimmt er sein Manuskript auf, betrachtet den Titel »Physiologie der Sinne«, und dann nimmt er aus einer Schublade eine Notiz vom Jahre 1907, welche das Datum 30. Juli trägt und lautet:
Heute angefangen mit meiner »Physiologie der Sinne«.
Dann richtet er den von seliger Wehmut erfüllten Blick nach einem imaginären, irgendwo hängenden Kalender:
»28. Oktober 1927.«
Mehr als zwanzig Jahre! ... Welch eine Stunde! ... Welch eine Minute! ...
Und während das Gesicht des Dr. Prologus den unaussprechlichen Stumpfsinn des Zurückblickens in die Vergangenheit widerspiegelt, sehen wir die nebelhaften Schemen seiner Arbeit der Reihe nach vor unseren Augen auftauchen.
Es zeigt sich ein schönes Frauenantlitz, ernst und geheimnisvoll, einen Finger an den Lippen, Es stellt die Menschheit dar. Von diesem Gesicht treten zuerst die Augen klar hervor und verschwimmen dann wieder. Jetzt das Ohr ... die Nase, der sich eine Rose nähert ... nun der Mund ... und der Finger: Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack, Gefühl ...: »Physiologie der Sinne«.
An Stelle des Antlitzes erscheint jetzt der Dr. Prologus der Erinnerung. Er nimmt eine Autopsie vor, seziert eine Zunge, studiert die Augen eines Nachtvogels, beugt sich über einen Ameisenhaufen, betrachtet durch ein Vergrößerungsglas eine Schnecke, folgt querfeldein einem Hunde, der mit hohem Windiange sucht, gibt sich mit der Zucht und Dressur von Brieftauben ab ...: »Physiologie der Sinne«.
Die ganze Vision verschwindet. Mit männlicher Geste hat der Gelehrte sie verscheucht. Er nimmt wieder sein Manuskript zur Hand, blättert darin ... zum Teufel: ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch ... Radierungen, Korrekturen, Darübergeschriebenes machen daraus etwas völlig Unleserliches – ausgenommen für den Verfasser.
»Vorwärts!« muntert er sich auf. »Noch ist es nicht fertig. Dieses Kryptogam muß noch maschinengeschrieben werden!«
Und höchst gemächlich nimmt er einer wundervollen Schreibmaschine die Hülle ab.
Das sieht eigentlich nach gar nichts aus, aber das Orchester muß darüber mehr wissen, denn sofort exekutiert es eine wilde, russische, außergewöhnlich leidenschaftliche, sozusagen alarmierende Weise. Wer in die Geheimnisse der russischen Musik eingeweiht ist, gewinnt sofort den Eindruck, daß die Schreibmaschine – Achtung! Bitte aufpassen! – eine eigene Rolle spielen wird, ganz sicher keine gewöhnliche! Die Pikkoloflöte pfeift wie eine Mutter-Kobra, der die Manguste Rickiticki-Tavi ihre quabbligen Eier raubte. Ein Duo dumpf klingender Signalhörner stößt dazu mißtönige Rufe aus. Violinen und Bratschen, Baß und Kontrabaß fallen mit ein. Um in sarkastischer Weise das Geräusch der Schreibmaschine nachzuäffen, vollführen die Geigenspieler erstickte Pizzikati, während andere mit dem Holzteile ihrer Streichbögen auf den Resonnanzboden der Instrumente loshämmern. Ach, Teuerste, ich sage Ihnen, wie das packend, illusionistisch, ja geradezu Hoffmannsthalisch wirkt, können Sie sich kaum vorstellen. Es ist das »Kommende«, so wie ehemals Saint-Saëns ... doch Schwamm darüber! Als Kind haben Sie sich doch oft damit unterhalten, Dinge zu suchen, die Ihre kleinen Gefährten versteckten? Erinnern Sie sich noch an das Konzert der jugendlichen Stimmen, das bald ein Gemurmel war, bald zu lautem Gekreisch ausartete. »Kalt ... kalt! ... sehr kalt! Warm ... heiß ... glühend!« und dann plötzlich: »du brennst! ... du brennst! ... du brennst!«
Aber der Dr. Prologus merkt nicht, daß er »brennt«, denn er achtet nicht auf die prophetischen Weisen des Orchesters, schließlich und endlich ist er ja nur eine Photographie, ein konventioneller Mime.
Er beschränkt sich darauf, von oben herab die Schreibmaschine zu betrachten, ohne sich vor die Tastatur zu setzen. Langweile malt sich auf seinen Zügen.
»Hm!« grübelt er vor sich hin. »Wie? Jetzt, wo ich ein epochales Werk vollendet habe, soll ich mich gleich wieder einspannen? Hab' ich mir nicht etwas Erholung verdient? Acht Tage Ferien? ... Und ob! Wir werden die ›Physiologie der Sinne‹ so in acht Tagen mal abklappern. Bis dahin wollen wir ein wenig leben, zum Satan!«
Er überdeckt wieder die Schreibmaschine, der arme Sterbliche, der nicht in die Zukunft zu schauen vermag und ist taub für die Mahnschreie des Orchesters, das hier den antiken Chor darstellt und ihm nun, leiser werdend, zuruft: »Kalt ... kalt ... sehr kalt!«
Doch im Schatten dort erscheint – oh' ausdrucksvolles Wunder! – die Schreibmaschine unter ihrer Hülle in purpurnem Flammenscheine! Sofort lassen wieder die Musikanten eine vielsagende Kakophonie erschallen.
Ehe Dr. Prologus sein Manuskript in die Schublade stopft, hält er einen Moment zögernd inne. Er schielt nach der Schreibmaschine hinüber, die sich beeilt, zu verlöschen, und er sieht nur ihre harmlose, nüchterne Hülle. Mit einem Rundblick überfliegt er noch sein Arbeitszimmer, dessen weitgeöffnetes Fenster die Aussicht auf einen höchst angenehmen Boulevard gewährt und durch welches das Orchester die verführerischen Klänge der Melodien des Lebens hereinfluten läßt.
»Es bleibt dabei! In acht Tagen! Gehen wir!« Die Schublade schließt sich über der »Physiologie der Sinne« und die Türe hinter dem Dr. Prologus.
Da ist er wieder! Tadellos angezogen, die rote Kommandeur-Rosette im Knopfloch. Obwohl er einen Gelehrten darstellt und Prologus ist und bleibt, macht er keinen lächerlichen Eindruck, denn er bewahrt die etwas unverschämte Sicherheit und das Selbstbewußtsein, das stets die Prologusse, die Lustigmacher der Bühne und Sprecher zum Publikum charakterisiert.
Als Feinschmecker fröhlichen Festes weilt er in Paris.
Jeder Urlaub verfliegt blitzschnell. Man wird sich dessen bewußt, sieht man voraus, was folgt. Kaum erscheint ein Bild, verschluckt es ein Nebel und ein anderes taucht auf der Leinwand auf, so daß oft zwei sich übereinanderschieben, was zumeist recht lästig ist. So erblickt man immer zwei Dr. Prologusse, von denen der eine deutliche Gestalt annimmt, während der andere sich verflüchtigt. Aber das Sonderbarste dabei ist, daß sich all dies im Rahmen eines großen Auges, eines Riesenmundes oder eines Kolossalohres einem nähert oder den Blicken entschwindet. Das sichtbare Leitmotiv. Halten wir uns nicht auf. Ihr habt ja verstanden, wißt sogar, liebe Leser, daß ständig das Klangleitmotiv der Schreibmaschine sich hartnäckig durch die Musik hindurchringt.
Dr. Prologus durchmißt die Herbst-Gemälde-Ausstellung. Saal an Saal reiht sich bis ins Unendliche aneinander. Tausende Bilder defilieren in Massen vorbei, als sähe man sie durch das Fenster eines Expreßzuges vorüberfliegen. Das gleiche gilt, mutatis mutandis, von den Skulpturen. Prologus trifft Freunde. Lebhafte höfliche Zwiegespräche über Kunst: Schulen, Farben, Preise, Zeichnung, Personalität, Gefühl für Natur usw.
Pomphaftes Diner bei der ewig schönen Madame Dupont, genannt »du Pont des Arts«, weil diese Brücke nach dem Institute der schönsten Künste führt. Saftige Geschichtchen, Klatsch, Schick, Geist, nackte Brüste, zuweilen geradezu Ärgernis erregend. Einzelne Literatur-, Kunst- oder Wissenschaftshanswurste. Wahrnehmung unter dem Tische: die sich miteinander unterhaltenden Füße der Damen und Herren. Dr. Prologus, gewohnt, sich auf den Untergrund des Planeten und die Kulissen der Gesellschaft einzustellen, lächelt philosophisch.
Konzerte. Dr. Prologus hat seine Liebhabereien. Er gustiert namentlich die etwas burlesken Tonwerke und symphonische Darstellungen: »Totentanz« – »Zauberlehrling« – »Gänsekönigin« ... erfüllen ihn mit Behagen. Er bewundert den Kapellmeister, wie geistreich er mit seinen Armen herumfuchtelt und gerät in Ekstase, als er »Petruschka« hört, zum Entzücken von Tänzerinnen und Tänzern gegeben, die den Bolschewiken entkamen.
Trauliche Spaziergänge im »Bois«. Die Herbstzeit, die alte Blondine, atmet den Duft von Nüssen aus. Sehr viele schöne Leute und Dummköpfe jeder Gattung. Natur. Saison. »Ganz Paris«, Liebeleien, Weltluft.
Dann: Empfänge, Tees, künstlerische und literarische Salons. Bälle, selbst »Dancings« mit Negern. Jazz. Wirbel. Anstrengendes Hüpfen. Tanzepilepsie. Zahllose Gecken. Wenn man schon Urlaub hat, muß man überall ein wenig hingehen.
Doch was liest Dr. Prologus, wenn er den nächtlichen Schlaf erwartet? Am meisten entzückten ihn stets »Micromégas«, »Die Insel der Freuden«, »Gulliver«.
Die folgenden Tage: Theater, Kinos, Zirkusse, Tingeltangels ... und unaufhörlich galoppiert, zusammengepfercht auf der Leinwand, die ganze Heerschar des Zeitalters, Männer, Zuhälter und Frauen, vorüber.
Ein jähes »Halt!« Der wahnwitzige Lauf stoppt. Gebieterisch, keine Widerrede zulassend, zeigt der Kalender in Riesenschrift den »6. November«.
Die acht Tage Ferien sind um.
Mit triumphaler Furie ertönt wie eine Fanfare, näselnd und höhnisch, das Leitmotiv der Schreibmaschine. Diabolische Lachsalven lösen sich aus den Instrumenten und begrüßen den Dr. Prologus, als er wieder sein Arbeitszimmer betritt.
Um Himmelswillen, was wird ihm zustoßen, daß ein derart infernalischer Musikhexensabbath losbricht, bei dem die verruchteste aller Trommeln einen disharmonischen Wirbel schlägt und die Klarinetten dazwischenkreischen wie eine Herde närrisch gewordener Enten?
Seelenruhig durchschreitet Dr. Prologus den friedlichen Raum und nimmt jetzt Platz, um die »Physiologie der Sinne« abzutypen.
Wie ein zärtliches Vorspiel streicht er mit den Fingern über die Maschine hin.
Das Manuskript neigt sich von der schiefen Fläche eines Pultes ihm zu.
Man liest die Aufschrift:
Physiologie der Sinne.Einleitung.
»Es ist sehr bedauerlich, daß Cournot in seiner Abhandlung ›Von der Ordnung und Zusammengehörigkeit der grundlegenden Ideen in der Wissenschaft und Philosophie‹, nicht minder übrigens Bonier in seiner ›Audition‹ und Laures in seinen ›Synesthesien‹, vollkommen mit Schweigen über das hinwegging, was doch schon Descartes und Condillas vorausahnten. Ich will sagen ... etc. ...«
Auf einem Tischchen erhebt sich der Stoß akkurat zugeschnittener weißer Blätter und daneben liegen die blauen Karbonpapiere, die dem Dr. Prologus gestatten, gleichzeitig zwei Exemplare seines Werkes abzutippen.
Sorgsam legt er ein Karbonpapier zwischen zwei weiße Blätter. Krack – die drei Blatt sind von der Walze ergriffen und – tack – tack – tack ... geht's los, und das Farbband gleitet, die Typen schlagen, das jungfräuliche Weiß der Bogen bedeckt sich mit den Titelworten:
Physiologie der Sinne.
Dr. Prologus lächelt behaglich. Er träumt von den Dingen und Wesen, die sich im polierten Schwarz der Maschine widerspiegeln: Diners, Gemälde, Konzerte, Tanz, Swift im Smoking, Voltaire im Besuchsanzuge ... das alles mischt sich in den Ideengang seiner Physiologie, in die Erinnerung an seine Vorarbeiten und Beobachtungen. In einem astronomischen Himmel, wo bevölkerte Welten kreisen, exekutieren Paare ihren »Black-bottom«. Mit den Netzaugen eines Insektes sieht Prologus wieder die Herbstausstellung.
»Zum Kuckuck! Aufpassen!« murmelt er, lächelt abermals und fährt in seiner Tätigkeit fort.
Einleitung.
»Es ist sehr bedauerlich, daß Cournot ...«
Bachanal im Orchester.
Endlich gelangt der Physiologist, zerstreut und ohne irgendeinen Schreibschnelligkeitsrekord aufzustellen, an das Ende der ersten Seite.
Das Resultat ist nicht allzuschlecht. Dies Blatt sieht gut aus. Wie schaut es mit dem Karbondurchschlag aus? Ist er sauber ausgefallen?
Verblüffung! Was ist das?!
Völlig verdutzt liest er:
Ein Mensch unter den Mikroben.
1. Teil.
Wunder über Wunder! Das Karbonpapier hat nicht die »Physiologie der Sinne« kopiert, sondern ganz etwas anderes. Dr. Prologus hat unter einem den Anfang seiner streng wissenschaftlichen Abhandlung und darunter – was? – abgetippt? Den Anfang einer Art Märchen ...
Ist's ein Traum? Ist er verhext? ...
Dr. Prologus fängt zu lachen an, die Violinen spielen dazu in Akkorden.
»Überraschendes Phänomen von Urzeugung«, murmelt er. »So wie Macduff – wenigstens nach Shakespeare – nicht wie alle anderen Menschen von einem Weibe geboren ward, so wird auch diese Geschichte nicht wie sonst alle Geschichten einem menschlichen Hirne entspringen.«
Und mit Feuereifer nimmt er wieder seine fabelhafte doppelte Tätigkeit auf und lacht, lacht, lacht. Seine Finger rivalisieren an Fixigkeit miteinander. Er ist der reinste Klavierkünstler, ein Kollege Paderewskis. Wie er so arbeitet, hallt es, als ob ein Platzregen auf das Dach niedertrommle. Weiter, weiter, weiter! Die Blätter türmen sich zum Stoße auf, auf der einen Seite die »Physiologie«, auf der andern »Ein Mensch unter den Mikroben«.
Verehrter Herr Prologus, jetzt können Sie abtreten. Über das Wissenswerte und Notwendige haben Sie uns unterrichtet. Ziehen Sie Ihren doktoralen Gehrock aus, schminken Sie sich ab und spielen Sie unter anderer Maske Ihre Mimenrolle weiter. Wir wissen ja, wer der »Mensch unter den Mikroben« ist.
Dem Leser steht es völlig frei, anzunehmen, daß sich das Kino, das unentwegte, mit ihm einen Witz erlauben will, oder daß jenes Büchlein, das die unwiderstehlichen Logenschließerinnen jetzt im Saale zum Verkaufe herumreichen, nur ein Märchen enthält. Er kann sich aber auch brummend an die Pantomime halten, wenn er die Zeit der Märchen für vorüber hält und glaubt, daß niemand mehr an den Erzeugnissen argloser Phantasie Gefallen finden kann.
ERSTER TEILFléchambeaus Verlobung
Erstes Kapitel Das Kapitel eines Hutes
»Saint-Jean de Nèves«, Sitz einer Unterpräfektur, ein kleines Nest am Fuße des Hochgebirges, glich einer vor Urzeiten niedergegangenen Erdlawine, auf der nach und nach die Kultur erblühte.
Den Mittelpunkt der Ortschaft bildete ein freier Platz mit einem Brunnen von schlichter Monumentalität, den die allegorische Figur der Republik, ein Weih mit riesigen Brüsten, krönte.
Dort wohnte Pons, der junge Dr. Pons, zwischen einem Perückenmacher und einem Notar, in einem echt savoyardischen Häuschen, dessen Front völlig unter Glyzinien verschwand, und dessen großes Dach alte Ziegel deckten. Ein Schriftsteller von gestern oder vorgestern würde zweifelsohne seine Geschichte damit beginnen, die große Enttäuschung Dr. Pons' zu schildern, als er bei seinem Schulaustritt von einem seiner Lehrer erfuhr, sein gesundheitlicher Zustand würde es nicht erlauben, daß er in Paris oder in einer anderen Großstadt die ärztliche Kunst ausübe, beziehungsweise daß er sich dort, wie er es wünschte, dem Studium ruhmvoller klinischer Forschungen hingebe, was zur Folge hatte, daß Dr. Pons nach »Saint-Jeanwo nur zwei Kollegen waren, die ihn hochschätzten, weil er sich sehr wenig aus Patientenzulauf machte.
Ein etwas modernerer Schriftsteller, wenn auch kein viel modernerer, würde seine Erzählung mit der Ankunft Fléchambeaus, eines Freundes von Dr. Pons, bei diesem beginnen; er würde berichten, daß Fléchambeau, Amtsnotar beim Pariser Obersten Gerichtshofe, ursprünglich nur ein paar Wochen in »Saint-Jean-de Nèves« zur Erholung und zum Vergnügen bleiben wollte, nach drei Monaten aber noch immer dort war, und zwar dank des unwiderstehlichen Eindrucks, den Fräulein Olga Monempoix, älteste Tochter des Herrn Emil Monempoix, Präsidenten des Zivilgerichts, und dessen Gattin, geborene Sanson-Darras, auf ihn gemacht hatte.
Wir dagegen gehen ohne lange Umschweife in medias res. –
»Viel Glück, Alter!« sagte Pons.
Sie standen in der Halle. Durch die offene Tür sah man auf den Platz hinaus, auf die vollbusige Brunnen-Marianne und gerade gegenüber auf das Haus des Herrn Präsidenten Monempoix.
Fléchambeau schüttelte seinem Freunde die Hand.
Lang wie ein Besenstiel – maß er doch von der Sohle bis zum Scheitel einen Meter sechsundneunzig Zentimeter –, zeichnete sich Fléchambeau noch durch brennrotes Haar aus – »Haar à l'a Crécy«, wie Pons sich im Spaße auszudrücken pflegte. Er war so hoch gewachsen, daß er zwanzig Sekunden brauchte, um das Kreuzzeichen zu machen, und wenn er den Hut auf sein flammrotes Haupt setzte, glich er einer brennenden Kerze, die sich selbst auslöscht.
Momentan trug er einen wundervollen blitzenden Zylinder. Sein tadellos geschnittenes Jackett von schwarzer Farbe stach vorteilhaft von dem rosenholzfarbenen Beinkleid ab. Lackschuhe Nr. 47 bekleideten die Füße des Riesen, und das Leder seiner Handschuhe (Nr. 9[3/4]), die er über die dicken Finger gezogen hatte, glänzte wie frische Butter. Drei Nelken, die Fléchambeau sich ins Knopfloch gesteckt, glichen im proportionalen Verhältnisse einer einzigen.