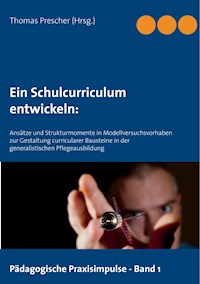
Ein Schulcurriculum entwickeln: E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Curriculumsentwicklung beschäftigt aktuell die Lehrkräfte in den Berufsfachschulen für Pflegeberufe. Häufig lässt sich eine Verunsicherung beobachten, was denn genau diese Curriculumsentwicklung bedeutet, wie sie innerhalb eines Trägers oder Berufsfachschule umgesetzt werden kann und worauf konkret zu achten ist. Im vorliegenden Band werden dazu konkrete Impulse gegeben, ohne sich in curriculumstheoretischen Betrachtungen zu verlieren. Im Ergebnis werden unterschiedliche Vorgehen dargestellt, welche sich an verschiedenen Modellversuchen als modulare Gestaltungsansätze orientieren und jeweils zusammenfassend darstellt, wie ein Modul für die generalistische Pflegeausbildung aufgebaut sein kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Thomas Prescher
Einleitung: Ein Schulcurriculum entwickeln
Eva Baborowsky und Anna Kamm
Curriculumsentwicklung: Strukturmomente eines curricularen Bausteins am Beispiel „Leben mit Behinderung“
Christina Schmidt und Lisa Schöpf
Einen curricularen Baustein mit einer Fallbeschreibung verbinden am Beispiel des Pflegeprozesses
Claudia Reimer
Curriculare Bausteine als Basis der Unterrichtsreihenplanung am Beispiel chronischer Schmerz bei onkologischen Patienten
Waltraud Bergmaier
Didaktische Jahresplanung als curricularer Baustein für die generalistische Pflegeausbildung am Beispiel Menschen mit chronischen Wunden situationsbezogen und individuell pflegen
Autorinnen und Autoren
THOMAS PRESCHER
Einleitung: Ein Schulcurriculum entwickeln
Zusammenfassung
Die Curriculumsentwicklung beschäftigt aktuell die Lehrkräfte in den Berufsfachschulen für Pflegeberufe. Häufig lässt sich eine Verunsicherung beobachten, was denn genau diese Curriculumsentwicklung bedeutet, wie sie innerhalb eines Trägers oder Berufsfachschule umgesetzt werden kann und worauf konkret zu achten ist. Im Beitrag werden dazu konkrete Impulse gegeben, ohne sich in curriculumstheoretischen Betrachtungen zu verlieren. Im Ergebnis wird mit Ausblick auf die verschiedenen Beiträge ein Vorgehen dargestellt, welches sich an Modellversuchen als modulare Gestaltungsansätze orientiert und zusammenfassend jeweils darstellen, wie ein Modul nach dem gewählten Ansatz aufgebaut sein kann.
1 Curriculare Arbeit in den Gesundheits- und Plegeberufen: Navigieren im Nebel
In der curricularen Ausbildung in den Gesundheitsberufen besteht Konsens darüber, dass eine Kompetenzentwicklung an die Erfahrung der Lernenden gebunden ist. Als zentrale bildungspolitische Leitkategorien fungieren das Lernfeld, die berufliche Handlungssituation und die Ausrichtung der schulischen und praktischen Unterweisung auf das übergeordnete Ziel der Handlungskompetenz sowie der Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Hundenborn & Brühe 2005, S. 28). In zahlreichen Publikationen zur Unterrichtsgestaltung werden dazu die Begriffe des Curriculums, der Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen oder der Subjekt- und Fallorientierung in der Lernprozessgestaltung entfaltet (z.B. Kremer et al. 2005).
All diesen Begriffen haftet jedoch der Charme von „Plastikwörtern“ an, wie es Pörksen (1992, S. 16ff.) formuliert. Unter Plastikworten versteht der Autor fachsprachliche Begrifflichkeiten, die sich kaum in die alltäglichen Lebenszusammenhänge einzufügen scheinen. Sie fungieren zwar auf der einen Seite als Türöffner zum Erschließen eines Raumes, eignen sich aber nicht dafür, das Hindurchgehen zu ermöglichen. Sie sind auf eine gewisse Art und Weise verständlich und ermöglichen Anschlüsse im professionellen Austausch, bleiben jedoch zu unspezifisch, als dass die Praxis mit diesen Worten tatsächlich etwas gestalten könnte.
Der Austausch mit Praxisvertretern führt folglich immer wieder zu der Frage, was der Begriff der Kompetenz meine und wodurch er sich jenseits des akademischen Diskurses beispielsweise von dem Verständnis der Schlüsselqualifikationen unterscheide. Dies ist insofern problematisch, als dass in der Ausbildung in den Gesundheitsberufen eine bildungstheoretisch motivierte Orientierung, wie sie in der Bildungstheorie nach Klafki (1996) zum Ausdruck kommt, vorherrscht, die nach wie vor am Inhalt ausgerichtet ist. Eine kompetenzorientierte Beschreibung der Lerngegenstände sind in Curriculars eher selten zu beobachten bzw. gibt es auch vorbildliche Beschreibungen, so folgt die Umsetzung oftmals einer inhaltlichen Logik.
Insgesamt scheint ein Theorie-Praxis-Problem zu bestehen. Auf der einen Seite steht die Praxis, in der die Auszubildenden eine klare Ausrichtung auf das benötigen, was sie in der täglichen Begegnung mit zu Pflegenden unterstützt. Hier stellt sich ein Bild von eher pragmatisch ausgerichteten SchülerInnen und FachlehrerInnen dar, welche mit den theoretischen und komplexen Modellen, wie zum Beispiel der interaktionistischen Didaktik nach Darmann-Fink (2010, S. 14), wenig anfangen können, da diese als „(…) wissenschaftlich begründete Handlungs- und Reflexionstheorien (…)“ (ebd. S. 13) verstanden werden. Damit soll keine Kritik an den theoretischen Modellen geübt werden, sondern mit Blick auf die anvisierte Zielgruppe der Auszubildenden in den Pflegeberufen die Art der praktischen und ungefilterten Umsetzung.
So erscheinen auf der anderen Seite Konzepte wie das Lernbegleitbuch für SchülerInnen der Akademie des Klinikums München (2012) als überzogen, weil zu komplex, zu abstrakt und zu theorielastig: Zum einen wirken die 228 Seiten nicht nur extrem umfänglich, sondern hinsichtlich der didaktischen Struktur im konkreten Einsatz durch die SchülerInnen auch intransparent. D.h., es fehlt eine klare Beschreibung, wann die LehrerInnen und SchülerInnen wie damit arbeiten sollen. Was in jedem Fall die Zielgruppe zu überfordern scheint, ist die Darlegung des didaktischen Ansatzes mit den drei Arten der Erkenntnisgewinnung als technisches, praktisches und emanzipatorisches Erkenntnisinteresse (ebd. S. 9). Allein diese Begriffsverwendung erscheint als nicht zielgruppenadäquat und die „(…) stellenweise (…) ausgeprägte Ignoranz gegenüber aktuellen (berufs-)pädagogisch-didaktischen Leitkategorien, wie z.B. Handlungsorientierung oder Lernfeldsystematik“ (Walter et al. 2011, S. 19), auch nicht verwunderlich.
Dabei ist die Ursache dafür sicherlich nicht in der Komplexität der theoretischen Modelle zu sehen, sondern in der Art und Weise der programmatischen Arbeit zur schulischen Lehrplangestaltung. Diese folgt häufig einem eher pragmatischen Ansatz ohne Lehrplankommission oder Bildungsgangkonferenz. Die Lehrplanverantwortlichen entwickeln ein „einfaches“ Zeit- und Inhaltsmodell mit entsprechenden zugeordneten Fachlehrern, welche im Wesentlichen innerhalb der Fächersystematik, Krankheitsbilder oder der pflegewissenschaftlichen Struktur selbst-verantwortlich die Zeitfenster methodisch ausgestalten (vgl. Walter 2008, S. 55).
Die Kunst didaktischen Handelns kann hier darin gesehen werden, die Vielfalt der Modelle und Prinzipien zu nutzen und in einem Prozess geschickter Reduktion auf das Wesentliche in die Entwicklung der Unterrichts- und Ausbildungsentwürfe einfließen zu lassen. Die Hauptherausforderung scheint in dem Aspekt zu bestehen, dass eigentlich zu viel an Handlungsoptionen und Begründungen zur Verfügung steht. So stellt für einen fallorientierten Zugang das phänomenologische Bearbeitungsmodell zur Entwicklung authentischer Handlungssituationen von Walter (2015, S. 13) sicher eine gangbare Handlungsstruktur zur Verfügung.
Jedoch erscheint die anvisierte Berufsfeldanalyse als sehr komplex und zeitaufwendig, so dass davon ausgegangen werden kann, dass sie in der Praxis wenig anschlussfähig ist. Solche wissenschaftlichen Konzepte verweisen aber darauf, dass die an Handlungs- und Lernsituationen orientierte Lernfeldkonzeption keineswegs eine triviale Aufgabe in der Umsetzung darstellt und dass diese Aufgabe durch entsprechende Professionalisierungsstrategien, wie es Winther et al. (2015, S. 9) formulieren, zu unterstützen ist. „Es ist daher eine Fortbildungskultur zu entwickeln, die anschlussfähig an die Professionalitätsdebatten des Lehrpersonals ist und die Wechselbeziehungen zwischen Prüfungsformaten und den fachdidaktischen Lehr-Lernsettings der beruflichen Bildung berücksichtigt“ (ebd.).
Die Berücksichtigung solcher Professionalisierungsstrategien erscheint aus zwei Aspekten heraus bedeutsam zu sein. Zum einem braucht es eine Transformation der Plastikwörter in ein stimmiges und nachvollziehbares Verständnis von Kompetenz und Kompetenzentwicklung als eine gemeinsam geteilte Anschauung darüber, welche Handlungen und Veränderungen möglich und notwendig sind (vgl. Pörksen 1992, S. 33). Zum anderen stellt sich die didaktische Modellierung von Kompetenzen in Unterricht, Ausbildung und Prüfungen als anspruchsvolle Aufgabe dar.
Schmidt et al. (2015) stellen in ihrem Beitrag verschiedene Transformationswerkzeuge zur kompetenzbezogenen Ausdifferenzierung curricularer Vorgaben dar. Diese erscheinen derart komplex, dass ohne eine eigenständige Einweisung des Ausbildungs- und Lehrpersonals in die Anwendung dieser Transformationswerkzeuge kaum handlungsorientierte Lern- und Prüfungsaufgaben zu entwickeln sind.
2 Konsequenzen für die Curriculare Arbeit: Das Haus des Curriculums
Bei aller Komplexität benötigt die Curriculumsentwicklung in den Berufsfachschulen einen Anfang. Der Schlachtruf „Curriculumsentwicklung ist bzw. braucht Schulentwicklung“ (vgl. Prescher 2019) liegt dabei nahe. Verständtlich ist jedoch auch, dass bei allen anstehenden Aufgaben und dem chronischen Personalmangel in den Berufsfachschulen dieses Thema behutsam und aus systemischer Perspektive stimmig angegangen werden muss. Die curriculare Arbeit als Projekt und dieses Projekt als Teil der Schulentwicklung zu verstehen erscheint dabei als ausreichend. Weitergehende Anliegen dieses Vorhaben mit einer Veränderung oder Weiterentwicklung der Lernkultur zu versehen mögen beherzt und gut gemeint sein, überfordern aber leider schnell die Akteure.
In den Workshops, die gegenwärtig durch den Autor mit Schulen zum Thema durchgeführt werden, stellt sich der folgende Einstieg als Gelungen dar, weil der Blick auf das Ganze gelenkt wird und gleichzeitig sichtbar wird, was konkret getan werden kann: Curriculumsentwicklung wird zum Projekt und als Projekt zum Teil der Schulentwicklung mit einem klar definierbaren Ziel.
Zwei Teilnehmer aus der Gruppe dürfen sich hinter einer Moderationswand das „Haus des Curriculums“ (vgl. Abbildung 1) anschauen, ohne es zu berühren. Sie repräsentieren die Schulleitung oder die Curriculumsbeauftragten. Sie erhalten folgende Aufgabe:
Aufgabe: Sie finden hinter der Moderationswand ihr Schulcurriculum. Sie haben max. 5 Minuten das Curriculum zu betrachten und sich einzuprägen. Ihre Aufgabe ist es, nach diesen 5 Minuten den anderen TeilnehmerInnen zu erklären, was Sie gesehen haben und ihnen mitzuteilen, was Sie tun sollen, um das Curriculum nachzubauen.
Abb. 1: Hinter einer Moderationswand steht das Haus des Curriculums
Das Ergebnis ist verblüffend. Die meisten TeilnehmerInnen wissen nicht nur nicht, was sie da sehen. Sie haben auch keine Vorstellung wie der Weg dort hin sein kann. Dem Kollegium dann zu erklären, was es mit einer Moderationskarte und Schere tun soll, um das Haus nachzubauen ist schier unmöglich.
Die Auswertung der Übung und der Übertrag auf die jetztige anstehende Aufgabe, ein Curriculum für die generalistische Pflegeausbildung zu entwickeln, mündet in verschiedene Erkenntnisse:
Das Kollegium hat keine gemeinsame Vorstellung, was das Ergebnis des Schulcurriculums sein soll und wie der Weg dahin aussehen kann. Dies schließt ein gemeinsames Verständnis, was die Generalistik ist ein. Es bringt nichts, Äpfel – wie es jetzt ist – mit Birnen – wie es sein wird – zu vergleichen. Dies bedeutet nur ein fortwährender Übertrag des Alten auf das Neue und damit ein Verharren im bisherigen. Die LehrerInnen in verschiedenen Workshops sprechen immer wieder davon, dass es darum geht das alte loszulassen und die Generalistik als ein neues Berufsbild anzuerkennen. Es ist ein neuer Beruf und nicht ein Beruf, der die alten drei Ausbildungsrichtungen kombiniert.
Deutlich wird in der Erklärung zum „Haus des Curriculums“ auch, dass zu viele Details verwirren und dass ein fehlender sprachlicher Konsens das Verständnis erschwert (z.B. Beschreibung des Dachs als Satteldach oder Pultdach). Schauen sich die Teilnehmer dann das Ergebnis an und entwickeln gemeinsam ein Bild vom Ziel, so werden auch immer wieder Stimmen laut, die sagen, dass Ganze sollte nicht „Haus des Curriculums“ heißen, sondern besser „Dach des Curriculums“. Was immer passend sein mag, wichtig ist, dass ein Kollegium ein gemeinsames Verständnis entwickelt.
Die Beschreibung, was am Ende das Ergebnis sein soll, wird als wertvoll empfunden. Wichtiger ist aber noch, dass die Verantwortlichen eine Vorstellung über den Weg zum Ergebnis haben und genaue Schritte formulieren. Es braucht eine gute Abstimmung, Begleitung und Koordination. Selbst das Haus in die Hand zu nehmen, aus verschiedenen Perspektiven zu schauen und den Nachbau auszuprobieren, Erfolge und Misserfolge zu reflektieren, wird als wertvoll empfunden. Aus Sicht eines Prozessbegleiters sogar als notwendig erachtet. Dieses Haus stellt eine derart komplexe Aufgabenstellung dar, dass selbst mit anfassen und ausprobieren Gruppen nicht auf die Lösung kommen. Scheinbar haben sie die nötigen Informationen, ein klares Zielbild, jeden erdenklichen Handlungsfreiraum und doch kommen sie nicht auf die Lösung. Eine Situation, die für das Formulieren curricularer Bausteine identisch ist.
Für die curriculare Arbeit wird auch deutlich, dass es wichtig ist, gemeinsam eine Struktur zu finden, bei der das Ganze gesehen wird, die Zusammenhänge berücksichtigt werden und dass der Weg zum Ziel ein „lückenloser“ Weg ist. Fehlt ein Schritt oder fehlen an einer Stelle Informationen, so kann kein Curriculum für eine dreijährige Ausbildung entwickelt werden, das systematisch und kohärent ist.
Im Folgenden soll als Kern des Bandes der Fokus auf das gemeinsame Zielbild gelenkt werden. Damit verbindet sich die Frage danach, wie ein Curriculum für eine generalistische Ausbildung aussehen kann. Wie in der Übung, wird dabei schnell deutlich, wie wichtig ein gemeinsamer Entwurf des Zielbildes bereits am Anfang ist.
Die AutorInnen des Bandes stehen als LehrerInnen und SchulleiterInnen in Berufsfachschulen für Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege selbst vor der Frage, wie in ihren Schulen ein Curriculum gestaltet werden kann. Sie wagen stellvertretend für ihr Kollegium und die LeserInnen des Bandes den Blick hinter die Moderationswand. Als Teil eines Netzwerkes haben sie sich auf den Weg gemacht, die verschiedenen bestehenden Häuser des Curriculums – d.h. Modellversuche und Konzepte zur generalistischen Pflegeausbildung zu sichten.
Sie haben sich zwei bis drei Konzepte zur Hand genommen und sie nach dem A-B-F-Schema (vgl. Abbildung 2) bearbeitet.
A Ansprechen: Dies umfasst das deskriptive Darstellen des Beispiels hinsichtlich Struktur, Aufbau, Grundannahmen usw.
B Beurteilen: Die zugrundegelegten Modelle wurden dann aus Sicht der Bildungspraxis und den konkreten Rahmenbedingungen vor Ort nach Vor- und Nachteilen, positiven und negativen Gesichtspunkten beurteilt.
F Folgern: Aus den Schritten A und B konnte dann eine begründete Entscheidung formuliert werden, indem die einzelnen Aspekte abgewogen wurden und ein Aufbau für das schulinterne Curriculum exemplarisch abgeleitet wurde. Dies wird dann jeweils an Hand eines konkreten curricularen Bausteins dargestellt.
Abb. 2: Analysemodell für ein schulspezifisches Haus des Curriculums (Abbildung aus einer Workshopdokumentation)
Im Ergebnis entsteht daraus ein praxisorientierter Ansatz der Curriculumsentwicklung. Dieser trägt insbesondere der Situation Rechnung, dass ab 2020 die generalistische Pflegeausbildung umgesetzt werden soll, aber sowohl die Bundesvorgaben und die Umsetzung auf Landesebene noch ausstehen. Den Schulen ist es so möglich, sich an das Thema durch die Sichtung der Modellversuche anzunähern (Schritt 1), ein Schulcurriculum nach einer Modulstruktur zu entwickeln (Schriftt 2) und die Module als curriculare Bausteine passend zum Kollegium zu formulieren und später mit dem Lehrplan abzustimmen bzw. Inhalte zuzuordnen.
Für das Land Bayern steht bei vielen Berufsfachschulen der ISB Modellversuch für eine generalistische Pflegeausbildung als zentraler Bezugspunkt „fest“.
Abb. 3: Drei Schritte zum eigenen Schulcurriculum
Aus den bisherigen Workshops können für dieses Vorgehen folgende Aspekte benannt werden, die eine Umsetzbarkeit und praxisnahe Bearbeitbarkeit ermöglichen:
Ein Curriculum ist keine Unterrichtsplanung. Es sollte daher nicht zu detailiert sein und im Sinne eines offenen Curriculums die Handlungsfreiheit der LehrerInnen wahren. Einen methodischen Anhang als möglicher Unterrichtsreihenverlauf wie





























