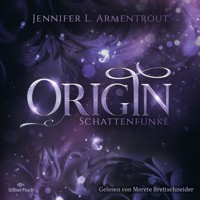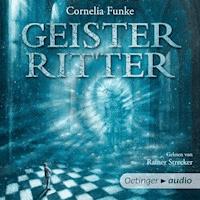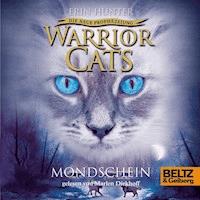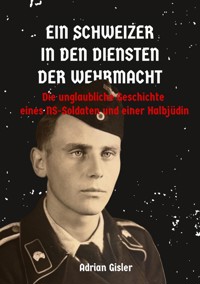
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
"Der Krieg ist eben anders, als wie er in den Geschichtsbüchern steht." - Willy Lämmle Ein Grossteil der Menschen kennt den Zweiten Weltkrieg aus einer distanzierten und neutralen Sicht. Millionen von Toten sind nur eine Statistik und ein Schlachtfeld mit abertausenden Panzern, Flugzeugen und der neusten Technologie ist nur ein Punkt auf der Landkarte. Die wahren Grauen eines solchen Konfliktes kommen erst mit den Geschichten und Erzählungen der Überlebenden zum Vorschein. In diesem Buch begleitet man Willy Lämmle, einen Panzersoldaten der Wehrmacht, durch die sandigen Dünen Nordafrikas über die schneebedeckten Landschaften Russlands bis zur Flucht in sein Heimatort Schwellbrunn in der Schweiz. Am Ende seiner Reise durch Nordafrika und Europa begegnet er seiner grossen Liebe, Ursula - Einer ungarischen Halbjüdin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Adrian Gisler
Ein Schweizer in den Diensten der Wehrmacht
Die unglaubliche Geschichte eines NS-Soldaten und einer Halbjüdin
© 2023 Adrian Gisler
Lektorat: Roland Blümel
Weitere Mitwirkende: Christa Pinggera, Jakob Pinggera, Reto Lehner, Evelina Lehner, Christina Pinggera, Daniel Gisler, Colin Masely, Andreas Beriger, Matthias Müller
ISBN Softcover: 978-3-347-68489-8
ISBN Hardcover: 978-3-347-68494-2
ISBN E-Book: 978-3-347-67501-8
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschliesslich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
«De Krieg isch ebe anders, als wie er in de Gschichtsbüecher stoht.»
- Willy Lämmle (1921-2021)
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Karten und Hilfen
Ränge der Wehrmacht
Aufbau eines Panzers und Positionierung der Mannschaft
Karten
Jugend und Rekrutierung
Ein friedliches Dörflein
Aushebung 6 des Soldaten
Ausbildung eines Frischlings
Blut, Sand und Feuer
Ein Mitglied des Deutschen Afrikakorps
Ab in den Urlaub
Durchbruch zum Suezkanal
Heia Safari
Die Teufelsgräben
Hölle auf Erden
Versorgungslinien
Diagnose Paludismus
Unteroffiziersschule
Unerwarteter Besuch
Eine gute Zeit
An der Ostfront
Christnacht im Krieg
Einen nach dem anderen
Eiskalt erwischt
Verspätete Anerkennung
Hilfe in der Not
Im dunklen Wald
Partisanen46 im Wehrmachtsloch47
Gnade vor Recht
Du bist noch so unschuldig
Auf der Jagd nach der Rohrbremse
Zurück nach Deutschland
Der letzte Panzer
Weg von hier
Ein neues Zuhause
Raus, raus aus der Stadt
Hättest du wohl gerne
Man sieht vor lauter Bäumen den Soldaten nicht mehr
Drei von hundertfünfzig
Vom Schlachthaus aufs Schlachtschiff
Ich bin wieder da
Heimwärts
Solch eine Frechheit
Eine gute Schwimmlektion
Wie abgemacht
Nach dem Konflikt
Ihr habt keine Ahnung
Familie und Freunde
Nachwort
Meine Bekanntschaft mit Ursula und Willy
Danksagung
Nachweise
Ein Schweizer in den Diensten der Wehrmacht
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Epigraph
Vorwort
Nachweise
Ein Schweizer in den Diensten der Wehrmacht
Cover
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Vorwort
Dieses Buch ist das weitergeführte Werk, das ich als Maturaarbeit an der Academia Engiadina in Samedan geschrieben habe.
Mit dem Wort ‘Leser’ ist die gesamte Leserschaft gemeint.
Das Buch handelt von meinen Urgrosseltern, Willy Lämmle (*03.09.1921 - †30.07.2021) und Ursula Brandt (*19.09.1924 - †17.03.2007) und ihrer unglaublichen Geschichte als NS-Soldat und Halbjüdin in einem grausamen Krieg. Willy Lämmle wird im Text als Schweizer und Deutscher bezeichnet. Er wäre staatenlos gewesen, hätte er sich nicht am Konflikt beteiligt. Da er in der Wehrmacht tätig war, konnte er seine deutsche Staatsbürgerschaft beibehalten. Weil er in der Schweiz aufgewachsen ist, Schweizerdeutsch sprach und wie ein Schweizer gedacht hat, bezeichne ich ihn aber auch als Schweizer.
Diese Geschichte ist mit Vorsicht zu geniessen. Sie wird nicht zu 100% dem entsprechen, was wirklich geschehen ist. Die zwei Hauptpersonen sind verstorben. Die Informationen habe ich zum Teil aus eigenen Interviews mit Willy Lämmle in Form von Tonaufnahmen, zum Teil aus zwei Notizkalendern der Jahre 1944 und 1945 und teilweise aus Aussagen der Tochter, Christa Pinggera-Lämmle, erhalten.
Dieses Buch beinhaltet nur einen Bruchteil ihrer Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Der Rest konnte leider nicht dokumentiert werden, da Willy, kurz bevor ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, verstorben ist. Ob es sich so abgespielt hat, wie es im Buch beschrieben ist, kann ich nicht nachweisen. Als Quellen habe ich vor allem Zeugenaussagen. Dies führt dazu, dass ich die Geschichte meines Urgrossvaters aus seinen Erzählungen dokumentiere. Ob er wichtige Details ausgelassen oder vergessen hat, ist mir nicht bekannt. Aber da er sich selbst nicht mit seiner Vergangenheit belasten wollte, gehe ich davon aus, dass er einige wichtige und unangenehme Erlebnisse verdrängt hat. Wie stark er von der Nazi-Ideologie beeinflusst und wie überzeugt er von dieser war, weiss ich nicht. Sein Vater war jedoch überzeugter Nazi, im Gegensatz zu seiner Schweizer Mutter. Aus diesen Informationen, seinen Erzählungen und wie er die Geschichte erzählt hat, schliesse ich, dass Willy Lämmle diese Ideologie nicht gefallen hat. Er war aber mit Sicherheit von dieser negativ beeinflusst worden, weil er permanent mit ihr in Kontakt war.
«Do gäbs natürlich viel zverzelle, do zwüschedine.»
- Willy Lämmle (1921-2021)
Die genauen Gedanken, Namen und Unterhaltungen sind mir nicht bekannt. Daher sind sie mithilfe des groben Inhalts eventuell ungenau nachgestellt. Bei fehlenden Passagen mit nur wenigen Informationen zwischen zwei Orten habe ich versucht, einen logischen und möglichst nachvollziehbaren Übergang zu ergänzen. Diese Teile sind am Anfang und am Ende mit einem (+) markiert.
Willys Gedanken sind kursiv geschrieben. Wenn ein ganzes Kapitel kursiv geschrieben ist, ist es aus der Sicht Ursulas beschrieben.
Vielen Menschen ist es nicht bewusst, wie nervenzerreissend ein Krieg sein kann, geschweige denn in einem Biest aus Stahl zu kämpfen. In einem Panzer ist man für Infanterie und Kanonen praktisch eine grosse Zielscheibe. Panzerkämpfe waren besonders brutal. Man war sich jederzeit bewusst, dass man im nächsten Moment in die Luft gejagt werden könnte, auch wenn man versteckt war oder auf der Lauer lag. Wie lang konnte man warten, bis der Feind abdrückte, oder man selbst die Initiative ergreifen musste? Die Besatzungen hatten Nerven aus dem gleichen Stahl wie ihre Panzer.
«Der Sieger wird immer der Richter und der Besiegte stets der Angeklagte sein.»
- Herrmann Göring (1893-1946)
Die Geschichte eines Krieges wird von den Gewinnern geschrieben. Die Deutschen haben im Zweiten Weltkrieg schreckliche Dinge getan, das steht nicht infrage, sowohl auf Feldzügen wie auch im Landesinneren. Aber in einem Krieg und deren Schlachtfeldern begehen alle Parteien Kriegsverbrechen, nicht nur die Verlierer. Man sollte nicht verallgemeinern. Nicht alle deutschen Bürger waren am Holocaust beteiligt. Sie haben in einer verzweifelten Lage jemanden gewählt, der versprach, alles in Ordnung zu bringen. Viele wussten bis zur Nachkriegszeit nichts vom Völkermord. Nicht alle Soldaten, die gezwungen wurden, am Krieg teilzunehmen, waren Nazis. Damit will ich nicht ausschliessen, dass Willy Lämmle ein Nationalsozialist war. Aber zu dieser Zeit haben sehr viele Leute, vor allem junge, diese Ideologie angenommen, akzeptiert und zum Teil gefördert. Es war wie ein Trend. Viele NS-Jugendorganisationen, wie Deutsches Jungvolk, Jungmädelbund, Bund Deutscher Mädel (BDM) und die Hitler-Jugend (HJ), haben dazu beigetragen. Nicht jeder deutsche Soldat hat die Naziideologie befolgt und geliebt. Nicht jeder Soldat in einem Krieg war ein skrupelloser Mann. Und auch andere Nationen haben Kriegsverbrechen begangen. Die Kriegsverbrechen der anderen Nationen erfolgten jedoch nur wegen des deutschen Angriffskriegs. Deshalb und wegen dessen Ausmass sind die deutschen Verbrechen gesondert, übergeordnet und nicht als gleichwertig zu betrachten.
«Die grössten Wunder militärischer Disziplin, die der Gegenstand des Erstaunens aller Kenner waren, wurden der Gegenstand meiner herzlichsten Verachtung; die Offiziere hielt ich für so viele Exerziermeister, die Soldaten für so viele Sklaven, und wenn das ganze Regiment seine Künste machte, schien es mir als ein lebendiges Monument der Tyrannei. […] Ich war oft gezwungen zu strafen, wo ich gern verziehen hätte, oder verzeih, wo ich hätte strafen sollen; und in beiden Fällen hielt ich mich selbst für strafbar.»
- Heinrich von Kleist (1777-1811)
Die deutschen Soldaten mussten, wie die Soldaten jedes anderen Landes auch, Befehle befolgen. Wenn man diese Befehle verweigerte, drohte man, ins Gefängnis zu kommen oder sogar hingerichtet zu werden. Viele deutsche Soldaten haben an der Ostfront an Massenerschiessungen teilgenommen. Es war den Soldaten jedoch erlaubt, sich von solchen Erschiessungskommandos abzumelden. Nicht, dass das viele gemacht hätten oder davon wussten, aber als Wehrmachtssoldat war die Möglichkeit vorhanden. Sehr viele Soldaten konnten ihre Erfahrungen nicht verarbeiten und mit den Schrecken ihrer Handlungen nicht umgehen. So haben sie zu Drogen gegriffen. Es war entweder Alkohol oder Pervitin. Pervitin ist auch als ‘Panzerschokolade’, ‘Hermann-Göring-Pillen’ und heutzutage vor allem als Methamphetamin oder Crystal Meth bekannt. Es sollte wachhalten und den Soldaten ermöglichen, weiterzukämpfen. Diese Medikamente wurden oft missbraucht, um nicht an die eigenen, schrecklichen Taten denken zu müssen. Viele Soldaten waren am Kriegsende abhängig. Willy hat sie allerdings nie erwähnt.
Mit diesem Buch will ich unter anderem zeigen, dass ein Krieg, unabhängig vom Ausmass, ein schreckliches Ereignis ist. Alle Parteien leiden: die Zivilisten, wie auch die Militärtätigen, die Deutschen, wie auch die Russen, die Amerikaner, wie auch die Japaner. Aber wie in allem im Leben kann auch Schönheit aus einer hässlichen Situation entstehen.
Es gibt keine ‘Guten’ oder ‘Bösen’ in einem Konflikt. In einem Krieg gibt es keine Gewinner, sondern nur Verlierer.
Karten und Hilfen
Ränge der Wehrmacht
Tabelle 1: Hierarchie und Unterteilung der Ränge in der Wehrmacht.
Generalfeldmarschall
Generäle
Offiziere
Generaloberst
General
Generalleutnant
Generalmajor
Oberst, Oberstarzt
Stabsoffiziere
Oberstleutnant, Oberfeldarzt
Hauptmann, Stabsarzt
Hauptleute
Oberleutnant
Leutnante
Leutnant
Stabsfeldwebel
Mit Portepee1
Unteroffiziere
Oberfeldwebel, (Feld-) Unterarzt
Feldwebel
Unterfeldwebel / Korporal
Ohne Portepee
Unteroffizier
Stabsgefreiter
Mannschaften
Obergefreiter (>6 Dienstjahre)
Obergefreiter (<6 Dienstjahre)
Gefreiter
Obersoldat
Soldat
Aufbau eines Panzers und Positionierung der Mannschaft
Abbildung 1: Zeichnung, Querschnitt eines der früheren Modelle des Pz. Kpfw. IV mit einem Kurzrohr.
Ein Panzerkampfwagen IV (Pz.Kpfw IV/Panzer IV) hatte fünf Besatzungsmitglieder, jeder mit einem Sitz. In Fahrtrichtung sass der Schütze Mitte links, der Lader/MG-Schütze Mitte rechts, der Kommandant in der Mitte, der Fahrer vorne links und der Funker/MG-Schütze vorne rechts. Der Kommandant hatte über sich eine Kuppel mit mehreren Sehschlitzen. Durch diese konnte er 360° in alle Richtungen spähen und die ganze Mannschaft koordinieren. Dazu hatte er, meistens auch der Rest der Mannschaft, eine Kommunikationsanlage in Form eines Kehlkopfmikrofons und Kopfhörer. So war er nicht mit anderen Aufgaben beschäftigt, konnte sich auf das Ziel konzentrieren und das Fahrzeug effektiver führen. Die Deutschen hatten so am Anfang des Krieges mit dieser fünfköpfigen Konfiguration einen grossen Vorteil. Die meisten anderen Länder hatten nur vierköpfige Besatzungen, verfügten so nicht über diesen Vorteil. Im Panzer gab es rundherum Sehschlitze für die Mannschaft. Der Fahrer hatte einen Sehschlitz mit gepanzertem Glas. Pistolenlöcher für herkömmliche Pistolen und Leuchtpistolen waren auch vorhanden. Alle Sehschlitze und Pistolenlöcher konnten geöffnet und geschlossen werden. Überall am Panzer waren Fluchtluken angebracht: auf der Kuppel, links und rechts je eine am Turm, oberhalb des Funkers und des Fahrers und eine unterhalb des Funkers. Diese Luke an der unteren Seite des Panzers wurde auch Mannloch genannt. Der Funk in einem Panzer IV hatte eine effektive Reichweite von bis zu zwei Kilometern.
Insgesamt war der Panzer in drei Abschnitte unterteilt. Der Motorraum hinten, der Mannschaftsraum in der Mitte und der Fahrerraum vorn. Der Motorraum und der Mannschaftsraum wurden von einer feuerfesten und gasdichten Schutzwand getrennt. Die zwei vorderen Räume waren nicht getrennt, jedoch oft durch Munition versperrt. Munition wurde im Mannschaftsraum verstreut gelagert; hinter dem Fahrersitz und seitlich an den Wänden in Halterungen oder auf dem Boden gestapelt. So hatte der Lader in allen möglichen Turmpositionen Zugang zu neuer Munition. Der Kraftstoff für den Panzer wurde unterhalb des Mannschaftsraumes in verschiedenen Tanks deponiert. Um Raum im Inneren des Panzers zu sparen, wurden weitere Sachen aussen am Panzer festgemacht oder im Kasten, auf der hinteren Seite des Turms, deponiert. Der Fahrer konnte mit zwei Hebeln, die die jeweiligen Ketten kontrollierten, fahren. Lenken konnte er, indem sich eine Kette langsamer drehte als die andere. Mit einem Maybach 120 TRM 12-Zilindermotor konnte der Panzer IV auf eine Geschwindigkeit von bis zu 42 km/h auf der Strasse und 25 km/h abseits der Strasse beschleunigen. Die maximale Reichweite lag bei 210 km beziehungsweise 130 km. Die 7.02 m lange (mit Rohr), 2.88 m breite und 2.68 m hohe Maschine wog bei Kampfgewicht 23.6 Tonnen.
Der Panzer IV hatte eine mächtige 7.5 cm KwK 40 Kanone, die die meisten alliierten oder sowjetischen Panzer auf über 1 km zerstören konnte. Die Waffe konnte mit zwei Kurbeln ausgerichtet werden. Eine erhöhte oder senkte das Geschütz, und die andere, rechts von der Kanone, drehte den Turm. Ein elektrisches Turmdrehwerk konnte dabei helfen. Dieses Drehwerk war zweieinhalbmal schneller, als wenn man es von Hand gedreht hätte. Der Auslöser war, nicht wie bei anderen Panzern ein Knopf oder eine Schur, sondern ein Pedal am rechten Fuss. Der Schütze konnte dank der Position des Auslösers schnell zwischen Zielen und Schiessen wechseln. So waren die Aufgaben der einzelnen Gliedmassen besser aufgeteilt. Dazu hatte das Fahrzeug zwei 7.92 mm MG 34 Maschinengewehre, einen am Turm und einen ausrichtbaren vorne rechts am Panzer. Die Kanone hatte ein 2.5-faches Vergrösserungsvisier. (Pantelic, 2020)
Im Verlaufe des Krieges wurde der Panzer IV durch weitere Ausführungen immer weiter verbessert. Dies waren eine dickere Panzerung, ein längeres Geschütz (höhere Projektilgeschwindigkeit) und Zimmeritbeschichtungen2. Diese Panzerreihe war, neben dem Sturmgeschütz III, das Rückgrat der deutschen Panzerformationen im Zweiten Weltkrieg. (Pantelic, 2020)
Die Uniform der Panzerbesatzungen bestand aus Stiefeln, Hosen, einer Jacke mit zwei Totenköpfen am Kragen, einem hoch angesetzten Gürtel und einer Mütze, alles in schwarz. Ein Hemd mit Krawatte wurde oft unter der Jacke getragen (Siehe S. 112, Abb. 35). Der Reichsadler mit dem Hakenkreuz war auf der Mütze und auf der rechten Seite der Jacke abgebildet. Die Auszeichnungen wurden mittig links an der Jacke befestigt (Siehe S. 49, Abb. 27 oder S. 109, Abb. 33 oder S. 8, Abb. 6). Die Uniform konnte je nach Schlachtfeld variieren. Die Afrikauniform sah ähnlich aus, aber in einer braunen Farbe. Die Mütze war eine andere und die Hosen waren breiter geschnitten (Siehe S. 13, Abb. 10). Ausserdem besass jeder Soldat eine elegantere Paradeuniform (Siehe S. 8, Abb. 7f).
Willys Geschichten geschehen vor allem in einem Panzer IV. Er hat jedoch auch in einem Panzer III und in einem Sturmgeschütz III gekämpft. Aufgrund seiner Erzählungen und dem Zeitfenster, in dem er in Russland war, gehe ich davon aus, dass er in einem Pz.Kpfw IV Ausf. G oder H gekämpft hat. Die Ausführungen G, H und J sind schwer auseinanderzuhalten. Der Aufbau anderer Panzer ist gleichartig.
Karten
Abbildung 2: Die wichtigsten Aufenthalte Willys in Europa.
Abbildung 3: Die wichtigsten Aufenthalte Willys in Nordafrika.
1 Ursprünglich eine Schlaufe, die verhindern sollte, dass eine Hiebwaffe zu Boden fällt. Später wurden daraus Standesabzeichen für einige Militärränge. Es bestand aus Band, Schieber, Stängel, Kranz und Quaste. Das Portepee hatte in der Wehrmacht die Form einer silbrigen Eichel. (Wikipedia - Portepee, 2021)
2 1943 entwickelt. Ein unebener Belag, der linienartig aufgetragen wurde. Haftminen sollten so schlechter oder gar nicht am Fahrzeug haften. Produktion wurde im Sept. 1944 eingestellt. (Wikipedia - Zimmer & Co., 2021)
Jugend und Rekrutierung
Ein friedliches Dörflein
Willy kommt am 3. September 1921 in Schwellbrunn in Appenzell Ausserrhoden zur Welt, wo er auch seine Kindheit und Jugend verbringt. Schwellbrunn hat zu dieser Zeit nur eine Primarschule. So müssen sich die Jugendlichen der Oberstufe etwa sechs Kilometer bis zum nächstgrössten Dorf begeben. Bis Herisau ist es etwa ein Marsch von einer Stunde, aber die Schüler laufen selten. Sie fahren im Sommer meistens mit dem Fahrrad und im Winter mit dem Schlitten oder mit den Skiern zur Schule. Mit dem Postauto geht es dann wieder nach Hause. In dieser Schule in Herisau schliesst Willy die Sekundarschule ab. Wie alle in seinem Alter muss sich Willy für eine Lehre entscheiden und er möchte gern eine kaufmännische Lehre absolvieren. Eine Stelle in Herisau wäre sogar frei, und seine Noten sind für die Lehre ausreichend. Willys Vater kann diese jedoch nicht finanzieren. Für eine solche Lehre muss man einen beträchtlichen Betrag zahlen. So sucht Willy eine andere Arbeit, die ihm gefallen könnte. Er entscheidet sich für eine Gärtnerlehre in Herisau.
Er muss jeden Morgen, sechs Tage die Woche, um 7:00 Uhr vor Ort sein, um zu arbeiten und dazu jede vierte Woche auch am Sonntag tätig sein. Die Arbeitszeit pro Woche ist unbegrenzt. Im ersten Lehrjahr verdient er nichts, im zweiten 15 Rappen die Stunde und im dritten 25 Rappen die Stunde. Die Lehre ist nach den drei Jahren am 31.03.1940 abgeschlossen. Willy arbeitet im selben Betrieb weiter, bis er von den Deutschen eingezogen wird. Um seine deutsche Staatsbürgerschaft beizubehalten, muss er in den Dienst des Dritten Reiches. Dies macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Er hatte ursprünglich vor, nach Hamburg zu reisen, um dort eine Pfarrerausbildung zu absolvieren. Entweder muss Willy in den Krieg ziehen oder sein Vater Wilhelm, wenn nicht gar beide.
Als Wilhelm3 Lämmle Paula Schneebeli nach dem Ersten Weltkrieg heiratet und in die Schweiz zieht, weigert er sich, sich einbürgern zu lassen. Hier ist noch zu erwähnen, dass Wilhelm selbst halb Schweizer ist und vor dem Krieg in der Schweiz gelebt hat. So ist Willy nur zu einem Viertel Deutscher. Die Familie Lämmle, jetzt zu sechst4, versucht wieder, sich im Jahr 1938 in Schwellbrunn einbürgern zu lassen, aber dies ist mit enormen Kosten verbunden. Es kostet um die 10.000 CHF. Mit einer solchen Summe könnte man ein Haus kaufen und immer noch mehrere tausend Franken übrighaben. Für die Familie Lämmle ist dies finanziell unmöglich. Sie haben ein Einkommen von um die 150 Franken im Monat. Als Willy aber 1940 nach Deutschland reist, kratzt Paula so viel Geld wie nur möglich zusammen, um den Rest der Kinder einbürgern zu lassen, damit ihnen nicht dasselbe widerfährt. Vater Wilhelm verweigert eine Einbürgerung aufs Neue.
Wilhelm hat eine aus der heutigen Sicht eigenartige Meinung gegenüber Kriegen. Er motiviert Willy, in den Krieg zu ziehen. Es sollte ihn ‘reif machen’. Er meldet sich sogar selbst für den Krieg, was eigenartig erscheint, weil er an einem der grausamsten, wenn nicht gar an dem grausamsten Krieg der Menschheit teilgenommen hat, am Grabenkrieg an der Westfront von 1914 bis 1918. Wilhelm ist ein überzeugter Nazi und will seinem Vaterland dienen5. Seine Ehefrau Paula kann jedoch verhindern, dass er eingezogen wird.
Aushebung 6 des Soldaten
Im Sommer 1940 stellt Willy ein Gesuch für das Missionsseminar in Hamburg-Altona und meldet sich in Zürich für die Aufnahmeprüfung. Für diese muss er Griechisch, Französisch und Englisch lernen. Beides wird abgelehnt, was Willy völlig absurd erscheint. Kurz darauf kommt ein Brief aus Deutschland mit dem Stellungsbefehl. Ende des Sommers begibt sich Willy nach St. Gallen zum deutschen Konsulat.
Er betritt das Gebäude und sieht eine Warteschlange vor einer Tür. Willy stellt sich hinten an und wartet und wartet und wartet.
Der vorherige Besucher verlässt das Zimmer. Endlich ist Willy dran.
Noch zwei Mal tief durchatmen. Er öffnet vorsichtig die Tür.
«Kommen Sie ruhig rein», sagt eine angenehme Stimme, «Wie ist Ihr Name?»
«Willy Lämmle», antwortet Willy, während sich die Tür hinter ihm schliesst und er sich dem Mann gegenübersetzt.
«So, Herr Lämmle. Sie wissen, warum Sie hier sind. Sie sind deutscher Bürger und müssen für Deutschland in den Krieg ziehen. Sie können wünschen, wo Sie in der Armee teilnehmen wollen. Haben Sie irgendwelche Wünsche?» Er scheint sympathisch und schaut Willy mit einem neugierigen Blick an.
«Ich habe mich schon für das Missionsseminar in Hamburg angemeldet. Es wurde aber abgelehnt.»
«Ich sehe, was Sie machen wollen. Das Missionsseminar dauert fünf Jahre.» Er macht eine Pause und verhöhnt Willy ein wenig. «Ich war auch einmal so jung wie Sie. Aber das Vaterland geht vor.»
«Nein, ich will mich nicht vor dem Krieg drücken. Das ist es nicht, aber ich habe keine Zeit, es zu erklären. Der einzige Wunsch, den ich habe, ist, nicht Infanterist zu werden.»
«Also Herr Lämmle, wie wäre es mit…» Der Konsul blättert durch ein Heft. Er braucht eine Weile, währenddessen schaut sich Willy im Büro um. Dutzende Haufen von Blättern und Mappen liegen auf den Tischen. An der Wand hängt eine ältere Uhr. Sein Blick wandert weiter und dort sieht er das Namensschild des Konsuls, ‘A. Weihrauch’. «…Teil einer Panzerbesatzung? Was halten Sie von dieser Idee?»
«Ausgezeichnet, Herr Weihrauch. Etwas Besseres gibt es fast nicht.»
«Sehr gut», antwortet Herr Weihrauch, während er etwas in sein Heft einträgt. «Ich sorge dafür, dass Sie ein schönes Plätzchen kriegen. Und eines garantiere ich Ihnen: In einem halben Jahr sind Sie in Afrika. Die genauen Informationen werden folgen.» Willy ist ein wenig schockiert und steht auf.
In einem halben Jahr muss ich nach Afrika reisen? Es ist kaum vorstellbar. Wie sollte ich mich am besten vorbereiten? bangt Willy, während er sich von Weihrauch verabschiedet
Eine Woche vergeht, zwei Wochen. Dann ein Monat, zwei Monate, drei Monate. Willy hat sich schon Sorgen gemacht, dass vielleicht etwas schiefgelaufen sei. Schlussendlich kommt ein Brief des Konsulats mit den weiteren Informationen. Er öffnet den noch verschlossenen Brief und liest ihn aufmerksam durch.
Willy packt sofort seine Siebensachen und bereitet sich vor. Am nächsten Tag beginnt er seine Reise mit dem Zug über die Grenze hinaus bis nach Sindelfingen/Böblingen. An Weihnachten kommt er bei seinen Schlummereltern7 an: ein älteres Ehepaar namens Dietle. Willy nennt sie Onkel Emil und Tante Rosa. Nachdem er sich sein Zimmer eingerichtet hat, meldet er sich bei der grossen Panzerkaserne und wird rasch eingeteilt. Die Ausbildung beginnt in den nächsten Tagen.
Abbildung 4: Rekonstruktion eines Einberufungsbefehls A für Willy. 8
Ausbildung eines Frischlings
Während der Rekrutenschule macht Willy nebenbei eine Fahrausbildung für den Opel Blitz9 und für allgemeine Personenwagen. Die Panzerausbildung erfolgt für den Panzer I, II und III.
Am 11. April 1941, zwei Tage vor Ostern, hat Willy nach etwa vier Monaten Ausbildung seine Prüfungsfahrt. Nachdem er von dem etwa 25 Kilometer entfernten Calw zurückkehrt, wartet die Gendarmerie10 am Tor der Panzerkaserne. Ein Mann tritt vor und grüsst Willy mit einem ernsten Gesicht:
«Heil Hitler!»
«Heil Hitler!»
«Sind Sie nicht der Soldat Lämmle?»
«Jawohl, der bin ich. Ist etwas passiert?»







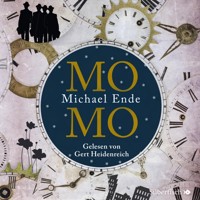



![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)